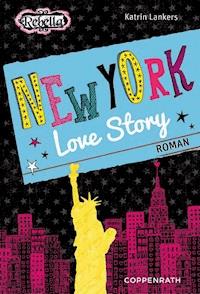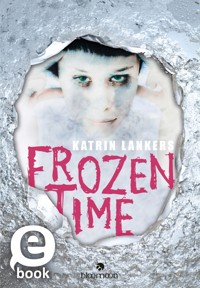Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Coppenrath
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Verrückt nach New York
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Love and the City Maxi ist am Boden zerstört, nachdem die Beziehung mit Alex zerbrochen ist. Dabei haben sie und ihre Freunde aus der Pinkstone-WG eigentlich genug um die Ohren. Der skrupellose Investor Miller versucht weiter mit unlauteren Methoden, die fünf dazu zu bewegen, das alte Haus im angesagten New Yorker-Stadtteil Williamsburg aufzugeben. Unter diesem enormen Druck hält Abby es nicht mehr aus und zieht zurück zu ihren Eltern. Nun muss zu allem Überfluss auch noch ein neuer Mitbewohner gefunden werden. Gar nicht so leicht, denn ein Kandidat ist schräger als der andere. Da taucht Alex plötzlich auf und bewirbt sich um das Zimmer. Und wieder weiß Maxi nicht, wo ihr der Kopf steht ... Liebe, Glamour & Intrigen: Diese Serie macht süchtig!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
eBook-ISBN: 978-3-649-66776-6
© 2015 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,
Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Umschlaggestaltung: Anna Schwarz unter Verwendung
von Illustrationen von Sara Vidal Peiró
Redaktion: Valerie Flakowski
www.coppenrath.de
Das Buch erscheint unter der ISBN: 978-3-649-61788-4
COPPENRATH
Es ist besser sein Geld zu verlieren, als sein Vertrauen, sagt meine Omama. Bislang hatte ich wenig Gelegenheit, das zu überprüfen. Denn viel Geld hatte ich nie. Und was das Vertrauen angeht, verließ ich mich vor allem auf mich selbst. Erst als ich beides dringend gebraucht hätte, wurde mir klar, wie schnell man es verlieren kann.
Eure Maxi
»Das ist deine allerletzte Chance.«
»Und ich sage dir, ich mache das nicht.«
»Dann siehst du von dem Geld keinen Cent.«
»Verflucht noch mal, du verstößt gegen ihren Willen.«
»Und du gegen meinen.«
»Darum geht es hier also. Dass du deinen Willen durchsetzt.«
»Nein, hier geht es um zehn Millionen.«
»Um mein Geld.«
»Noch nicht.«
»Du kannst mich nicht dazu zwingen.«
»Oh, ich denke schon.«
KAPITEL1
Fünfzigtausend? Sie musste wahnsinnig geworden sein! Völlig den Verstand verloren haben! Dabei hatte sie noch ganz vernünftig gewirkt, als ich sie vor zwei Wochen am Flughafen verabschiedet hatte. Na ja, so vernünftig wie meine Omama, die seit jeher zu Verrücktheiten neigte, eben sein konnte. Aber das hier war der Gipfel aller verrückten Dinge, die sie jemals getan hatte.
Okay, es war vermutlich schon sehr verrückt gewesen, mit einem Mann, den sie erst seit einem halben Jahr kannte, nach New York zu fliegen und dort mit ihm den Bund fürs Leben zu schließen. Insbesondere da es sich um einen Birnenkopf mit Halbglatze handelte. Andererseits hatte ich Omama noch nie so glücklich erlebt wie bei ihrer Hochzeit am Valentinstag. Und ganz sicher noch niemals so verliebt.
Verrückt waren natürlich auch die Seancen gewesen, die sie in unserer Küche abgehalten hatte, bis ihr Roy Black erschienen war und sie wochenlang mit »Ganz in Weiß« verfolgt hatte. Ziemlich verrückt war auch ihre Angewohnheit, überall in der Wohnung Lavendel gegen böse Geister zu verteilen, sowie ihr traditionelles Neujahrspicknick auf dem Balkon bei Minusgraden. Aber all das fand ich noch recht normal, verglichen mit den fünfzigtausend Euro, die sie mir aufs Konto überwiesen hatte.
»Omama, was soll das?«, schrie ich aufgeregt in mein Handy, kaum hatte sie den Anruf angenommen.
»Maxi, ist alles in Ordnung? Warum rufst du mitten in der Nacht an?«, brüllte Omama zurück. Sie brüllte immer am Telefon, weil sie glaubte, dass ich sie sonst »am anderen Ende der Welt« nicht verstehen würde.
»Oh, entschuldige.« Mist, in der Aufregung hatte ich glatt die sechs Stunden Zeitunterschied vergessen.
»Schon in Ordnung.« Sie seufzte laut. »Also, was ist los?«
»Was ist das für Geld?«, kam ich ohne Umschweife auf den Grund meines Anrufs zurück. Erst hatte ich die Überweisung für einen Fehler gehalten, als ich meine üblicherweise eher besorgniserregende Finanzlage online geprüft hatte. Dann war mein Kopfkino gestartet und hatte angefangen, mir die wildesten Theorien vorzuspielen: Spekulierte meine Omama neuerdings an der Börse? Hatte sie im Lotto gewonnen? Oder war sie womöglich in irgendwelche kriminellen Aktivitäten verstrickt? Hehlerei? Geldwäsche? Schutzgelderpressung? Aber was machte diese Riesensumme dann auf meinem Konto?
»Warum überweist du mir fünfzigtausend Euro?«, schob ich hinterher, weil meine Omama nicht sofort reagierte.
»Das ist dein Anteil«, erklärte Omama nüchtern.
»Mein Anteil?« Also wirklich etwas Kriminelles?!
»Vom Haus.«
»Wieso vom Haus?« Ich verstand nur Bahnhof.
»Ich habe das Haus verkauft. Weil ich jetzt bei Hubertus wohne. Wer nicht auszieht, kommt nicht heim, so sagt man doch. Nun brauche ich das alte Ding nicht mehr. Und der Buchladen war mir schon lange zu viel. Den habe ich gleich mit verkauft. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die Immobilienpreise explodiert sind. Da kam ein schönes Sümmchen zusammen. Und da dachte ich mir: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Deshalb solltest du deinen Teil davon bekommen. Sicher kannst du das Geld gut gebrauchen, oder?« Sie lachte fröhlich, aber mir war gar nicht nach Lachen zumute.
»Du hast das Haus verkauft?«, echote ich hohl. Bilder schossen durch meinen Kopf: unsere Ikea-Style-Küche, wo wir oft über einer Tasse Kakao gesessen und geredet hatten. Mein Kinderzimmer mit dem bunt lackierten Holztisch, an dem ich vom ersten bis zum letzten Schuljahr meine Hausaufgaben erledigt hatte. Und natürlich der verwinkelte, staubige Buchladen, in dem ich mich ungezählte Stunden in Büchern verloren hatte, auf der Theke das Einmachglas mit Gummibärchen, aus dem ich mich bedient hatte, wenn ich aus der Schule heimkam … »Du hast den Buchladen verkauft?«
Lautes Hämmern direkt über meinem Kopf machte es mir unmöglich zu verstehen, ob und was meine Omama antwortete, und holte mich zurück in die Gegenwart.
»Rick!«, brüllte ich, wobei ich das Handy auf Armlänge von mir wegstreckte. »Hör mal kurz auf, ich telefoniere.« Ein noch kräftigeres Hämmern erklang als Antwort.
»Rick!« Ich griff nach dem erstbesten Gegenstand – einem Wildleder-Pumps mit Plateau-Sohle – und schleuderte ihn gegen die Zimmerdecke. Poch. Poch. Poch. Meine Schuhattacke prallte unbemerkt von meinem handwerkenden Mitbewohner an der Decke ab, und mit dem Pumps rieselte eine Wolke Putz zu Boden. Mist! Ich hielt es ohnehin für eine hirnrissige und halsbrecherische Idee, um sieben Uhr abends das Dach neu decken zu wollen. Aber Rick neigte zu extremen Aktionen und hatte erklärt, er wolle das nur schnell zu Ende bringen, nachdem er schon den ganzen Tag dort oben herumgeturnt war. Zum Glück legte er nun tatsächlich eine kurze Pause ein und aus dem Handy in meiner Hand drang Omamas Stimme zu mir.
»Maxi? Maaaaxi, bist du noch dran?«
»Ja.« Ich drückte mir das Telefon wieder ans Ohr.
»Was ist denn bei euch los?«
»Rick deckt das Dach.«
»Um diese Zeit?«
»Sag ihm das.«
Poch. Poch. Poch. Jetzt ging das schon wieder los! Im Grunde war ich ja dankbar, dass Rick sich so für die Renovierung von Pinkstone einsetzte. Denn Pamela und Saida, unsere anderen beiden Mitbewohnerinnen, hatten ihre Hilfe zwar fest zugesagt, hielten sich nun aber zurück, angeblich, weil sie zu viel mit ihren Jobs zu tun hatten. Pam kellnerte neuerdings in einem Diner am Times Square, wo die Mitarbeiter die Gäste nicht nur mit Burgern und Pommes, sondern auch mit Musical-Hits erfreuten. Und Saida bereitete sich auf ihr erstes Mode-Shooting und ihre Gerichtsverhandlung vor. Aber mal ehrlich: Daneben blieb eigentlich viel Zeit, um im Haus mit anzupacken. Ich schaffte es ja auch, obwohl ich als Redaktionspraktikantin bei dem Magazin Zeitgeist jede Menge zu tun hatte. Ein bisschen mehr Engagement hätte ich mir schon gewünscht. Immerhin war die Renovierung des Hauses die Voraussetzung dafür, dass wir hier leben durften. Zumindest noch drei Monate, bis der Besitzer es meistbietend versteigern wollte.
Poch. Poch. Poch.
»RIIIIICK!« Wie gesagt: Ich war ihm dankbar, aber das Hämmern nervte gewaltig. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, dabei war das gerade bitternötig.
»Du hast unser Haus also verkauft?«, hakte ich in der nächsten Poch-Pause bei Omama nach. Ich vermute, dass ich dabei ziemlich jämmerlich klang, denn ihre Antwort fiel deutlich zurückhaltender aus als zuvor.
»Ja, mein Mädchen, das habe ich. Ich hätte nicht gedacht, dass dich das stören würde.«
»Und wo soll ich wohnen, wenn ich wieder nach Hause komme?«, fragte ich kleinlaut. Ich hatte nie besonders an unserem Haus gehangen, zumindest hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo es verkauft war, vermisste ich es plötzlich schrecklich. Zumal mir nicht klar war, wo ich nach Ablauf der Frist durch unseren Vermieter leben würde, falls Pinkstone dann womöglich doch abgerissen würde. Denn die Option bestand ja nach wie vor.
»Aber, Maxi, dann wohnst du natürlich bei uns«, versuchte Omama, mich eilig zu trösten. »Ich habe deine Möbel alle mitgenommen. Du hast hier dein eigenes Zimmer. Hubertus besitzt ein riesiges Haus. Ein wunderschönes Haus. Es wird dir gefallen. Mein Haus ist dein Haus – das sagen die Spanier, glaube ich. Oder die Italiener? Na egal, Hubertus sieht das jedenfalls genauso!«
Poch. Poch. Poch. Poch. Poch.
Meine Güte, hörte das denn gar nicht mehr auf? So langsam fing mein Kopf an zu dröhnen. Der Lärm über mir gepaart mit diesem Telefonat war einfach zu viel. Nicht genug, dass meine New Yorker Bleibe eine Baustelle war und womöglich in Kürze nicht mehr existieren würde. Nun hatte ich auch kein Zuhause mehr in Deutschland, in das ich zurückkehren konnte. Über diese deprimierenden Gedanken hatte ich den eigentlichen Grund des Anrufs ganz vergessen.
»Es tut mir leid, Maxi«, sagte Omama, als das Pochen erneut pausierte. »Ich hätte vielleicht besser vorher mit dir darüber reden sollen. Aber mir war nicht klar, dass es dir etwas ausmachen würde. Ich hoffe, du freust dich wenigstens über das Geld …« Erst als sie es erwähnte, fiel mir die unglaubliche Summe wieder ein, die sie mir überwiesen hatte. Fünfzigtausend Euro! Ob ich mich darüber freute? Im Moment war ich eher traurig, weil sie unser Haus verkauft hatte. Aber mal davon abgesehen, dass es mir schwerfiel, mich über das Geld zu freuen … Es war einfach so unvorstellbar viel! Was sollte ich bloß damit anfangen?
»Maxi?«, fragte Omama nach, weil ich nicht sofort reagierte. Was sollte ich ihr auch sagen? Sie hatte vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen – so sah ich das zumindest. Aber sie war auch ungeheuer großzügig gewesen und ich wollte nicht nörgeln und undankbar erscheinen.
»Ähm«, machte ich, weil mir keine diplomatische Antwort einfiel. Doch dann blieb mir jede Art von Antwort erspart. Denn in diesem Augenblick war über meinem Kopf zuerst ein heftiges Poltern zu hören, dann krachte etwas gewaltig und kurz darauf schrie Rick: »Shit!« Nur Sekunden später stürzte die Decke ein. In einer gewaltigen Wolke aus Staub und Schutt landete Rick laut fluchend mit dem Hintern zuerst auf meinem Wildleder-Pumps mit Plateau-Sohle, der – den zehn Zentimeter-Absatz nach oben gerichtet – noch dort auf dem Boden lag, wo er vorhin hingefallen war.
»Rick«, kreischte ich. »Alles okay?«
»Alles okay?«, brüllte meine Omama gleichzeitig durchs Handy.
»Ja, ja, alles okay.« Rick hob beschwichtigend die Hände und verzog erst danach schmerzlich das Gesicht. Er tastete unter seinem Po herum, bis er den Übeltäter entdeckt hatte.
»Ich habe schon immer geahnt, dass High Heels mörderisch sind«, stellte er trocken fest und streckte mir den Pumps hin, dessen Absatz wie ein gebrochenes Bein im rechten Winkel abstand. Behutsam nahm ich den Schuh in meine freie Hand und betrachtete das Desaster. Mir stiegen Tränen in die Augen, die Rick fälschlicherweise als Kummer um den verunglückten Schuh deutete.
»Ich schmier dir ein bisschen Sekundenkleber drauf, dann ist er wie neu.« Er rappelte sich hoch, wobei er sich mit einer Hand den Hintern rieb und mit der anderen den Staub aus den Augen wischte, und kam zu mir, um mich unter einer seiner Bärenumarmungen zu begraben.
»Maxiiii!«, brüllte Omama in diesem Moment. Ich hatte in dem Tumult völlig verdrängt, dass sie noch in der Leitung hing.
»Hier ist alles in Ordnung«, versuchte ich, sie schnell zu beschwichtigen, wobei ich mich bemühte, meine Stimme nicht tränenerstickt klingen zu lassen. »Nur ein kleiner Unfall beim Dachdecken. Ich muss aufhören, wir reden ein anderes Mal.« Mit diesen Worten klickte ich sie einfach weg. Nicht gerade die feine Art, aber Omama würde mir das sicher verzeihen. Denn aktuell hatte ich ein deutlich größeres Problem: In der Decke meines Zimmers klaffte ein zwei mal zwei Meter großes Loch, durch das ich direkt in den dunklen, sternenlosen Himmel schauen konnte.
»Ich krieg das schon wieder hin, irgendwie«, versuchte Rick, mich zu beruhigen, als mir nun tatsächlich ein paar Tränen über die Wangen liefen. Aber nicht das Loch war es, was mich so verzweifeln ließ. Es war das Gefühl, buchstäblich kein Dach mehr über dem Kopf zu haben. Nicht mehr in Deutschland und bald auch nicht mehr in New York.
Selbst wenn unser Vermieter Pinkstone nicht an den Investor Larry Miller verkaufte, der es abreißen wollte, war noch längst nicht gesagt, dass ein anderer neuer Besitzer uns hier wohnen lassen würde. Ich hatte mir etwas vorgemacht, als ich meine Mitbewohner überredet hatte, uns auf den Deal einzulassen. Wir renovierten Pinkstone, nur damit Donald Duck (wie wir den Erben der Pink Lady und damit Besitzer von Pinkstone nannten) es am Ende verschachern konnte. In diesem Moment erschien mir die ganze Renovierungsaktion vollkommen sinnlos. Doch dann hatte ich eine Eingebung …
KAPITEL2
Maxi, du spinnst.« Pamela steckte eine Handvoll Gummibärchen in den Mund – meine Gummibärchen – und kaute energisch. Dafür dass sie eigentlich ständig auf Diät war, verputzte Pam eine erstaunliche Menge – meiner – Gummibärchen.
Alarmiert durch das Poltern, waren meine Mitbewohner in meinem Zimmer aufgetaucht und hatten das Loch im Dach angemessen bestaunt. Nun hockten wir auf dem pinken Flokati darunter. Obwohl die kalte Nachtluft den Raum merklich abkühlte, erschien mir der Platz für eine Krisenbesprechung am passendsten. Ich vergrub meine Finger in den pinken Schlingen des Flokatis, was eine beruhigende Wirkung auf mich hatte. Den Teppich hatte ich anfangs aus meinem komplett pinken Zimmer verbannt – die Pink Lady hatte es in ihrer Lieblingsfarbe eingerichtet –, hatte ihn dann aber nach kürzester Zeit reuig wieder aus der Abstellkammer hervorgezerrt, weil ich das kuschelige Ungetüm vermisst hatte.
Ich atmete tief durch, um meine Gedanken zu ordnen. Ich musste die anderen von meiner Idee überzeugen, denn allein hatte ich keine Chance!
»Mensch, Pam«, wandte ich mich deshalb zuerst an die tatkräftigste meiner Mitbewohnerinnen. »Du hast damals gesagt, dass wir Pinkstone am Ende womöglich selbst kaufen könnten.« Ich hatte ihre Worte noch genau im Ohr.
»Das war doch bloß so dahingesagt.« Pamela griff wieder in eins der Schraubgläser, die ich mitten auf den Flokati gestellt hatte. Dieses Mal erwischte sie die orangen Bären, die optimistisch stimmen sollen – zumindest wenn man der Gummibärchen-Farbenlehre folgte, die ich vor einigen Jahren aufgestellt hatte. Bei Pam war von dieser Wirkung allerdings nichts zu spüren. »Das schaffen wir niemals, da können wir uns noch so abrackern.«
»Ja, aber wir rackern uns ohnehin schon ab, um das Haus zu renovieren.« Ich warf einen beifallsuchenden Blick zu Rick, der entschieden nickte. »Zumindest Rick und ich.« Diese kleine Spitze konnte ich mir nicht verkneifen. »Da wäre es doch total bescheuert, wenn wir nicht wenigstens versuchen würden, Pinkstone selbst zu ersteigern. Stellt euch vor, Investor Miller bekommt das Haus am Ende doch – dann war unsere ganze Arbeit umsonst, weil er es abreißen lässt! Oder irgendein Snob zieht ein, der sich freut, dass wir das Haus so schön für ihn renoviert haben.«
»So lautet nun mal der Deal«, erklärte Pam pragmatisch. »Wir renovieren und Donald Duck lässt uns dafür drei Monate mietfrei wohnen. Nicht zu vergessen: Du musst schön darüber in deinem Blog berichten, damit sich noch mehr Leute für Pinkstone interessieren und er am Ende einen noch dickeren Batzen Geld dafür bekommt.«
»Ja, aber wenn es eben doch nicht so läuft«, erwiderte ich hitzig. »Wenn wir es selbst schaffen, das Geld zusammenzubekommen und das Haus zu kaufen. Dann würde Pinkstone uns gehören. Niemand könnte es mehr abreißen. Und wir hätten es für uns selbst renoviert.«
»Dadgumit.« Pamela wurde langsam ungeduldig. »Nur weil du dir durch deine Zimmerdecke neuerdings die Sterne anschauen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du auch einen erwischst, wenn du versuchst, danach zu greifen!«
»Warum haltet ihr meinen Vorschlag eigentlich für so abwegig?« Wütend knetete ich den Flokati. »Ich habe es euch doch erzählt: Ich habe fünfzigtausend. Wenn das kein Startkapital ist, weiß ich es auch nicht!«
»Pah«, mischte Saida sich zum ersten Mal ein. »Fünfzig Riesen sind ein Witz. Ich meine: Nicht dass ich sie im Moment nicht gut gebrauchen könnte. Aber sie reichen niemals, um ein Haus zu kaufen.«
»Fünfzigtausend Euro«, verteidigte ich mich sofort. »Das sind über sechzigtausend Dollar.«
»Pah«, machte Saida wieder. »Hast du dir mal die Immobilienpreise in New York angeschaut? Für sechzigtausend bekommst du höchstens eine Haustür, aber niemals ein ganzes Haus. Dafür musst du ein paar Millionen lockermachen.«
»Das ist mir auch klar«, erwiderte ich gereizt. »Ich habe ja nie gesagt, dass ich Pinkstone damit kaufen könnte. Ich habe nur gesagt, dass es ein Anfang wäre. Und dass wir vielleicht eine Chance haben, wenn wir alle versuchen, in der uns verbleibenden Zeit so viel Geld wie möglich aufzutreiben. Kapiert ihr das denn nicht? Dass wir es gemeinsam vielleicht schaffen könnten?«
Ich fing an, nervös mit einem der Medaillons an meiner Halskette zu spielen. Dream as if … stand darauf. Es war der Anfang eines Zitats von James Dean: Träume, als würdest du ewig leben. Lebe, als müsstest du heute sterben. Und es bedeutete mir sehr viel, obwohl oder gerade weil die Story dahinter so kompliziert war.
Vielleicht sollte ich an diesem Punkt etwas klarstellen: Ich bin eigentlich keine Träumerin. Im Gegenteil. Ich bin ein logisch denkender Mensch, der für alles einen Plan hat. Wenn Plan A nicht funktioniert – was in New York leider ziemlich häufig der Fall ist –, dann bin ich auch nicht um Plan B oder C verlegen. Und ich erstelle Listen, denn für alles, was ich mir vornehme, brauche ich mindestens drei gute Gründe. Also:
3 gute Gründe, Pinkstone zu kaufen:
Es wird garantiert nicht abgerissen!Wir haben nicht umsonst so viel Arbeit reingesteckt!Wenn wir das Haus retten, retten wir auch unsere Freundschaft!Dieser dritte Punkt war vielleicht der wichtigste von allen, dachte ich. Obwohl ich es mir nur ungern eingestand – denn eigentlich war ich stolz darauf, immer alles allein zu schaffen –, machte mir die Aussicht, mit dem Verlust von Pinkstone auch meine Freunde zu verlieren, am meisten Angst. So große Angst, dass ich mich kaum traute, den Gedanken laut auszusprechen.
Was, wenn die anderen bloß darüber lachten? War es nicht typisch für Amerikaner, dass für sie Freundschaften eher oberflächlich blieben? Zumindest war es das, was ich über die amerikanische Mentalität gehört hatte. Andererseits hatte sich unsere Freundschaft in den letzten Monaten als sehr stabil erwiesen. Sogar unsere Feuerprobe, als mein Ex-Kollege Chris versucht hatte, einen Keil zwischen uns zu treiben, hatten wir bestanden. Ach, verflixt, ich hatte bislang einfach zu wenig Erfahrung mit Freundschaften gesammelt. Rick, Pam, Saida und Abby waren die ersten Menschen in meinem Leben, die ich als echte Freunde betrachtete. Und da meine rationalen ersten beiden Gründe nichts bewirkt hatten, musste ich es wohl darauf ankommen lassen …
»Bedeutet euch das, was wir hier haben, denn gar nichts?«, fragte ich provokant. »Mir bedeutet es auf jeden Fall eine Menge. Für mich seid ihr nicht bloß Freunde. Für mich seid ihr wie eine zweite Familie. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir auch in Zukunft zusammen in Pinkstone wohnen können.« Okay, jetzt war es raus. Unsicher betrachtete ich die Gesichter meiner Mitbewohner. Keiner von ihnen sah aus, als wollte er lachen. Familie war bei uns allen im Moment ein heikles Thema.
Pam hatte Stress mit ihren Eltern, die auf einer Ranch in einem texanischen Kuhkaff lebten, weil sie von ihr verlangten, zurück nach Hause zu ziehen, um sich um ihre rückenkranke Mutter und vor allem die vier Männer der Familie zu kümmern. Dass Pam in New York bleiben wollte, um Schauspielerin zu werden – zumindest war das bis vor Kurzem ihr Plan gewesen –, verstanden sie nicht.
Saidas Verhältnis zu ihrer Mutter war stark angespannt, weil Saida von Mrs Stones Konto mehrere tausend Dollar an eine Tierschutzorganisation gespendet hatte. Noch wütender war Saidas Mutter aber vermutlich darüber, dass ihre Tochter vor Gericht gelandet war, weil sie einen Freund versteckt hatte, der von der Polizei gesucht worden war. Nun türmten sich auf Saidas Schuldenberg zusätzlich die Anwaltskosten.
Abby war zurück nach Hause gezogen, nachdem aufgeflogen war, dass sie bei einer Pornofilm-Firma gearbeitet hatte. Sie war dort zwar als Sekretärin beschäftigt gewesen, aber selbst das hatten ihre strenggläubigen Eltern nicht dulden können. Nun hatte sie einen Job im Gemeindesekretariat, bei dem sie sich zu Tode langweilte.
Ricks Großfamilie, die aus Italien stammte und nach seiner Aussage konservativer als der Papst war, sprach nicht mehr mit ihm, seit er durch die Intrigen meines Ex-Kollegen als schwul geoutet worden war.
Und ich? Ich hatte nie so etwas wie eine richtige Familie gekannt. Meine Mutter Sandy war in die große weite Welt verschwunden, kaum dass sie mich in sie hineingeboren hatte. Obwohl wir uns hier in New York wiedergetroffen und angenähert hatten, blieb unser Verhältnis distanziert. Wer mein Vater war, wusste ich nicht. Und meine geliebte Omama, bei der ich aufgewachsen war, erlebte ihren zweiten Frühling mit Birnenkopf Hubertus und hatte das einzige Zuhause, das ich jemals besessen hatte, gerade verkauft.
»Ich finde das supisüß von dir, Maxi, dass du das so sagst«, brach Abby schließlich das Schweigen. Obwohl sie offiziell nicht mehr bei uns wohnte, verbrachte sie jede freie Minute in Pinkstone. »Ich habe nur leider keinen Cent übrig, den ich beisteuern könnte. Wenn ich noch bei Lola Productions arbeiten würde, wäre das vielleicht was anderes. Da habe ich wirklich fantastisch verdient. Aber jetzt bekomme ich einen Hungerlohn, und meine Eltern verlangen, dass ich den Großteil davon an sie abgebe, weil ich wieder bei ihnen wohne.« Sie lächelte mich entschuldigend an. Trotzdem war ich ihr dankbar, dass sie meine Idee wenigstens nicht für völlig abwegig hielt.
»Ich wüsste auch nicht, wie ich das Geld auftreiben sollte«, mischte Pamela sich ein. »Mein Gehalt ist zwar nicht schlecht, aber ich kriege keine Unterstützung mehr von zu Hause. Deshalb reicht es gerade so für mich selbst. Wenn es der Sache dient, wäre ich natürlich bereit, einen Millionär zu heiraten. Aber bisher habe ich nur die Tellerwäscher bei uns im Diner kennengelernt.« Sie lachte trocken und schob sich noch ein paar orange Gummibärchen in den Mund. Vielleicht hatte ich die Wirkung der Bärchen unterschätzt, zumindest schien Pams Stimmung sich aufzuhellen.
»Mal ganz im Ernst.« Saida wirkte alles andere als begeistert vom Verlauf des Gesprächs. »Dieser Modeljob bringt zwar gutes Geld, aber ihr kennt meine finanzielle Lage. Erst mal muss ich meine Schulden abstottern. Und dafür brauche ich mehr als bloß ein Engagement.«
Rick hatte bisher noch kein Wort gesagt. Scheinbar in Gedanken spielte er die ganze Zeit mit meinem massakrierten Pumps herum. Doch dann richtete er den spitzen Schuh plötzlich wie eine Waffe auf mich und erklärte: »Also, ich hab eh schon überlegt, ob ich nicht mein eigenes Business starten soll. Wenn es gut läuft, bleibt am Ende vielleicht ein bisschen Kohle übrig.«
»Was?« Ich war so überrascht, dass ich mich im ersten Moment gar nicht richtig freuen konnte, dass Rick meinen Vorschlag unterstützte. Rick war zwar immer der jenige von uns mit den meisten Jobs gewesen – er arbeitete im Fitness-Studio, als Baseball-Trainer und als Fahrradkurier –, aber ich hatte angenommen, dass er keine Lust hatte, sich auf eine Sache festzulegen. Vermutlich hatte dabei auch eine Rolle gespielt, dass seine Eltern von ihm erwartet hatten, dass er das Restaurant seiner Familie irgendwann übernehmen und weiterführen würde. Und auch wenn Rick dazu nie Lust gehabt hatte, hatte er sich diese Option irgendwie offengehalten. Und jetzt wollte er sich selbstständig machen? »Was hast du denn genau vor?«, hakte ich nach.
»Ich dachte an eine Art Bootcamp. Für Leute, die extrem schnell extrem fit werden wollen. So auf die ganz harte Tour. Die Leute richtig schön quälen.« Er zog einen Mundwinkel und eine Augenbraue in die Höhe – das ultra-coole Rick-Grinsen.
»Aber dafür bräuchtest du einen Trainingsraum. Wie willst du das bezahlen?« Pam blieb wie immer pragmatisch.
»Nee, ich veranstalte das draußen.« Rick schien sich tatsächlich schon ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht zu haben, was mich erneut überraschte. Er war mir nie als jemand erschienen, der großartig Pläne schmiedete. »Es gibt da eine Trainerin, eine Deutsche übrigens, die bietet so was auf der Brooklyn Bridge an. Kommt total gut an. Und ich dachte mir: Wieso sollte das hier auf der Williamsburg Bridge nicht genauso klappen? Ist vielleicht nicht so schick, aber passt gut zur harten Tour.«
Wow, so viele Sätze am Stück hatte ich Rick noch nie reden gehört. Und seine Idee gefiel mir auch richtig gut. Sie passte zu ihm.
»Ja, mach das auf alle Fälle«, stimmte ich begeistert zu. »Das ist genau dein Ding.« Erst dann fiel mir auf, was das für Pinkstone bedeutete: Wenn Rick sein Bootcamp aufziehen wollte, würde ihm garantiert weniger Zeit bleiben, um bei der Renovierung des Hauses mitzuhelfen. Und wenn wir damit nicht vorankamen, würde unser Vermieter uns vermutlich hinauswerfen, noch bevor die Frist abgelaufen war. Wie sollten wir das schaffen? Genau diese Frage stellte ich in die Runde, wobei ich vor allem Saida und Pam scharf anschaute. Doch wieder antwortete Rick.
»Das hab ich auch überlegt«, erklärte er. Er schien sich in letzter Zeit eine Menge Gedanken gemacht zu haben … »Und ich denke, wir müssen uns einen neuen Mitbewohner suchen. Am besten einen, der ein bisschen stärker ist als ihr, Mädels, damit er hier mit anpacken kann. Und der was vom Dachdecken versteht.« Mit dem Pumps deutete er auf das Loch in der Decke.
Abby sah ein bisschen unglücklich aus bei dem Vorschlag, vermutlich fürchtete sie, nicht mehr so willkommen in Pinkstone zu sein, wenn ihr altes Zimmer neu vermietet wäre. Aber Saida nickte zustimmend und Pam quietschte vergnügt (die orangen Bärchen schienen tatsächlich zu wirken): »Am besten, wir finden einen Millionär als Mitbewohner. Damit wären alle Probleme gelöst.«
Ich lachte, nicht nur über Pams Vorschlag, sondern weil ich erleichtert war, dass offensichtlich allen daran gelegen war, eine Lösung für Pinkstone zu finden. Jetzt brauchte ich nur noch einen genialen Einfall, wie wir an sehr viel Geld kommen konnten. Ein Millionär als Mitbewohner wäre ein guter Anfang, dachte ich, während wir unsere Versammlung auflösten, weil es mittlerweile bitterkalt in meinem Zimmer geworden war.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Probleme damit erst anfangen würden …
We want you! Die Pinkstone-WG sucht einen neuen Mitbewohner.
Wir bieten: ein helles Zimmer mit süßen Spitzendeckchen und Porzellanfigürchen (die Abby hinterlassen hat) in einem tollen (leider stark renovierungsbedürftigen) Haus in einer angesagten Wohngegend (mitten in Williamsburg) sowie eine ziemlich verrückte, aber liebenswerte Wohngemeinschaft. Und das Beste: Du wohnst mietfrei – na, wenn das kein Angebot ist!
Was du mitbringen solltest: handwerkliches Geschick, die Bereitschaft, bei der Renovierung mit anzupacken. Und idealerweise ein paar Millionen auf dem Konto (das ist allerdings keine zwingende Voraussetzung).
KAPITEL3
Du hast doch nichts dagegen, wenn ich die Schuhe ausziehe.« Das war keine Frage. Das war eine Feststellung. Zumal der langhaarige, langbärtige Typ, der sich als Lyrics vorgestellt hatte – sollte das wirklich ein Name sein? – die Jesuslatschen bereits abgestreift hatte und nun ausgiebig mit seinen haarigen Zehen wackelte. Nackte Füße an diesem durchwachsenen Märztag – noch dazu so hässliche! – waren für mich eigentlich Grund genug, Lyrics oder wie auch immer er hieß, sofort wieder zur Tür hinauszubefördern. Aber wir brauchten einen neuen Mitbewohner und womöglich war dieser Hippie ein handwerkliches Genie. Also führte ich ihn in die Küche, wo meine Mitbewohner schon gespannt auf Bewerber Nummer eins warteten.
»Das sind Pamela, Saida, Rick und Abby.« Ich deutete mit dem Finger auf jeden Einzelnen am Küchentisch. »Und das ist …« Mist, ich hatte seinen komischen Namen auf dem kurzen Weg von der Haustür zur Küche schon wieder vergessen. Ich war noch nie besonders gut mit Namen gewesen. Doch statt sich selbst vorzustellen, machte der Typ das Peace-Zeichen in die Runde, zog sich umständlich die Gitarre über den Kopf, die auf seinem Rücken gebaumelt hatte, und schälte sich aus seinem Lammfellmantel. Darunter trug er: nichts!
»Ups«, machte Pamela. Abby schloss mit einem Quieken die Augen und Rick zog verwundert eine Augenbraue hoch. Nur Saidas Gesichtsausdruck blieb völlig ungerührt.
»Das stört euch doch nicht, wenn ich so herumlaufe.« Wieder eine reine Feststellung. »Ich mache das seit Jahren so. Fühle mich viel freier seitdem. Kleidung drängt uns bloß in einen konstanten Kampf zwischen Individualität und Konformismus. Nacktheit befreit uns davon, indem sie ein Klima komfortabler Individualität ohne Vortäuschungen fördert. Seht ihr doch auch so.« Wieder eine Feststellung.
»Ähm«, machte ich und registrierte dankbar, dass er jetzt immerhin die Gitarre über seine primären Geschlechtsmerkmale legte.
»Das ist eine wirklich befreiende Erfahrung. Ich rate euch auch dazu. Indem man alle Kleider ablegt, entledigt man sich auch der ganzen sozialen Last, die mit dem Nacktheitstabu in unserer Gesellschaft einhergeht. Ich kann euch da gerne ein bisschen Nachhilfe geben, wenn ich erst mal hier eingezogen bin. Kann ich jetzt das Zimmer sehen?«
»Ähm«, machte ich wieder. Ich war ja ein Fan von Verrückten. Aber dieser Nackedei stand auf der Verrücktheitsskala eindeutig schon kurz vor der Einweisung in die geschlossene Anstalt. Ich warf einen verzweifelten Blick in die Runde meiner Mitbewohner. Wie wurden wir diesen Kerl, der eine Gitarre für die angemessene Bekleidung bei einem WG-Vorstellungsgespräch hielt, so schnell wie möglich wieder los? Aber niemand schien in der Lage zu sein, die Initiative zu ergreifen. Abby hielt die Augen fest geschlossen, Rick starrte irritiert auf die üppige Brustbehaarung unseres Gegenübers, Pamela machte den Eindruck, als würde sie vor unterdrücktem Lachen gleich platzen, und ich selbst war noch immer sprachlos. Ausgerechnet Saida rettete uns.
»Du, das ist ein echt interessanter Ansatz«, erklärte sie. »Aber mir passt es nicht, dass du einen Lammfellmantel trägst. Hast du dir mal überlegt, wie qualvoll das für die kleinen Tiere ist?« Und damit geleitete sie unseren Gast so entschieden zur Tür, dass er kaum Zeit fand, wieder in seinen Mantel zu schlüpfen.
»Wie cool war das denn?«, fragte Rick perplex, als Saida wieder in die Küche kam.
»Ist er weg?« Abby blinzelte vorsichtig zwischen halb geschlossenen Lidern hervor.
»Wenn der Typ hier einzieht, können wir unseren Fernseher verkaufen«, amüsierte sich Pamela. »Der ist besser als jede Comedy.«
»Das war der Tiefpunkt«, erklärte ich hoffnungsvoll. »Ab jetzt kann es nur noch besser werden.« Aber darin hatte ich mich leider getäuscht.
»Natürlich bin ich handwerklich begabt.« Kandidatin Nummer zwei hatte eine Stimme, deren Frequenz jeder Hundepfeife Konkurrenz machte. »Ich meine, schaut euch nur mal diese Strasssteine an!« Auffordernd streckte sie uns ihre zu schrillen Kunstwerken manikürten Fingernägel entgegen. »Hab ich alles selbst gemacht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geschickt man dafür sein muss.«
Ich konnte mir vor allem nicht vorstellen, wie sie mit diesen Krallen ein Haus putzen, geschweige denn, wie sie es renovieren wollte.
»Das ist ja wirklich, äh, ungewöhnlich«, erwiderte ich diplomatisch. »Aber wir suchen eigentlich einen Mitbewohner, der hier mit anpackt, äh …« Wie hieß die blond gelockte Krallenfrau noch mal?
»Cindy«, kam Blondie mir zu Hilfe. »Eigentlich Cinderella, aber ich finde, das klingt total nach Disneyland.«
Stimmt, und da hätte sie auch super hingepasst, dachte ich. Aber ich sagte: »Also, Cindy, welche handwerklichen Fähigkeiten besitzt du denn sonst noch so?«
»So einige.« Sie lachte spitz und schaute in die Runde, bis ihr Blick an Rick hängen blieb. Mit maskaraverklebten Wimpern blinkerte sie meinen Mitbewohner an. »Bisher hat sich zumindest noch keiner beschwert.«
Ach du Sch…! Versuchte sie tatsächlich, Rick anzugraben? Dann kannte sie meinen Blog wohl nicht, oder sie war noch dümmer, als ich bisher vermutet hatte. Sonst hätte sie ja gewusst, dass ihre Annäherungsversuche bei Rick vergebliche Liebesmühe waren. Pamela prustete laut los, Abby schloss schon wieder die Augen, und Rick, der sich noch nicht ganz von dem nackten Hippie erholt zu haben schien, bekam den Mund vor Staunen gar nicht mehr zu. Wieder war es Saida, die dieser Horror-Show ein Ende setzte.
»Hör zu, Süße. Rohre verlegen ist so ziemlich das Einzige, was wir hier nicht vorhaben. Und wenn ich dich so anschaue, wird mir schlecht bei der Vorstellung, wie viele Tiere bei schrecklichen Tierversuchen sterben mussten, damit du dir diese ganze Schminke ins Gesicht kleistern konntest. Deshalb würde ich sagen, du gehst jetzt besser, bevor ich auf die Idee komme, meine handwerklichen Fähigkeiten zu nutzen, um dir die Krallen zu stutzen.«
Cinderella stieß ein entsetztes Hundepfeifen-Kreischen aus und stürzte zur Tür.
»Okay«, erklärte ich, als die Haustür mit einem Rums hinter ihr ins Schloss gefallen war. »Das war definitiv der Tiefpunkt.« Die anderen schauten mich zweifelnd an.
»Vielleicht brauchen wir doch keinen neuen Mitbewohner«, sagte Rick. Abby nickte vehement.
»Aber, Rick.« Ich schaute ihn über den Tisch hinweg streng an. »Es war doch dein Vorschlag.«
»Schon, aber wir kriegen das auch so hin.« Rick stand von seinem Stuhl auf und fing an, vor dem Tisch auf und ab zu laufen. Rick war eigentlich immer in Bewegung. Es fiel ihm schwer, länger als fünf Minuten still zu sitzen, vor allem, wenn ihn etwas beschäftigte. »Dann muss das Bootcamp halt noch ein paar Monate warten.«
»Auf gar keinen Fall!« Ich war so froh, dass Rick endlich etwas gefunden hatte, das er mit Begeisterung tun wollte, und ich durfte nicht zulassen, dass er nun zugunsten von Pinkstone darauf verzichtete. »Wollt ihr wirklich nach nur zwei Versuchen aufgeben? Wir haben …« Ich warf einen Blick auf den Notizzettel mit der Liste von Bewerbern, der vor mir auf dem Tisch lag. »Insgesamt einundzwanzig Interessenten. Da wird ja wohl einer dabei sein, der gut zu uns passt, handwerklich was draufhat und kein totaler Freak ist.« Aber zum zweiten Mal täuschte ich mich.
An diesem Nachmittag zog eine Schar der kuriosesten Gestalten, die New York zu bieten hatte, durch unsere Küche. Ich fragte mich, ob ich in meinem Blogbeitrag nicht hätte erwähnen sollen, dass wir alle ein bisschen verrückt waren. Ich hatte nicht bedacht, dass die Auffassung von »verrückt« sehr stark auseinanderging. Ich verstand darunter: etwas speziell, aber liebenswert. Doch auf die meisten Kandidaten unseres WG-Castings traf nur eine einzige Beschreibung zu: absolut durchgeknallt.
»Ich hab da schon mal einen Verteidigungsplan ausgearbeitet.« Bewerber Nummer sieben schmiss eine Pistole mitten auf unseren Küchentisch. An seinem Gürtel hingen unübersehbar eine weitere Schusswaffe sowie ein Messer, das länger war als unser größtes Küchenmesser. »Heutzutage muss man auf alles vorbereitet sein. Und in eurer Situation erst recht. Die Straßen von New York sind so sicher wie nie? Dass ich nicht lache. Alles nur Geschwätz von Politikern, die keine Ahnung haben, wie es in der Wirklichkeit zugeht. Jeder Amerikaner muss in der Lage sein, sein eigenes Haus zu verteidigen, sage ich. Also, wie sieht eure Verteidigungsstrategie aus? Ihr habt keine? Dachte ich mir. Deshalb hab ich da, wie gesagt, etwas vorbereitet.«
»Meine Mom sagt, dass es jetzt endlich Zeit wird, mir was Eigenes zu suchen.« Kandidat Nummer elf biss nervös auf seinen Fingernägeln herum, die ohnehin schon fast bis zum Nagelbett abgekaut waren. »Und mein Psychiater ist auch dieser Meinung. Mit neunundzwanzig sollte man nicht mehr zu Hause wohnen, meint er. Aber ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Ich bin es ja gar nicht gewohnt, allein zu leben. Kochen kann ich auch nicht so gut. Also eigentlich gar nicht. Ich frage mich, was ich dann essen soll, wisst ihr. Deshalb dachte ich, in einer WG ist es doch fast wie in einer großen Familie. Da sorgt einer für den anderen. Ich brauche auch eigentlich gar kein eigenes Zimmer. Mir wäre es ohnehin lieber, wenn ich mit jemandem das Zimmer teilen könnte. Bisher habe ich mir das Zimmer nämlich immer mit meiner Mutter geteilt, wisst ihr, und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, wie das sein wird, ganz allein zu schlafen.«
»Diese Pflanzen sind sehr empfindlich.« Kandidatin Nummer fünfzehn hatte ihre Hände schützend um einen Holzkasten mit mickrigen Kakteen gelegt. »Sie brauchen viel Licht, aber nur Nachmittagssonne, das Zimmer liegt doch nach Südwesten, oder? Und sie vertragen absolut keine Zugluft. Die Fenster sind doch ausreichend abgedichtet, oder? Sie sind so anspruchsvoll wie Kinder, ach, was sage ich? Anspruchsvoller! Ich muss jeden Tag mindestens zwei Stunden mit ihnen reden, sonst gedeihen sie nicht. Aber ihr dürft auf keinen Fall mit ihnen sprechen, sie sind da sehr eigen. Sie fremdeln stark, ihr versteht das sicher, oder?«
»Ich bin Künstler, euch ist ja wohl klar, dass man darauf Rücksicht nehmen muss.« Kandidat Nummer neunzehn strich sich die langen, fettigen Haare aus der Stirn. »Wenn die Inspiration kommt, dann kommt sie. Die Muse kennt keine Tageszeiten. Meistens arbeite ich nachts. Wenn alles um mich herum still ist, kann meine Kreativität frei fließen.« – »Was für eine Art Künstler bist du denn?« – »Bildhauer.«
»Zucht und Ordnung, sage ich, müssen in einem solchen Haus herrschen.« Kandidatin Nummer einundzwanzig war so alt, dass sie unser aller Mutter hätte sein können, und hatte offenbar Ansichten, wie sie höchstens von unseren Ururgroßeltern vertreten worden waren. »Ich bringe den Saustall hier schon auf Vordermann, das könnt ihr mir glauben. Feste Essenszeiten, Putzplan und Nachtruhe um halb zehn. Damit fangen wir direkt morgen an. Meine Kinder haben mich Drill Sergeant genannt. Und diese Bezeichnung habe ich mir redlich verdient. Yes, Ma’am! Das sind die einzigen zwei Wörter, die ich von euch hören will. Also, wollt ihr, dass ich bei euch einziehe?«
»Puh«, machten wir alle wie aus einem Mund, als auch der weibliche Drill Sergeant das Haus verlassen hatte. Es war spät und wir waren erschöpft. Nein, wir waren absolut fix und fertig nach diesem Bewerbungsmarathon der Gruselgestalten. Aber das Schlimmste war, wir hatten immer noch keinen neuen Mitbewohner gefunden. Als das Telefon im Flur schrillte, drehten wir alle bloß matt den Kopf in Richtung des Klingelns, aber niemand konnte sich aufraffen, den Anruf entgegenzunehmen. Erst beim zehnten Läuten erbarmte Pamela sich.
»Das war noch ein Interessent«, erklärte sie, als sie in die Küche zurückkehrte, wo wir alle in derselben Haltung am Tisch saßen, zu platt, um uns nur einen Millimeter zu bewegen. »Und er klang richtig nett. Ziemlich normal, soweit man das am Telefon beurteilen kann.«
»Das ist doch gut.« Ich versuchte, wenigstens ein bisschen Begeisterung zu verbreiten. »Wann kann er kommen?«
»Da liegt das Problem.« Pamela ließ sich wieder auf ihren Stuhl fallen. »Er schafft es heute nicht mehr und würde gerne morgen Vormittag vorbeischauen.«
»Das ist ja blöd.« Ich seufzte. »Da muss ich leider arbeiten. Aber wisst ihr was: Ihr schaut ihn euch einfach ohne mich an. Wenn er der Richtige ist, könnt ihr das genauso gut allein beurteilen.« Leider lag ich damit zum dritten Mal an diesem Tag absolut falsch.
KAPITEL4
Er ist perfekt!« Pam klang absolut überzeugt. »Wir sind uns alle einig: Der Typ passt super zu uns.«
»Und sag ihr auch, wie gut er aussieht, ja?«, hörte ich Abby aufgeregt aus dem Hintergrund rufen. Es knisterte heftig in der Leitung, dann quietschte Abby direkt in mein Ohr. »Er ist supisüß. Natürlich nicht so umwerfend wie William« – sie meinte Prinz William, den britischen Thronfolger, für den sie (un)heimlich schwärmte –, »aber er hat etwas, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, etwas Geheimnisvolles …«
»Schluss mit dem Gequatsche, Abby.« Das war Ricks genervte Stimme, dann wieder Knistern, dann mein Mitbewohner am Telefon. »Der Kerl ist cool. Ziemlich sportlich. Der kann hier garantiert mit anpacken.«
Ich war gespannt, was Saida zu dem Bewerber zu sagen hatte – ob er wohl die richtigen Klamotten trug? –, aber sie meldete sich nicht zu Wort, vermutlich war ihr Schweigen die größtmögliche Zustimmung. Stattdessen hatte ich plötzlich wieder Pam am Apparat.