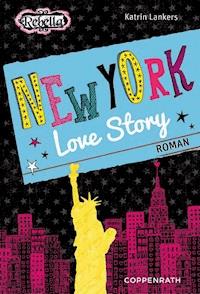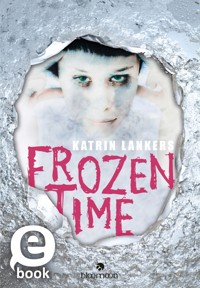Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Coppenrath
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Rebella
- Sprache: Deutsch
Vier Wochen Interrail! Was wie ein tolles Abenteuer klingt, ist für Lena der größtmögliche Albtraum. Denn sie muss ausgerechnet ihre zickige Schwester Juli auf diese Reise begleiten, nachdem sich deren beste Freundin das Bein gebrochen hat. Für Lena gibt es nur einen einzigen Grund mitzufahren: Sie will es zum Abschiedskonzert ihrer Lieblingsband nach Barcelona schaffen. Dafür nimmt sie nicht nur Julis Launen in Kauf, sondern stellt sich auch den Tücken der Tour. Als die beiden Schwestern allerdings auf Tobias und Felix treffen, wird die Reise zu einer rasanten Achterbahnfahrt der Gefühle: Die Mädchen gehen mit den zwei Jungs eine heiße Wette ein und liefern sich ein Rennen durch ganz Europa. Und schon bald schlagen sämtliche Herzen höher ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN 978-3-649-61609-2 (eBook)
eBook © 2013 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,
Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
ISBN 978-3-649-61325-1 (Buch)
Buch © 2013 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,
Hafenweg 30, 48155 Münster
Text: Katrin Lankers, vertreten durch:
Literatur Agentur Hanauer, München
Umschlaggestaltung: Anna Schwarz
Coverillustration: Marion Rekersdrees
Lektorat: Isabelle Ickrath
Satz: Sabine Conrad, Rosbach
www.coppenrath.de
Wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet ein Paar High Heels für mich mal Schicksal spielen würde? Dabei trage ich gar keine. Aber genau so war’s!
aus Lenas Tagebuch
An einem ruhigen Sonntagnachmittag, wenige Tage vor Beginn der Sommerferien, rief das Schicksal bei uns an. Das Telefon klingelte, aber ich blieb auf meinem Bett liegen und stellte die Musik lauter. Wer immer da telefonisch unseren Hausfrieden störte, wollte garantiert nicht mich sprechen, sondern Juli.
Hätte ich zu diesem Zeitpunkt bereits geahnt, dass dieser Anruf mir meine gesamten Sommerpläne versauen würde … Ich wäre von meinem Bett gesprungen und die Treppe heruntergerast, um noch vor meiner Schwester am Telefon zu sein – und hätte mir unterwegs nach Möglichkeit beide Beine gebrochen. Ahnte ich aber nicht. Ich lag auf dem Bett, hörte Musik und trauerte.
»Don’t you ever leave me, don’t you ever go«, sang Joey mir durch die Stöpsel meines iPods direkt ins Ohr, und ich mussteblinzeln, weil mir wieder Tränen in die Augen stiegen. »Your love is so special, you’re my only one«, fuhr Joey fort, und natürlich kullerten mir dabei die ersten Tränen aus den Augenwinkeln über die Schläfen und versickerten im Kissen, das ohnehin schon ganz feucht von meinem Geheule war.
Denn Joey hatte genau das vor: mich zu verlassen!
Und nicht nur er. Die fünf Jungs vonNo Way– der besten Band aller Zeiten – hatten gestern angekündigt, dass sie sich trennen würden, und zwar schon diesen Sommer. Fünf Konzerte waren noch geplant, eins auf jedem Kontinent, dann sollte Schluss sein. Bei dem Gedanken konnte ich ein leises Aufschluchzen nicht unterdrücken. »You are the girl of my dreams«, sang Joey und die anderen stimmten in den Refrain ein: »Don’t you ever leave me …«
Nein, Joey, ich werde dich nie verlassen, dachte ich. Ich werde dich immer lieben! Denn ich liebte Joey schon so lange, seit über einem Jahr, dass ich mir nicht vorstellen konnte, jemals wieder etwas Ähnliches für einen anderen Jungen zu empfinden.
Könnte ich ihn doch nur einmal treffen …, dachte ich, und während ich »Dreamgirl« in Endlosschleife hörte, verlor ich mich in einem meiner Tagträume. Ich sah mich auf dem Konzert vonNo Wayin der allerersten Reihe, direkt vor der Bühne, stehen, und während Joey »You are the girl of my dreams« anstimmt, schaut er mich an, die ganze Zeit über. Der Blick seiner knallblauen Augen bohrt sich in meinen, während er den Song nur für mich singt, es gibt nur noch unsbeide. Und dann, am Ende des Stücks, kommt er an den Rand der Bühne und streckt mir seine Hand entgegen. Ich greife danach und er zieht mich zu sich hoch. Die Menge tobt, doch wir hören nichts außer dem Klopfen unserer Herzen, als wir uns küssen.
Poch, poch, POCH!
Heftiges Hämmern gegen meine Zimmertür riss mich aus meinen Träumereien. Widerstrebend zog ich die Stöpsel aus meinen Ohren, als bereits die Tür aufflog und Juli ins Zimmer stürmte.
»Ich hab dich nicht reingebeten«, brauste ich sofort auf und schoss vom Bett hoch.
»Bist du nicht langsam zu alt für diesen Kinderkram?« Juli ignorierte meine Empörung einfach. Ihr verächtlicher Blick glitt über dieNo-Way-Plakate über meinem Bett und blieb an den Ohrstöpseln auf dem Kissen haften, aus denen noch immer, wenn auch gedämpft, Joeys Stimme zu hören war.
Ich hasse es, wenn Juli das tut. Bei jeder Gelegenheit muss sie mir vorhalten, dass sie bereits achtzehn und somit zwei Jahre älter ist als ich. Dabei benimmt sie sich meistens so, als ob es umgekehrt wäre! Hektisch wischte ich mir die Tränenspuren von den Wangen und machte eine gelangweilte Miene.
»Das geht dich gar nichts an, Miss Supererwachsen. Immerhin spielstdunoch mit Barbies.«
»Ichspielenicht mit ihnen, ichstylesie«, ließ sich Juli zu einer Verteidigung hinreißen. Ha, Punkt für mich!
»Wie auch immer.« Juli wuschelte mit spitzen Fingern denultrakurzen Pony ihres ultrakurzen Haarschnitts in Form.Pixiehieß diese Frisur, wie Juli jedem erklärte, der weniger Ahnung von Mode hatte als sie selbst – also so ziemlich jeder. »Unsere Eltern wollen mit dir reden.«
Ups. Warum das denn? Hatte ich etwas ausgefressen? Wohl kaum. Ich hatte den ganzen Tag tiefdeprimiert auf dem Bett gelegen, da gab es kaum Gelegenheiten, irgendetwas anzustellen. Und dann Julis Tonfall, als hätte sie in eine extrasaure Zitrone gebissen. Was war bloß los?
»Was gibt’s denn?«, fragte ich betont gelassen.
Doch anstelle einer Antwort machte Juli auf dem Absatz ihrer hochhackigen Sandaletten kehrt (trotz Schuhverbots zog sie ihre Parkettkiller auch im Haus nie aus) und stürmte aus meinem Zimmer. Etwas unwillig, aber zumindest auch ein kleines bisschen neugierig folgte ich ihr, nachdem ich mit einem letzten wehmütigen Seufzen meinen iPod ausgeschaltet hatte.
Unsere Eltern saßen bereits an dem großen, runden Tisch, jeder eine Tasse Tee vor sich (wie konnten sie bei dieser Sommerhitze Tee trinken?), als ich in die Küche kam. Nur Juli lehnte mit dem Po, der von einem Häkel-Minikleid mehr schlecht als recht bedeckt wurde, gegen die Spüle, die Arme vor der Brust verschränkt. Unruhig wippte sie mit der Fußspitze auf und ab, was ein nervtötendesKlack-Klackauf dem Holzboden verursachte. Sie sah angespannt aus und trotzdem perfekt.
Wieder einmal fiel mir auf, dass die Gene in unserer Familie extrem ungleich verteilt worden sind. Und leider hat meine ältere Schwester, zumindest optisch, all die guten abbekommen. Ihre dunkelbraunen, kajalumrandeten Augen wirkten riesig in ihrem schmalen Feengesicht und wurden nur vom lipglossigen Kussmund an Vollkommenheit überboten. Juli sieht fast aus wie eine exakte Kopie der Schauspielerin Emma Watson, die in Harry Potter dessen Freundin Hermine spielt. Wobei zwischen der Schauspielerin und ihrer Filmfigur meines Erachtens Welten liegen: Emma Watson ist im wahren Leben zum Niederknien hübsch – und Hermine gerade mal langweiliger Durchschnitt.
Und genau das bin ich auch: der Hermine-Granger-Typ (außer dass ich nicht so ein Streber bin). Nicht total daneben, sondern in jeder Hinsicht Durchschnitt. Durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, mittellange, mittelblonde Haare und mittelbraune Augen. Mittelmäßiger geht es eigentlich nicht.
»Ähm, also«, räusperte sich mein Vater und stierte in seine Tasse, als könnte er im Teesatz lesen. Fahrig fuhr er sich mit der Hand über den Kopf. Unsere straßenköterblonden Haare – die Juli natürlich mit hellblonden Strähnen veredelt – haben wir von ihm geerbt. Was man allerdings nicht mehr sehen kann, weil er inzwischen vollkommen kahl ist.
»Ähm, also«, wiederholte mein Vater und strich sich nun über seinen imaginären Bart.
Was war hier bloß los? So langsam kam mir die ganze Sache sehr komisch vor.
»Folgendes ist passiert«, mischte sich meine Mutter, pragmatisch wie immer, ein und tätschelte meinem Vater die Hand. »Julia hat gerade einen Anruf von Laura erhalten. Die Arme liegt im Krankenhaus. Sie ist auf der Treppe ausgerutscht und hat sich einen Bänderriss zugezogen.«
Kein Wunder, dachte ich gehässig, bei den mörderisch hohen High Heels, die auch Julis beste Freundin ständig an den Hacken hatte.
Ich fürchte, manchmal habe ich eine etwas lange Leitung, sonst hätte ich in diesem Moment garantiert die Flucht ergriffen, aber mir war immer noch nicht klar, was Lauras Bänderriss mit mir zu tun haben sollte.
»Jedenfalls«, fuhr meine Mutter unbeirrt von meinem Schweigen fort, »wird Laura nächste Woche auf keinen Fall mit Julia auf Interrailtour gehen können.«
Aha. Darum ging es also: um Julis seit Monaten geplante Reise, die unsere Eltern ihr zum Abi geschenkt hatten. Vier Wochen mit dem Zug quer durch Europa. Dieser Reise fieberte ich mindestens ebenso entgegen wie Juli selbst. Denn für mich bedeutete sie vor allem eins: vier Wochen Juli-frei! Vier Wochen ohne meine nervige große Schwester, in denen ich nichts anderes tun würde, als mich in der Hängematte in unserem Garten zu räkeln, einen schönen Liebesroman nach dem nächsten zu verschlingen und – als Folge der neuesten Entwicklungen beiNo Way– meinen akuten Liebeskummer zu pflegen.
»Julia hat herumtelefoniert.« Gedankenverloren fegte meine Mutter ein paar Krümel von der Tischplatte. »Leider hatkeine von ihren anderen Freundinnen Zeit, deine Schwester auf dieser Reise zu begleiten.« Jetzt schaute sie mich auffordernd an, als würde sie von mir erwarten, etwas Produktives zu dem Gespräch beizutragen. Dummerweise war mir gerade die Kinnlade heruntergefallen, und mein Mund fühlte sich staubtrocken an, denn plötzlich dämmerte mir, worauf das Ganze hinausgehen sollte.
»Aber …«, startete ich einen schwachen Gegenanlauf, als Juli mir zuvorkam.
»Und deshalb soll dieses Baby hier als mein Babysitter mitkommen?« Schwungvoll stieß sie sich von der Spüle ab und stolzierte mit wütenden Schritten zum Küchentisch. Sie donnerte mit ihrer rechten Faust so heftig auf die Tischplatte, dass der Tee aus den Tassen schwappte. »Das ist nicht euer Ernst.«
»Julia, mein Schatz, sei doch mal vernünftig.« Auch nach achtzehn Jahren schien meine Mutter noch nicht kapiert zu haben, dass Vernunft nicht gerade zu Julis Stärken zählt.
»Eine solche Reise allein anzutreten, ist viel zu gefährlich. Und auch schrecklich langweilig.« Das war wieder mal typisch für meine Mutter. Als Lehrerin hielt sie es wohl für eine geschickte pädagogische Strategie, einem einzureden, alles, was sie entschied, sei bloß zu unserem Besten. »Sicher habt ihr zu zweit viel mehr Spaß.«
»Auf keinen Fall«, riefen Juli und ich wie aus einem Mund und warfen uns augenblicklich einen irritierten Blick zu. Es kommt selten vor, dass wir uns über etwas so einig sind.
»Bevor ich die Tour mit Lena mache, gehe ich lieber für vier Wochen ins Kloster«, ereiferte Juli sich.
»In Ordnung, das wird sich arrangieren lassen.« Meine Mutter wirkte plötzlich sehr gelassen, was Juli nur zu neuer Raserei trieb.
»Ihr habt mir die Reise geschenkt. Schon vergessen?« Ihre rot lackierten Fingernägel trommelten im Stakkato auf den Tisch. »Ihr könnt sie mir nicht einfach wieder wegnehmen.« Sie klang wie ein kleines Kind, dem man die Lieblingspuppe entrissen hatte, um sie in die Waschmaschine zu stecken.
»Doch, liebe Julia, das können wir«, entgegnete meine Mutter noch immer ruhig. »Es ist immerhin unser Geld, mit dem du verreisen willst. Und du bist unsere Tochter. Deshalb tragen wir die Verantwortung dafür, dass dir auf dieser Reise nichts zustößt.«
Juli schnaufte, und ich versuchte, meine Atmung unter Kontrolle zu bringen, die so hektisch geworden war, dass ich garantiert kurz vor dem Hyperventilieren stand.
»Aber …«, versuchte ich es noch einmal, doch ich wurde wieder unterbrochen, dieses Mal von meiner Mutter.
»Meine Güte, Mädchen, ihr stellt euch ja an, als würden wir euch aneinanderketten und in die Wüste schicken.« Sie verdrehte die Augen. Das theatralische Wesen hat Juli definitiv von unserer Mutter geerbt, während ich eher der ruhige, etwas schüchterne Typ bin, wie unser Vater. Apropos. Der sah aus, als würde ihm unsere aktuelle familiäre Massenkarambolage heftig auf den Magen schlagen. Und er brachte noch immerkein Wort heraus. Dafür gelang es mir endlich, mich aus meiner Schreckstarre zu lösen.
»Darf ich vielleicht auch mal was dazu sagen?«, fragte ich schnippisch.
»Natürlich.« Meine Mutter wandte sich mir mit einem etwas angestrengten Vertrauenslehrerlächeln zu. »Was möchtest du sagen?«
»Ich habe keine Lust auf diese Reise«, stieß ich hervor. »Überhaupt nicht. Ich weiß wirklich nicht, warum ich durch die Gegend gondeln soll, nur damit Juli ihre tolle Tour machen kann. Sorry, sucht euch bitte einen anderen Deppen!«
Ich senkte den Blick, damit ich meine Eltern nicht direkt anschauen musste, und wollte mich umdrehen, um aus dem Krisenherd in der Küche zu flüchten, da donnerte mein Vater plötzlich seine Faust auf den Tisch, was noch viel lauter rumste als eben bei Juli.
»Jetzt reicht’s«, fuhr er uns an. »Da ackert man Tag für Tag, um euch alles zu ermöglichen, was ihr euch wünscht. Und was erntet man dafür? Nichts als Meckerei. Eure Mutter und ich bieten euch die Chance zu reisen, die schönsten Plätze Europas kennenzulernen, am Strand zu liegen und etwas zu erleben. Und ihr? Wollt nicht. Na, dann eben nicht. Julis Ticket geben wir zurück. Ende. Aus.« Seine Hand sauste noch einmal mit einem Rums herunter, dann blieb sie auf der Tischplatte liegen, als wüsste mein Vater nicht mehr, was er damit anfangen sollte. Wir alle starrten ihn an. So viele Worte auf einmal hatte er schon länger nicht mehr gesagt.
»Das könnt ihr nicht machen!«, kreischte Juli in die Stille hinein, die auf den Ausbruch meines Vaters gefolgt war. Und dann erging sie sich in höchsten Tönen darüber, dass diese Reise ihr gutes Recht sei, weil sie hart dafür geschuftet habe (was nicht ganz stimmte, denn sie hatte zwar ein tolles Abizeugnis bekommen, aber eigentlich musste sie nie groß für ihre guten Noten lernen), und dass sie volljährig sei und unsere Eltern ihr nichts verbieten könnten …
Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, denn in meinem Kopf fuhren die Gedanken plötzlich Karussell. Ausgelöst durch das kleine Wörtchen »Ticket«, hatte sich ein Denkprozess in Gang gesetzt, der ungefähr so aussah: Das einzige Europakonzert vonNo Waywürde in vier Wochen in Barcelona stattfinden, im größten Stadion Europas. Für mich war es somit bisher unerreichbar gewesen, zumal sämtliche Tickets innerhalb der ersten acht Stunden nach Bekanntgabe der Pläne vonNo Wayrestlos ausverkauft waren. Aber man konnte nie wissen. Vielleicht hatte ich ja Glück und konnte vor der Konzerthalle noch ein Ticket ergattern. Vorausgesetzt ich schaffte es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das erschien mir plötzlich gar nicht mehr so unmöglich wie noch bis vor ein paar Minuten …
»Okay«, sagte ich mitten in Julis Gezeter hinein. Und weil mich niemand hörte, wiederholte ich lauter: »Okay, ich komme mit.«
Juli klappte ihren Mund auf der Stelle zu und starrte mich mindestens ebenso verblüfft an wie meine Eltern.
»Wie bitte?«, stieß sie schließlich so atemlos hervor, als hätte jemand die Luft aus ihr herausgelassen.
»Im Ernst?«, fragte meine Mutter gleichzeitig.
Nur mein Vater sagte natürlich nichts, sondern nickte mir nur mit einem kleinen, anerkennenden Lächeln zu.
»Ja«, bekräftigte ich. »Ich fahre mit, damit Juli ihre Tour nicht absagen muss. Ich habe nur eine Bedingung.«
»War ja klar«, ätzte Juli sofort, aber meine Mutter bedeutete ihr mit einer Handbewegung, mal für einen Moment die Klappe zu halten.
»Was für eine Bedingung?«
»Ich will in vier Wochen in Barcelona sein«, sagte ich so fest wie möglich und kam mir vor wie ein Pokerspieler, der sein ganzes verbliebenes Geld setzt – allerdings habe ich noch nie Poker gespielt und weiß von daher nicht, ob es sich wirklich genauso anfühlt.
»Das Abschiedskonzert vonNo Way.« Juli stöhnte und verdrehte die Augen wie vorhin unsere Mutter.
»Ja. Was dagegen?« Jetzt verschränkte ich die Arme und funkelte Juli herausfordernd an. Die grummelte irgendetwas Unverständliches, doch unsere Mutter klatschte bereits begeistert in die Hände und sprang auf.
»Das klingt nach einem guten Kompromiss. Dann müssen wir jetzt nur noch ein zusätzliches Ticket für Lena besorgen und schon kann es losgehen. Meine beiden großen Mädchen auf Reisen. Fantastisch.« Tatendurstig rieb sie sich die Hände, als wolle sie sofort zum Bahnhof fahren, um die Fahrkartezu besorgen. Julis Grummeln ignorierte sie ebenso wie meine bockige Haltung, stattdessen schien sie still in sich hineinzulächeln. Fast hätte man meinen können, dass sie irgendeinen Plan verfolgt hatte, der gerade aufgegangen war.
Ich hingegen war noch immer hin- und hergerissen. Klar, ich hatte die einmalige Chance,No Waylive zu erleben – oder zumindest konnte ich in ihrer Nähe sein. Aber der Preis, den ich dafür zahlen musste, würde verdammt hoch sein: vier Wochen on tour mit meiner grässlichen Schwester!
Schlimmer geht immer. An dem Spruch ist schon was dran. Und die Steigerungsform von schlimmer ist meine Schwester!
aus Lenas Tagebuch
»Meine Damen und Herren, auf Gleis 5 fährt ein: Intercity Express 128 von Frankfurt Hauptbahnhof nach Amsterdam Centraal über Oberhausen Hauptbahnhof. Abfahrt zehn Uhr sechsundvierzig. Nächster Halt Ihres Zuges ist Düsseldorf Hauptbahnhof. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt.«
»Habt ihr auch alles? Ausweise, Tickets, Geld …?« Die Stimme meiner Mutter überschlug sich fast.
Zum gefühlt hundertsten Mal in den letzten zehn Minuten klopfte ich auf den hässlichen Brustbeutel, den sie mir aufgedrängt und den ich wohlweislich gut unter meinem T-Shirt versteckt hatte.
»Ja, Mama, alles dabei.«
Während meine Mutter mich stürmisch umarmte und meinen Kopf mit zahllosen Küssen bedeckte, starrte Juli gelangweilt Kaugummi kauend zur hohen Glaskuppel des Kölner Hauptbahnhofs empor. Ich gestand es mir ungern ein, aber indiesem Moment beneidete ich meine Schwester ein bisschen um ihre Coolness.
In meinem Magen schlug das Brötchen, das ich zum Frühstück runtergezwungen hatte, unangenehme Purzelbäume. Ja, ich war aufgeregt. Sehr sogar. Ich bin nämlich eigentlich nicht der Typ für solche Abenteuer, ich habe es gern geordnet, ganz im Gegensatz zu meiner Schwester. Als ich sie Anfang der Woche, einen Tag nach unserer Familienkrisensitzung, nach ihren Plänen für diese Interrailtour befragte, lautete ihre niederschmetternde Antwort nur: »Mensch, Lena, das lassen wir auf uns zukommen.«
Argh! Die Übersetzung dazu: keine Ahnung. Kein Plan. Keine einzige Unterkunft gebucht. Nicht einmal einen Reiseführer hatte Juli organisiert. Und mir blieben nur fünf Tage, um das in Ordnung zu bringen und mir die Apps möglicher Reiseziele auf mein Handy zu laden. Immerhin konnten wir uns auf Station eins unserer Route einigen: Amsterdam. Und ich fand nach ewiger Sucherei (ganz Amsterdam schien ausgebucht zu sein) ein Hostel im Internet, wo ich uns zwei Betten reserviert hatte.
Mit einem dröhnenden Summen bretterte der ICE in den Bahnhof und kam mit quietschenden Bremsen vor uns zum Stehen, worauf um uns herum das große Gedrängel startete. Ich entwand mich der Umarmung meiner Mutter und hievte mir meinen vollgepackten Rucksack auf den Rücken. Meinen kleinen Rucksack mit wichtigem Schnickschnack hielt ich in der Hand, weil ich nicht wusste, wohin damit, und erschlenkerte mir gegen das Bein, als ich mich in die Schlange vor der Zugtür einreihte. Auch Juli wurde von unserer Mutter zum Abschied fast erdrückt, dann kam endlich Bewegung in die Warteschlange, und ich stieg in den Zug ein, wobei ich mir verbot, mich noch einmal umzudrehen, sonst hätte ich womöglich in letzter Sekunde doch noch gekniffen und die Reise abgeblasen!
Wagen 12, Plätze 55 und 57, betete ich mir im Kopf immer wieder vor. Wagen 12 war schon mal richtig, das hatte ich vor dem Einsteigen schnell noch auf der digitalen Anzeige neben der Tür kontrolliert. Jetzt mussten wir nur noch die reservierten Sitzplätze finden.
Millimeterweise schoben sich die Reisenden in den Waggon, und kaum hatten wir die Abteiltür erreicht, schlug mir schon die klimatisierte Luft mit ihrem plastikartigen Geruch entgegen. Die Schlange stockte wieder, denn direkt vor mir versuchte eine ältere Dame, ihren Rollkoffer auf die Gepäckablage zu wuchten. Sie schaffte es gerade mal bis zur Höhe meines Knies, das sie schwungvoll rammte. Ich schnappte hörbar nach Luft, aber sie schien den Zusammenstoß gar nicht bemerkt zu haben.
»Nun mach schon«, maulte Juli hinter mir. Keine Ahnung, ob sie damit mich oder die Kofferoma meinte.
Endlich war der Trolley mit tatkräftiger Unterstützung eines langhaarigen Lehramtsstudenten – zumindest sah er danach aus – auf der Ablage verstaut und ich konnte mich zu unseren Plätzen weiterschieben. 51, 53, da: 55 und 57. Ein Vierersitzplatz und die beiden gegenüberliegenden Sitze waren zum Glück weder besetzt noch reserviert.
Ich kämpfte mich aus den Riemen meines Rucksacks und brach mir fast das Kreuz bei dem Versuch, es der alten Dame gleichzutun und das Teil nach oben zu bugsieren. Wo waren die langhaarigen Lehramtsstudenten dieser Welt, wenn man sie am meisten brauchte? Juli machte sich erst gar nicht die Mühe und quetschte ihren Rucksack einfach unter den Tisch. Na prima, und wo sollte ich jetzt meine Füße hinstellen?
Juli löste das Problem auf ihre eigene lässige Art. Sie legte ihre Füße, die wie immer in Schuhen steckten, bei deren bloßem Anblick mir die Zehen wehtaten, einfach auf den gegenüberliegenden Sitz.
»Hast du eigentlich noch andere Schuhe dabei?«, erkundigte ich mich mit einem abschätzigen Blick auf ihre mindestens zehn Zentimeter hohen High Heels, während ich mich auf den Platz neben ihr fallen ließ. Natürlich hatte meine Schwester sich, ohne zu fragen, sofort den Fensterplatz gesichert.
»Klar, fünf Paar.« Sie deutete auf ihr Gepäck am Boden, auf dem ich gerade vergeblich versuchte, meine Beine zu falten. Ich fragte mich, ob auch nur ein einziges davon mit weniger hohen Absätzen ausgestattet war, als der Zug sich mit einem leichten Beben in Bewegung setzte. Ich nahm meinen Krimskramsrucksack auf den Schoß und begann, darin nach meinem iPod und meiner Reiselektüre zu kramen. Da ich unmöglich meinen ganzen Stapel ungelesener Bücher mitschleppen konnte, hatte ich mich einfach entschieden, nur meinen absoluten Lieblingsroman einzupacken: »Stolz und Vorurteil« von Jane Austen. Ich las ihn bestimmt schon zum fünften Mal und fand die Geschichte immer noch ultraromantisch.
»’tschuldigung, ist hier noch frei?«
Neben mir richtete Juli sich augenblicklich aus ihrer Fläzhaltung auf und rückte sich und ihren ansehnlichen Vorbau in eine vorteilhaftere Position. Ich unterbrach meine bislang vergebliche Suche nach Buch und iPod, um mir anzuschauen, wer das wissen wollte. Es war ein Typ in Julis Alter, Marke Surferboy, mit schulterlangen, hellblonden Haaren und einem beeindruckenden Bizeps, der dank eines ärmellosen Muskelshirts auch dem flüchtigen Betrachter sofort auffallen musste. Logisch, dass der Kerl bei meiner Schwester einen Hormonschub auslöste.
»Für dich immer«, flötete sie und wurde sofort mit einem Lächeln belohnt, so breit, dass ein Surfbrett quer reingepasst hätte. »Es könnte allerdings unten rum ein bisschen eng werden«, fügte sie hinzu und klimperte vielsagend mit ihren langen Wimpern. Würg!
Ich muss mal kurz etwas klarstellen: Meine Schwester ist nicht billig, auch wenn man bisher vielleicht den Eindruck bekommen hat. Sie sieht toll aus, sie zieht sich immer topmodisch an und ihre Wirkung auf das andere Geschlecht ist entsprechend durchschlagend. Leider weiß sie das auch. Sie hatte schon so viele Freunde, dass meine zwei Hände nicht ausreichen würden, um sie alle an den Fingern abzuzählen, die Zehen müsste ich mindestens noch dazunehmen. Keine ihrer sogenannten Beziehungen hielt länger als ein oder zwei Monate, dann hat sie jeden noch so vielversprechenden Kandidaten wieder abgeschossen. Meine Schwester ist – vorsichtig ausgedrückt – sehr spontan. Dass es allerdings keine fünf Minuten dauerte, bis sie auf dieser Tour einen neuen Flirt an Land gezogen hatte, war selbst für Juli ein Rekord.
»Das Problem sollten wir in den Griff bekommen«, entgegnete Surferboy und das Surfbrettlächeln wurde noch ein bisschen breiter. Innerhalb von Sekunden hatte er den Rucksack unter dem Tisch rausbugsiert und auf die Gepäckablage geworfen, als würde das Teil rein gar nichts wiegen. Sein eigenes Gepäck folgte, dann ließ er sich auf den Sitz gegenüber von Juli fallen und stellte sich vor – zumindest Juli, denn mich schien er gar nicht zu bemerken, aber das war ich schon gewohnt.
»Tobias«, sagte er, noch immer mit diesem Dauergrinsen im Gesicht. »Und das ist mein Kumpel Felix.« Er deutete auf einen zweiten Typen, der sich in diesem Moment durch den Gang zu unserem Vierersitz durchschob.
Im Vergleich zu Mr Sonnenschein wirkte sein Kumpel auf den ersten Blick wie ein unscheinbares Brötchen, okay, ich korrigiere: ein süßes Brötchen mit dicker, schokobrauner Glasur, äh, Haaren, aber seine riesige schwarzrandige Brille stempelte ihn unverkennbar als Nerd ab.
»Hi«, sagte das Schokobrötchen und setzte sich neben Surferboy.
»Hi, Felix«, begrüßte meine Schwester den Neuankömmling erwartungsgemäß mit weit weniger Enthusiasmus.
»Und, wohin wollt ihr?«, fragte Tobias, worauf ich mich schnell wieder meinem Rucksack zuwandte. Die Zugfahrt nach Amsterdam würde knapp drei Stunden dauern, und ich hatte nicht vor, sie mit sinnlosem Smalltalk zu verbringen. Endlich stieß ich auf meinen iPod und steckte mir dankbar die Stöpsel in die Ohren. Auch mein Buch traute sich schließlich aus seinem Versteck, und mit Joey im Ohr tauchte ich in die Geschichte von Elizabeth, genannt Lizzy, ein, die über sehr viele Umwege und Verstrickungen zu ihrem Mr Darcy findet. »Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau«, las ich und dachte: Hach, wenn das doch immer so einfach wäre!
Erst kurz hinter Oberhausen wurde ich wieder ins wirkliche Leben zurückkatapultiert, als Juli mich unsanft in die Seite stieß. Ich schaute hoch und entdeckte den Schaffner, der bereits etwas ungeduldig darauf zu warten schien, dass ich endlich meine Fahrkarte rausrückte. Ich nestelte den Brustbeutel heraus, der sich natürlich mit den Kabeln des iPods verhedderte, und es dauerte eine Ewigkeit, in der ich garantiert rot anlief, bis ich endlich die gewünschten Tickets vorlegen konnte. Bis zur Grenze hatten wir eine normale Bahnfahrkarte, weil der Interrailpass innerhalb Deutschlands nicht gültig war, aber ab dort konnten wir ihn dann nutzen. Kompliziert, kompliziert.
»Gute Fahrt«, sagte der junge Schaffner, der gar nicht mal schlecht ausgesehen hätte (ein bisschen wie Zac Efron), wenn er nicht so verkniffen geschaut hätte.
»Tobias und Felix machen auch vier Wochen Interrail, ist das nicht witzig?«, sagte Juli in meine Richtung, bevor ich mich wieder schnell genug mit meiner Musik abstöpseln konnte.
»Hm«, machte ich unbestimmt.
»Sie sind übrigens beide neunzehn und wohnen auch in Köln«, fuhr Juli unbeirrt fort – woher kam bloß plötzlich ihr Mitteilungsbedürfnis? »Tobias studiert Sport auf Lehramt und Felix …«
»Physik«, ergänzte Felix, weil es meiner Schwester schon wieder entfallen zu sein schien.
»Und die beiden wollen auch nach Amsterdam.«
Überraschung! Warum sollten sie wohl sonst in diesem Zug sitzen?
»Wir haben gerade überlegt, wie wir die Zeit rumkriegen sollen«, ergriff nun Tobias das Wort. »Hast du eine Idee?« Hallo, was war das für eine blöde Frage? Warum wollten sie das ausgerechnet von mir wissen?
»Lesen?«, schlug ich vor. Juli und Tobias lachten, als hätte ich einen guten Witz gemacht, nur Felix rang sich nicht einmal ein Lächeln ab.
»Nun lasst sie doch in Ruhe«, sagte er kopfschüttelnd. Aha, daher wehte also der Wind, meine Schwester und ihr neuer Verbündeter wollten mich bloß ärgern.
»Wie wäre es mit Wahrheit oder Pflicht?«, schlug ich schnippisch vor. »Kindisch genug seid ihr ja für dieses Spiel.«
Die beiden lachten wieder, doch dann wurde Tobias plötzlich ernst: »Gar kein schlechter Vorschlag. Wer macht mit?«
»Verlockend … aber, nein«, lehnte ich eilig ab und widmete mich wieder meinem Buch. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir nicht wieder die iPod-Stöpsel in die Ohren steckte, dafür war ich von Natur aus einfach zu neugierig. Juli hingegen war natürlich sofort Feuer und Flamme für die Idee und auch Felix schloss sich mit einem Schulterzucken an. Sofort knallte Tobias sein Smartphone auf den Tisch zwischen uns und auf Felix’ fragenden Blick hin erklärte er: »Flaschendreh-App.« Oh, Mann, der war noch kindischer, als ich gedacht hatte.
»Und damit es mehr Spaß macht, gibt es noch eine echte Flasche dazu.« Tobias zog eine Flasche Wodka aus seinem Rucksack auf der Ablage. Meine Güte, es war noch nicht mal Mittag. »Wer kneift, trinkt«, legte Tobias die Regeln fest und nahm direkt mal einen großzügigen Schluck.
Ich warf einen verstohlenen Blick zum Nachbartisch, um zu sehen, ob unsere Runde bereits unangenehm Aufmerksamkeit erregte, aber die beiden Anzugträger, die sich dort gegenübersaßen, hackten verbissen auf ihren Laptops herum und schienen von dem Saufspiel keine Notiz zu nehmen.
»Also los.« Mit einem lässigen Wischen seines Zeigefingers brachte Tobias die virtuelle Flasche auf seinem Smartphone zum Rotieren und grölte los, als sie bei Juli stehen blieb.
»Wahrheit oder Pflicht?«
»Wahrheit.« Juli kicherte.
»Hm, lass mal überlegen. Okay, dann, hm, was findest du an einem Kerl sexy?«
»Lange, blonde Haare, einen sportlichen Körper und ein süßes Lächeln«, ließ Juli sich nicht lange bitten. Surferboy strahlte.
»Du bist dran.«
»Felix.« Juli klang ein bisschen enttäuscht. »Wahrheit oder Pflicht?«
»Pflicht.«
»Oh, prima. Dann würde ich sagen: Du musst jemanden küssen. Und zwar … Tobias.«
Ich konnte ein leises Stöhnen nicht unterdrücken, das jedoch niemand wahrnahm. Felix griff zur Wodkaflasche.
»Willst du etwa kneifen?«, zog Tobias ihn auf.
»Nein, desinfizieren«, erwiderte Felix trocken. Na, der hatte wenigstens Humor. Und dann drückte er seinem Kumpel tatsächlich einen Kuss auf den Mund. Tobias schüttelte sich und ich musste innerlich grinsen. Geschah ihm recht.
Und so ging es weiter bis kurz vor Amsterdam. Inzwischen war die Wodkaflasche zu zwei Dritteln geleert, das meiste davon befand sich in Tobias’ Magen, und so ziemlich jeder war mindestens einmal geküsst worden, sogar der süße Schaffner, der zwar etwas perplex, aber gar nicht so unglücklich aussah, als Juli ihre Lippen auf seine presste.
Der Bahnhof war bereits angesagt worden, und ich hatte gerade begonnen, meine Sachen zusammenzupacken, als Tobias auf eine neue zündende Idee kam.
»Letzte Aufgabe«, verkündete er. »Dieses Mal für alle. Wer schafft es, in Amsterdam guten Stoff für einen Joint zu besorgen?«
»Tobi, du weißt genau, dass die Holländer nichts mehr an Ausländer verkaufen dürfen«, mischte Felix sich ein.
»Darum geht es ja«, wimmelte Tobias ihn ab. »Sonst wäre es doch keine Herausforderung.«
Ich betrachtete meine Schwester, die ihrerseits ihren neuen Schwarm mit rot glühenden Wangen anschaute. Juli würde mitmachen, das war mir sofort klar. Und wenn es nur darum ging, Tobias zu beeindrucken.
»Kein Problem«, erklärte sie auch schon und Felix zuckte nur wieder mit den Schultern.
»Dann ist das abgemacht«, stellte Tobias begeistert fest. »Wir treffen uns morgen Abend um acht auf demLeidseplein,da soll einiges los sein. Wer das leckerste Gras mitbringt, gewinnt.«
»Abgemacht«, stimmte Juli zu.
Ich stopfte mein Buch in den Rucksack und schwieg. Welche vernünftigen Argumente sollte man gegen so viel geballten Blödsinn schon vorbringen? Trotzdem hatte ich ein ungutes Gefühl, als ich hinter meiner völlig überdrehten Schwester aus dem Zug kletterte.
Bahnhof Amsterdam Centraal. Station eins unserer Reise. Dabei hatte ich nach den ersten drei Stunden Zugfahrt eigentlich schon genug davon, Urlaub mit meiner Schwester zu machen.
Ich dachte eigentlich, wir wollten eine Reise mit dem Zug machen – aber es scheint eher eine Achterbahnfahrt zu werden.
aus Lenas Tagebuch
»Was ist denn hier los?« Überrascht betrachtete ich die Menschenmassen, die sich vor dem Bahnhof drängten. Der nicht gerade kleine Platz war zum Bersten voll, wobei das noch die Untertreibung des Jahrhunderts sein dürfte. Er war voll, voll, voll, überall um uns herum waren Menschen. Und was mich am meisten daran wunderte, war, dass viele von ihnen in Kostümen herumliefen. In ziemlich engen Kostümen mit ziemlich wenig Stoff. Männer wie Frauen.
»Sorry«, murmelte ich automatisch, als mich ein Typ anrempelte, der eine schwarze Lederweste und nichts darunter trug, außer einem sexy Sixpack, das vom Nabel bis zur Brust mit einem Tribal Tattoo verziert war.
»Was ist hier los?«, wiederholte ich in Julis Richtung und sah, wie meine Schwester grinste.
»Gay Pride«, erwiderte sie, als sei das Allgemeinwissen.
»Wie bitte?«
»Dieses Wochenende findet in Amsterdam die jährliche Schwulen- und Lesbenparty statt. Ist so was Ähnliches wie der Christopher Street Day in Köln. Hast du das bei deinen Internetrecherchen etwa nicht herausgefunden?« Sie grinste wieder und ich hätte sie erwürgen können. Nicht, dass ich was gegen eine solche Party hätte, aber ich hätte es gern vorher gewusst!
»Nein«, gab ich bissig zurück. »Ich habe uns ein Zimmer organisiert.« Jetzt kapierte ich wenigstens, warum das so kompliziert gewesen war.
»Na, dann wollen wir mal schauen, ob wir es bis zu diesem Zimmer schaffen«, erklärte meine Schwester fröhlich und fing an, sich durch die Menschenmassen zu schieben. Ich warf einen wehmütigen Blick zurück auf die rote Backsteinfassade des schnörkeligen Bahnhofsgebäudes, dann beeilte ich mich, Juli zu folgen. Nicht auszudenken, wenn ich sie in dem Gedränge verlieren würde.
Von der Webseite der Jugendherberge hatte ich mir die Wegbeschreibung abgeschrieben und noch im Zug rausgekramt. Vom Bahnhof die Tram Nummer 1, 2 oder 5 nehmen, sechs Stationen fahren, aussteigen an derPrinsengracht. Das hatte einfach geklungen, jedoch überfielen mich angesichts der aktuellen Situation Zweifel, ob es tatsächlich so leicht werden würde. Nachdem wir uns durch eine Gruppe Frauen in Matrosenanzügen gequetscht, einen Schwarm männlicher Bienen hinter uns gelassen hatten und einer trommelnden und tanzenden Sambaformation nur knapp entkommen waren, erreichten wir schließlich die Tramstation, an der in just diesemMoment eine blau-weiße Straßenbahn der Linie zwei hielt. So weit alles super, nur leider wollten noch ein paar andere Leute hier einsteigen.
Ich fasse mich kurz: Irgendwie passten wir noch in diese Tram, auch wenn ich während der ganzen Fahrt an nichts anderes denken konnte, als dass ich am Ende vermutlich flach wie eine Flunder gedrückt war und platt auf den Bürgersteig kippen würde, weil mich von vorn ein Typ im hautengen Catsuit mit seinem kugelrunden Bauch an die Haltestange drängte und mein steinschwerer Rucksack mir das Ausweichen nach hinten unmöglich machte.
»Cool, schau mal«, hörte ich Juli alle paar Minuten rufen. Leider war der Catsuit-Typ so hoch wie rund und versperrte mir jegliche Aussicht. Also zählte ich stumm die Haltestellen mit und drängelte mich an der sechsten zur Tür.
Draußen waren fast ebenso viele Menschen unterwegs wie am Bahnhof. Wir überquerten eine Brücke, unter der das Wasser in einer der Amsterdamer Grachten träge dahinfloss. Ich fragte mich, wie Juli es schaffte, mit ihren Pfennigabsätzen auf dem Kopfsteinpflaster zu laufen, ohne umzuknicken, und dabei noch so grazil auszusehen wie ein Model auf dem Laufsteg. Ich hingegen bekam das bloße Laufen mit meinen Sneakers kaum hin. Noch eine Brücke, dann erreichten wir dieLeidsegracht, an der die Jugendherberge liegen sollte. Ich ließ meinen Blick über die Backsteinbauten mit den Treppengiebeln wandern und entdeckte auf unserer linken Seite ein wirklich sehr schmales Haus mit auffallend roten Fensterläden, über dessenEingangstür ein Schild mit ebenfalls roter Schrift verkündete, dass wir hier richtig waren: »Hostel«.
»Süß!«, trällerte meine Schwester und steuerte auf die dunkle Holztür zu. Und »süß« war das Wort, das sie in der nächsten Viertelstunde etwa hundert Mal benutzte. Der Typ an der Rezeption war »süß«, der Aufenthaltsraum mit den ausgesessenen Ledersofas war »süß«, die Bettdecken in unserem Zimmer, auf denen in Englisch, Französisch und Holländisch »Gute Nacht« stand, waren ebenfalls »süß«. Sogar die gelb gestrichenen, abschließbaren Schränke, Modell Schwimmbadumkleide, waren »süß«.
Mir hingegen stieß ziemlich sauer auf, dass wir unser Zimmer, das ebenfalls kaum größer war als eine Umkleidekabine, mit zwei weiteren Mädels teilen sollten. Das war mir vorher nicht klar gewesen und ich ärgerte mich, denn eigentlich habe ich beim Schlafen gern meine Ruhe. Auf den beiden belegten Betten stapelten sich Klamotten, ansonsten war von unseren Mitbewohnerinnen nichts zu sehen.
»Na komm, Lena, zieh nicht so ein Gesicht.« Meine Schwester warf ihren Rucksack auf das freie Bett an der Wand – damit blieb für mich eins in der Raummitte – und fing sofort an, in ihren Sachen zu wühlen. Nach kürzester Zeit hatte sie ein gepunktetes Vintagekleid übergestreift, das sie mit einem breiten Gürtel in der Taille schnürte, dazu kombinierte sie eine riesige Sonnenbrille und schlüpfte in grüne Lederstiefeletten mit allgemeinverträglichen Absätzen. Selbst meine Schwester gab sich anscheinend dem Kopfsteinpflaster geschlagen.
»Los«, drängte sie. »Oder willst du in dieser Besenkammer versauern?« So viel zum Thema »süß«.
»Schon gut.« Ich verstaute meinen Rucksack ungeöffnet unter dem Bett, denn ich fand eigentlich nicht, dass man nach einem halben Reisetag bereits das Outfit wechseln musste.
Ohrenbetäubende Technobeats schallten uns entgegen, als wir wieder vor das Hostel traten. »Die Canal Parade hat schon angefangen«, jubelte meine Schwester und eilte die Straße hinunter zurPrinsengracht, wo sie sich durch die Schaulustigen bis an den Rand der Gracht drängelte. Noch immer etwas grummelig, weil sie mir vorher nichts davon gesagt hatte, was mich hier in Amsterdam erwartete, bahnte ich mir einen Weg zu Juli.
Die Beats dröhnten von einem Boot, auf dem eine bunte Truppe in hautengen Leoprintanzügen abtanzte. Ihre Körper zuckten so ekstatisch, dass ich Sorge hatte, einige von ihnen würden gleich über Bord gehen. Das Schiff fuhr vorbei und als nächstes folgte eines mit schwarz gekleideter Besatzung.
Im Bug stand eine einsame Sängerin in löchrigen Netzstrümpfen, kniehohen Stiefeln und Lackmontur, die Haare einen halben Meter hochtoupiert und das Gesicht weiß geschminkt. Mit unfassbar tiefer Stimme röhrte sie ins Mikro. War das etwa ein Mann?
Auf dem nächsten Schiff befanden sich mehrere Zweimetergrazien in barocken Rüschenkleidern und mit weiß gepuderten Perücken auf den Köpfen und schaukelten im Rhythmus von »Dreamgirl« ihre Hüften. Eine junge Frau neben mir begann, den Text meines Lieblingsliedes lautstark mitzusingen.
So gern ich Juli noch ein bisschen gegrollt hätte, ich merkte schnell, dass ich mich dieser großartigen Stimmung einfach nicht entziehen konnte.
»Ist das nicht Hammer?«, freute sich meine Schwester und ich nickte. Ja, das war der Hammer! Die Parade auf dem Wasser dauerte fast zwei Stunden und die Besatzungen der Schiffe überboten sich mit ihren schrillen Outfits und den Tanz- und Gesangsdarbietungen.
»Und jetzt?«, fragte Juli, als sich die Zuschauermenge um uns herum aufzulösen begann.
»Wie wäre es mit einer Runde Ausruhen?« Ich sehnte mich danach, mich auf meinem Bett auszustrecken und meinem Rücken, der vom Rucksackschleppen noch immer schmerzgeplagt war, eine Pause zu gönnen. Außerdem hätte ich gern ein paar Seiten in meinem Buch gelesen.
»Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist«, konterte Juli. Argh, warum war ausgerechnet ich mit einem Duracellhasen als Schwester geschlagen?
»Ach, bitte, Juli, nur eine halbe Stunde«, bettelte ich.
»Nix da, wir haben eine Mission.« Juli war wirklich erbarmungslos.
»Du hast vielleicht eine Mission. Ich mach bei dem Quatsch garantiert nicht mit.« Meine gute Laune war wieder dahin. Ich wusste genau, was Juli meinte: Sie wollte losziehen und das Zeug besorgen, mit dem sie morgen Abend Tobias beeindrucken wollte.
»Dann leg dich halt hin«, gab Juli mit einem gelangweiltenSchulterzucken zurück. »Ich such mir so lange einen schönen Coffeeshop.«
Aber so einfach war das nicht. Denn ich hatte auch eine Mission, zumindest hatte ich meiner Mutter ein Versprechen geben müssen, kurz bevor meine Schwester und ich unsere Reise antraten. Am Abend vor der Abreise war sie in mein Zimmer gekommen und hatte sich zu mir aufs Bett gesetzt. »Passt du ein bisschen auf Julia auf?«, hatte sie mich gebeten. Und als ich nur genervt stöhnte, fuhr sie fort: »Ich weiß, dass deine Schwester die Ältere ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass du viel vernünftiger bist als Juli.« Womit meine Mutter wohl den Nagel auf den Kopf getroffen hatte.
»Schon gut«, seufzte ich mal wieder. »Ich komme mit.«
Es war immer noch unglaublich viel los in der Stadt, aber die Party schien sich jetzt langsam von den Straßen weg in die Bars und Clubs zu verlegen.
Einen Coffeeshop zu finden, war definitiv nicht der schwierige Teil der Aufgabe. Es gab die Kiffercafés quasi an jeder Straßenecke, unverkennbar war der süßliche Geruch, der aus den Türen nach draußen quoll und mir leichte Übelkeit verursachte.
»Suchst du was Bestimmtes?«, wollte ich schließlich von meiner Schwester wissen, als sie bereits am dritten Laden vorbeigelaufen war.
»Hm, nee«, räumte sie ein und stieß die grün gestrichene Tür eines Shops auf, dessen Schaufensterscheibe mit den Köpfen rauchender Rastalockenträger bemalt war. Ohne sich nachmir umzusehen, marschierte Juli hinein. Ich gab mir einen Ruck und folgte ihr.