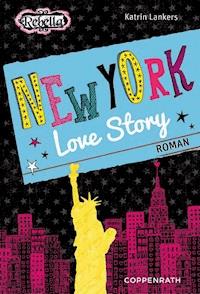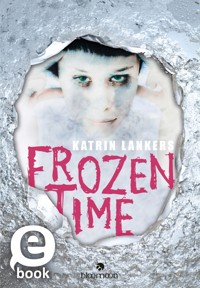Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Coppenrath
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Verrückt nach New York
- Sprache: Deutsch
Als die Temperatur in New York plötzlich unter -10 Grad fiel, sank auch die Stimmung in meiner WG auf den Gefrierpunkt. Rick konnte mir kaum in die Augen schauen. Pam stürzte alle drei Minuten zur Toilette. Abby blickte permanent nervös auf ihr Handy. Und Saida rannte wie von der Tarantel gestochen in der Küche herum. Ich schob das merkwürdige Verhalten meiner Mitbewohner auf die Tatsache, dass unsere Heizung lahmgelegt war und wir in einem kalten Haus saßen. Auf die Idee, dass mehr dahinterstecken könnte, kam ich erst viel, viel zu spät …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
eBook-ISBN: 978-3-649-62199-7
© 2015 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,
Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Satz: Sabine Conrad, Rosbach
Umschlaggestaltung: Anna Schwarz unter Verwendung
von Illustrationen von Sara Vidal
Redaktion: Valerie Flakowski
www.coppenrath.de
Das Buch erscheint unter der ISBN 978-3-649-61759-4
Entdecke unseren Bonustitel zur neuen New York Reihe von Katrin Lankers! In „Verrückt nach New York – Tipps & Trends aus der Lifestyle-Metropole“ findet ihr zusätzliche Storys, Tipps, DIY-Anleitungen und Trends rund um die Traummetropole New York. Das eBook erscheint unter der ISBN 978-3-649-62226-0
Band 3: Verrückt nach New York – erscheint im Herbst 2015 (eBook: 978-3-649-66776-6 / Buch: 978-3-649-61788-4)
Band 4: Verrückt nach New York – erscheint im Herbst 2015 (eBook: 978-3-649-66777-3 / Buch: 978-3-649-61776-1)
COPPENRATH
Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Freunde gefunden. Und ich dachte, dass es nun keine unlösbaren Probleme mehr geben dürfte. Allerdings hatte ich bislang wenig Erfahrung mit Freundschaften, eigentlich gar keine. Deshalb war mir nicht klar, dass gerade Freunde mit einem vermeintlich kleinen Fehler eine große Katastrophe auslösen können, die die ganze Freundschaft in Gefahr bringen kann.
Eure Maxi
Kapitel 1
Spätestens als ich die Wetterwarnung im Radio hörte, hätte mir klar sein müssen, dass das Ganze in einer Katastrophe enden würde. Aber ich hatte noch nie einen Winter in New York verbracht. Ich lebte erst seit knapp drei Monaten in der Megametropole und bisher hatte sie sich zumeist von ihrer sonnigsten Seite gezeigt. Bis weit in den Dezember hinein reichte sogar mir eine Strickjacke, um auf die Straße zu gehen, obwohl ich schnell fror. Fünf Tage vor Weihnachten stürzte die Temperatur dann über Nacht ab und schlug unsanft zehn Grad unter dem Gefrierpunkt auf, sodass ich in meinem dünnen Mary-Quant-Mäntelchen vor Zähneklappern kaum noch sprechen konnte, sobald ich vor die Tür trat. Doch nicht einmal da kam ich auf die Idee, dass ich ein Problem haben könnte.
Ich packte also am 23. Dezember ordentlich einen Teil meiner Sommerklamotten in meinen Koffer, der es von der Größe ohne Weiteres mit einem Zwergpony aufnehmen konnte. Mit den wenigen Shirts und Röcken war er kaum zur Hälfte gefüllt. Auf dem Rückflug würde das anders aussehen, denn ich wollte ihn mit allen dicken Wintersachen vollstopfen, die ich besaß. Dabei versuchte ich, mich auf Weihnachten zu freuen, auf selbst gebackene Spekulatius und Glühwein, den es in New York nirgendwo zu geben schien, und auf das Wiedersehen mit meiner Omama. Aber so richtig wollte das mit dem Freuen nicht gelingen und dafür gab es drei Gründe:
Ich machte mir Gedanken, weil ich seit Halloween nichts mehr von Alex gehört hatte. Dreimal waren wir uns zufällig über den Weg gelaufen, dabei hätte vermutlich schon ein einziges Treffen gereicht, um mich hoffnungslos in den Jungen mit den Meeraugen zu verlieben. Beim letzten Mal hatte er mir fest versprochen, dass wir uns wiedersehen würden. Aber seither: nichts! Und nun hoffte ich gegen jede Vernunft immer noch darauf, dass er sich melden würde. Was, wenn er ausgerechnet an Weihnachten versuchen würde, mich zu erreichen, während ich 6000 Kilometer entfernt unterm Weihnachtsbaum hockte?Ich machte mir Gedanken um Pinkstone. Vor zwei Monaten hatte die zuständige Behörde entschieden zu prüfen, ob das alte pinke Haus – mein Zuhause in New York – unter Denkmalschutz gestellt werden sollte. Doch bisher war nichts passiert. Mehrmals hatte ich schon bei der Denkmalkommission nachgefragt, wie weit das Verfahren fortgeschritten war, aber keine Antwort erhalten. Allmählich verließ mich die Hoffnung, dass die Kommission sich für den Erhalt von Pinkstone entscheiden würde, und dann würde der skrupellose Investor Miller das Haus doch noch kaufen und abreißen lassen. Das wäre das Aus für unsere schräge WG – ein Gedanke, den ich umso schlechter ertrug, als meine verrückten Mitbewohner mittlerweile meine Freunde geworden waren. Die ersten echten Freunde, die ich in meinem Leben gefunden hatte.Und ich machte mir Gedanken um meine geliebte Omama. Bei unserem letzten Telefonat hatte sie komisch geklungen, so, als würde sie mir etwas verheimlichen, und das war gar nicht ihre Art. »Es ist nichts, wirklich nicht«, hatte sie betont und schließlich auf mein Drängen erklärt: »Wir sprechen darüber, wenn du hier bist.« Womit schon mal klar war, dass nicht nichts los sein konnte. Und dieses Nicht-Nichts füllte meine hyperaktive Fantasie seit Tagen mit Horrorvisionen von Wohnungsbrand über Totalinsolvenz bis hin zu tödlichen Krankheiten.Schluss mit Grübeln, Maxi! Schwungvoll klappte ich meinen Koffer zu. Punkt eins und zwei würden warten müssen, bis ich in einer Woche wieder in New York war. Und für Punkt drei – was auch immer das Problem sein mochte – würde ich eine Lösung finden, sobald ich erst einmal mit meiner Omama darüber gesprochen hatte. Deshalb war es jetzt umso wichtiger, dass ich rechtzeitig zum Flughafen kam, um meinen Flieger nicht zu verpassen. Ich schaltete das kleine pinke Radio aus, das ich nur hatte laufen lassen, um die Stille zu übertönen, die meine bereits zu ihren Familien gefahrenen Mitbewohner in Pinkstone hinterlassen hatten, gerade in dem Moment, als die Nachrichtensprecherin vor einem Jahrhundert-Blizzard warnte, der am Nachmittag New York erreichen sollte.
Als ich die schwere Holztür von Pinkstone hinter mir schloss, begann es zu schneien. Wie schön, dachte ich in einem Anflug von nostalgischer Rührung, weiße Weihnachten – und hoffte auf ähnliches Wetter in Deutschland. Vorsichtig bugsierte ich den Zwergponykoffer die wenigen Stufen vor dem Haus hinunter, die vom ersten Schnee bereits schmierglatt wurden. Wie schön, dachte ich wieder, während ich die bunt flackernden Rentiere vor unserem Nachbarhaus betrachtete, um die nun die weißen Flocken wirbelten.
Wie schön war auch die Bedford Avenue mit ihrer beleuchteten Straßendekoration. Die sonst so belebte Hauptstraße des quirligen Stadtteils Williamsburg lag im stärker werdenden Schneetreiben fast wie ausgestorben da, nur einige wenige New Yorker mit hochgeschlagenen Mantelkrägen und tief gezogenen Strickmützen hetzten in die kleinen Supermärkte, um diese kurz darauf voll beladen mit Dosensuppen und Wasserkanistern wieder zu verlassen. Spätestens bei diesem ungewohnten Anblick der leeren Straße hätte mir klar werden müssen, was auf mich und auf ganz New York zukam. Aber ich hatte ja keine Ahnung.
Mein kurzer Anflug von Weihnachtsnostalgie verflüchtigte sich erst schlagartig, als mir eine eiskalte Windböe waagerecht den Schnee ins Gesicht trieb. Brr! Ich beeilte mich, die rutschigen Stufen zur Subway-Station zu nehmen. Auf dem Bahnsteig drängten sich dick vermummte Gestalten mit mürrischen Gesichtern. Eine blecherne Stimme verkündete über die Lautsprecher, dass der L-Train mit dreißigminütiger Verspätung jetzt einfahren werde.
Der Zug aus Manhattan war bereits überfüllt, trotzdem drängten die Menschen vom Bahnsteig in die silberfarbenen Waggons, als ob es die letzte Möglichkeit wäre, hinaus in die Vororte zu gelangen – was tatsächlich stimmte, aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die sonst eher toleranten New Yorker warfen mir einige böse Blicke zu, als ich nicht nur mich, sondern auch meinen Zwergponykoffer in den Mittelgang zu quetschen versuchte. »Stand clear off the closing doors« – Bitte die Türen freihalten – schepperte die übliche Ansage aus den Lautsprechern, doch es brauchte fünf Versuche, bis sich tatsächlich alle Türen schließen ließen und der Zug losrattern konnte.
Dann leerte er sich von Station zu Station, fast niemand stieg mehr zu. Im A-Train, der zum JFK-Flughafen fuhr, saßen außer mir nur noch vier Leute, drei Männer im Business-Outfit mit Rollköfferchen und eine dick vermummte kleine Frau, die ununterbrochen auf Spanisch in ihr Handy quatschte. Gegen die dreckigen Scheiben des Waggons peitschten die Schneeflocken inzwischen in solchen Massen, dass man kaum nach draußen schauen konnte. Ohnehin gab es dort nicht viel zu sehen, denn obwohl es erst früher Nachmittag war, hatte der Himmel sich so stark verdunkelt, dass es mir vorkam, als führe der Zug durch die tiefste Nacht. Langsam stellte sich auch bei mir eine böse Vorahnung ein.
Als uns der A-Train am Endhaltepunkt ausspuckte, war die Außentemperatur um gefühlte zwanzig Grad gefallen. Eiskalter Wind fegte mir den Schnee ins Gesicht, der sich auf meinen Wangen wie winzige Nadelstiche einbrannte. Der Air-Train, der die Station mit dem Flughafenterminal verbindet, war bereits ausgefallen. Mit gesenkten Köpfen warteten meine wenigen Mitfahrer und ich schlotternd eine Viertelstunde auf den Shuttle-Bus.
»Wollt ihr wirklich zum Flughafen?«, begrüßte der Busfahrer uns mit hochgezogenen Augenbrauen, nachdem er eine Horde Menschen abgesetzt hatte, die sich in unseren wartenden Zug Richtung Manhattan drängten. »Sicher?« Wir nickten und hechteten in den geheizten Bus. Was auch immer uns am Terminal erwartete, es konnte nur besser sein als das Ausharren in der Eiseskälte, dachte ich. Doch auch damit lag ich falsch. Am Flughafen herrschte längst das reinste Chaos.
Tausende Passagiere strömten aus dem Flughafengebäude, quetschten sich in die Shuttle-Busse und warfen sich beinahe vor die Taxis, um eines der umlagerten gelben Cabs zu kapern. Durch die entgegenkommenden Massen schlängelte ich mich ins Gebäude, und erst dort wurde mir wirklich klar, was los war. Denn auf der großen digitalen Anzeigentafel, auf der die Abflüge aufgelistet sind, stand ein einziges Wort, immer und immer wieder, in leuchtend roter Schrift: cancelled – gestrichen!
Ein jäher Stich der Enttäuschung durchfuhr mich. Erst in diesem Moment wurde mir bewusst, wie sehr ich mich trotz allem auf Weihnachten daheim bei meiner Omama gefreut hatte. Doch dann blieb mein Blick an der Spalte hängen, in der mein Flug aufgeführt war, und da stand: Abflug planmäßig. Yeah! Die Dame am Abflugschalter lächelte etwas verkrampft, machte mir aber weiter Mut: Ja, der Flieger hebe pünktlich ab.
Im Wartebereich gönnte ich mir einen völlig überteuerten Kaffee und eine noch teurere Tüte Gummibärchen und starrte durch die große Glasfront. Draußen war es stockfinster, der Schnee trieb horizontal gegen die Scheiben, die beleuchteten Flieger an den Terminals verschwammen im Nebel. Mein Handy spielte »Ganz in Weiß« – mein Klingelton für Omama, der bei einer Séance einmal Roy Black erschienen ist und sie tagelang verfolgt hat.
»Maxi! Wage es ja nicht, in dieses Flugzeug zu steigen«, brüllte meine Großmutter mir ins Ohr, als ich den Anruf annahm. So kannte ich sie: immer geradeheraus und der festen Überzeugung, schreien zu müssen, damit ich sie am anderen Ende der Welt, wie sie sich ausdrückte, verstehen konnte.
»Ist ja gut«, versuchte ich, sie zu beruhigen. »Hier läuft alles nach Plan.« Ich machte ständig Pläne, auch wenn ich inzwischen begriffen hatte, dass es in New York häufiger als anderswo nötig war, flexibel zu sein.
»Bist du verrückt? Hast du nicht von dem Schneechaos gehört?« Omama klang kein bisschen beruhigt.
»Doch«, erwiderte ich und betrachtete das undurchdringliche Gestöber vor dem Fenster. »Aber ich bin schon am Flughafen, mein Flug geht planmäßig, morgen sitzen wir zusammen unterm Baum.« Und trinken Glühwein und essen Spekulatius und reden über alles, fügte ich in Gedanken hinzu. »Ich kann dich doch an Weihnachten nicht allein lassen.«
»Ich komme prima allein zurecht«, ereiferte Omama sich, aber es hörte sich komisch an und so, als würde sie mir etwas verheimlichen. Sofort wurde ich hellhörig.
»Was ist eigentlich mit dir los?«, hakte ich nach, in der Hoffnung, sie würde es mir am Telefon erzählen und ich könnte auf dem Flug bereits über eine Lösung nachdenken. Aber wieder wehrte sie ab.
»Nichts. Gar nichts, worüber du dir jetzt Gedanken machen solltest.« Na, das klang ja schon wieder nicht nach nichts. »Sieh lieber zu, dass du zurück nach Hause fährst und dir die Decke über den Kopf ziehst.«
»Vergiss es. Ich komme«, erklärte ich entschieden. Ihr Anruf hatte meine Entschlossenheit nur weiter gefestigt. »Und jetzt muss ich Schluss machen, mein Flug wird gerade aufgerufen.« Damit legte ich einfach auf.
Kurze Zeit später saß ich auf meinem Platz im Flugzeug, und während der Kapitän uns fröhlich begrüßte, zog ich mein Handy noch einmal hervor, um es auszuschalten. Ich hatte sieben neue Nachrichten. Drei waren von Omama, in denen sie mich dringend und in Großbuchstaben aufforderte, gefälligst in New York zu bleiben. Ich löschte sie sofort. Die anderen vier waren von meinen Mitbewohnern.
Pamela: Hast du genug Vorräte im Haus?
Saida: Mach die Fenster richtig zu!
Abby: Du kannst gern eins meiner Bücher ausleihen, wenn dir allein langweilig ist.
Rick: Falls es in Pinkstone Probleme gibt, bei meiner Familie bist du jederzeit willkommen.
Alle vier schienen fest davon überzeugt zu sein, dass ich noch in New York festhing. Ich schickte ihnen allen die gleiche Nachricht: Sitze im Flugzeug. Merry X-Mas. Dann schaltete ich das Telefon aus.
Pah, dachte ich, als ob mich so ein bisschen Schnee daran hindern könnte, an Weihnachten nach Hause zu fliegen!
Im selben Moment dockte das Flugzeug vom Gate ab … nur, um nach zehn Metern wieder stehen zu bleiben. Dann passierte nichts mehr. Eine Stunde lang. Die zunächst geflüsterten Fragen in der Kabine wurden immer lauter. Schließlich eine Durchsage des Piloten: An der Enteisungsanlage gebe es einen Stau, wir seien die fünfte Maschine in der Warteschlange. Die Stimmung in der Kabine beruhigte sich wieder. Eine weitere Stunde später hatten wir uns noch keinen Zentimeter weiterbewegt.
Das Rollfeld lag inzwischen unter einer dichten Schneedecke, die Tragflügel waren von einer Eiskruste bedeckt, an den ovalen Kabinenfenstern bildeten sich weiße Kristalle. Der übergewichtige Anzugträger neben mir, der locker zwei Sitze hätte buchen müssen, drückte entnervt auf den Serviceknopf. Eine bemüht beherrschte Stewardess erschien.
»Wann geht es endlich los?«, rüpelte der Dicke sie an.
»Der Enteisungstruck muss neu betankt werden, dann sind wir an der Reihe«, antwortete sie mit zusammengebissenen Zähnen, das Lächeln bloß noch eine Grimasse. Diese Frage bekam sie garantiert nicht zum ersten Mal gestellt. In der Reihe vor uns begann ein Baby zu schreien und hörte nicht mehr auf.
Ich versuchte, in meinem Buch zu lesen (eine Schmonzette, die ich mir tatsächlich von Abby geliehen hatte, ich brauchte dringend neuen Lesestoff aus dem Buchladen meiner Omama), gab aber schnell auf. Meine ungute Vorahnung kehrte mit neuer Macht zurück. War es möglich, dass dies einer der Pläne war, die nicht aufgingen? Und wie bitte lautete Plan B?
Nach drei Stunden rollten wir zurück zum Gate. Der Kapitän meldete sich mit einer »leider nicht so guten Nachricht«. Der Flug war gestrichen. Doch von Bord durften wir noch nicht. Das Bodenpersonal sei bereits nach Hause gegangen, erst müsse Ersatz herbeigeschafft werden.
Ein zweites Kleinkind war in das Gebrüll eingefallen. Weiter vorn lieferten sich einige Fluggäste heftige Wortgefechte mit einer Stewardess. Die anderen Flugbegleiter teilten das Abendessen aus: Hühnchen oder Nudeln? Ich hätte am liebsten beides genommen und gegen die Kabinenwand gepfeffert. So ein Mist! Plan B, ich brauchte dringend Plan B. Auf meinem Smartphone versuchte ich, Informationen über den Flug zu finden und wenn möglich umzubuchen. Doch auf der Internetseite der Airline fand ich nur den Hinweis, dass mein Flug pünktlich um 17.45 Uhr starten werde. Da war es bereits Viertel nach neun.
Um halb elf gelangte ich schließlich ans Gepäckband und zerrte meinen Zwergponykoffer aus einem Berg anderer Taschen. Entnervt und ermüdet machte ich mich auf den Weg zum Serviceschalter, an dem eine einsame Mitarbeiterin vergeblich versuchte, sich hinter ihrem Computer zu verstecken. Davor: rund hundertfünfzig weitere Gestrandete mit leeren Gesichtern und schlafenden Kindern auf den Gepäckwagen. Um kurz vor Mitternacht musste ich Plan A endgültig abhaken. Es ging kein Flug mehr nach Deutschland, den nächsten freien Platz in einer anderen Maschine gab es erst einen Tag nach Weihnachten. Somit blieb nur Plan B: so schnell wie möglich zurück nach Pinkstone, wenn ich nicht auf dem glänzenden Steinboden des Abflugterminals zwischen Hunderten anderen Passagieren übernachten wollte. Und das wollte ich auf gar keinen Fall.
Also: raus aus dem Flughafengebäude, rein in den Schneesturm. Willkommen in einer Kulisse wie aus einem Endzeitfilm! Schneeberge überall, Dunkelheit nur durchbrochen von flackernden Straßenlaternen. Kein Shuttle-Bus weit und breit. Keine Taxis. Und noch immer schüttete der Himmel eiskalte weiße Flocken in riesigen Mengen über uns aus. Nach einer gefühlten Ewigkeit, meine Finger spürte ich bereits nicht mehr, meine Nase begann gerade abzusterben, kam ein klappriger Kleinbus angeschlingert und stoppte direkt vor mir und einer Gruppe weiterer Wartender, wobei er eine nasse Ladung Schneematsch auf uns spritzte.
»Manhattan?«, fragte der Fahrer mit schwerem Latinoakzent aus dem Beifahrerfenster. Der Vater einer vierköpfigen Familie, ein quengelndes Kleinkind auf dem Arm, nickte begeistert.
»Sollen wir dich mitnehmen?«, fragte er mich fürsorglich, während er Frau und Kinder in das rostige Gefährt manövrierte.
Ja, bitte, dachte ich. Egal wohin. Bloß weg hier. Und immerhin lag Williamsburg auf dem Weg nach Manhattan. Trotzdem fragte ich erst in Richtung des Fahrers: »Wie viel kostet das?«
»150 Dollar«, erklärte er kaum verständlich. Und als sei das nicht unverschämt genug, schob er hinterher: »Für jeden.«
War das zu fassen? Der schlug aus der Not der Leute hier auch noch Profit. So viel war ich nicht bereit zu zahlen. Außerdem hatte ich gar nicht so viel Geld dabei.
»Nein danke«, erklärte ich deshalb in Richtung des Familienvaters, der mir einen besorgten Blick zuwarf. Kaum hatte ich abgelehnt, schob sich ein sonnengebräuntes Pärchen mit Riesenrucksäcken an mir vorbei in den Wagen und knallte mir die Schiebetür vor der Nase zu. Der Kamikazefahrer machte sich schlingernd davon. Und dann tauchte nicht einmal mehr ein illegales Taxi wie dieses auf.
Gequirlter Mist! Was hatte ich mir bloß dabei gedacht, nicht einzusteigen? Jetzt hing ich endgültig fest und würde vermutlich Heiligabend am Flughafen verbringen müssen. Keine verlockende Vorstellung! Überteuerter Kaffee, überteuerte Gummibärchen und harter Steinfußboden statt Glühwein, Spekulatius und erleuchtetem Tannenbaum. Ich musste mir dringend etwas einfallen lassen, wie ich hier wegkam. Ich brauchte jemanden, der ein Auto besaß und (größen)wahnsinnig genug war, damit bei diesem Wetter zum Flughafen zu fahren.
Leider gab es nur einen einzigen Menschen in ganz New York, den ich kannte, auf den diese Beschreibung zutraf: meinen Kollegen Chris. Und leider war Chris der letzte Mensch, den ich um einen Gefallen bitten wollte. Aber wie gesagt: In New York lief längst nicht immer alles nach Plan. Und im Notfall brauchte man halt Plan C. C wie Chris. Seufzend kramte ich mein Handy aus der Tasche.
Kapitel 2
Mein Verhältnis zu meinem Kollegen Chris, oder wegen seiner allwetterfesten Frisur auch Mr Powerlocke genannt, war – um es mal vorsichtig auszudrücken – kompliziert. Gestartet waren wir als Konkurrenten um ein Jahrespraktikum bei dem Lifestyle-Magazin Zeitgeist, was, sehr zu meiner Enttäuschung, Chris abgeräumt hatte. Stattdessen arbeitete ich nun als Teamassistentin in der Redaktion und musste Chris dabei zusehen, wie er eine spannende Story nach der nächsten schreiben durfte, während ich Termine tippte. Immerhin: Mein Blog über unsere Pinkstone-WG war noch immer ein Klick-Magnet, während Chris seinen Blog über die Dreharbeiten für eine Fernsehserie hatte aufgeben müssen, weil kaum jemand ihn noch lesen wollte, nachdem die Pilotfolge komplett gefloppt war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!