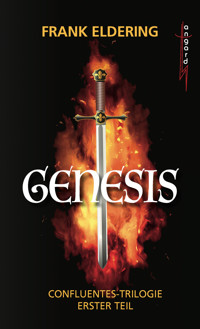6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: angard-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Hallo, Chris«, sprach eine Stimme. Er wirbelte herum. Im fahlen Licht stand, in ein langes Gewand gehüllt, ein Toter. Chris Lucas, ehemaliger Agent des BND, erkennt die Stimme, die aus dem Halbdunkel zu ihm spricht. Dieser Mann ist der Mörder seiner Frau und galt als tot. Mit Hilfe der Archäologin Helen Schumann findet Chris anhand eines Schachrätsels heraus, dass der fanatische Prediger der Fraternitas Confluentis, der sich jetzt Morten DeLanier nennt, kurz davor steht, den drei Weltreligionen einen zerstörerischen Schlag zu verpassen. Chris bleiben nur wenige Stunden, ihn zu stoppen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank Eldering VERSCHWÖRUNG, Confluentes-Trilogie DRITTER TEIL
https://frank-eldering.de
1. Auflage, Oktober 2023
Originalausgabe
angard-verlag Johannes Terwogt, Idstein 2023
© 2023 angard-verlag
Alle Rechte vorbehalten
E-Mail: [email protected]
Umschlaggestaltung:
angard-verlag
Coverbild Springer:
Johannes Terwogt
Coverbild Feuer:
Adobe Stock
Layout und Satz:
angard-verlag
Autorenfoto:
Kathryn Pfahler
Lektorat:
Kathryn Pfahler, Johannes Terwogt
Korrektorat:
Paul Pfeffer
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Duetsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://dnb.de abrufbar
ISBN Print
978-3-948042-06-6
ISBN E-Book
978-3-948042-07-3
printed in Germany
VERSCHWÖRUNG
Confluentes-Trilogiedritter Teil
vonFrankEldering
angard-verlag 2023
VERSCHWÖRUNG
Confluentes-Trilogie dritter Teil
Ich versichere, dieses Buch ausschließlichmit mensclicher Intelligenz verfasst zu haben
Idstein, 1. September 2023Frank Eldering
Ich widme dieses Buch
allen unsichtbaren Helden dieser Welt
Euch, die Ihr schweigt im Schattenland,unbeachtet, unerkannt.Und Menschen in höchster Notentgegenstreckt eure Hand.Ohne Zögern, ohne Furcht,auch nicht vor dem Tod.
Denkt nicht, ich sei gekommen,
Frieden auf die Erde zu bringen.
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen,
sondern das Schwert!
(Matthäus 10,34)
Observation
Koblenz, Deutsches Eck,
Freitag, 21. Februar 2014, um Mitternacht
Als er den Rhein auf der Pfaffendorfer Brücke überquerte, schien es Chris Lucas, als überschreite er eine Schwelle in die Vergangenheit. Eine Vergangenheit, von der er glaubte, sie für immer den Rücken gekehrt zu haben.
Eine Schwelle in die Gefahr!
Er warf einen Blick auf die Uhr im Armaturenbrett: zehn Minuten vor Mitternacht.
Nach der Brücke fuhr er auf die Neustadt, vorbei am hell beleuchteten kurfürstlichen Schloss; folgte dem Weg zur Mosel. Vor ihm tauchten die Laternen der Balduinbrücke auf. Er bog rechts in die enge, leicht ansteigende Burgstraße und löschte die Scheinwerfer. Das karge Licht der Straßenlaternen genügte, sich zu orientieren. Am Florinsmarkt wendete er den Citroen in die Richtung, woher er gekommen war, stellte ihn am Straßenrand ab. Den Schlüssel ließ er stecken. Aus alter Gewohnheit.
Hinter der Sitzlehne griff er nach dem Rucksack. Darin hatte er eine Nachtsicht-Digitalkamera mit Zoomobjektiv, eine Thermoskanne mit heißem Kaffee, eine Tafel Schokolade, eine MagLite Taschenlampe und eine alte Decke verstaut. Für Aktionen wie diese heute Nacht bevorzugte er den Rucksack. So war er beweglicher. Schneller, wenn es sein musste.
Chris öffnete die Tür. Die Türkontakte hatte er mit Tape überklebt, damit die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür nicht automatisch anging.
Er schaute sich um; niemand schien ihm gefolgt zu sein. Er ging die Straße hinunter zur alten Burg und nahm den Weg über eine Treppe auf einen tiefer gelegenen Innenhof, von dort unter einem gemauerten Bogen hindurch zur Uferstraße entlang der Mosel.
Links von ihm ragten die Bögen der Balduinbrücke schemenhaft aus dem Wasser empor. Die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos warfen grelle Blitze durch die Öffnungen des Sandsteingeländers in die Nacht.
Er drehte der Brücke den Rücken zu. Im Schutz der Mauer ging er flussabwärts das Ufer entlang. Nach einer Weile fixierte er den Blick in der Ferne auf eine Gruppe von Bäumen. Wie stille Wächter standen sie vor einem dahinter liegenden Bauwerk aufgereiht, das ihre Kronen überragte: die Statue des Kaisers Wilhelm I.
Sein Zielort in dieser Nacht.
Am Ende der Uferpromenade stieg er nach rechts ein paar Stufen hoch auf einen breiten Platz. Das Deutsche Eck. Die nach Norden spitz zulaufende Landzunge erinnerte ihn an das Vordeck eines Schlachtschiffes aus dem Ersten Weltkrieg. Ein paar Spaziergänger schlenderten herum, was zu dieser Stunde nicht ungewöhnlich war.
Er ging bis zur Bugspitze vor; schaute eine Weile zu, wie die Strömung der Mosel tosend in den Rhein floss. Dann drehte er sich um, näherte sich dem Denkmal. Beim ersten Mal, das er hier war, hatte ihn die gewaltige Statue beeindruckt. Jetzt erschien sie ihm wie ein Relikt einer von Größenwahn geprägten Ära.
Chris bestieg die Treppe, die sich zwischen zwei schweren Mauern über die ganze Breite des Platzes erstreckte und betrat die dem Standbild vorgelagerte Ebene.
Er sah zur Reiterstatue hoch, auf der Suche nach einem geeigneten Versteck. Auf einem zweistöckigen Sockel stand das Schlachtross. Im Sattel sonnte sich der Kaiser im grellen Licht der Scheinwerfer, die ihn von vier Seiten anstrahlten. Flankiert von der geflügelten Gestalt der Genie, seines Glücksbringers.
Viel Glück hat sie Euch nicht gebracht, Hoheit!
Das Gebäude, auf dem das Standbild ruhte, kam Chris vor wie ein Mausoleum: vier Reihen quadratischer Säulen, darüber zurückversetzt was aussah wie ein mit Schießscharten versehener Bunker. Der beste Ort für sein Vorhaben schien wohl das Säulenbauwerk zu sein. Von dort hatte er einen freien Blick über den Vorplatz. Nur ein wenig Licht der Strahler fiel auf die Kolonnaden. Er spähte in die dunklen Zwischenräume und stellte fest, dass es unmöglich war, tiefer als bis zur vordersten Säulenreihe hineinzusehen. In der schwarzen Kleidung würde er mit der Finsternis verschmelzen.
Er schaute sich um; die letzten Spaziergänger verließen den Platz.
Zeit zu verschwinden!
Über die Treppe links von der Reiterstatue stieg er zur Rückseite des Denkmals auf ein Plateau, das von einer im Halbkreis angeordneten Kolonnade umschlossen war.
Der Ort der Deutschen Einheit.
Mauerscheiben wechselten sich ab mit Öffnungen, unterbrochen von quadratischen Säulen. Er beugte sich über die massive Brüstung, warf einen Blick in die Tiefe: Gemauerte Rundbögen stützten sich auf eine schräg nach außen neigende Sockelmauer. Aus jedem Mauerteil dazwischen ragten offene Betonrinnen heraus: Wasserspeier. Am Fuße der Mauer wuchsen Sträucher und dichtes Gestrüpp. Er schauderte.
Gott bewahre, wenn ich da hinunterspringen muss!
Im Licht der Straßenlaternen erkannte Chris die schwere Mauer aus der Kreuzritterzeit. Dahinter ein weißes Gebäude. Er kannte es: das Deutschherrenhaus, damaliges Domizil des deutschen Ritterordens, heute ein Museum. In der Ferne ragte die graue Silhouette der Basilika Sankt Kastor in den nächtlichen Himmel empor. Ihre Zwillingstürme verschmolzen mit der Schwärze der Nacht.
Chris drehte sich zur Reiterstatue. Das Bauwerk wuchs aus einer kreisrunden Treppenanlage empor, die bis an die Kolonnaden reichte. Eckpfeiler aus gewaltigen Basaltquadern teilten die Stufen wie der Bug eines Kriegsschiffes die heranbrandenden Wellen.
Er bestieg die mittlere, von zwei Absperrketten gesäumte Treppe. Eine schmiedeeiserne Gittertür versperrte den Zugang zu einer Wendeltreppe, die zum höher gelegenen "Bunker" führte. Ohne die Taschenlampe zu benutzen, ertastete er im Dunkeln den Weg zwischen den klobigen Säulen hindurch. Hinter der vorderen Säulenreihe auf der Seite des Glückbringers des Kaisers – man kann nie wissen – breitete er die Decke auf dem Boden aus. Er nahm die Kamera aus dem Rucksack, schaltete die Nachtsichtfunktion ein, richtete das Zoomobjektiv auf die Bugspitze des Deutschen Ecks. Für die größte Entfernung schien das Bild ausreichend hell. Nach diesen Vorbereitungen stopfte er den Rucksack zwischen seinen Rücken und die Säule und lehnte sich dagegen.
Er sah auf die Uhr: Viertel vor eins. Das Warten begann.
Stunden vergingen. War er umsonst hergekommen? Er wollte sich eine vierte Tasse Kaffee einschenken, da geschah etwas auf der Moselseite. Zwei Gestalten traten aus dem Dunkeln hervor.
Er fokussierte die Kamera auf sie. Vor der Begrenzungsmauer blieben sie stehen. Er zoomte sein Objektiv ein auf das Gesicht des Mannes, der ihm zugewandt war. Er trug einen dunklen Schal um den Hals geschlungen.
Chris´ Atem stockte. Der Mann kam ihm bekannt vor! Er studierte die Gesichtszüge genauer. Kein Zweifel, er kannte ihn. Er schoss ein paar Bilder.
Die zweite Person stand mit dem Rücken ihm zugewandt. Ein Kopf mit kurz geschnittenem weißen Haar über dem hochgeschlagenen Kragen eines langen Mantels, der fast den Boden berührte. Mehr war nicht zu sehen.
Die zwei unterhielten sich.
Motorengeräusch drang von der Rheinseite herüber. Ein schwarzer Mercedes erschien, fuhr langsam über den Platz; hielt vor der Treppe an. Der Mann auf dem Beifahrersitz stieg aus, in der linken Hand einen Aktenkoffer.
Chris zoomte heran und erstarrte. Auch dieses Gesicht kannte er aus grauer Vergangenheit: hohe Stirn, buschige Brauen, dunkles, mittellanges Haar, nach hinten gekämmt, glitzernd von Pomade, der offene Kragen, die schwere Goldkette um den Hals. Ein Warnsignal ertönte in seinem Kopf, instinktiv zog er sich tiefer in die Dunkelheit zurück.
Pomade ging auf die Wartenden zu, nickte kurz.
Der Mann mit dem Schal kramte eine Taschenlampe hervor und gab ein Signal in Richtung Mosel. Wenig später drang ein dumpfes Geräusch über das Wasser. Ein Motorboot näherte sich der Stelle, wo die Stufen zur Uferpromenade des Deutschen Ecks hinabführten.
Pomade gab ein Handzeichen. Zwei Männer stiegen darauf aus dem Fond des Mercedes und liefen die Stufen hinunter. Ein Seil wurde vom Boot herübergeworfen, einer von ihnen befestigte es an einem Fahnenmast. Ein Koffer wurde hinübergereicht. Zu zweit trugen sie ihn die Treppe hinauf. Der Mercedes fuhr heran, die Heckklappe sprang auf. Die Männer wuchteten den Koffer hinein, öffneten ihn; prüften den Inhalt. Daumen hoch in Richtung der Gruppe, der Kofferraum wurde zugeklappt, die Bootsleine gelöst. Das Motorgrollen schwoll an, dann wurde es leiser, bis es sich in den Geräuschen der Nacht auflöste. Die Aktion hatte keine fünf Minuten gedauert.
Der Aktenkoffer wechselte den Besitzer, die drei Männer unterhielten sich kurz. Die zwei Helfer warteten. Ein Händedruck; die beiden, die zuerst gekommen waren, verließen den Ort.
Chris schoss mehrere Bilder vom Weißhaarigen, bekam ihn aber nur für wenige Sekunden von der Seite zu sehen. Er schaute ihm durch die Kameraoptik nach, bis er aus dem Blickfeld verschwand. Ein mulmiges Gefühl beschlich ihn: Für einen kurzen Augenblickhatte das Bild in seinem tiefsten Inneren etwas aufgewühlt.
Er richtete den Blick auf den Mann, der am Fuß der Treppe stand. Pomade schien es nicht eilig zu haben. Er zündete sich eine Zigarette an, nahm ein paar kräftige Züge. Dann schritt er langsam auf den Mercedes zu. Auf ein Zeichen von ihm setzten sich die zwei Helfer in Bewegung, gingen wortlos an ihm vorbei. Sie stiegen die Treppen hoch, einer auf jeder Seite des Denkmals.
Die kommen zu mir herauf!
Pomade hatte etwas bemerkt. Hatte seinen Männern ein Zeichen gegeben.
Ich sitze in der Falle!
Hastig entfernte er die Speicherplatte aus der Kamera; steckte sie in die Tasche des Anoraks. Er hob den Rucksack auf, schlich durch die Säulen zur Rückseite. Die Männer hatten das hintere Plateau erreicht. Er fokussierte den Blick auf ihre Hände, erkannte aber im Halbdunkel nicht, ob sie Waffen trugen.
Der Mann links blieb stehen, gab ein Handzeichen. Darauf stieg der andere die Stufen auf der gegenüberliegenden Seite hoch.
Wohin? Chris zog sich hinter die nächste Außensäule zurück und nahm die schwere Taschenlampe aus dem Rucksack.
Schritte kamen die steinerne Treppe herauf.
Mit pochendem Herzen wartete er, bis der Mann an der Säule vorbeiging; dann schlich er um sie herum, hob die Lampe.
Der Mann wirbelte herum. Mit Wucht knallte Chris ihm die Mag-Lite an den Kopf, umfasste ihn mit dem linken Arm, ließ ihn zu Boden sinken. Eine Pistole mit Schalldämpfer steckte im Schulterholster unter der Jacke des Bewusstlosen. Chris beugte sich vor.
Bewegung am anderen Ende des Ganges. Eine Silhouette. Neben ihr schnellte etwas hoch.
Keine Zeit, die Waffe zu ziehen! In einem Reflex sprang Chris hinter die Säule, knallte gegen ein Eisengeländer. Ein Geräusch wie von einem springenden Sektkorken, etwas zischte an ihm vorbei. Er sprang über das Geländer auf das tiefer gelegene Podest, warf sich auf den Rucksack, rutschte kopfüber die hohen Betonstufen hinunter. Federte den Aufprall ab, richtete sich auf. Kugeln schlugen rechts und links von ihm ein; geduckt sprintete er über das Plateau der Deutschen Einheit zur Kolonnade. Ein Projektil streifte seine Wade, dann war er an der Balustrade. Er warf den Rucksack hinüber, schwang sich auf den dahinterliegenden Wasserspeier.
Keinen Sekundenbruchteil zu spät!
Kugeln schlugen an der Stelle, wo er soeben gestanden hatte, ein. Vom Speier herunterhängend ließ er sich fallen, rutschte bäuchlings an der schrägen Mauer hinunter, die Hände über die Ziegelsteine schrammend, Kugeln zischten an ihm vorbei. Er landete im Gestrüpp, sprang auf.
Wo ist der Rucksack? Egal, weg hier!
Adrenalin pumpte den Schmerz weg. Er rannte die Straße hinunter, an der über ihm ragenden mittelalterlichen Mauer entlang in Richtung Kastor-Kirche.
Hinter ihm Schreie, rechts Scheinwerferlicht, ein Auto hielt an, Männer sprangen heraus.
Schneller! Seine gummibesohlten Turnschuhe trommelten ein lautloses Staccato auf das Pflaster. Doch der Schutz der Mauer währte nicht lange. Vor ihm tauchte die graue Masse der Basilika Sankt Kastor aus der Dunkelheit auf. Weiter! Am Hauptportal vorbei. Wohin jetzt? Zum Moselufer nicht, dort schneiden sie mir den Weg ab! Er wählte das Rheinufer, den Fußweg hinunter, die Südseite der Kirche entlang. Vor ihm ein Parkplatz, dahinter das mit Ahornbäumen gesäumte Konrad-Adenauer-Ufer, die Basisstation der Seilbahn, schweigend.
Der Hall sich rasch nähernder Schritte jagte ihn über den Parkplatz. Er versteckte sich hinter einem Kastenwagen, der neben einem Kleinlaster geparkt stand, hockte sich hin; lauschte. Sekunden später rannten zwei Männer an ihm vorbei.
Motorengeräusch vom Rheinufer her! Er kroch unter den Kleinlaster; ein Fahrzeug hielt an. Lichtkegeln wanderten über den Parkplatz, verharrten kurz auf den Kastenwagen. Erloschen, eine Tür schlug zu, das Auto fuhr weiter. Chris wartete ein paar Sekunden; rollte unter dem Kleinlaster hervor.
Er spürte den Angreifer, bevor er ihn sah. Blitzschnell drehte er sich auf den Rücken, zog die Knie an, katapultierte die Füße nach oben. Sie trafen den Mann im selben Moment, als der seine Waffe auf ihn richtete. Die Hand mit der Pistole schlug gegen den Kastenwagen, ein gedämpfter Schuss löste sich. Mit einem Ruck zog er den Gegner an dessen Mantel herunter. Der Kopf des Mannes prallte hart auf den Asphalt. Regungslos blieb er liegen.
Schwer atmend hob Chris die Pistole auf; betrachtete sie: eine schallgedämpfte Beretta 9 mm. Er sicherte sie; steckte sie in den Hosenbund; horchte. Als er nichts Verdächtiges hörte, kroch er zwischen den Fahrzeugen hervor; spähte über Parkplatz und Uferstraße; beide waren menschenleer.
Er blickte zur Rheinseite gegenüber. Oben am Felsen strahlte die Festung Ehrenbreitstein. Hinter ihr im Osten hellte der Himmel auf, die Nacht zog sich zurück.
Zeit für mich, das Gleiche zu tun.
Ein Blick auf die Uhr: kurz vor vier. Im Schutz der Bäume ging er die Uferstraße hinunter; bog auf die Rheinstraße in die Innenstadt, immer nach verdächtigen Fahrzeugen spähend. Die Stadt schien verlassen, außer ihm und einer Handvoll Mafiakillern.
Seine Gedanken kehrten zurück zu den Ereignissen, die er beobachtet hatte.
Eine geheime Übergabe, dazu am Deutschen Eck! Dort, wo man es am allerwenigsten erwartet … Der Gipfel der Dreistigkeit! Es benötigte keine Fantasie, zu erahnen, um was es sich bei der Ware handelte. Erst recht nicht angesichts des Mannes, dessen Schergen ihn jagten: Mario Andretti, Spitzname Aurelio, der Goldkette wegen, die er immer trug. Einer der gefürchtetsten Drogenbosse Deutschlands! Dass er persönlich einen Geldkoffer überreichte, zeigte, dass es sich um eine überaus große Drogenmenge handelte. Bei dem Umfang des Deals fragte er sich, warum nur er für die Observation ausgewählt worden war und nicht mehrere Agenten? Hatte sein Auftraggeber davon nichts gewusst? Kaum zu glauben! Doch das ging ihn weiter nichts an.
Anders der Mann mit dem Schal: Der hatte sein Interesse geweckt. Weshalb war der Leiter eines Seniorenheims in Wiesbaden in Drogengeschäfte verwickelt? Und wer war der Weißhaarige, dessen Gesicht er nie zu sehen bekommen hat-te? Woher kamen die beiden? Zu Fuß? Er hatte kein Auto gehört. Fragen, auf die er keine Antworten hatte. Noch nicht.
Am Jesuitenplatz schlug er den Weg Richtung Liebfrauenkirche ein. Er war jetzt in der Fußgängerzone, wo Fahrverbot herrschte. Er zweifelte, ob Mafiakiller sich daran halten würden.
Er behielt recht. Kaum hatte er die Kirche erreicht, hörte er hinter sich ein Auto in die Straße einbiegen. Er stürzte sich in die nächste Gasse. Der Fahrer beschleunigte. In Gedanken zählte er die Sekunden, die seine Verfolger bis zur Einmündung benötigten. Dann drehte er sich um, entsicherte die Beretta, ließ sich aufs linke Knie herunter; zielte mit beiden Händen, die Ellbogen auf das rechte Knie gestützt. Als das Licht der Scheinwerfer in die Straße einbog, feuerte er zwei Schüsse ab. Die Frontscheibe zersprang, das Fahrzeug kam mit einem Ruck zum Stehen; die Türen flogen auf, zwei Männer sprangen heraus. Chris eilte die Gasse hinunter. Vereinzelt beleuchtete Fenster warfen ein spärliches Licht aufs Kopfsteinpflaster. Vor ihm tauchte der Florinsmarkt auf. Er rannte zum Auto, riss die Fahrertür auf, stürzte sich hinters Lenkrad, warf die Waffe auf den Beifahrersitz, drehte den Zündschlüssel. Der Motor sprang an. Ein schneller Blick zurück. Die Verfolger kamen über den Marktplatz, die Arme vor sich ausgestreckt. Eine Kugel zerfetzte das linke Seitenfenster, warf Glassplitter an seinen Hinterkopf. Etwas Warmes kroch den Nacken hinunter. Chris duckte sich, gab Vollgas. Zweihundert PS katapultierten den Citroen nach vorne. Zwei weitere Kugeln trafen das Blech. Im Sitz zurückgelehnt, den Blick knapp über dem Armaturenbrett, peitschte er das Fahrzeug mit heulendem Motor die enge Straße hinunter.
Am Ende der Burgstraße richtete er sich auf, warf einen Blick in den Rückspiegel. Scheinwerfer! Links ab, bei Rot auf die Kreuzung, das Heck des Wagens scherte aus; er wirbelte das Lenkrad nach rechts, dann nach links; ein Fahrzeug kam ihm hupend entgegen, er verfehlte es knapp. Mit schreienden Reifen be-schleunigte er stadtauswärts, hinter ihm Lichter. Die Verfolger?
Mit Vollgas über die Rheinbrücke, den Blinker nach rechts, als wollte er abbiegen. Kurz vor der Ausfahrt löschte er Blinker und Scheinwerfer, riss in letzter Sekunde das Lenkrad herum. Haarscharf verfehlte er die Leitplanke, raste blind in den Tunnel. Er konnte nicht sehen, ob der Wagen hinter ihm abbog. Er driftete in der Linkskurve zu weit nach außen, schrammte die Wand. Aus dem Tunnel her-aus auf die Schnellstraße. Erneuter Blick in den Rückspiegel: hinter ihm ein Fahrzeug! Ohne Licht raste er durch das nächtliche Ehrenbreitstein. Nach der Ortsdurchfahrt wurde die Straße breiter. Er trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, der Auspufflärm des V6-Motors dröhnte ohrenbetäubend durch die zertrümmerte Scheibe.
Die Scheinwerfer kamen näher.
Ein begrünter Seitenstreifen. Chris reagierte sofort; Vollbremsung, von der Straße herunter, anhalten; mit Pistole über die Mittelkonsole durch die Beifahrertür, kopfüber in den Graben, Waffe entsichern, zielen. Das Fahrzeug raste an ihm vorbei, verschwand in der Nacht. Er senkte die Waffe, atmete tief durch. Wartete einige Minuten. Als er sicher war, dass kein weiteres Auto ihm folgte, stieg er ein und fuhr los.
Er lehnte sich zurück. Mission accomplished! Seine früheren Fähigkeiten hatte er nicht verloren.
Doch es war knapp gewesen.
Ein Gedanke ließ ihn nicht los: Die Vorgehensweise der Männer am Denkmal deutete auf Vorwissen hin, dass jemand sie beobachten würde.
Aurelio hatte einen Tipp bekommen.
Von wem?
An der Autobahnauffahrt fuhr er auf die A 44 nach Osten.
Am Horizont fing das Morgenrot an, dem neuen Tag Leben einzuhauchen.
TEIL I – Gregor
Ja, Schlangengeifer ist ihr Wein und grausames Natterngift.
Liegt dieses nicht bei mir aufbewahrt, versiegelt in meinen Kammern,zum Tag der Rache und der Vergeltung,zum Zeitpunkt, da ihr Fuß wankt?
Nahe ist ihres Unheils Tag, es eilt heran ihr kommendes Schicksal.
(5. Buch Moses – Deuteronomium, Kapitel 32, Vers 33-35)
1 Hochmeister
Weyarn,Samstag, 1. März
Gregor Hanig entstieg im Hauptbahnhof München dem ICE aus Frankfurt am Main. Er ging zum Stand eines Autovermieters. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, fuhr er aus der Stadt hinaus auf die A8 Richtung Rosenheim.
Nach etwa einer Viertelstunde bog er an der Ausfahrt Weyarn ab. Nach der Ortseinfahrt folgte er den Hinweisschildern zur ehemaligen Augustiner Klosterkirche. Dort parkte er, nahm sein Telefon, wählte. »Hier Gregor Hanig, ich stehe jetzt auf dem Parkplatz.« Er hörte kurz zu; stieg aus; betrachtete einen Moment die alte Pfarrkirche. Dann schritt er zu einer schweren Eichentür, öffnete sie, trat ein. Die Kirche empfing ihn weiß, leer und kalt.
Er ließ den Innenraum auf sich einwirken.
Obwohl er nicht gläubig war, beeindruckte ihn die Baukunst vergangener Jahrhunderte, sobald er eine historische Kirche, Kathedrale oder einen Dom betrat. Er schritt die Kirchenbänke entlang; setzte sich in die vorderste Sitzreihe.
Nach wenigen Minuten öffnete sich eine Seitentür; ein Mann trat herein. Er trug einen weißen Umhang über einer schwarzen Soutane. Auf dem linken Ärmel prangte ein Tatzenkreuz. Er war von mittlerer Statur, kräftig gebaut; trug eine Brille mit Stahlgestell und runden Gläsern, durch die er den Besucher intensiv musterte.
Gregor erhob sich. Der Mann kam auf ihn zu; reichte ihm die Hand. »Willkommen im Hause der Fratres Domus Hospitalis …«, kurz hielt er inne, »… Sanctae Mariae Teutonicorum Jerosolimitani«, vollendete er den Satz mit einem Lächeln.
Vor Gregor stand der Hochmeister des Deutschen Ordens, Prior Dr. Waldemar Geiss.
»Ich grüße Sie, Hochmeister. Bin etwas erstaunt darüber, dass Sie höchstpersönlich und nicht der Provinzial, Prior Dr. Eugen, mit dem ich telefoniert hatte, mich hier empfängt.»
Der Prior senkte den Kopf, sah ihn über den Brillenrand an. «Ich hatte das Gefühl, dass diese Angelegenheit von größter Wichtigkeit sei, Herr Hanig«, antwortete er. »Es hat in der Vergangenheit … Probleme mit der deutschen Brüderprovinz in Bayern gegeben, wie Sie vielleicht wissen. Ich erachtete es diesmal für erforderlich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.«
Gregor nickte. »Verstehe.«
Waldemar Geiss winkte zur Tür. »Begeben wir uns zum Gespräch in eine etwas … geselligere Atmosphäre, was meinen Sie?« Ohne Gregors Antwort abzuwarten, drehte er sich um. Sie verließen die Kirche durch die Seitentür. Gregor folgte dem Prior an einem liebevoll gepflegten Rosengarten vorbei zu einem weißen Gebäude. Sie betraten die Pfarrei. Der Hochmeister führte ihn in ein geräumiges Arbeitszimmer.
»Warten Sie hier einen Moment, ich will mich kurz meines Umhangs entledigen«, sprach der Prior und verschwand.
Gregor sah sich um. Alte Eichendielen auf dem Boden. Holzgetäfelte Wände. Ein antiker Eichentisch in einer Ecke des Raumes. Dahinter ein schweres Holzregal, gefüllt mit unzähligen, in Leder gebundenen Büchern. Sein Blick schweifte zur anderen Seite, wo ein runder Tisch mit drei Polstersesseln zum Verweilen einlud. Ein Fenster gab die Sicht frei auf einen Kräutergarten, der von einer weißen Mauer umschlossen war. Keine Bilder schmückten die Wände.
Bis auf eines.
Er trat näher heran, betrachtete es. Es zeigte ein mittelalterliches Feldlazarett an einer Küste.
»Die Geburtsstunde des Deutschen Ordens.«
Gregor hatte nicht bemerkt, dass der Hochmeister hereingekommen war. Er trug jetzt ein schwarzes Gewand und stellte sich neben ihn.
»Vor der Festung Akkon, im Winter des Jahres 1190 in Palästina«, ergänzte Gregor. »Etwas mehr als hundert Jahre später war es an genau dieser Stelle zu Ende.«
»Zumindest mit der Arbeit im Heiligen Land«, antwortete der Hochmeister. Mit einer einladenden Handbewegung bat er Gregor, auf einem der Sessel Platz zu nehmen.
Ein leises Klopfen an der Tür. Ein junger Mönch trat herein; stellte ein Tablett mit einer Kaffeekanne und zwei Tassen auf den Tisch; verschwand ebenso geräuschlos, wie er gekommen war.
»Ich habe uns Kaffee bringen lassen, da ich vermute, dass wir ihn brauchen werden«, sagte Geiss. Er schenkte Milch in seine Tasse; rührte. »Bedienen Sie sich.« Er lehnte sich im Sessel zurück und musterte Gregor. »Am besten, ich schildere Ihnen den Anlass für meine Bitte an Sie.« Er schwieg einen Augenblick, fuhr dann fort: »Wie Sie vermutlich wissen, handelt es sich bei unserer Arbeit hauptsächlich um Alten- und Behindertenpflege, Drogenhilfe für Jugendliche und Seelsorge. Zu diesem Zweck gründete der Deutsche Orden als Unterorganisation die Deutschordenswerke. Diese unterhalten in Deutschland Einrichtungen für die Unterkunft und Pflege älterer, gebrechlicher Menschen. Zuerst als reine Pflegeeinrichtungen, doch in jüngster Zeit gibt es eine vermehrte Tendenz nach sogenannten Service-Wohnungen. Für Senioren, die zwar nicht pflegebedürftig sind, aber auf die Dienstleistungen zurückgreifen können. Allerdings muss dabei eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben, da unser Hauptaugenmerk nach wie vor auf die Pflege fällt. Wegen der Gemeinnützigkeit, versteht sich.«
Er schwieg, um Gregor die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen. Als das nicht der Fall war, fuhr er fort. »Wir haben in letzter Zeit festgestellt, dass dieses Verhältnis gekippt ist. Soll heißen, das Angebot an Service-Wohnungen ist größer als das an Pflegezimmern. Einige Stifte sind dazu übergegangen, besser situierte Senioren aufzunehmen, gegen entsprechende Bezahlung.«
Hier legte Geiss eine Pause ein.
Gregors Gedanken kreisten um seine Freundin Magdalena. Als ehemals berühmte Opernsängerin hatte sie ordentlich Geld verdient. Der Verkauf ihrer CDs brachte immer noch hohe Einnahmen.
Er räusperte sich. »Bei einem dieser Seniorenheime handelt es sich um meinen Nachbarn, die Seniorenresidenz im Adamstal, vermute ich?« Geiss nickte. »Nicht nur das. Wir glauben sogar, dass dort die Quelle sitzt, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Gregor begriff sofort, dass die Bemerkung des Hochmeisters auf den Leiter der Residenz Wolfram König zielte. Er nannte ihm den Namen. »Als Prior Dr. Eugen einen Privatdetektiv suchte, wurde ich ihm vom Prior der Sankt Kastorkirche in Koblenz Walter von Gerbrand, empfohlen. Als er feststellte, dass ich sogar nebenan wohne, rief er an und bat mich, hierher zu kommen.«
Er trank einen Schluck. »Was kann ich für Sie tun?«
Die Augen des Hochmeisters fixierten ihn. »Wir brauchen Beweise. Zum Beispiel genaue Informationen über die Verträge. Danach sehen wir weiter.«
Gregor überlegte. »Kein Problem, die besorge ich Ihnen.«
Geiss lehnte sich zurück; wechselte das Thema. «Wussten Sie, dass es in Koblenz, dem ehemaligen Sitz des Deutschen Ordens, nach langer Zeit wieder eine Kommende gibt? Im damaligen Deutschherrenhaus?«,
Gregor schüttelte den Kopf. »Nein, das wusste ich nicht. Das ist doch das heutige Ludwig Museum? Sie müssen entschuldigen, ich weiß wenig über Koblenz.«
»Das Museum vermietet seit einigen Jahren im südlichen Trakt Räume an den Deutschen Orden. Mit einem eigenen Eingang auf der Seite der Basilika Sankt Kastor.« Gregor sah, dass der Gesichtsausdruck des Hochmeisters sich verdunkelte.
»Gibt es ein Problem mit dieser Kommende?«
»Mit ihrem Vorsteher, einem Priester namens DeLanier. Sie nennen ihn Bruder Morten.«
»Bruder Morten?« Aufregung durchfuhr Gregor. Er unterdrückte sie schnell, doch nicht schnell genug für den scharfen Blick des Hochmeisters.
»Sie haben den Namen schon mal gehört?«
»Ich hatte vor etwas mehr als einem Jahr mit dem Prior von Sankt Kastor in einer Angelegenheit zu tun, in der es um einen Bruder Morten ging«, erklärte Gregor. »Er hatte nur den Namen erwähnt.«
Der Hochmeister beobachtete ihn. Ihm war klar, dass Gregor mehr wusste, als er preisgab, ging aber nicht weiter darauf ein.
Gregor begegnete dem Blick des Priors. »Dieser DeLanier ist jetzt ein Priester des Deutschen Ordens?«
»Ja, zurzeit ist er das … noch«, antwortete Geiss.
»Was heißt das? Soll er seines Amtes enthoben werden?«
»Im Generalkapitel … wird dieser Schritt überlegt.«
Gregor wunderte sich, dass der Hochmeister auf dieses Thema zu sprechen kam, obwohl es nichts mit der Sache zu tun hatte, wegen der er hergebeten worden war. Er hakte nach: »Wieso erzählen Sie mir das?«
»Weil DeLanier nach Aussage eines Vertrauten öfter vom Leiter jener Seniorenresidenz von der Sie sprachen, diesem Herrn König, Besuch bekommt.«
»Sie vermuten eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Herren?«
»Der Gedanke ist mir gekommen.«
»Erzählen Sie mir von diesem DeLanier.«
»Dazu muss ich ein wenig ausholen in den religiösen Hintergrund des Deutschen Ordens. Wenn es Ihnen nichts ausmacht?« Er schaute Gregor an; als der keine Einwände äußerte, legte er los.
»Geschichtlich gesehen hat der Deutsche Orden eine Bindung an die römisch-katholische Kirche. Unsere Priester sind katholische Priester.« Hier stockte der Hochmeister, schaute in die leeren Tassen. »Wollen wir uns einen zweiten Kaffee gönnen?«
Nach einer Unterbrechung, in der frischer Kaffee gebracht wurde, setzte Geiss seine Erzählung fort:
»DeLanier erhielt vor einigen Jahren die Priesterweihe. Kurz darauf kam er nach Koblenz. Im letzten Jahr bekam er die Leitung der Kommende übertragen. Er hatte sich persönlich intensiv um ihre Gründung bemüht.«
»Wie lange war er in der Zeit davor Ordensbruder?«
»Das weiß ich nicht, er wurde mir erst kurz vor der Priesterweihe vorgestellt. Vor etwa einem Jahr trat eine Veränderung in sein Auftreten ein. Vielleicht schon früher. Seine Predigten bekamen einen härteren, aggressiveren Ton. Er fing sogar an, die Grundlage der katholischen Lehre offen infrage zu stellen. Allem voran die Dreifaltigkeit und die Auferstehung Christi. Kurz nach einer aggressiven Predigt, die er kürzlich hielt, erhielt Ich ein mahnendes Schreiben des Heiligen Offiziums …«, Geiss stockte, als er den fragenden Ausdruck in Gregors Gesicht sah, »früher Kongregation der Glaubenslehre genannt. Noch früher … Inquisition.«
Er fuhr fort: »Der Brief kam direkt aus Rom. Wir waren erstaunt über den für vatikanische Verhältnisse recht scharfen Ton.«
»Rom wird seine Gründe haben«, flüsterte Gregor, der an die Geschehnisse vor über einem Jahr wegen des Papyrus Schumann dachte.
»Was meinen Sie damit?« Verwundert über diese Aussage, sah der Hochmeister ihn an.
Gregor begegnete dem Blick des Priors; überlegte. Er war nicht nach Weyarn gekommen, um Geheimnisse zu hüten. Vor ihm stand immerhin der Hochmeister des Deutschen Ordens.
Er beschloss, Waldemar Geiss aufzuklären. »Haben Sie jemals von einem Geheimbund mit dem Namen Fraternitas Confluentis gehört?«
2 Auftrag
Genua,zur gleichen Zeit
»Confluentes«, sprach die Stimme.
Das Codewort. Zum ersten Mal nach fast zwei Jahren.
»Meine Schuld ist beglichen«, antwortete Kamil al-Raschid, »Ich habe meine Pflicht erfüllt.«
»Da hast du recht, Kamil.« Die sanfte Stimme schien aus dem Jenseits zu kommen. »Und du wurdest reichlich belohnt.«
Er warf einen Blick durch die geöffnete Schiebetür auf die Holzterrasse, die der gesamten Hausfront vorgelagert war. Dahinter nichts außer Meer. Er hörte die Wellen tosend auf die Klippe brechen, auf der das Haus neu errichtet worden war. Sah sie in weiß schaumendes Chaos explodieren. Sogar drinnen streichelte die Gischt sein Gesicht, schmeckte er das Salz auf den Lippen.
Ja, er wurde fürstlich belohnt.
»Quest-ce que je dois faire ce temps?«
Die Stimme sagte ihm, was er dieses Mal zu tun hatte.
Er zögerte. »Ich muss wissen, was Sie vorhaben. Ich bin vom Orden der Hasschischiyyin, führe nicht jeden Auftrag aus.»
»Ich weiß, Kamil, ich weiß. Diese Mission steht deinen Grundsätzen nicht entgegen. Im Gegenteil. Du wirst eine Veränderung hervorbringen, deren Ausmaß die Welt der Andersgläubigen noch nie erlebt hat.«
Ein Hauch von Begeisterung klang durch die Leitung.
»J´écoute.«
Er hörte zu. Als der Anrufer geendet hatte, verschlug es ihm für einen Moment die Sprache. Dieser Plan war ungeheuerlich, das Produkt aus dem Gehirn eines eiskalten Fanatikers. Er diente dem wahren Glauben. Der Islam würde siegen. Inschallah!
»Wie viel?«
»Zehn Millionen für dich, je zwei für deine Männer.«
Kamil schwieg eine Weile.
Dann: »J´accepte.«
Was über das Rauschen in der Leitung kam, hörte sich fast wie ein Lächeln an.
»Nichts anderes habe ich erwartet.«
Ein sanftes Klick, das Gespräch war beendet.
Kamil legte den Hörer auf, verharrte eine Weile. Schritt hinaus auf die Terrasse, stützte sich mit gespreizten Armen auf die eiserne Umwehrung; starrte in die Ferne.
Am Horizont stiegen dunkle Gewitterwolken in den frühen Abendhimmel empor. Reitern der Apokalypse auf gigantischen Schlachtrössern gleich rollten sie heran, hungrig nach Vergeltung. Der Schaum der Wellenköpfe blitzte auf unter ihren trampelnden Hufen. Sie näherten sich der einsamen Person auf dem Deck, hoch über den Felsen.
Unaufhaltsam. Drohend.
Der Assassine drehte dem nahenden Sturm den Rücken zu; kehrte zurück ins Haus. Schloss die Schiebetür.
Rollte sein Gebetsteppich aus.
»Allahu Akhbar …«
3 Mittagessen mit Folgen
Wiesbaden,Sonntag, 2. März, Spätmorgens
Gregor Hanig starrte aus dem offenen Fenster seines Arbeitszimmers hinüber zum Gebäude auf dem Nachbargelände. Wie seine eigene Villa – so nannte er sein Haus – lag die Seniorenresidenz auf einem leicht nach Südosten geneigten Hang. Durch diese Lage genossen die Bewohner einen herrlichen Weitblick ins Adamstal. Diese Wohnqualität war nicht ohne Eigennutz des Betreibers ermöglicht worden. Für solche Wohnlagen bezahlten betuchte Senioren eine Menge Geld.
Vor einem Jahr hatte sein Schachfreund, der Architekt Chris Lucas, den Bau der Wohnanlage fertiggestellt. Ihm schauderte, wenn er an die Zeit zurückdachte. Zu frisch waren die Erinnerungen an die Ereignisse, die sich damals abgespielt hatten: Die Villa war von Schergen des Opus Dei angezündet worden, der gesamte Altbau aus hölzernem Fachwerk dem Feuer zum Opfer gefallen. Das Haus war bis auf die Grundmauern abgebrannt, seine Enkelin Helen in den Flammen fast umgekommen.
Nur dem Bestandschutz und Chris´ Hartnäckigkeit verdankte er es, dass die Villa überhaupt wieder aufgebaut werden konnte.
Erneut kochte Wut in ihm hoch bei der Erinnerung, wie die Baubehörde damals mit der Seniorenwohnanlage nebenan verfahren war. Das Projekt hätte nie genehmigt werden dürfen, es lag im so genannten Außenbereich. Für Otto Normalverbraucher hätte das bedeutet: keine Baugenehmigung. Ohne Geld oder gute Beziehungen, um Ausnahmen zu bewirken. Ein neues Planungsverfahren mit Übernahme der Erschließungskosten hatte den Bau ermöglicht. Sowie Zusagen, die unter der Hand abliefen, da war sich Gregor sicher.
Er warf einen letzten Blick auf die Gebäude, schloss das Fenster; rief seine Freundin an. Nach dreimal Klingeln hob sie ab.
»Wo bist du?« Klingeltöne für spezielle Personen ermöglichten es ihr, zu wissen, wer anrief.
»Zu Hause. Wollen wir uns in der Stadt zum Mittagessen treffen?«
»Ich bin auf der Wilhelmstraße, auf dem Weg zu Käfer´s Bistro zum Sonntagsbrunch.«
Darf es etwas Preisgünstigeres sein?
»Okay, treffen wir uns dort, ich bin in einer Viertelstunde da.«
Käfer’s Bistro lag im nördlichen Seitenflügel des Wiesbadener Kurhaus. Als eines der angesehensten Restaurants Wiesbadens pflegte es eine alte Familientradition. Gäste, die hier zum Speisen kamen, schätzten sie.
Magdalena Henrietta Solms war solch ein Gast. Vor zwei Jahren hatte sie in der Mailänder Scala ihr letztes Konzert gegeben. Trotzdem gehörte sie zu jenen Berühmtheiten, über die immer noch in der Presse berichtet und in Frauenzeitschriften geschrieben wurde. Man erkannte sie auf der Straße beim Einkaufen, bat sie um ein Autogramm. Sie war die Queen of Scala, so genannt wegen ihrer immensen Erfolge, die sie in den Opernsälen der Welt, vor allem in Mailand, gefeiert hatte. Eine hochgewachsene Frau, ihr Alter schwer zu schätzen; eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Szene. Zwischen fünfzig und siebzig, so lautete die einstimmige Meinung. Ihre einst dunkelbraunen Haare waren jetzt silbergrau und, anders als bei vielen Frauen im gleichen Alter, nicht gefärbt. Sie verliehen ihr etwas Majestätisches, das durch ihre hohe Stirn und die vorstehenden Wangenknochen verstärkt wurde. Doch das Auffälligste an ihr waren die Augen. Die Iris leuchteten blau, schimmerten je nach Lichtverhältnissen – oder Stimmung? – grün wie Kristalle.
Gregor war sie zum ersten Mal bei einem Auftritt in der Frankfurter Oper begegnet. So begeistert war er von ihr, dass er kurz entschlossen in der Pause hinter die Bühne gekommen war und sie nach dem Konzert auf einen Trunk eingeladen hatte. Sie wusste bis heute nicht, wie er es geschafft hatte, an den Sicherheitsleuten vorbeizukommen. Obwohl sie sich über die Art und Weise aufgeregt hatte, wie er zu ihr vorgeprescht war, hatte er sie beeindruckt. Zuletzt überzeugten sie seine Offenheit und ehrliche Art; sie hatte die Einladung angenommen.
Seit diesem Abend hatte ihr Leben neu angefangen.
Als er ins Restaurant hereinkam, bemerkte sie ihn sofort. Mit dem langen hellen Mantel, roten Bart und kahl geschorenen Schädel kam er ihr vor wie ein mittelalterlicher Ritter. Bei ihrer ersten Verabredung zum Abendessen hatte er sich sogar ein Langschwert umgeschnallt, sich unter den erstaunten Blicken der Gäste vor ihr hingekniet und es ihr überreicht. Wie Ritter Lancelot einst dem König Artus als Ausdruck seiner Treue. Es gab begeisterten Applaus. So war er eben; sie liebte ihn wie keinen ihrer zahlreichen Liebhaber vor ihm.
Gregor hängte den Mantel an die Garderobe; drückte ihr einen Kuss auf die Wange, die sie ihm mit geschlossenen Augen und einem Lächeln darbot, und setzte sich. »Hast du schon bestellt?«
»Heute ist Selbstbedienung. Nur die Getränke muss man bestellen. Ich habe mir ein Aperitif bringen lassen.«
Vor ihr stand ein Glas Sekt, gedanklich schnell korrigiert in Champagner; bei Lena die wahrscheinlichere Variante.
»Dasselbe«, sagte er zu der lautlos herbeigeschwebten Serviererin, zeigte auf das Glas. Spätmorgens trank er für gewöhnlich nie Alkohol. Ab und zu eine Ausnahme für Sekt. Erst recht für Champagner, dazu in Begleitung von Magdalena Solms.
Das Getränk wurde gebracht, sie prosteten sich zu.
Gregor hüllte sich eine Weile in Schweigen. Für Lena ein sicheres Anzeichen dafür, dass ihm Dringendes auf dem Herzen lag. Sie beugte sich konspirativ zu ihm vor, legte die Hand auf seine; fragte: »Reden wir jetzt gleich, oder holen wir uns vorher etwas zum Essen?«
Er lächelte und stand auf.
Nachdem sie fertig gegessen hatten, legte Lena ihre Serviette auf den Tisch. »Was kann ich für dich tun?«
»Ich brauche deine Hilfe.«
»Schieß los.«
Gregor zögerte. »Ist nicht so leicht. Weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll.«
Sie musterte ihn mit hochgezogenen Brauen. »Das ist ungewöhnlich für dich, du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen.«
Er schaute um sich. Keiner in Hörweite. Beugte sich zu ihr. »Ich muss an den Rechner des Leiters deiner Residenz.«
»An Wolfram Königs Computer? Und weshalb?«
Gregor sah die Verwandlung in ihren Augen. Vorher blau, wechselten sie die Farbe wie ein Chamäleon, das Gefahr wittert. Jetzt leuchteten sie mit grünem Glanz.
»Ich habe den Auftrag erhalten, gewisse … Umstände in der Seniorenresidenz zu untersuchen. Es geht um Verträge mit älteren Bewohnern.« Ihr Blick schoss einen Giftpfeil auf ihn ab. Schnell korrigierte er: »mit vermögenden Personen, die sich in die Seniorenresidenz eingekauft haben.«
»Leute wie mich.« Ihr Blick wich nicht von seinen Augen.
Er nippte am Champagnerglas. »Leute wie dich.«
»Von wem hast du diesen Auftrag bekommen? Von Jemandem, der nicht wusste, dass du ein Detektiv im Ruhestand bist?« Sie betonte Ruhestand.
Er erzählte ihr vom Gespräch mit dem Hochmeister des Deutschen Ordens.
»Hat er die Befürchtung, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht?«, fragte sie leicht verdutzt.
Gregor fasste ihre Hand. »Es ist erst mal eine Vermutung. Lass mich einen Blick auf deinen Vertrag werfen.« Er lächelte ihr zu, als wollte er ihr sagen: Glaube ruhig, dass ich spinne.
»Ich glaube, du spinnst mal wieder«, sagte sie, nachdem die Teller weggeräumt worden waren und sie sich beide einen Cappuccino bestellt hatten. »Habe ich Grund zur Annahme, dass sich der Herr wieder als rettender Kreuzritter aufführen will?«
»Ich denke darüber nach. Wer weiß, vielleicht landet eine fette Fliege in meinem Netz.«
»Wie damals in der Alten Oper?« Ihr grüner Blick bohrte sich in ihn. In einem verzweifelten Versuch, den Fauxpas wieder hinzubiegen, warf Gregor das Netz weg. »Sie war alles andere als fett und ich konnte sie nicht fangen.« Er spielte auf seinen Heiratsantrag an, den Lena abgelehnt hatte.
Es ist besser, wenn wir unsere Wege in getrennter Gemeinsamkeit beschreiten, wie sie es damals ausdrückte. Immerhin hatte sie sich in die benachbarte Seniorenresidenz eingekauft und dort eine Wohnung bezogen. So war sie in seiner Nähe, aber nicht in seinem Haus. Bisher hatte sich die Vorgehensweise für beide bestens bewährt.
»Lass uns gehen.«
Sie verließen das Käfers mit einem lächelnden Gruß an die Serviererin, die ebenso freundlich zurücklächelte, ein sattes Trinkgeld in der Tasche.
Draußen vor dem Lokal blieb Gregor stehen und betrachtete die Grünanlage, die sich vor ihm erstreckte. Englische Kurgäste tauften sie einst das Bowling Green, wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Rasenflächen, worauf dieses Ballspiel daheim gespielt wurde. An beiden Enden der Grünfläche standen die berühmten Kaskadenbrunnen.
Das Bowling Green wurde von zwei Kolonnadenbauwerken flankiert: Zur rechten Seite erstreckte sich das Wiesbadener Kasino bis an die Wilhelmstraße.
Von verdunkelten Fenstern vor unerwünschten Blicken geschützt, versuchte man im kleinen Spiel sein Glück an einarmigen Banditen und anderen Spielautomaten. Dagegen lockte das große Spiel im ansprechenden Ambiente des Kurhauses die Könner an, die Edelzocker, bei Roulette und Kartenspiel das Glück herauszufordern.
Gregors Blick wechselte zur gegenüberliegenden Seite. Die Theaterkolonnade unterschied sich von der des Kasinos durch die vorgelagerten Stufen, die sich über die ganze Länge des Gebäudes erstreckten.
Zwei ungleiche Spielhäuser. Im Linken wird für Geld vorgespielt, im Rechten Geld verspielt.
»Denkst du an deine Spielschulden?«, riss ihn Lena aus seinen Betrachtungen.
»Klar doch, immer!« Er legte den Arm um sie, drückte sie an sich. »Aber die sind Vergangenheit. Ich habe soeben mit meiner Traumfrau genüsslich zu Mittag gegessen. Besser als ein Sechser im Lotto.« Mit einem Wink zur Theaterkolonnade fügte er hinzu: »Vielleicht versuche ich eine späte Karriere als Schauspieler.«
»Oder als Sänger?« Sie lachte schallend. »Lass uns zu mir gehen.«
»Aber nur, wenn du mich mitnimmst in deinem gelben Cabrio.«
Er hielt die Hand auf.
»Und dich fahren lasse?« Sie reichte ihm die Autoschlüssel.
4 Ein Plan
Sonntagnachmittag, 2. März
Er fuhr den Saab in die Tiefgarage; stellte den Motor ab. In der Wohnung öffnete Lena die Terrassentür. »Komm, wir setzen uns draußen hin.« Sie schaltete den Infrarotstrahler an. »Mixt du uns etwas zu trinken? Ich hole inzwischen den Ordner mit den Unterlagen.«
Gregor nahm zwei hohe Gläser aus dem Schrank; bereitete einen milden Cocktail zu; brachte die Getränke zum Tisch, wo Lena sich hingesetzt hatte, den Ordner vor sich. Er zog ihn zu sich; öffnete ihn. »Prost!« Sie stießen an. »Hm!, das schmeckt nach Caipiriña, wie hast du das wieder hingezaubert?«
»Wenn du es hier draußen Anfang März sommerlich warm machst …« Er blätterte im Ordner; fand den Vertrag. Las ihn; sah zu ihr auf. »Verstehe ich das richtig? Du hast ein Wohnrecht auf Lebenszeit und musstest dafür eine Lebensversicherung abschließen? Die hast du an die Stiftung abgetreten. Sie verfügt nach deinem Tod über den Betrag? Sozusagen als Spende? Über die Höhe der Versicherungssumme sind hier keine Angaben gemacht, die Police ist nicht dabei. Hast du die irgendwo?«
»Nein, die habe ich ja abgetreten.«
»Hm … kennst du zufällig die Höhe?«
Sie versuchte, sich zu erinnern. »Drei Millionen, glaube ich. Hab mich nicht dafür interessiert, ich bekomme das Geld ja nicht.«
Gregor starrte sie an. »Du zahlst jeden Monat …«, er blätterte zurück, »… fünftausend Euro ein?«
Sie nickte. »Schien ein fairer Deal zu sein. Für das Geld kann ich mir eine solche Wohnung mit allem Komfort und den gebotenen Dienstleistungen anderweitig nicht leisten. Was damit nach meinem Tod passiert …«, sie fuhr mit der Hand durch die Luft, als verscheuchte sie eine Fliege, »… ist mir egal.«
Gregor runzelte die Stirn. »Hier ist die Rede von einer einmaligen Zahlung von zehntausend Euro – auf ein Konto bei einer anderen Bank –, womit du Aktionärin der Stiftung geworden bist.«
»Ja, mir wurde gesagt, dass sei so etwas wie eine Aufnahmegebühr.«
»Hast du wegen der verschiedenen Banken mal nachgefragt?«
»Nein, sollte ich?«
Gregor schwieg. Er hatte nach dem ersten Schluck sein Glas nicht angerührt. Jetzt nahm er einen kräftigen. Überlegte. Der Vertrag war ungewöhnlich, aber eine kriminelle Absicht konnte er auf Anhieb nicht erkennen. Nur die Summe von drei Millionen, die schien ihm sehr hoch. Aus der Sicht von Magdalena war alles nachvollziehbar, sie bekam eine komfortable Wohnung mit allem Schnickschnack, zahlte einen anständigen Preis. Und nach ihrem Tod …?
Trotzdem. »Irgendwas an dem Vertrag stimmt nicht, Lena. Was mir merkwürdig vorkommt, ist die Sache mit den verschiedenen Bankhäusern. Bei den Konten kann ich nachvollziehen, dass unterschiedliche Vorgänge aus buchhalterischen Gründen getrennt werden. Aber warum zwei Banken?«
Gregor las den Vertrag nochmals durch; hob die Brauen. »Ich habe hier etwas gefunden.« Er drehte den Ordner so, dass Lena den Text lesen konnte. »Da steht, dass die Konten auf deinen Namen ausgestellt worden sind.«
»Ist das ungewöhnlich?«
»Man würde erwarten, dass sie auf die Stiftung … hast du eigentlich Zugriff auf diese Konten?«
»Nur auf das, worauf die Dividenden eingehen, auf das andere nicht.«
»Aber du könntest, wenn du wolltest, auf das Konto einzahlen.«
»Gregor, ich habe doch mein eigenes; außerdem, wieso sollte ich mehr zahlen als den monatlichen Beitrag?«
»Was passiert mit den Konten nach deinem Tod? Darüber steht hier nichts.«
»Die werden dann wohl aufgelöst, oder?«
»Von wem?«
»Von jemand der Stiftung, nehme ich an; ich kann ja schlecht hingehen und sagen ›Hey Leute, ich sterbe jetzt, ich löse die Konten auf‹.« Gregor grinste. »Dir traue ich alles zu.« Er wurde wieder ernst. »Hast du der Stiftung eine Vollmacht erteilt?«
Sie nickte. »König hat meine Vollmacht. Ist daran etwas verdächtig?«
»König«, flüsterte er, als hätte er ihre Frage nicht gehört. Er starrte vor sich hin.
»Okay, ich fasse zusammen.« Er zählte die Punkte an den Fingern der linken Hand ab. »Erstens, die Lebensversicherung: Sie ist ungewöhnlich, erst recht in der Höhe, denn normalerweise schließen ältere Leute keine solche mehr ab. Zweitens, zwei Konten, auf verschiedenen Banken: Buchhalterisch betrachtet ergibt das wenig Sinn. Drittens, und am allerwichtigsten: Sie stehen auf deinem Namen.« Er strich sich über den Kopf. »Wenn man sich vorstellt, wofür diese Konten nach dem Tod des Inhabers … oder der Inhaberin … verwendet werden könnten …«
Er beugte sich zu ihr, als fürchtete er, dass jemand mithören würde. »Ich glaube, die Sache stinkt.«
Lena senkte den Kopf; betrachtete ihn von unter den Wimpern.
»Wonach?«
Gregor kannte diesen Ausdruck: neugierig, zugleich herausfordernd. »Nach Betrug.« Er lehnte sich zurück. »Es ist alles nur eine Vermutung, aber es erinnert mich an diesen Fall, von dem neulich im Fernsehen berichtet wurde. Es ging um Lebensversicherungen von alten Menschen, die ihnen von einem dubiösen Fonds für einen relativ niedrigen Preis abgekauft wurden. Als Nächstes bot dieser privaten Geldanlegern an zu investieren, mit der Aussicht auf satte Renditen. Die Fondsmanager gingen davon aus, dass die Alten innerhalb eines Zeitraumes von um die sieben Jahren sterben würden. So will es ja die Statistik. Doch sie lebten länger, für die Anleger ein Fiasko. Ein Geschäft mit dem Tod. Das hier riecht verdächtig nach einem ähnlichen Geschäft, nur viel dreister: Die Lebensversicherung wird an eine Stiftung abgetreten. Wenn die Person uralt wird …«
»… das ist nicht logisch«, unterbrach sie ihn. »Dann nutzt es nichts.«
»Nicht kurzfristig, da hast du recht.«
Sie wurde bleich. »Oh Gott, du meinst doch nicht, dass die …«
»Das ist etwas für Krimis im Fernsehen, würde schnell auffallen. Nein, die gehen raffinierter vor.«
Gregor stand auf. Er konnte besser nachdenken, wenn er dabei hin und her ging.
»Wie du gesagt hast, wäre das ein unrentables Geschäft, es sei denn, sie müssen Geld unter die Leute bringen, oder zutreffender: ›unter die Toten‹. Das lagert auf Konten der Verstorbenen, die sie an die Stiftung abgetreten haben …, voilà, schon kann man damit tun, was man will, steuerfrei, versteht sich.«
Hin … her.
»Aber wird ein Konto im Falle des Todes nicht gelöscht?«, warf Lena ein.
»So lange es Kontenbewegungen gibt, kontrolliert keine Bank, ob der Konteninhaber am Leben ist oder nicht. Konten werden selten automatisch gelöscht, und wenn, dann nach Jahren. Ist mir selbst einmal passiert. Ich hatte vergessen, ein Konto aufzuheben. Die Bank zog zwei Jahre lang die Sollzinsen und Kontogebühren ein, bis sie es aufgelöst haben.«
Er blieb am Tisch stehen, trank einen kräftigen Schluck. »Die setzen auf Kontinuität.«
Er setzte seine Denkschritte wieder fort.
Hin … her.
Lena öffnete den Mund. Bevor sie fragen konnte, was er damit meinte, fuhr er fort: »Ich sagte schon, die werkeln sehr raffiniert. Ein Geschäft mit Edel-Seniorenanlagen. Mit Menschen wie dir …, in der Blüte ihres Lebens«, fügte er schnell hinzu. »Senioren, die eine eigene Wohnung haben, auch solche, die schon älter sind und gepflegt werden. In deiner Wohnanlage gibt es dazu entsprechende Einrichtungen. Und regelmäßig sterben welche.«
Oft sah er die Leichenwagen vom Grundstück wegfahren; in solchen Momenten begriff er nicht, warum seine Freundin sich dort eingekauft hatte.
Hin … her.
»Okay, es sterben welche. Wie gehts weiter?« Lena hörte jetzt mit grün schimmernden Augen zu.
»Ich vermute Folgendes: Nach dem Tod werden die Versicherungssummen ausgezahlt, aber die Konten bleiben auf den Namen der Verstorbenen stehen. Die Vollmacht für die Verwendung des Geldes bleibt bei der Stiftung, in diesem Fall bei Wolfram König. Über diese Konten kann er beliebig große Summen schieben, das merkt keiner.«
»So weit habe ich das verstanden, aber warum tut er das? Was ist der Sinn und Zweck dieser Vorgehensweise? Kannst du mir das verraten?«
Hin … Gregor blieb stehen, sah sie an. »Ich erkenne nur einen Sinn und Zweck: Geldwäsche! In deiner Seniorenresidenz ist etwas nicht so, wie es sein sollte.«
»Aber es sind alles nur Vermutungen, du hast keinerlei Beweise.«
»Deshalb benötige ich einen Zugang zu Königs Computer … und dazu brauch ich deine Hilfe.« Er setzte sich.
Lena musterte ihn, lehnte sich zurück. »Wie willst du das anstellen?«
»Ich habe eine Idee. Dazu muss ich mich aber vorab in Königs Büro umschauen. Am besten an einem Tag, wo er nicht da ist. Zum Beispiel bei einem Fest, einer Feier. Die interessieren ihn nicht. Ein Fest, bei dem die Bewohner der Residenz Gäste einladen können. Da verläuft sich manch einer schon mal. Ich würde mich für längere Zeit auf die Toilette verdrücken …«
Ein feines Lächeln an ihren Mundwinkeln. »Wie willst du in sein Büro hineinkommen?«
»Du willst alles genau wissen, oder? Ich weiß noch nicht, wie ich vorgehe; habe ja Zeit, mir etwas einfallen zu lassen.«
Er trank sein Glas leer, stellte es zurück auf den Tisch. »Wie wollen wir ein Fest organisieren?«
Schweigen.
Dann Lena: »Ich könnte singen.«
5 Vorbereitungen
Drei Wochen später
In den kommenden Tagen führte Gregor verschiedene Telefonate; machte ein paar gezielte Einkäufe. Jetzt war Freitagnachmittag, Lenas Auftritt sollte am nächsten Tag stattfinden.
Ihr Vorschlag, einen musikalischen Nachmittag zu veranstalten, war bei den Bewohnern und dem Pflegepersonal in der Seniorenresidenz auf große Begeisterung gestoßen. Lena hatte einen befreundeten Musiker gewonnen, sie am Klavier zu begleiten. Mit dem Versprechen eines exklusiven Abendessens zu zweit in einem Restaurant seiner Wahl. Etwas, wofür sich Gregor nur bedingt begeisterte, bis Lena ihm erzählte, dass es sich um einen jungen Absolventen der Frankfurter Musikhochschule handelte. Dass er dazu ein flammender Verehrer von ihr war, hatte sie ihm verschwiegen.
Gregor studierte die Broschüre der Seniorenresidenz, die er neben dem Laptop ausgebreitet hatte. Darin ein Grundriss: Königs Büro lag im Obergeschoss, am Ende eines Korridors zur Straße hin. Es bestand aus zwei Räumen: vorne die Besprechung, hinten das Arbeitszimmer. Daneben lag das Sekretariat. Lena hatte ihm erzählt, wie das Büro eingerichtet war. Auf ein Blatt Papier zeichnete er die Büroräume im größeren Maßstab nach. Ihn interessierten vor allem der Schreibtisch und das Bücherregal. Er faltete die Zeichnung zusammen. Details würde er vor Ort einzeichnen.
Am Samstagmorgen rief er bei Lena an. Nach drei Klingeltönen hob sie ab. »Guten Morgen, …«. Weiter kam er nicht.
»Gregor, ich bin fürchterlich im Stress, kannst du in einer halben Stunde nochmals anrufen?« Klick.
Sie hat aufgelegt! Gregor starrte zum Hörer. Lächelte. Ein Déja-vu-Erlebnis, das kannte er aus der Zeit, als sie noch aktiv gesungen hatte. Kurz vor einem Konzert gab es bei ihr immer puren Stress.
Einiges ändert sich nie. Er legte den Hörer auf.
Nach einer Stunde klingelte es. »Tut mir leid, Gregor, aber hier ist auf einmal solch eine Hektik, ich war gerade dabei, ein paar Leute vom Personal einzuweisen. Bei mir hört das Telefon nicht mehr auf zu klingeln, es hat sich herumgesprochen, dass ich ein Konzert gebe. Jetzt rufen alte Bekannten an. Der Wiesbadener Kurier hat nachgefragt, ob ich ein Comeback plane.« Sie schien außer Atem. »Was wolltest du mir sagen?«
»Ich wollte mich mit dir verabreden.«
»Oh, klar. Das Konzert findet im Speisesaal statt. Es beginnt nachmittags um vier. Ich werde etwa eine Stunde vorher da sein. Willst du mit mir kommen, oder lieber auf eigene Faust?«
Gregor überlegte. »Zu früh möchte ich dort nicht herum stehen. Besser, ich komme allein. Wie lange wird dein Auftritt dauern?«
»Etwa eine Stunde, denke ich. Reicht dir das, für was du vorhast?«
»Damit hab ich sogar genügend Zeit, dir zuzuhören. War von Anfang an meine Absicht, dich dazu zu bringen, endlich mal wieder zu singen.« Er hatte sich dabei ertappt, dass er diesen Tag herbeisehnte.
»Du Charmeur«, wies sie ihn lächelnd zurecht, »das kannst du hinterher gut sagen.«
»Im Ernst, Lena, es ist lange her, seit ich dich zum letzten Mal hab singen hören. Obwohl der Anlass nicht so erfreulich ist, freue ich mich darauf.«
Schweigen.
»Lena?«
»Ich höre dich, Gregor, ich denke nur … ob das Ganze so eine gute Idee ist. Ich meine nicht das Singen, du verstehst schon.«
»Ich will mich doch nur ein wenig umschauen, dauert nicht lange. Falls mich dort jemand erwischt, wo ein normaler Sterbliche sonst nicht sein sollte, bin ich auf der Suche nach einer Toilette.«
Lena seufzte. »Bis heute Mittag, Gregor. Bitte, sei vorsichtig.« Damit beendete sie das Gespräch.
6 Lenas Konzert
Samstag, 22. März, am Nachmittag
Um Viertel vor vier betrat Chris Lucas das Foyer der Seniorenresidenz, wo ihn eine freundliche junge Dame mit einem Glas Sekt empfing. Er ging in den Speisesaal, der mit einer kleinen Bühne versehen war, einschließlich Klavier. Vor der Bühne waren so viele Stuhlreihen aufgestellt worden, dass sie den Saal komplett ausfüllten.
Lenas Auftritt hat sich herumgesprochen!
Die meisten Plätze waren belegt. Einige Stühle in der ersten Reihe waren für spezielle Gäste reserviert, zu denen Chris gehörte. Er schaute sich um. Etwas abseits unterhielt sich Lena mit ein paar Personen. Als sie ihn bemerkte, winkte sie ihm zu; dann wanderte ihr Blick zum Eingang. Chris drehte sich um. Gregor kam herein.
Gregor hängte den Mantel in der Garderobe auf. In diesem Augenblick kam ein hoch gewachsener Mann die Treppe herunter. Eine schwere Hornbrille und graues Haar gaben ihm ein älteres Aussehen, als die Anfang fünfzig, die er in Wirklichkeit war. Er trug einen dunkelgrauen, scharf geschnittenen Anzug, dazu ein schwarzes Hemd mit maisfarbener Krawatte. Stahlblaue Augen musterten Gregor, die Mundwinkel verzogen zu einem dünnen Lächeln. Er blieb vor ihm stehen, ohne ihm die Hand zu reichen.
»Hallo Gregor, dass man dich hier mal sieht.« Er drehte den Kopf in Richtung Magdalena Solms. »Nach dem Anlass brauche ich wohl nicht zu fragen?«
Lena sah zu ihnen herüber, hob die Brauen, setzte ihr Gespräch fort. »Wie gehts dir, Wolfram? Nette Krawatte.« Er wollte nicht anmerken lassen, dass ihn Königs Wohlbefinden nicht im Geringsten interessierte. Der Versuch misslang.
»Ich glaub nicht, dass wir uns mit Floskeln aufhalten sollten; aber danke der Nachfrage.« Wolfram König griff nach seinem Mantel. »Wünsch dir einen vergnüglichen Abend.«
Es klang nicht überzeugend.
»Ach, du bleibst nicht?« Gregor konnte seine Freude kaum unterdrücken.
»Steh nicht so auf klassische Musik; erst recht nicht auf Gesang.« König nickte, verließ das Foyer.
Es hatte Gregor auf der Zunge gelegen, zu fragen, wie lange er wegbleiben würde.
Keine gute Idee.
Wie der Zufall es wollte, hatte ihm die Begegnung in die Karten gespielt. Die beste Gelegenheit für seine Aktion war jetzt. Er schaute zu Lena hinüber. Als sie seinem Blick erwiderte, hob er kurz den Daumen; verschwand im Flur hinter der Garderobe.
Chris sah den Blick, den Gregor nach Königs Verschwinden mit seiner Freundin wechselte; dass er kurz den Daumen hob, bevor er verschwand. Ihm kam dieses Verhalten merkwürdig vor.
Was will er im hinteren Trakt, wo die Büros liegen? Das Konzert kann jeden Moment anfangen!
Er folgte ihm. Das Publikum verstummte. Jemand hielt eine Einführungsrede. Chris blieb stehen, unschlüssig. Applaus. Das Klavier setzte ein, Lena fing an zu singen. Er hörte kurz zu; stieg die Treppe hoch. Der Gang, vier Fenster links, vier Türen rechts, die ersten zwei zu den Toiletten. Er öffnete die mit »Herren«, warf einen Blick hinein, horchte. Sie schien leer zu sein.
Er bekam ein mulmiges Gefühl, schritt weiter den Flur entlang, öffnete die beiden letzten Türen, schaute hinein. Kein Gregor.
Bleibt nur die Tür am Ende des Flurs, zum Büro des Heimleiters König.
Er fasste den Türgriff, hielt inne. Im unteren Türrahmen in Kniehöhe: zwei kleine Öffnungen, eine auf jeder Seite.
Lichtschranke!
Von der wusste er nichts. König musste sie nach Fertigstellung der Anlage eingebaut haben. Wozu benötigte der Leiter der Seniorenresidenz eine Lichtschranke? Barg sein Büro Geheimnisse, die mit dem Betrieb nichts zu tun hatten?
Hatte Gregor das Büro betreten? Wusste er von der Lichtschranke?
Ich muss ihn warnen!
Von unten klangen die ersten Klaviertöne zu ihm empor. Lena fing an zu singen. Schumann. Gregor verharrte einen Moment vor der Tür, lauschte der Musik. Er kannte das Stück: Rätsel, Opus 25, Nummer 16. Passend. Kurz überlegte er, den Plan aufzugeben, nach unten zu gehen, sich hinzusetzen, die Musik zu genießen.
Er wischte den Gedanken beiseite. Aus der Tasche zog er den Schlüssel, den ein alter Bekannte, der einen Schlüsseldienst hatte und keine Fragen stellte, angefertigt hatte. Zuvor hatte er am letzten Freitag beim Schach mit Chris von dessen Generalschlüssel während einer Toilettenpause einen Wachsabdruck erstellt. Später den Schlüssel heimlich an Lenas Wohnungstür getestet.
Er steckte ihn ins Schloss, stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als die Tür aufging. Betrat das Zimmer, schloss die Tür.
In Königs Mercedes klingelte kurz darauf das Telefon.
Chris öffnete die Tür, lugte hinein. Die Tür zum hinteren Büro stand offen.
Er stieg über die Lichtschranke; eilte ins hintere Zimmer.
»Gregor! Was tust du hier?«
Der Angesprochene fuhr herum. »Erkläre ich dir später. Okay?«
»Nix okay. Du bist vorhin durch eine Lichtschranke gegangen. Wundere dich nicht, wenn bald einer kommt. Egal, was du hier vorhast, beeile dich, dir bleibt nicht viel Zeit.«
Er drehte sich um, verließ den Raum. Zurück in den Saal setzte er sich auf einen der zwei freien Plätze in der vordersten Reihe und lauschte der Musik.
Eine Lichtschranke! Warum habe ich die nicht bemerkt?
Hastig betrachtete er den Schreibtisch: Flachbildschirm. Tastatur mit Maus. Die Anschlusskabel verschwanden durch eine Öffnung in der Tischplatte. Gregor schaute unter den Tisch. Der Rechner stand auf einer Konsole, montiert an der Seite des Unterschranks.
Nicht schwer, an die Anschlüsse auf der Rückseite zu kommen.
Er machte sich an die Arbeit. Hatte Glück: Im Regal neben Königs Schreibtisch stand eine Reihe Leitz-Ordner, angefangen mit der Aufschrift Buchhaltung 2014.
Er schoss Bilder vom Regal und Schreibtisch.
Fünf Minuten, dann ging er zurück in den vorderen Raum. Bevor er die Tür öffnete, warf er einen Blick aus dem Fenster.
Zu spät! Königs schwarzer Mercedes hielt auf dem Parkplatz; König stieg aus, lief mit eiligen Schritten zur Eingangstür.
Gregor überlegte. Niemals würde er es schaffen, von König ungesehen die Treppe hinunter zu steigen, geschweige denn das Foyer zu erreichen!
Die Toiletten! Er zwang sich, nicht loszurennen, sondern die Tür leise zu öffnen. In Gedanken stellte er sich König vor, der durch das Foyer eilte, in den Flur einbog, die Treppe heraufkam … Der Gang war leer. Aus dem Erdgeschoss klang Schumanns viel Glück zur Reise, Schwalben. Solches Glück konnte er jetzt gebrauchen!
Er stieg über die Lichtschranke, schloss die Tür, eilte über den Gang, öffnete leise die Tür zur Herrentoilette und schlich hinein. Schwere Schritte kamen die Treppe hoch; stampften vorbei; eine Tür wurde geöffnet, dann Ruhe. Sofort verließ er die Toilette, hastete hinunter; verlangsamte das Tempo; betrat den Saal. Er wollte sich in der hintersten Reihe hinsetzen, sah den Sitzplatz in der vordersten Reihe, für ihn reserviert. Er schlich nach vorne, setzte sich neben Chris, der ihn kurz ansah. »Danke«, flüsterte er ihm ins Ohr. Chris nickte.
Lena sang: Gekämpft hat meine Barke … Es dauerte eine Weile, bis sich Gregors Puls beruhigte und er in der Lage war, die Musik in vollen Zügen zu genießen. Dann gab er sich Schumann und der Stimme seiner Freundin hin.
Im Foyer stand Wolfram König. Er suchte die Reihen der Gäste nach Gregor Hanig ab. Als er ihn in der vordersten Reihe sitzen sah, holte er tief Luft. Er blieb einen Moment stehen; drehte sich um, stieg die Treppe wieder hoch; verschwand im Büro.
7 Der Neffe
Samstag, 22. März, am späten Nachmittag
Nach einer Stunde Gesang und fünfzehn Minuten Zugabe beendete Magdalena Solms den Auftritt; erntete einen tosenden Applaus. Eine Frau überreichte ihr einen Blumenstrauß. Kameras blitzten.
Gregor hätte am liebsten sofort ihre Hand gefasst, sie aus dem Saal geschleppt. Doch es dauerte eine Weile, bis die Gäste gratuliert hatten und einen nach dem anderen abzogen.
In der Garderobe zog er den Mantel an; sah aus dem Augenwinkel, dass jemand hinter ihm stand.
»Hats dir gefallen?« Er drehte sich um. Wieder dieses hämische Grinsen.
»Mir schon, und dir? Hattest du mir nicht gesagt, du musstest fort?«, fragte er mit unschuldiger Miene.
»Ja, hatte ich, aber nicht, wie lange.« Er musterte Gregor mit kaltem Blick.
»Gut, dann hast du ja doch noch etwas für deine kulturelle Bildung getan.« Gregor nahm Lenas Mantel und ließ König in der Garderobe stehen. Er drängte sich zu der Sängerin vor, die zusammen mit Chris und dem Pianisten in einem Pulk von Verehrern im Foyer stand.
»Wenn Sie uns jetzt entschuldigen wollen, das Taxi wartet.« Er legte Lena den Mantel um, fasste sie am Arm; führte sie zum Ausgang.
»Matthias, Chris, ihr kommt mit uns«, rief Lena.
Draußen hatte es angefangen zu regnen.
Chris verabschiedete sich, stieg ins Auto.
Im Rückspiegel stapften sie zu dritt durch den Regen.
Zu Lenas Wohnung. Anders als die übrigen Gäste wunderte er sich nicht, wo das Taxi stand, das angeblich auf sie wartete.
Nach einem Glas Champagner verabschiedete sich Matthias der Pianist. Nicht ohne Lena nochmals gelobt zu haben. Mit dem Versprechen, beim nächsten Auftritt wieder für sie bereitzustehen.
Gregor plumpste auf das Zweiersofa, faltete die Hände im Nacken, streckte die Ellbogen nach hinten. Er lächelte Lena zu. »Schön hast du gesungen.«