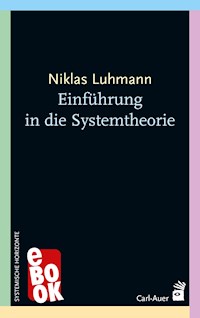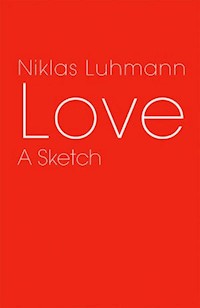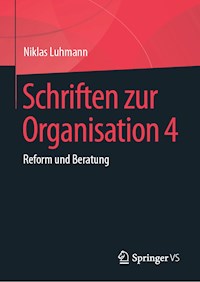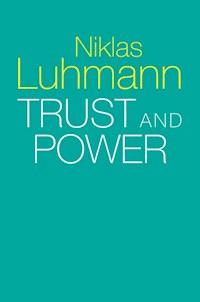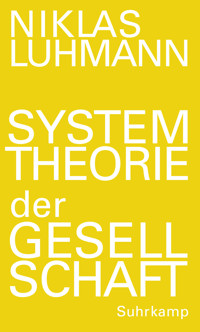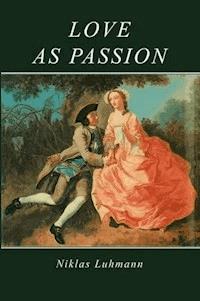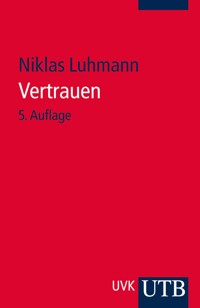
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vertrauen im weitesten Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens. Von Vertrauen spricht man im täglichen Leben meist in moralischem Sinne. Dem gegenüber analysiert Luhmann Funktion, Bedingungen und Taktiken des Vertrauens sozialwissenschaftlich. Vor allem wird dabei angestrebt, den Bereich der rationalen Handlungen nach Möglichkeit zu erweitern. Das kann erreicht werden, wenn man in der Lage ist, durch persönliches Vertrauen oder Vertrauen in das Funktionieren gesellschaftlicher Systeme sich auf höhere Risiken einzulassen. Niklas Luhmann unternimmt es also in diesem schon klassisch gewordenen Buch, den in der Alltagssprache und der traditionellen ethischen Vorstellungswelt vielfach besetzten Begriff des Vertrauens im Rahmen theoretischer Soziologie zu erörtern und das in einer so anschaulichen und anregenden Weise, dass das Buch seit langem breite Beachtung gefunden hat – weit über den Kreis der Fachsoziologen hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas. wuv · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
A. Francke Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft · Baden-Baden
Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK / Lucius · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Bristol
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Niklas Luhmann
Vertrauen
Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität
5. Auflage
UVK Verlagsgesellschaft mbH · Konstanz mit UVK/Lucius · München
Die Originalausgabe erschien 1968 im F. Enke Verlag, Stuttgart
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urhberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Dieses eBook ist zitierfähig. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenangaben der Druckausgabe des Titels in den Text integriert wurden. Sie finden diese in eckigen Klammern dort, wo die jeweilige Druckseite beginnt. Die Position kann in Einzelfällen inmitten eines Wortes liegen, wenn der Seitenumbruch in der gedruckten Ausgabe ebenfalls genau an dieser Stelle liegt. Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler.
4. Auflage: © Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2000
5. Auflage: © UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2014
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart Satz und Layout: Sibylle Egger, Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft mbH Schützenstr. 24 · D-78462 Konstanz Tel.: 07531-9053-0 · Fax 07531-9053-98www.uvk.de
UTB-Band Nr. 2185 ISBN(eBook) 978-3-8463-4004-2
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Vorwort
Ob man der Soziologie raten sollte, Worte des täglichen Sprachgebrauchs und Begriffe der traditionellen ethischen Vorstellungswelt zu verwenden, ist ernsthafter Überlegung wert. Bei einer solchen Umrüstung moralischer in soziologische Begriffe scheinen zunächst Vorteile und Nachteile sich die Waage zu halten; sie lassen sich aber weitgehend trennen. Bleibt man auf der Ebene der kritischen Zersetzung und überraschender Verfremdung, der Ideologieentlarvung durch kausale Erklärung oder des Nachweises heimlicher Nebenzwecke stehen, überwiegen die Nachteile. Die Identität des benutzten Wortes wird dann zur Diskreditierung seines hergebrachten Bedeutungshorizontes mißbraucht. Das ist in der geistigen Situation der Gegenwart ein leichtes Geschäft – und vielleicht zu leicht, als daß die Soziologie daran lernen und an dieser Aufgabe eine eigene Theorie heranbilden könnte. Gelänge es ihr dagegen, diese Ebene zu verlassen und ihre geistige Position positiv, das heißt durch eine eigene Theorie, zu festigen, von der aus sie dann ein Gespräch mit dem Alltagsverständnis der sozialen Welt und dessen Ausformung durch die Ethik zu führen vermöchte, könnte es sein, daß die Vorteile eines gewissen gemeinsamen Vokabulars die Nachteile überbieten. Die folgenden Überlegungen zum Begriff des Vertrauens möchten in diesem Sinne zur soziologischen Theoriebildung beitragen.
Das Manuskript habe ich an der Sozialforschungsstelle der Universität Münster in Dortmund ausarbeiten können. Das hat mir mit besonderer Schärfe vor Augen geführt, wie weit das, was heute über Vertrauen gesagt werden kann, von methodisch gesicherter Verifikation noch entfernt ist. Eingehende Diskussionen mit den Herren Dr. H.-J. Knebel und Dr. F. X. Kaufmann haben mir viele Anregungen gegeben und mich in der Auffassung bestärkt, daß diese Kluft zwischen Theorie und Empirie unvermeidlich, aber nicht unüberbrückbar bleiben wird.
Dortmund, im Winter 1967/68
Niklas Luhmann
Inhalt
Vorwort
1. Das Bezugsproblem: Soziale Komplexität
2. Bestände und Ereignisse
3. Vertrautheit und Vertrauen
4. Vertrauen als Reduktion von Komplexität
5. Überzogene Information und Sanktionsmöglichkeiten
6. Persönliches Vertrauen
7. Medien der Kommunikation und Systemvertrauen
8. Taktische Konzeption: Vertrauen als Chance und als Fessel
9. Vertrauen in Vertrauen
10. Vertrauen und Mißtrauen
11. Vertrauensbereitschaft
12. Rationalität von Vertrauen und Mißtrauen
Literatur
Sachregister
[1]1. Das Bezugsproblem: Soziale Komplexität
Vertrauen im weitesten Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens. Der Mensch hat zwar in vielen Situationen die Wahl, ob er in bestimmten Hinsichten Vertrauen schenken will oder nicht. Ohne jegliches Vertrauen aber könnte er morgens sein Bett nicht verlassen. Unbestimmte Angst, lähmendes Entsetzen befielen ihn. Nicht einmal ein bestimmtes Mißtrauen könnte er formulieren und zur Grundlage defensiver Vorkehrungen machen; denn das würde voraussetzen, daß er in anderen Hinsichten vertraut. Alles wäre möglich. Solch eine unvermittelte Konfrontierung mit der äußersten Komplexität der Welt hält kein Mensch aus.
Diesen Ausgangspunkt kann man als unbezweifelbares Faktum als „Natur“ der Welt bzw. des Menschen feststellen und würde damit etwas Wahres aussagen1. Alltäglich vertraut man in dieser Selbstverständlichkeit. Zutrauen in jenem fundierenden Sinne ist für das tägliche Leben Komponente seines Horizontes, Wesensmerkmal der Welt, aber nicht intendiertes (und damit variierbares) Erlebnisthema.
Man kann die Notwendigkeit des Vertrauens auch als wahren und gewissen Grund für die Herleitung von Regeln richtigen Verhaltens ansehen. Sind Chaos und lähmende Angst die einzige Alternative zum Vertrauen, so läßt sich daraus folgern, der Mensch solle, seinem Wesen entsprechend, Vertrauen schenken, wenn auch nicht blindlings und nicht in jeder Hinsicht2. Man gelangt auf diese Weise zu ethischen oder naturrechtlichen Maximen – zu Prinzipien mit eingebauter Zulassung des Gegenteils, deren Brauchbarkeit so umstritten ist.
[2]Eine dritte Möglichkeit ist, die Angst einer Existenz ohne Vertrauen gleichsam spielerisch zu durchdenken und dichterisch auszumalen. Man kann auf diese Weise die Alltagswelt transzendieren und sich von ihrer Auslegung durch die philosophische Tradition distanzieren. Der Blick auf jene Grenzsituation hat Psychologen und Ärzte3, ja sogar bedeutende Denker der Gegenwart fasziniert. In der Tat läßt sich aus schwindelerregenden Vorstellungen eine Art instruktiver Genuß ziehen. Doch bleibt die Instruktion durch den Schwindel getrübt.
Die funktionale Forschung in Psychologie und Sozialwissenschaften findet sich in mancher Hinsicht in der Nähe solcher existenzphilosophischen Bemühungen – vor allem durch ihre Ablehnung des Substanzprinzips. Deshalb muß sie um so größere Sorgfalt darauf verwenden, sich von ihnen abzusetzen4. Ihren eigenen Charakter gewinnen funktionale Analysen durch die Art ihrer Forschungsperspektive und deren Denkvoraussetzungen. Diese Eigenart ist umstritten5 und muß daher in ihren Grundzügen aufgewiesen werden6, bevor wir nach der Funktion des Vertrauens fragen können.
Funktionale Analysen knüpfen nicht an sichere Gründe, bewährtes Wissen, vorliegende Gegebenheiten an, um daraus sekundäres Wissen zu gewinnen, sondern sie beziehen sich letztlich auf Probleme und suchen Lösungen für diese Probleme zu ermitteln. Sie gehen also weder deduktiv noch induktiv vor, sondern heuristisch in einem ganz speziellen Sinne. Als Hebel der Problematisierung dient ihnen die Frage nach der Erhaltung des Bestandes von Handlungssystemen – man könnte auch abstrakter formulieren: [3]die Frage nach der Identität in der wirklichen Welt. Bestand ebenso wie Identität werden dabei nicht mehr als Wesenskern oder als Invarianz begriffen, sondern als Beziehung zwischen variablen Größen, zwischen System und Umwelt. Sowohl Probleme als auch Problemlösungen erhalten in dieser Forschungsperspektive ihren besonderen Sinn nicht durch einen vorausgesetzten invarianten Wesenskern, sondern durch ihre besondere Stellung in einem Gefüge anderer Möglichkeiten; ihr „Wesen“ definiert sich durch die Bedingungen ihrer Ersetzbarkeit. Das Forschungsschema der funktionalen Analyse ist daher, von der Methode her gesehen, für alle Möglichkeiten offen. Ihr Potential für Komplexität scheint unbegrenzt zu sein, und manche Einzelzüge deuten darauf hin, daß in dieser Erweiterung der Kapazität für Komplexität gegenüber dem alltäglichen und dem traditionellen Weltverständnis der zusammenhaltende Grundgedanke aller Aspekte der funktionalen Methode zu finden ist7.
Komplexität ist aber nicht nur das heimliche Motiv, die verbindende Aspiration hinter allen Orientierungsbegriffen der Methode, sie ist zugleich das letzterreichbare sachliche Bezugsproblem der funktionalen Forschung. Denn die Welt als Ganzes, der Universalhorizont allen menschlichen Erlebens8, ist nur unter dem [4]Gesichtspunkt ihrer äußersten Komplexität ein mögliches Problem. Sie ist kein System, weil sie keine Grenzen hat. Sie ist ohne Umwelt, daher nicht bedrohbar. Selbst radikale Umwandlungen ihrer Energieform sind nur als Geschehen in der Welt vorstellbar. Einzig in ihrer Relation zum Identischen-in-der-Welt gibt die Welt als solche ein Problem auf, und zwar durch ihre raum-zeitlich sich entfaltende Komplexität, durch die unübersehbare Fülle ihrer Wirklichkeiten und ihrer Möglichkeiten, die eine sichere Einstellung des einzelnen auf die Welt ausschließt. Unfaßbare Komplexität ist die Innenansicht der Welt, der Problemaspekt, den sie Systemen darbietet, die sich in der Welt erhalten wollen.
Ein zweiter Vorzug des Bezugsproblems der Komplexität ist, daß es dank seiner Abstraktheit und Welthaftigkeit den Unterschied von psychischen Systemen und sozialen Systemen übergreift und damit auch den Unterschied psychologischer und soziologischer Theorien. Wir wissen aus Lebenserfahrung ebenso wie durch wissenschaftliche Forschung, daß die Bereitschaft, Vertrauen zu erweisen, abhängt von psychischen Systemstrukturen, zum Beispiel von solchen, die mit der F-Skala gemessen werden9. Ebenso sicher ist, daß eine psychologische Erklärung allein nicht ausreicht. Denn Vertrauen wird, psychologisch gesehen, aus völlig verschiedenen Gründen erwiesen bzw. verweigert10; und Vertrauen ist in jedem Falle eine soziale Beziehung, die eigenen Gesetzlichkeiten unterliegt. Vertrauen bildet sich in einem Interaktionsfeld, das sowohl durch psychische als auch durch soziale Systembildungen [5]beeinflußt wird und keiner von ihnen exklusiv zugeordnet werden kann. Deshalb müssen wir in eine allgemeinere Theoriesprache ausweichen, die die Begriffe System, Umwelt, Funktion und Komplexität so abstrakt verwendet, daß sie sowohl psychologisch als auch soziologisch interpretierbar sind. Einen ähnlichen Ausweg sucht Talcott Parsons, wenn auch in Richtung auf eine andersartige, stärker strukturell orientierte Theorie eines allgemeinen „Handlungssystems“11.
Der Begriff Komplexität muß deshalb sehr abstrakt definiert werden. Das kann geschehen im Hinblick auf eine Differenz von System und Umwelt schlechthin und im Hinblick auf das Aktualisierungspotential von Systemen. Er bezeichnet die Zahl der Möglichkeiten, die durch Systembildung ermöglicht werden12. Er impliziert, daß Bedingungen (und somit Grenzen) der Möglichkeit angebbar sind, daß also Welt konstituiert ist, und zugleich, daß die Welt mehr Möglichkeiten zuläßt, als Wirklichkeit werden können, und in diesem Sinne „offen“ strukturiert ist. Unter einem Gesichtswinkel läßt sich diese Beziehung von Welt und System als Überforderung sehen und als Bestandsgefährdung problematisieren. Das ist die Betrachtungsweise der funktionalistischen Systemtheorie. In entgegengesetzter Perspektive erscheint dasselbe Verhältnis als Aufbau einer „höheren“ Ordnung von geringerer Komplexität durch Systembildung in der Welt und läßt sich als Selektionsleistung problematisieren. Das ist die Betrachtungsweise der kybernetischen Systemtheorie.
Für jede Art realer Systeme in der Welt, und seien es physische oder biologische Einheiten, Steine, Pflanzen oder Tiere, ist die Welt übermäßig komplex: Sie enthält mehr Möglichkeiten als die, auf die das System sich erhaltend reagieren kann. Ein System stellt sich auf eine selektiv konstituierte „Umwelt“ ein und zerbricht an etwaigen Diskrepanzen zwischen Umwelt und Welt. Dem Menschen allein wird jedoch die Komplexität der Welt selbst und damit [6]auch die Selektivität seiner Umwelt bewußt und dadurch Bezugsproblem seiner Selbsterhaltung. Er kann Welt, kann bloße Möglichkeiten, kann sein Nichtwissen thematisch erfassen und sich selbst erkennen als jemanden, der entscheiden muß. Beides, Weltentwurf und eigene Identität, wird ihm zum Bestandteil seiner eigenen Systemstruktur und zur Verhaltensgrundlage dadurch, daß er andere Menschen erlebt, die jeweils aktuell erleben, was für ihn nur Möglichkeit ist, ihm also Welt vermitteln, und die zugleich ihn als Objekt identifizieren, so daß er ihre Sichtweite übernehmen und sich selbst identifizieren kann.
Dies Offenhalten der Welt und die Identifikation von Sinn und Selbstsein in der Welt sind also nur möglich mit Hilfe einer ganz neuartigen Dimension der Komplexität: der erlebten (wahrgenommenen) und verstandenen subjektiven Ichhaftigkeit des anderen Menschen. Der andere Mensch hat originären Zugang zur Welt, könnte alles anders erleben als ich und kann mich daher radikal verunsichern. Über die Fülle sachlich verschiedenartiger Gegenstände und über die Potenzierung dieser Vielfalt durch ihren zeitlichen Wechsel hinaus wird die Komplexität der Welt durch die Sozialdimension, die den anderen Menschen nicht nur als Ding, sondern als anderes Ich ins Bewußtsein bringt, nochmals erweitert. Deshalb werden zugleich mit dieser zusätzlichen Komplizierung neuartige Mechanismen der Reduktion von Komplexität erforderlich – allen voran natürlich die Sprache und das reflexible Selbstbewußtsein als Mechanismen der Generalisierung und der Selektivität.
Eine überzeugende philosophische Erfassung dieses Tatbestandes des alter ego innerhalb der immer schon intersubjektiv konstituierten (und anders nicht vorstellbaren) Welt ist bisher nicht gelungen – auch im Rahmen der sich sehr grundsätzlich darum bemühenden transzendentalen Phänomenologie Husserls nicht13. [7]Die positiven Wissenschaften gehen auf verschiedene Art und Weise von der prinzipiellen Unberechenbarkeit anderer Menschen aus (sofern sie sie nicht einfach ignorieren) und sehen darin ein Problem, das die Funktionen bestimmter Ordnungsleistungen erklärt. Der Versuch von Thomas Hobbes, die Notwendigkeit absoluter politischer Herrschaft zu begründen, hat hierin seine Wurzel, wenngleich er dem Komplexitätsproblem als Sicherheitsproblem eine zu enge Fassung gibt und deshalb absolute Herrschaft als Lösung ohne Alternativen zu Gesicht bekommt. Die von Husserl konzipierte, von Alfred Schütz ausgearbeitete Theorie der intersubjektiv übereinstimmenden Typisierung der Erlebnismöglichkeiten hat diesen Hintergrund einer unberechenbaren Komplexität, die in der Gegenwärtigkeit eines alter ego in der Welt an sich angelegt ist und auf gemeinsame Typen reduziert werden muß. Parsons’ Theorie des sozialen Systems baut ebenfalls auf jenem Grundgedanken auf, und zwar in Form der These von der zweiseitigen Offenheit, der „double contingency“, aller Interaktionen, die eine Normbildung notwendig macht, soll die Komplementarität der Rollenerwartungen sichergestellt werden14. Die neuere wirtschaftswissenschaftliche Organisationstheorie sucht ihn zu berücksichtigen und geht damit über die utilitaristischen Bemühungen um eine Kombination rein individueller Nutzenfunktionen hinaus15. All diese Gedanken können wir in eine einzige [8]Formel zusammenpressen: Auf der Grundlage sozial erweiterter Komplexität kann und muß der Mensch wirksamere Formen der Reduktion von Komplexität entwickeln.
Das ist nicht so zu verstehen, als ob historisch erst das eine und dann das andere aufgetreten wäre, als ob das eine Ursache oder Motiv des anderen sei16. Kausal gesehen ist nur beides zusammen möglich, sich wechselseitig bedingend und bewirkend. Die funktionale Zerlegung dieses einheitlichen Geschehens in einen Problemaspekt (Erweiterung der Komplexität) und einen Lösungsaspekt (Reduktion der Komplexität) dient lediglich als Schema des Vergleichs mehrerer Lösungsmöglichkeiten. Letztlich gehören Erweiterung und Reduktion zusammen als komplementäre Aspekte der Struktur des menschlichen Verhaltens zur Welt. Man kann, mit einer leichten Umstellung der Begriffe, auch sagen, daß die Sozialdimension des menschlichen Erlebens mit ihren beiden Aspekten zusätzlicher Komplexität und neuer Möglichkeiten der Absorption von Komplexität das Komplexitätspotential und damit die Welt des Menschen erweitert. Durch die Existenz eines alter ego wird die Umwelt des Menschen zur Welt der Menschheit17.
Diesen Ausgangspunkt auch nur in einige seiner wichtigsten Konsequenzen hinein zu verfolgen, verbietet sich im Rahmen dieser Studie. Er definiert jedoch das Bezugsproblem, im Hinblick auf welches Vertrauen funktional analysiert und mit anderen, funktional äquivalenten sozialen Mechanismen verglichen werden kann. Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns, steigt die Komplexität des sozialen Systems, also die Zahl der Möglichkeiten, die es mit seiner Struktur vereinbaren[9] kann, weil im Vertrauen eine wirksamere Form der Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht. Auf dieser Grundlage soll eine Analyse des Vertrauens im folgenden versucht werden. Ein Vergleich würde entsprechende Vorarbeiten über andere Mechanismen, etwa Recht und Organisation, voraussetzen und kann daher nicht in einer einzelnen Monographie geleistet werden. Es muß uns, von beiläufigen Hinweisen abgesehen, genügen, den Tatbestand des Vertrauens vergleichsfähig aufzuarbeiten.
1 Er findet sich denn auch durchweg in dem leider spärlichen Schrifttum, das sich thematisch mit Vertrauen befaßt. Siehe z. B. E. Diesel 1947, S. 21 ff.
2 Siehe z. B. N. Hartmann 1962, S. 468 ff.; B. Bauch 1938, S. 67–74; F. Darmstaedter 1948, Sp. 430–436 (433); H. Eichler 1950, S. 111 ff.; G. Stratenzverth 1958, S. 78 ff. Wie gerade die zuletzt genannte Erörterung lehrt, ist eine solche Ja/Aber-Argumentation nur sinnvoll, wenn eine geltende Wertordnung vorausgesetzt werden kann, die angibt, wo das Ja ins Aber umschlägt.
3 Siehe z. B. A. Nitschke 1952, S.175–180.
4 Eine erste aber unzureichende Orientierung könnte Marcels Dichotomie von „problème“ und „mystère“ bieten. Siehe besonders G. Marcel 1935, S. 162ff. Sie wird jedoch dadurch, daß sie den Problembegriff auf Probleme des Herstellens und Habens festlegt, weder den Möglichkeiten einer transzendentalen Phänomenologie noch den Möglichkeiten funktionaler Analyse gerecht. „Herstellen“ und „Haben“ dienen hier im Grunde als Chiffren für eine sehr viel abstraktere fundamentale Beziehung des Ich zur Welt: für ein Verhältnis unabhängiger Variabilität bzw. relativer Invarianz.
5 Siehe z. B. den Versuch einer Einschmelzung der funktionalen in die kausale Analyse bei K. Davis 1959, S. 757–772, der verbreiteten Überzeugungen Ausdruck gibt.
6 Eingehender dazu: N. Luhmann 1971, S. 9ff., 31 ff.
7 Als solche Einzelzüge wären zu nennen: (1) daß alle funktionalen Aussagen nur relativ auf bestimmte Handlungssysteme gelten und daß es Systeme in extrem hoher Zahl gibt; (2) daß eine Handlung mehreren Systemen zugerechnet werden kann, Systeme also komplex ineinandergeschachtelt werden können; (3) daß die funktionale Systemanalyse nicht nur manifeste Funktionen (bewußte Handlungszwecke), sondern besonders nachdrücklich auch latente Funktionen zu erschließen sucht; (4) daß sie nicht nur funktionale, sondern auch dysfunktionale Folgen des Handelns berücksichtigt und als Folgeprobleme zum Ausgangspunkt weiterer Analysen macht; (5) daß sie eine vergleichende Methode ist, welche die Vorbedingung eines Vergleichs im täglichen Leben, vorausliegende Ähnlichkeiten, abwirft und Erkenntnis gerade darin sucht, möglichst heterogene Dinge unter dem Gesichtspunkt spezifischer Leistungen als funktional äquivalent zu erweisen, indem sie das Gleichheitsurteil aus dem Objekt in die Funktion verlegt. All dies zusammengenommen zeigt, daß es der funktionalen Methode im Prinzip darum geht, die Blickbegrenzungen der Handlungsperspektive aufzuheben und durch transintentionale Forschung mehr Komplexität zu erfassen.
8 Zu diesem phänomenologischen Weltbegriff vgl. namentlich E. Husserl 1948, S. 23 ff.; ders. 1954, S. 105 ff. und dazu L. Landgrebe 1940. Dt. Übers. in ders, 1963; G. Brand 1955, S. 13 ff.; E. Fink 1958; J. Bednarski 1957, S. 419 ff.; H. Hohl 1962
9 Siehe M. Deutsch 1960 b. Zu den Unsicherheiten und den methodischen Schwierigkeiten, die in dieser Forschung schon bei sehr problemnah und fast tautologisch gewählten Persönlichkeitsvariablen auftreten, vgl. insb. L. S. Wrightsman 1966.
10 „A trusting choice may be based upon ‘despair’, ‘conformity’, ‘impulsivity’, ‘innocence’, ‘virtue’, ‘faith’, ‘masochism’, or confidence“, so deutet M. Deutsch 1962, S. 303, mit fachlich allerdings nicht sehr verfeinerten Begriffen diese Vielfalt an. Allerdings ist gerade die Sozialpsychologie, die das soziale Feld immer wieder auf individualpsychologische Variablen zu reduzieren versucht (siehe. auch M. Deutsch 1962, S. 306 ff.), nicht in der Lage, diesem Tatbestand ausreichend Rechnung zu tragen. Erst eine Theorie sozialer Systeme öffnet den Blick dafür, daß sehr unterschiedliche psychische Systeme in sozialen Systemen funktional äquivalent operieren können, so daß soziale Systeme sich von Prozessen psychischer Individualisierung in gewissem Umfange unabhängig machen können.
11 Siehe als neueste Darstellung und als Auseinandersetzung mit dem individualpsychologischen Reduktionismus der Sozialpsychologie T. Parsons 1970.
12 Der Begriff der Komplexität läßt sich mithin dem Materiebegriff der alteuropäischen Philosophie vergleichen. Aber „Materie“ war auf „Form“ hin konzipiert, während der Begriff der Komplexität reduzierende selektive Systeme voraussetzt.
13 Vgl. besonders: E. Husserl 1952, S. 190 ff.; ders. 1954, S. 185 ff., 415 ff. und passim. Bezeichnend für die Grenze des Husserlschen Denkens ist, daß er einen Vorrang der Ich-Subjektivität im Sinne des transzendentalen Subjektivismus behauptet und erst auf diesem Boden die Konstituierung des Mitmenschen, der intersubjektiven Erlebensgemeinschaft und der Welt als ihres Horizontes zu begreifen sucht. Dieser Ausgangspunkt ist für das Denken in der Welt aber nur durch methodisch-bewußte Abstraktionen erreichbar, die Husserl Reduktionen nennt. Insofern verstrickt Husserl sich in dasselbe Dilemma wie ein absolut gesetzter Funktionalismus, künstlich isolierte Perspektiven als Grund behaupten zu müssen. – Alle dadurch stimulierten Versuche, sich diesem Dilemma zu entziehen, führen aus ihm heraus und wieder in die schon konstituierte Welt zurück und verfehlen schon damit den Rang des Husserlschen Problems. Siehe insb. A. Schütz 1932, insb. S. 186 ff., und eine Reihe späterer Aufsätze, zusammengestellt in: A. Schütz, 3 Bde. 1962–1966; ferner als Kritik der Versuche Husserls: A. Schütz 1957. Vgl. außerdem: J.-P. Sartre 1950, S. 273 ff. M. Merleau-Ponty 1945, S. 398 ff.; W. E. Hocking 1953/54, S. 451 ff.; L. Landgrebe 1963, S. 89 ff.; M. Theunissen 1965
14 Siehe als eine besonders klare Formulierung: T. Parsons, E. A. Shils 1951, S. 16; ferner T. Parsons 1951, S. 10 ff., und dazu A. W. Gouldner 1959, sowie ders. 1960.
15 Dies gilt einerseits für den Gedanken Simons, von der unzureichenden rationalen Fähigkeit des Menschen her – und das ist eine spiegelbildliche Fassung des Komplexitätsproblems – die Funktion der Organisation von Entscheidungsprozessen zu begreifen; siehe insb. H. A. Simon 1955 und ders. 1957 b; ferner auch für die durch die Spieltheorie angeregten Bemühungen um eine Organisationstheorie, welche das Problem der „rationalen Unbestimmtheit“ aller Situationen, an denen mehrere Menschen beteiligt sind, mit Strategie-Konzeptionen angeht – siehe z. B. J. von Neumann und O. Morgenstern 1961, insb. S. 9 ff.; J. Marschak 1954; ders. 1955 und dazu G. Gäfgen 1963, insb. S. 176 ff., und ders. 1961. Auch H. Garfinkel (1963) orientiert sich am Modellfall des Spiels, um die allgemeine These zu stützen, daß hinter allem „normalen“ Erleben das Vertrauen steht, daß andere Menschen einer gemeinsamen Ordnung konstituierender Erwartungen folgen.
16 Auch die Staatsvertragslehren der frühen Neuzeit benutzen die historische oder utopische Darstellung nur als Einkleidung einer funktionalen Aussage.
17 Vgl. dazu: P. Plessner 1964, S. 41 ff., und als Kontrast J. Cazeneuve 1958.
2. Bestände und Ereignisse
Schon bei oberflächlichem Hinblick ist am Thema Vertrauen ein problematisches Verhältnis zur Zeit erkennbar. Wer Vertrauen erweist, nimmt Zukunft vorweg. Er handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre. Man könnte meinen, er überwinde die Zeit, zumindest Zeitdifferenzen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Ethik aus einem heimlichen Vorurteil gegen die Zeit heraus Vertrauen empfahl als eine Haltung, die sich vom Zeitfluß unabhängig zu machen und so der Ewigkeit nahezukommen sucht. Aber die Vorstellung von Zeit, die solch einem Urteil zugrunde liegen könnte, ist, wie das Urteil selbst, unzulänglich geblieben. Die Zeit kann nicht als Fluß, als eine Bewegung, und auch nicht als Maß der Bewegung gedacht werden. Im Bewegungsbegriff ist ja in unerkannter Weise der Zeitbegriff schon vorausgesetzt.
Noch weniger hilft die in der Soziologie übliche Unterscheidung von Struktur und Prozeß. Von ihren offenkundigen Mängeln abgesehen – daß sie nämlich weder die Änderbarkeit der Strukturen noch die Strukturiertheit der Prozesse erfaßt –, benutzt sie objektivierende Begriffe von etwas Feststehendem und etwas Fließendem, in deren Entgegensetzung das Wesen der Zeit verborgen bleibt. Wir würden zögern, Vertrauen, sei es als Struktur, sei es als Prozeß zu identifizieren, und das zeigt schon Grenzen dieser Unterscheidung, zeigt die Unzulänglichkeit der herrschenden soziologischen Theorie, wenn es um das Thema Vertrauen geht, und zeigt schließlich eine Nähe dieses Themas zu einem noch nicht erfaßten Begriff von Zeit an.
[10]Eine Theorie des Vertrauens setzt eine Theorie der Zeit voraus. Diese Voraussetzung führt in ein so schwieriges, dunkles Gelände, daß wir sie hier nicht einlösen können. Immerhin bieten neuere systemtheoretische Überlegungen einige Anhaltspunkte. Sie betreffen den Zusammenhang von System/Umwelt-Differenzierungen und Zeitlichkeit.
Sobald Systeme durch Ausdifferenzierung Grenzen gegenüber ihrer Umwelt bilden, entsteht ein Zeitproblem, das heißt zunächst eine Verschiebung der Prozesse, die die Ausdifferenzierung erhalten, in ein Nacheinander. Denn nicht alle Beziehungen zwischen System und Umwelt können momenthafte Punkt-für-Punkt-Korrelationen sein; vielmehr erfordert die Erhaltung der Differenz, zumindest bei komplexeren Systemen, Umwege, die Zeit brauchen. Auf Umweltereignisse wird teils überhaupt nicht, teils später, teils antizipatorisch reagiert und nur in sehr geringem Maße sofort. Hierauf gründet Talcott Parsons sein berühmtes Vier-Felder-Schema der Systemprobleme, konstruiert durch Gegenüberstellung der Differenz von System und Umwelt und der Differenz gegenwärtiger und künftiger Erfüllung1. Parsons wertet diesen Gedanken nur für eine Theorie der Systemdifferenzierung aus. Er hat jedoch sehr viel weittragendere Bedeutung für die Konstitution von Zeitlichkeit selbst und für daraus folgende Probleme systeminterner struktureller Generalisierung.
Wenn diese Ableitung zutrifft, geht es in der Zeitlichkeit um ein durch Ausdifferenzierung ausgelöstes Zusammenbestehen von Veränderung und Nichtveränderung. Dieser Sachverhalt findet sich in sinnhaften Systemen menschlichen Erlebens und Handelns wieder und bestimmt auch hier die Erfordernisse struktureller Generalisierung.
Allem menschlichen Zeiterleben liegt als in der Reflexion erreichbarer letzter Befund ein Erleben von Dauer trotz Wechsels von Impressionen zugrunde2. Dieser Befund bietet, was immer er sein [11] mag3, der Interpretation zwei entgegengesetzte Ansatzpunkte: die Dauer und den Wechsel. Aus diesem Befund wird durch einen Prozeß intersubjektiver Konstitution die „objektive Zeit“ gebildet als ein für alle Menschen gleiches Kontinuum von Zeitpunkten, in dem etwas dauern oder wechseln kann, das aber selbst gegen diesen Unterschied neutral ist. Die Paradoxie dieses Unterschiedes wird also gleichsam durch den Zeitbegriff unterlaufen, aber sie bleibt erhalten als Gegensatz zweier einander ausschließender Weisen der Identifikation in der Zeit.
Entweder kann nämlich etwas als Ereignis identifiziert werden, das an einem Zeitpunkt feststeht, unabhängig vom je gegenwärtigen Erleben, das auf der Skala der Zeitpunkte voranschreitet, unaufhörlich Zeitpunkt für Zeitpunkt aus der Zukunft in die Vergangenheit überführend. Das Ereignis hat seine zeitpunktbezogene Identität also unabhängig von der Qualifikation als künftig, gegenwärtig oder vergangen, und der Sinn seiner Identität ist gerade diese Invarianz gegenüber dem Wechsel der Zeitqualitäten. Es bedarf aber dieses Wechsels, um in der Gegenwart Wirklichkeit werden, um sich ereignen zu können.
Oder etwas kann als Bestand identifiziert werden, der unabhängig vom Wechsel der Zeitpunkte dauert. Solche Dauer hat lediglich die je kontinuierlich aktuelle Gegenwart, während alles Zukünftige kommt, alles Vergangene wegfließt. Bestände können also nur als gegenwärtig identifiziert werden. In der Zukunft oder der Vergangenheit lassen sie sich allenfalls als Ereignisserien fassen und in der abgewandelten Form von kontinuierlich gegenwärtigen Erwartungen oder Erinnerungen zu Beständen machen4. So [12] hat denn auch die Antike mit gutem Recht sich ewigen Bestand nur als Gegenwart vorstellen können, während es der heutigen Auffassung, die sich an der Identität der Zeitpunkte orientiert und sich deshalb die Gegenwart als bewegt vorstellen muß, näher läge, Ewigkeit als Gesamtereignis der Welt, etwa als creatio continua, zu begreifen und die Zeit demgemäß als eine Historie von Ereignissen zu sehen.
Beide Perspektiven schließen sich wechselseitig aus, da jede als ihr Identitätsprinzip das konstant hält, was die andere variieren muß, um ihr eigenes Identitätsprinzip zu gewinnen. Sie können deshalb nicht gleichzeitig gebraucht werden. Gerade durch diese Ausschließung aber fundieren beide Identifikationsformen sich auch als komplementäre Negationen. Variation ist als solche nämlich unbegreiflich, wenn man nicht Identitäten voraussetzen kann, in bezug auf die sich etwas ändert. Beide Identifikationsformen negieren (und machen dadurch begreiflich), was sich an der je anderen ändert. Sie beleuchten dadurch das, was die Zeit für die jeweils andere Art von Identität bedeutet: Die Identität der Ereignisse konstitutiert das, was die zeitliche Problematik der Bestände ausmachte, nämlich das Fortschreiten der Gegenwart als eines je aktuellen Momentes, der seine Bestände nicht ohne weiteres mitnehmen kann, sondern sich immer um Erhaltung und Neuerwerb bemühen muß; die Identität der Bestände konstituiert das, was die Zeitproblematik der Ereignisse ausmacht, nämlich ihr unbeständiges Wegfließen aus der Zukunft in die Vergangenheit und ihre nur zufällige, glückhafte Allianz mit den Beständen.
Der Widerspruch dieser Identifikationsweisen erlaubt keinen Rückschluß auf die vermeintliche „Unrealität“ der Zeit5. Ein solcher Schluß wäre besonders dann unergiebig und irreführend, wenn man einen Realitätsbegriff unterstellt, der von der Zeitlichkeit [13] bereits abstrahiert. Vertrauen bezieht sich keineswegs auf ein unreal gestelltes Problem. Vielmehr konstituiert sich die Zeitlichkeit als jene doppelte Möglichkeit der Negation, die als Möglichkeit ebenso wie als Negation real ist, nämlich wirklich und mit nachweisbarer Leistungsfähigkeit orientiert6. Erst diese doppelte Negation des am je anderen Variierten ergibt ein vollständiges Schema der Zeit, die sich selbst der Erfassung entzieht. Weder der antike, gegenwartsbezogene noch der moderne, zeitpunktbezogene Zeitbegriff reichen aus. Mit diesen an je eine der beiden Perspektiven sich bindenden Zeitbegriffen gewinnt man lediglich ein Schema der Problematisierung der Bestände bzw. Ereignisse, das durch ein gegenperspektivisches Zeitdenken korrigiert werden müßte.