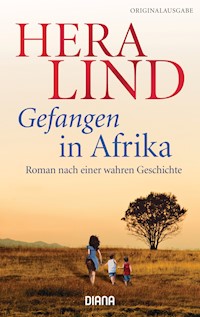9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das halbe Leben ist vorbei – höchste Zeit, endlich unvernünftig zu werden
Drei Frauen in der Mitte des Lebens: Carin lebt allein und mag nicht ihren Nachbarn heiraten, nur weil ihre Mutter das prima fände. Sonja arbeitet hart an ihrer Traumfigur, doch ihre Tochter ist tausendmal schöner als sie. Billi, Hausfrau mit Mann und Kindern, die sie auffressen, überlegt, noch den Doktor zu machen. Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel – bis ein junger Mann auftaucht, der das Leben der drei Frauen kräftig durcheinanderwirbelt und ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
HERA
LIND
Verwechsel-
jahre
ROMAN
Vorbemerkung
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.
Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel der Autorin mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Sie lässt bewusst Grenzen verschwimmen.
Copyright © 2013 by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung | t.mutzenbach design, München unter Verwendung von Motiven von © Joerg Steffens/Corbis; shutterstock
Autorenfoto | © Regina Hügli
Satz | Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-09134-7
www.diana-verlag.de
1
Nebenan wurde was für dich abgegeben.« Meine Mutter saß mit ihrer Lieblingswolldecke vor dem Fernseher. Sie war gerade einundneunzig geworden und wohnte noch bei mir. Na ja, die Wahrheit war: Ich wohnte noch bei ihr. Das Schicksal hatte es so gewollt, dass wir seit sechsundvierzig Jahren eine eingeschworene Zweck- und Wohngemeinschaft waren. Abgesehen von meinem schrecklichen Aufenthalt in dieser grauenhaften Klinik damals, waren Mutter und ich noch nie länger als drei Tage getrennt gewesen.
»Bei welchem Nebenan?« Schwungvoll stellte ich die Einkaufstüten auf den Tisch und schob Mutter ein Kissen in den Rücken. Bitte sag jetzt nicht: »Bei Rainer«, flehte ich innerlich.
Rainer Maria Frohwein war unser direkter Nachbar im Sechsparteienhaus. Ein früh pensionierter Lehrer, der mich aus irgendeinem Grund vergeblich liebte. Es war wirklich anstrengend, ihm ständig begegnen zu müssen.
»Bei Rainer!«
Ich schluckte. Anscheinend gab es kein Entrinnen. Ich meine, Rainer Frohwein war nett, keine Frage. Aber irgendwas in mir stellte sich quer. Ich konnte auch ohne Rainer leben.
»So ein hilfsbereiter Mann.« Mutter richtete sich auf und lächelte mich an. Im Schein der Nachmittagssonne, die durch den Vorhangspalt fiel, sah ich ihre tausend lieben Fältchen. Sie streckte ihre mageren Hände nach mir aus. »Komm, Kind, setz dich!«
Ich ließ mich auf die Lehne ihres Rollstuhls sinken. Mutters Augen wurden wässrig: »Carin, Liebes. Der Rainer ist doch so ein netter Kerl.«
»Ja, Mutter. Ich weiß.«
»Und er schreibt dir so nette Briefe.«
Ich verdrehte die Augen.
»Mutter, was wurde bei Rainer für mich abgegeben?«
»Ein Zettel. Mit einer Telefonnummer. Ich hatte meine Brille nicht griffbereit, deshalb habe ich zu Rainer gesagt, er soll ihn dir doch nachher selber geben.«
Wenn das nicht ein Trick war. Rainer gab mir ständig Zettel. Da standen Gedichte drauf.
Kostprobe gefällig?
Dort,
wo ich
immer hinwollte –
am Ende
des Regenbogens –
dort
fand ich
dich.
Schön, nicht? Wenn unsere benachbarten Wohnungen im Maiblümchenweg 17 a für ihn das »Ende des Regenbogens« waren – warum nicht. Ich sah darin eher eine Warteschleife. Meine Mutter wollte nur, dass Rainer wieder einen Grund hatte, vorbeizuschauen. Sie hatte einen Narren an ihm gefressen. Klar, er war ein »alleinstehender Mann«, geschieden, gediegen, nett und zuverlässig … leider auch sterbenslangweilig. Seinen Modeberater hätte ich erschlagen können. (Kleiner Scherz: Er hatte keinen. Irgendjemand hatte ihn bereits erschlagen.) Ich versuchte, unseren Nachbarn auf Abstand zu halten, was gar nicht so einfach war.
»Verstehe. Und was ist das für eine Telefonnummer?«
»Keine Ahnung. Laut Rainer hat jemand aus Hamburg bei ihm angerufen, der eigentlich dich sprechen wollte.«
»Wer ist denn so blöd und ruft Rainer an, wenn er mich sprechen will?« Ich lachte auf. Wenn das nicht schon wieder einer seiner Tricks war. »Haben wir etwa kein Telefon?«
»Doch.« Mit zitternder Hand griff Mutter nach dem kleinen Gerät, mit dem sie die Lehne ihres Rollstuhls elektrisch verstellen konnte. Versehentlich fuhr sie erst mal in die Horizontale. »Aber ich hab das Klingeln nicht gehört, mein Hörgerät war nicht an. Und du warst ja nicht da.«
»Nein, Mutter.« Ich fuhr sie wieder in die Sitzposition. »Ich war in der Bibliothek. Wie jeden Tag.« Ich verdrehte die Augen. »Ich arbeite dort. Auch da bin ich telefonisch zu erreichen.« Ich tätschelte meiner Mutter liebevoll die Hand. Manchmal hatte sie den einen oder anderen kleinen Aussetzer. Vielleicht kultivierte sie das aber auch und spielte mir die Verwirrte vor, um ihre Ziele zu erreichen.
»Rainer sagt, der Anrufer war von irgendeinem Verlag.«
Ach so. Jetzt verstand ich, was los war. Ich wollte den Stern abonnieren und hatte irgendeinem Zeitschriftenanbieter auf den AB gesprochen und um Rückruf gebeten. Ich begann, die Einkäufe auszupacken. »Das ist nicht so wichtig, Mutter. Aber erzähl, wie ist es dir heute so ergangen?«
Mutter schilderte mir, was sie den ganzen Tag erlebt hatte. Erst war die Putzfrau da gewesen. Dann war der Briefträger gekommen, anschließend Essen auf Rädern, schließlich war sie vor dem Fernseher eingenickt, bis Rainer wegen dieser Telefonnummer vorbeigeschaut hatte – und schon war der Tag fast wieder vorbei.
»Warum hat Rainer den Zettel nicht einfach hiergelassen?« Leicht verärgert stellte ich Milch und Joghurt mit etwas zu viel Karacho in den Kühlschrank.
»Ich glaube, er will dir einfach mal wieder Hallo sagen.«
Ich seufzte. »Mutter. Bitte hör endlich auf, mich mit Rainer zu verkuppeln.« Mit einem Joghurt und einer Serviette setzte ich mich zu ihr. »Hier. Vanille. Deine Lieblingssorte.« Mutter ließ sich folgsam füttern.
»Er wäre immer für dich da, mein Kind.«
»Ja, ich weiß. Es ist schön, wenn man nette Nachbarn hat.«
»Wenn ich mal nicht mehr bin.«
»Mutter: Erstens bist du noch, und zweitens bin ich erwachsen.«
»Aber du brauchst doch jemanden …« Mutter bekam feuchte Augen. »Du warst doch noch nie allein auf dich gestellt …«
»Aber Mutter!« Ich wischte ihr mit dem Serviettenzipfel eine Träne ab, die sich gerade verselbstständigen wollte. »Was sind denn das heute für düstere Gedanken?«
»Ich habe Angst, dass ich bald abkratze.«
Oh. Dieses Gespräch nahm eine immer unerfreulichere Wendung. »Wir müssen alle eines Tages sterben!«
»Aber ich habe vielleicht nicht mehr lange …« Sie sah mich mit einem verzweifelten Lächeln an.
Ich musste ein Grinsen unterdrücken. Diesen Spruch hörte ich nun seit über dreißig Jahren. Seit dreißig Jahren sagte sie: »Das könnte mein letztes Weihnachten sein. Das könnte mein letzter Frühling sein. Das könnte mein letzter Muttertag sein.« Jeder Feiertag wurde von ihr auf diese Weise anmoderiert.
Jetzt sagte sie weise: »Das könnte mein letzter Sommer sein.«
Mir gefror das Lächeln auf den Lippen. »Dann lass ihn uns doch noch genießen! Komm, ich bringe dich auf den Balkon.«
Energisch zog ich die Vorhänge auf und schob meine Mutter hinaus in die Sonne.
Auf dem Balkon nebenan hantierte Rainer. Im Moment hängte er seine gewaschenen Hemden umständlich auf einen Wäscheständer. Alle hatten dieselbe undefinierbare Form und Farbe und waren von der Marke »Keiner wäscht Rainer«. Rainer war immer zufällig auf dem Balkon, wenn unsere Balkontüre aufging. Er schien eine Art Frühwarnsystem in seiner Wohnung zu haben: Achtung, die Nachbarbalkontür! Wenn das Alarm schlug, flitzte er aus seinem Bau, um Witterung aufzunehmen. Ich warf einen Blick auf seine unsägliche Wachstuchtischdecke, auf der seine Kakteensammlung stand. »Hallo«, sagte ich freundlich.
»Oh, Carin, gut, dass ich dich sehe!« Rainer wurde ein bisschen rot. »Grüß Gott, Frau Bergmann!«, begrüßte er meine Mutter artig.
»Er ist so ein netter Mann!«, flüsterte die mir unüberhörbar zu. »Er braucht dringend eine Frau im Haus!«
»Mutter!«, zischte ich zurück. »DENK nicht mal dran!«
Das hatte er gehört.
Seine Unterlippe zitterte leicht, und er steckte die Hände in die Taschen seiner ausgebeulten Cordhosen. Sein schütterer Haarkranz lag wie ein verdorrter Adventskranz um seine Glatze. Rainer sah irgendwie rührend aus in seinem eingelaufenen Wollpullunder über dem angegrauten Hemd, das er wahrscheinlich mit der Buntwäsche in die Maschine getan hatte. Der Kragen wellte sich wie eine Wurstscheibe, die zu lange in der Sonne gelegen hat. Ich musste mich schwer beherrschen, ihn nicht in Form zu ziehen. Aber das hätte eindeutig ein falsches Signal gesetzt. Ich räusperte mich, bemühte mich um einen neutralen Nachbarinnen-Ton.
»Mutter sagt, du hast eine Nachricht für mich?«
»Ja. Hier.« Mit zitternden Fingern reichte Rainer mir den Zettel. Ich erkannte seine Handschrift auf Anhieb, schließlich war sie mir wohlvertraut.
Zwischen
gestern und heute
habe ich dich
ganz deutlich
an mir
gespürt –
auch wenn da
noch eine gewisse
Entfernung war.
Aha. Die Entfernung betrug zwar nur wenige Zentimeter in Form einer Wohnungszwischenwand, aber er meinte wahrscheinlich eher meine freundliche, aber unwiderrufliche Distanziertheit, die er einfach nicht akzeptieren wollte. Der letzte Brief, den er mir zugesteckt hatte, lag mir noch schwer im Magen:
Nichts,
was im Kopf entsteht,
ist
unveränderlich.
Aber
meine Liebe zu dir
entstand im Herzen.
Auf seine Art war Rainer Frohwein wirklich bezaubernd, aber er war weit davon entfernt, mein Traummann zu sein. Mutter hingegen fand sein altmodisches Werben einfach nur hinreißend.
»Wer schreibt denn heute noch so wundervolle Gedichte?«, sagte sie immer wieder. »Und dann noch in dieser wunderbaren Handschrift. Jeder normale Mann benutzt inzwischen den Computer!«
Tja, wo sie recht hatte, da hatte sie recht. Natürlich war es romantischer, seine Angebetete mit grüner Tinte zu besingen, statt ihr eine SMS oder eine Mail zu schreiben. Aber nachdem wir Wand an Wand wohnten, und das seit achtzehn Jahren, waren seine Bemühungen um mich auch etwas penetrant. Als Frühpensionär mit amtsärztlich bescheinigtem Burn-out-Syndrom hatte der Mann eindeutig zu viel Zeit. Für mich.
»Rainer! Nicht noch ’n Gedicht! Mutter sagt, da hat jemand aus Hamburg für mich angerufen?«
»Wie?« Rainer wühlte in den Untiefen seiner ausgebeulten Cordhose. »Ach so, entschuldige. Das solltest du erst später kriegen.«
Mutter ließ uns nicht aus den Augen.
Ich kam mir total bescheuert vor, als ich da mit ausgestreckter Hand auf dem Balkon stand. Doch was Rainer Frohwein nun aus der Hosentasche zauberte, war ausnahmsweise mal kein Gedicht. Mir entfuhr ein erleichterter Seufzer. Na also, geht doch! Es war eine Telefonnummer mit Hamburger Vorwahl.
»Bestimmt vom Verlag«, stellte ich fest, nachdem ich die Lesebrille aufgesetzt hatte. Ich warf ihm ein strahlendes Lächeln zu.
»Es war ein gewisser Roman Stiller dran«, bemerkte Rainer eifrig.
»Sicherlich ein Mitarbeiter aus der Abo-Abteilung.«
Mein Nachbar zuckte die Achseln. »Er bittet um dringenden Rückruf.«
Ich sah auf die Uhr. »Es ist schon nach sechs. Meinst du, ich kann da jetzt noch anrufen? Ich wollte einfach nur den Stern abonnieren. Da ist sicher niemand mehr im Büro.«
In Rainers Augen glomm Hoffnung auf. »Ich kann das auch gern für dich im Internet erledigen.« Schon trat er näher an unsere halbhohe Trennmauer heran. Der Wäscheständer wackelte bedenklich. Ich sah, wie die winzigen Schweißperlen auf Rainers sommersprossiger Stirnglatze in der Sonne glänzen.
»Lass nur, das kann ich auch«, entgegnete ich würdevoll.
»So lass dir doch von Rainer helfen, Kind! Er meint es nur gut.«
»Mutter!«
»Ich will mich ja nicht aufdrängen«, beteuerte Rainer, ohne rot zu werden.
Nein. Nicht doch. Rainer und aufdrängen? Was für ein absurder Gedanke, stöhn! Ich warf dem in Liebe Entbrannten einen genervten Blick zu. Diesen Spruch hörte ich ebenfalls seit Jahren. Warum tat er es dann? Immer wenn ich ihn bat, meine Privatsphäre zu respektieren, sagte er Sätze wie: »Du bist ein freier Mensch. Tu, wonach dir ist. Entfalte dich nach Herzenslust.« Dabei schien er sich unheimlich großzügig vorzukommen. Als ob es eine Gnade wäre, von ihm in Ruhe gelassen zu werden. Ich meine, hallo? Wir waren Nachbarn! Wir waren KEIN PAAR! Jedenfalls nicht aus meiner Sicht. Ich schluckte und versuchte, eine unangenehme Erinnerung in den Schlund des Vergessens zurückzubefördern.
»Siehst du, Kind, er will sich nicht aufdrängen!«, sagte Mutter wie zu einem lernbehinderten Erstklässler. »Er hält sich bescheiden im Hintergrund.«
Na, das wüsste ich aber! Ich schob Mutter so, dass sie ein wenig in die Sonne blinzeln konnte. »Hast du alles?«
»Ja, ja, Kind, mir geht es gut. Kümmere dich ruhig um deine Angelegenheiten.«
Täuschte ich mich, oder zwinkerte sie Rainer vertraulich zu? Ich schüttelte den Kopf. »Du meldest dich, wenn du mich brauchst?«, fragte ich Mutter. Dasselbe fragte mich Rainer. Mit leerem Blick starrte ich ihn an. Ging wieder in die Wohnung. Und zog die Balkontür laut vernehmlich hinter mir zu. Man sollte doch eine gewisse Distanz wahren. Denn war Rainer erst mal bei uns in der Wohnung, ging er nicht so schnell wieder. Dann fand er hier was zum Schrauben, dort was zum Sägen, holte mit großer Geste seinen Handwerkskoffer der Marke Jippijahaha hervor und hatte schon wieder eine Duftmarke gesetzt. (Nein, zum Pinkeln ging er schon noch nach nebenan, aber Sie wissen, was ich meine.) Es wäre halt so praktisch gewesen! Rainer und Mutter träumten gleichermaßen davon, die Wand zwischen unseren Dreizimmer-Eigentumswohnungen niederzureißen. Die Umbaupläne hatte Rainer schon gezeichnet. Dann wären wir eine perfekte Kleinfamilie. Vater, Mutter, Großmutter. Denn ein Kind hatten wir ja keines. Leider.
Das war ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Ich wischte mir hastig über die Augen. Bloß nicht darüber nachdenken. Das war Vergangenheit.
Die Vorstellung, mit Rainer zusammenzuziehen, war einfach bizarr. Besonders die Vorstellung von einem gemeinsamen Schlafzimmer »nach hinten raus«. (Bitte nicht falsch verstehen. Die ursprüngliche Bedeutung ist schon schlimm genug.) In Eiche rustikal. Mit bügelfreier Frotteebettwäsche. Dann doch lieber ein Massai, der nicht lesen und schreiben kann (und die Missionarsstellung nicht mal ansatzweise in Erwägung zieht). Oder vielleicht doch nicht? Egal, beides war für mich ähnlich verlockend. Mutter waren solche Dinge natürlich egal. Aus dem Alter war sie raus. Sie dachte da viel praktischer. »Endlich ein Mann im Haus!«, würde sie jubeln. Ein großer, starker (dicker) Bär, der uns beschützt. Nun ja, er hätte sich um sie gekümmert. Betreutes Fernsehen, so was in der Art. Dann hätte ich ihr gegenüber nicht so ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn ich sie täglich acht Stunden allein ließ.
Leider gab es da eine winzige Kleinigkeit, die mich daran hinderte, begeistert die Handwerker zu bestellen: Ich, Carin Bergmann, sechsundvierzig und ledig, wollte nicht mit Rainer Frohwein zusammenleben! Obwohl ich auf dem besten Wege war, eine alte Jungfer zu werden, wie Mutter gerne durchblicken ließ. Lieber welkte ich einsam vor mich hin, wurde wunderlich und vertrocknete meinetwegen (alles düstere Prognosen meiner Mutter), als so einen faulen Kompromiss einzugehen! Mutter war fest davon überzeugt, dass ich nie mehr einen Mann kennenlernen würde, der mich so auf Händen trug wie Rainer. Was ich mir denn noch erträume, in meinem Alter?! Worauf ich denn warte?! Sooo schön sei ich nun auch nicht mehr! Welkende Blumen müsse man pflücken und schnell ins Wasser stellen, bevor sie faulig werden. (Danke, Mutter!)
Doch ich war zufrieden mit meinem Leben. Es hatte Turbulenzen gegeben, aber bei wem gibt es die nicht? Und ich musste auch gar nicht auf Händen getragen werden. Naaaaa guuuut, zugegeben: Natürlich war da mal was gewesen, mit Rainer und mir. Vor Jahren. Er hatte wirklich alles versucht, mich für eine eheähnliche Partnerschaft zu gewinnen, und wir waren ein paarmal zusammen aus gewesen. Und, jaaaaaa, wir waren auch einmal im Bett gelandet, nach zwei Flaschen Froh-Wein. Oder waren es doch mehrere Male gewesen? Jaaaaa, zugegeben, ich hatte versucht, mir den Mann schönzutrinken, allein schon meiner Mutter zuliebe. Und jaaaaa, ich hatte versucht, über meinen Schatten, sprich, über die Balkonmauer zu springen. Gott, war ich damals betrunken! Ich erinnerte mich nur ungern daran. Es war, ohne Rainer zu nahe treten zu wollen (denn dafür sorgte er selbst), nicht so der Hit. Nein, also, alles, was recht ist. Es war … bemüht. Er bemühte sich, mich glücklich zu machen, und ich bemühte mich, ihn in dem Glauben zu lassen, er hätte mich glücklich gemacht. (Selber schuld, Carin Bergmann!) Im Nachhinein fand ich es schrecklich unfair von mir, ihn so belogen zu haben. Ich schämte mich, als ich am Morgen danach in den Spiegel sah. Er war so siegesgewiss, so rührend verliebt gewesen. Er hatte richtig glücklich gelacht und geglaubt, mein glückliches Lachen sei echt gewesen. Dabei konnte ich nach vollbrachtem Akt gar nicht schnell genug in meine Behausung zurückkommen. Er dachte, ich wäre genauso verliebt wie er, und rief zärtlich: »Lass dir Zeit, denk in Ruhe über alles nach!« Während ich einfach nicht fassen konnte, dass mir so etwas Dämliches passiert war! O Gott, warum täuscht man als erwachsene Frau einen Orgasmus vor? Das ist doch ein Eigentor!
Solche Dinge konnte ich leider nicht mit meiner Mutter diskutieren. Das Einzige, was sie je zu diesem Thema gesagt hatte, war: »Pah! Eine Frau MUSS keinen Orgasmus haben. Es gibt Wichtigeres im Leben.« Und in ihrer Denkblase stand: »Wo kommen wir denn da hin, wenn jede Frau einen Orgasmus haben will!« EINEN, Mutter? Ich bin nicht sicher, ob wir in derselben Liga spielen!
Aber zurück zu Rainer. Briefe wurden unter dem Türspalt hindurchgeschoben, in denen stand: »Ich will dich ganz für mich gewinnen!«, und: »Du hast einen glücklichen Mann aus mir gemacht«, dabei hatte ich einen Trottel aus ihm gemacht, und er hatte mich längst verloren. Er tat mir leid, und ich schämte mich, aber manchmal packte mich auch die Wut. Wie konnte man nur so grenzenlos naiv sein! Es war ein One-Night-Stand! Oder mehrere. So was kann schon mal passieren. Es war ein Versehen. Es hatte keinerlei Bedeutung.
Für ihn aber sehr wohl. Ich war seine Traumfrau und wohnte zu meinem großen Pech gleich nebenan.
Behutsam versuchte ich, das Ganze einschlafen zu lassen. Ich bat um Abstand. Um Zeit. Was gar nicht so einfach war bei unseren Wohnverhältnissen und meiner pflegebedürftigen Mutter, die dauernd nach ihm rief: Glühbirne hier, Klospülung da. Oh, Rainer war da sehr flexibel. Und seitdem beteuerte er mir, dass ich alle Zeit der Welt hätte, um über eine Beziehung nachzudenken. Dabei gab es nichts nachzudenken. Er dachte aber, dass ich immer noch darüber nachdächte, und half mir folgendermaßen auf die Sprünge:
Wir
haben uns
lange nicht gesehen,
und ich
möchte dich fühlen,
an mir spüren.
Aber
zwischen uns
ist ein Stacheldraht
aus Fragen,
aus Wenns und Abers.
Ich
umarme
dich
nicht,
weil ich weder dich
noch mich verletzen will.
Ach, was für eine unschöne Situation! Ich wollte ihm auf keinen Fall wehtun. Aber ihn eben auch nicht heiraten! Leider schien es keinen Mittelweg zu geben.
»Eine Frau MUSS keinen Orgasmus haben. Sie KANN dabei auch an die Decke gucken.«
Apropos Decke: Unter der steckte Mutter mit Rainer. Also im übertragenen Sinn. Nur leider wollte er nicht SIE heiraten. Sondern mich.
2
Erst am nächsten Tag fiel mir Rainers Zettel beim Aufräumen wieder in die Hände. Instinktiv hatte ich ihn zu seinen anderen Gedichten in die Küchenschublade gestopft. Doch diesmal stand ausnahmsweise kein Gedicht, sondern eine Hamburger Telefonnummer darauf. Das Abo, genau! Ich blinzelte in den blauen Sommerhimmel. Es war Samstag, und Mutter machte ihr Schläfchen. In unserer kleinen beschaulichen Vorstadtsiedlung Butterblum standen alle Balkontüren und Fenster offen. Kinderlachen und Schaukelquietschen waren zu hören. Rainers blank geputzter grüner Ford stand in der Einfahrt. Ich meine, Männer, die Ford fahren, sollen doch einfach nur fortfahren! Aber Rainer wollte mit unserer »Beziehung« fortfahren. Welch schreckliches Missverständnis! Obwohl sein Auto da war, hörte ich nichts von Rainer. Bestimmt war er mit seinem megacoolen Elektrofahrrad unterwegs. Auch so was, das für mich gar nicht ging: Mit Helm, Knieschonern und in einem hautengen neonfarbenen Fahrraddress, der sein Beamtenbäuchlein erst recht zur Geltung brachte, pflegte mein Nachbar am Wochenende um den See zu radeln. Um sich vom Nichtstun zu erholen. Und das auch nur, um mir zu gefallen. Ich hatte irgendwann mal angedeutet, dass ich Wert auf Sportlichkeit lege und versuche, nicht aus dem Leim zu gehen. Weshalb ich regelmäßig ein Fitnessstudio besuche. Daraufhin hatte Rainer ganz schlau reagiert: Schau her, ich bin auch sportlich. Ich »bike«. Wow. Cool. Aber noch lieber setzte er sich mit seinem Notizblock auf eine Bank, packte Butterbrot und Thermoskanne aus, fütterte die Schwäne und dichtete, was das Zeug hielt.
Ich
bin ein Wanderer
auf
einsamen Straßen.
Ich
suche alles
und
will es
jetzt,
solange ich noch lebe.
Damit klang er fast schon so wie meine Mutter: Los, Kind, ich lebe nicht mehr lange. Tu was. Unterhalte mich. Kümmere dich um mich. Sonst bin ich tot, und du bist schuld.
Ich seufzte. Im Gegensatz zu meiner Mutter beharrte ich trotzig auf dem Standpunkt, a) ohne Mann leben zu können oder b) wenn schon, einen Mann von Welt verdient zu haben, egal wie alt und alleinstehend ich auch war. Doch Mutter dachte noch in diesen altmodischen Versorgungskategorien. »Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad.« Diesen Spruch hatte sie noch nie verstanden: »Fische fahren doch gar nicht Fahrrad! Aber Rainer durchaus! Schau doch nur, Kind, wie viel Mühe er sich gibt.«
Nein, eine Frau ohne Mann war für Mutter ein hilfloses Wesen, das am Hungertuch nagen muss. Sie selbst hatte diese schreckliche Erfahrung nämlich machen müssen: Als Vater starb, war ich erst vierzehn, und sie hatte große Angst, uns nicht durchzukriegen. Sie hatte keinerlei Berufsausbildung. Und dann wurde sie auch noch so krank, dass sie nicht mal putzen gehen konnte. Wir lebten zu zweit in einer Besenkammer und wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Zu allem Überfluss passierte mir auch noch diese entsetzliche Geschichte. Eine Geschichte, über die ich nie, nie wieder nachdenken wollte. Nein, diese Zeit war endgültig vorbei. Ich hatte einen Schlussstrich darunter gezogen. Das Leben war weitergegangen. Schon lange.
Ich straffte mich. Die Zeiten hatten sich zum Glück geändert. Ich war nicht auf einen Mann angewiesen – weder auf seine Frührente noch auf seinen Bohrer (ich meine natürlich den vom Baumarkt). Ich verdiente mein eigenes Geld, war frei und unabhängig, liebte meine zwei besten Freundinnen Billi und Sonja, die ich regelmäßig im Fitnesscenter traf, konnte mit einem Computer umgehen und eine Zeitschrift abonnieren. Wenn es denn sein musste, auch über das Internet. Ach, wie schön es jetzt wäre, den neuesten Stern zu lesen, ganz in Ruhe auf dem Balkon. Wie schön es doch wäre, das aktuelle Exemplar jeden Donnerstag im Briefkasten zu haben. Am Wochenende würde ich mich dann den Rätseln widmen. Einfach nur abschalten und die Füße hochlegen. (Großartig weg konnte ich ja nicht. Wegen Mutter.) Ich warf einen erneuten Blick auf besagten Zettel, ohne auch nur im Geringsten zu ahnen, dass er mein Leben von Grund auf ändern sollte. Obwohl ich nicht damit rechnete, am Wochenende jemanden zu erreichen, griff ich zum Telefon und wählte die Hamburger Nummer. Nach dreimaligem Klingeln wurde abgehoben.
»Stiller«, meldete sich eine Männerstimme.
Oh. Das war der, von dem Rainer mir erzählt hatte. Der war bestimmt ganz heiß darauf, endlich ein Abo zu verkaufen. Ich räusperte mich. »Mein Name ist Bergmann. Toll, dass Ihr Büro auch am Wochenende …«
»Danke für Ihren Rückruf«, unterbrach mich der Mann. Er hatte eine tiefe, sonore Stimme und klang auf einmal ganz aufgeregt.
»Carin Bergmann?«
»Ja?«
»Carin mit C?«
»Ähm … ja?!«
»Geboren am 7. Juli 1967 in München?«
»Ja! Genau die bin ich!«
»Wohnhaft von 1979 bis 1983 in Tutzing am Starnberger See?«
»Ja!« Der Mann war aber gut informiert!
»Die Carin Bergmann, die ins Liebfrauen-Gymnasium gegangen ist?«
»Äh … ja?« Meine Güte, was das Internet doch alles für Informationen über einen ausspuckte! Und das, obwohl ich doch nur ganz arglos eine Illustrierte abonnieren wollte! Vielleicht wusste er auch noch meine damaligen Lieblingsfächer Musik und Turnen? Oder den Namen meines Lateinlehrers, Eberhard Brünger, der mich mit einer Vier minus durchs große Latinum gebracht hatte?
Doch der engagierte Mitarbeiter aus Hamburg hatte eine noch viel größere Überraschung für mich parat. Herr Stiller wusste sogar, dass meine Mutter Paula hieß. »Sie machen Ihren Job aber gründlich«, lobte ich den fleißigen Mann. (Das hätte Mutter auch getan.) »Und das am Samstag, mitten in den Sommerferien!« Bestimmt hatte der nichts Besseres zu tun, als Leute zu googeln und sie mit solchen Informationen zu beeindrucken.
»Sie sind ledig und Leiterin der städtischen Bibliothek?«
»Auch das ist korrekt.«
»Sie leben mit Ihrer Mutter im Maiblümchenweg 17 a?«
»Sie sind ein Ass!« Ich lachte. »Bestimmt kennen Sie auch die Farbe unserer Wohnzimmertapete!«, scherzte ich. »Und was es heute Mittag bei uns zu essen gab?«
»Nein.«
»Aber dass unser Nachbar Rainer Frohwein heißt, wissen Sie. Sonst hätten Sie ja nicht bei ihm angerufen.«
»Ich konnte Sie persönlich nicht erreichen«, sagte der übereifrige Mensch. »Ich bitte um Entschuldigung.«
»Ich wollte eigentlich nur den Stern abonnieren«, erklärte ich. »So dringend, dass Sie deshalb extra bei meinem Nachbarn anrufen müssen, ist das auch wieder nicht.«
Der Mann vom Verlag räusperte sich verlegen. In der Leitung blieb es lange still. Merkwürdig. War das irgendein Trick für die »Versteckte Kamera«? Hockte der Mann in Wahrheit mit einem Fernglas hinter der Hecke? Ich überlegte gerade, ob mein gut informierter Gesprächspartner auch noch mein Gewicht, mein Lieblingsgericht und den Farbton meiner Strähnchen kannte, als er eine Frage stellte, die mir komplett den Atem verschlug.
»Und waren Sie 1983 als Leiterin der Katholischen Jugend im Ferienlager Ried am Wolfgangsee?«
Mein Herz begann zu rasen. An diese Zeit wollte ich NICHT erinnert werden. Nie mehr. Auch nicht von einem Abo-Verkäufer aus Hamburg oder wer immer der war.
»Ja«, flüsterte ich mit trockener Kehle. »Aber das ist wirklich vollkommen uninteressant. Ich wollte nur eine Zeitschrift abonnieren.«
»Dann kannten Sie auch den damaligen italienischen Austauschvikar Alessandro Bigotti?«
Meine Beine gaben nach. Ich hörte ein Klirren, als ich aus Versehen irgendwas vom Tisch fegte, bevor ich aufs Sofa sank. Die Vase mit Rainers Blumenstrauß. Eine übel riechende Lache breitete sich auf dem Teppich aus.
»Wer sind Sie?«, hörte ich mich flüstern. »Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Ruhe!« Ich wollte ihn anschreien, diesen unheimlichen Störenfried. Aber ich schrie nicht. Ich bekam keinen Laut heraus. In meinen Ohren dröhnte es, als hätte sich ein Düsenjäger in meine Gehörgänge verflogen. Das war doch nicht … Das konnte doch nicht … Warum heute? Warum jetzt? Es rauschte im Hörer. Es rauschte in meinem Kopf. Ich wollte etwas sagen, egal was, konnte aber nicht. Der Mann namens Stiller sagte auch nichts mehr. Er WAR nicht von der Abo-Abteilung des Stern. Ich musste die Augen schließen. Bilder tauchten auf. Schöne Bilder, schreckliche Bilder. Er war jemand ganz anderes. Jemand, den ich vor dreißig Jahren im Arm gehabt hatte. Den ich an mich gedrückt und nie mehr hatte hergeben wollen. Er hatte schwarze Haare gehabt. Und dunkelbraune Augen. Er hatte mich unverwandt angesehen, während meine verzweifelten Tränen auf sein niedliches Gesicht getropft waren. Der Mensch, den ich so innig geliebt hatte wie niemanden sonst. Den mir diese kirchliche Organisation weggenommen hatte. Dem ich von Herzen nur das Beste wünschte. Für den ich immer noch betete, auch wenn ich mit diesem Verein nichts mehr zu tun haben wollte. Seit dreißig Jahren hoffte ich jeden Abend vor dem Einschlafen, dass er Menschen gefunden hatte, bei denen er glücklich war. Und diesen Mann hatte ich jetzt am Telefon? Er hatte mich gefunden? Warum rief er mich an? Was wollte er von mir? Das war der Moment, den ich erst jahrelang ersehnt und dann jahrelang gefürchtet hatte! Ich telefonierte mit dem Menschen, den ich verzweifelt hatte vergessen wollen und von dem ich nach wie vor jede Nacht träumte. Den ich erst vergeblich gesucht und dann aus meinen Erinnerungen verbannt hatte.
Die Einzige, die ihn damals noch gekannt hatte, war meine Mutter. Sie hatte mir in der Klinik bei dieser entsetzlichen Trennung beigestanden. Damals hatte ich nicht geahnt, dass es eine Trennung für immer sein würde. Es sollte doch nur vorübergehend sein. Bis es Mutter besser ging. Bis ich einen Job gefunden hatte. Dieses schreckliche, nie mehr angesprochene Geheimnis verband Mutter und mich. Ein Geheimnis, das mich daran hinderte, eine feste Beziehung einzugehen, eine Familie zu gründen, mich frei zu fühlen, mein Leben zu genießen. Ich fühlte mich schuldig. Jede Sekunde meines Lebens. Seinetwegen. Wegen dieses Mannes, den ich jetzt am Telefon hatte.
In meinem Kopf herrschte nichts als Chaos. Wieso hieß er Roman Stiller? Das passte doch überhaupt nicht zusammen! Er hieß doch … Nein! Wie er sich jetzt nannte, konnte ich doch gar nicht wissen! Nicht mal meine zwei besten Freundinnen Billi und Sonja kannten dieses Geheimnis. Aber dieser Mann am anderen Ende der Leitung kannte es.
Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Minutenlang starrte ich auf die Scherben der Vase, auf die Scherben meines bisherigen Lebens. Warum? Warum heute? An einem ganz normalen Samstag im Juli? Ich presste den Hörer ans Ohr. Hatte er noch weitergesprochen? Hatte er noch etwas gesagt? Oder hatte er aufgelegt?
Er war noch dran. Er atmete. Auch er war tief bewegt. Mir war, als hörte ich sein Herz durch die Leitung schlagen. Mein Mund formte ein O. Mit letzter Kraft brachte ich meine Stimmbänder zum Schwingen und einen heiseren, krächzenden Ton hervor.
»Oliver«, flüsterte ich. »Bist du das?«
3
Es war Oliver. Es war mein Sohn.
Er hieß nur nicht mehr Oliver, sondern Roman Stiller. Und er arbeitete als Journalist bei einem Verlag in Hamburg. Aber nicht beim Stern. Es war ein sportwissenschaftlicher Verlag, der Fachbücher und Fitnessratgeber herausgab oder so was in der Richtung. Sosehr ich auch versuchte, die Informationen zu verarbeiten, so fassungslos war ich über die Tatsache, dass er mich gefunden hatte. Nach dreißig Jahren.
Ich hatte damals alles versucht, um ihn zu finden. Alles. Schon drei Monate nach dem schrecklichen Tag, an dem sie Oliver holten, hatte ich meine Unterschrift bitter bereut. Dabei hieß es doch in diesem unseligen Dokument ausdrücklich, ich erkläre mich bereit, das Kind »in Pflege zu geben«. Und nicht zur Adoption freizugeben! Aber nach drei Monaten war Oliver spurlos verschwunden. Die kirchliche Organisation wollte mir keine Auskunft geben. Das dürfe sie nicht. Im Interesse des Kindes. Ich war damals fast gestorben vor lauter Kummer. Mutter war zu dieser Zeit sehr krank gewesen. Es hieß, sie habe nicht mehr lange zu leben. Ich war knapp siebzehn. Die Kirche hatte sich gekümmert. Um Mutter. Um mich. Um Oliver. Die Kirche hatte alles geregelt. Diskret. Der alte Schmerz loderte wieder auf.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!