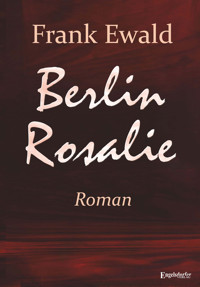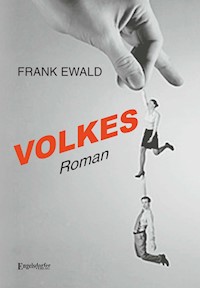
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Volkes - ein Tyrann, der seit ewigen Zeiten unter uns Menschen weilt und jedem die Hand reicht, um sich hofieren zu lassen. Der oben angekommen ist, wenn er auf sein Volk hinabblicken kann, das ihm zu Füßen liegt. Von den Menschen selbst an die Spitze gesetzt, kann er dort einsamer nicht sein. Denn auch Volkes möchte ins Licht hinein, aber ohne aus dem Schatten zu treten, der so dunkel wie feige ist. Keine Kleider, die das verstecken können, auch die dunkelsten nicht. Ein einziger Schritt nur, um das Licht der Welt zu erblicken. Doch die Menschen zweifeln. Sie müssten Volkes loslassen und selber laufen. Aber das können sie nicht. Sie können fliegen - vielleicht, aber loslassen können sie nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Ewald
VOLKES
Roman
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2018
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Lektorat: Dr. Gregor Ohlerich
Titelbild: Hand of power and control © Sergey Nivens
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
1. Innen
2. Außen
1. INNEN
Sie waren auf der Flucht im Hagel mit Blitz und Donner. Auf der Flucht vor Volkes. Denn Volkes hätte sie töten müssen, wollte er sein Geheimnis wahren.
Und sie wussten das.
Aber sie wussten nicht, ob sie standhalten würden. Unerträglich war der Gedanke, nicht zu wissen, wohin es ging, welche Richtung sie nehmen sollten.
Einer von ihnen war Max. Er war ein Läufer und er rannte durch einen Wald, einen weißen Wald, umgeben von Birkenstämmchen mit grünem Blätterrauschen nach dem Sturm, wo die Blitze aus Sonnenstrahlen waren, wie Pfeile, die vom Himmel schossen. In der Luft lag die Schwere eines Kampfes, einer Revolution.
Wie von Sinnen lief er, strauchelte und fiel. Das Laub duftete. Er spürte die Zeit, wurde getrieben von der Eile, am Leben bleiben zu wollen, und sprang auf, weil Laufen sein Leben war.
Und da dachte er an den Anfang zurück. Stillstand, zu Reihen erstarrt auf steinhartem Beton, einer Sackgasse gleich. Kein Argument, das noch etwas gezählt hätte. Der Hochmut vor dem Fall.
Seit jener Zeit lag das Städtchen dort unten in seiner grauen Tristesse vor dem Hafen. An manchen Tagen, wenn der Nebel von hier oben aus dem Birkenwäldchen hinunterstieg, wurde es von ihm verschluckt, wurde eins mit dem Grau des Meeres, als hätte es das Städtchen nie gegeben. Und noch etwas war ihm schon damals aufgefallen: Diese grauen Tage waren nicht über Nacht gekommen. Sie hatten ihre Zeichen vorausgeschickt. Erst kurz vor dem Stillstand waren keine Farben mehr zu sehen gewesen.
Max verstand es nicht. Wo waren sie geblieben? Extra wegen der Farben war er an diesen Ort gekommen, was ihn mit Stolz erfüllte, weil es nicht viele von ihnen bis hierher geschafft hatten. Doch für sein Hiersein gab es einen Grund und der hieß: Volkes.
Volkes war die Geschichte von der Suche, den eigenen Weg zu finden.
So hatte auch Max’ Weg dort begonnen, wo er für alle Menschen begann: bei der Mutter. Sie war es gewesen, die Max auf diese Reise geschickt hatte, sodass es für ihn schwer war zu sagen, ob er sein Ziel erreicht hatte, oder nicht. Einfach, weil er nicht wusste, wessen Ziel es war: das seine oder das seiner Mutter?
Dabei schien ihm seine Mutter immer kleiner als er selbst zu sein. Sie hatte ihn groß werden lassen und war dabei ins Unauffällige entschwunden. Wie in diesem Nebel. Doch für ihn war es wie ein Leuchten, als hätte es das schon immer gegeben, als hätte es ihm schon immer den Weg gezeigt, der ihn hierher ins Städtchen gebracht hatte. Ein Leuchten wie von einer schillernden Glasmurmel aus seinem Kindheitsreich.
Denn Volkes hatte hier sein Reich erschaffen, ein Vorzeigestädtchen, wie ein Spielzeugland mit Menschen drin. Einen Ort, wo die Bücher zu Hause waren und wo die Wissenschaft wohnte in all ihrer Überlegenheit, die strahlen sollte bis weit in die ganze Welt hinaus. Ja, überlegen wollte Volkes sein, über alles und jeden.
Den Preis dafür kannte Max noch nicht, wie ihn keiner seiner Kommilitonen kannte. Und vielleicht war es auch der Eifer. Dass sie vor Eifer brannten, immer höher steigen wollten, um es zu genießen, sich wissend zu fühlen, doch in Wahrheit wurden sie von Süße geblendet, auf dass sie das Feste nicht mehr vom Weichen unterscheiden konnten. Sie hatten die schlausten Bücher dieser Welt gelesen und wussten am Ende nicht einmal, dass selbst jedes Buch seinen Preis, seine Farbe hatte.
Volkes hingegen verstand nichts von Büchern. Und von der Wissenschaft verstand er auch nichts. Doch das war ihm egal. Ihm ging es allein um die Macht des Wissens. Er brauchte sie, um vor der ganzen Welt anzugeben. So fühlte er sich stark und überlegen, weil er glaubte, dass beste Land auf Erden erschaffen zu haben. Nur eben, dass es nicht sein Wissen war, sondern das seiner Leute.
Max fand das ungerecht. Sie hatten all die Arbeit und Volkes hoch oben behielt den Lohn für sich allein. Und das sollte richtig sein. Es stand in Parolen an den Wänden geschrieben und wurde im Fernsehen gezeigt. Die Masse selbst war es gewesen, denn sie hatte dafür gestimmt. Nur, wenn die Menschen geführt würden, könne kein Lohn ein höherer sein. Und die richtige Wahl hätten sie auch getroffen. Denn nur der Beste von ihnen wäre zur Führung bereit. So war es schon zu Volkes Großvaters Zeiten gewesen und Max fragte sich, warum die Wahl immer wieder Volkes Familie traf, weil auch das in den Parolen geschrieben stand, einer Prophezeiung gleich: Eine Familie aus Besten der Besten.
Doch das konnte nicht sein. Es gab da nämlich die Geschichte vom Amulett der Elite, die sich in einer Zeit weit vor Volkes Reich zugetragen hatte. Schon damals gab es den Wettstreit um die Besten. Aber dort blieben die Besten nicht unter sich. Sie gingen unter die Leute und forderten sie zum Mitmachen auf. Sie wollten das Amulett weiterreichen, es in Bewegung halten. Sie standen von ihren Plätzen auf und meinten, dass niemand einen Anspruch auf die Führung habe. Sie führen zu dürfen, sei ein Geschenk der Menschen, aus Vertrauen gemacht, das verdient werden müsse, weil es sich von keiner Süße blenden ließe.
Und was die Süße betraf, so kam hinzu, dass Max nicht allein auf seinem Weg war, eine gute Sache, nicht allein zu sein, verführerisch gut, um den eigenen Weg zu achten, um zum Schluss nicht am Ziel eines anderen zu sein.
Seine Verführung war Sophie, von Anfang an, fast so, als hätte er in ihr den Schatten seiner Mutter erkannt. Sie hatte sich auf den freien Platz neben ihn gesetzt, damals im Zug, als sie auf der Fahrt hierher ins Städtchen gewesen waren. Seither waren sie miteinander verbunden wie eine Selbstverständlichkeit, die nicht anders sein durfte, wie ein Gesetz, das in Stein gemeißelt war.
Es gab aber einen entscheidenden Unterschied, der sie nicht erstarren ließ, sondern der sie beweglich machte: Jeder konnte von seinem Platz aufstehen und laufen wohin er wollte!
Volkes reagierte wie von Sinnen. Überall ließ er Zäune errichten, Lampen aufstellen, die die Nacht zum Tage machten. Denn alle Menschen standen auf und liefen bunt durcheinander, wohin sie wollten.
Sie alle liebten das. Es war eine schöne Zeit gewesen. Es war ihre Zeit. Bewegung im Spiel der Farben. Das Gefühl, etwas tun, etwas mitgestalten zu können. Die Wissenschaft blühte und sie pflückten die Früchte vom Baum der Erkenntnis.
Doch Volkes, der diesen Baum selbst gepflanzt hatte, ließ noch mehr Zäune errichten. Und er fing an, sie in Ketten legen zu lassen, nein, keine aus Metall, sondern aus Menschen gemachte. Das war das erste Mal, wo sie bemerkt hatten, dass die Farben begannen, sie zu verlassen, wie sie sich von ihnen abwandten, sich auflösten – im Einheitsgrau der Wächter. Überall brach das Grau hervor, auf den Straßen und Plätzen, bald an jeder Ecke bis in die Häuser hinein.
Und mit einem Mal hatte sich alles so sinnlos angefühlt. Wie Laufen ohne Vorwärtskommen, wie ein Gaul im Kreis an der Leine. Alles, das sich zu wiederholen begann und dann verblasste, um schließlich einheitlich und grau zu werden, als hätte sich Volkes’ großer Schatten über das Städtchen gelegt wie eine Armee aus Schokoladensoldaten, die alles mit Schokofäden gefangen hielten. Damit sie selbst einen festen Stand hatten und stark sein konnten, keine Farbe annehmen mussten, frei von jeder Meinung sein durften und somit vor dem Licht der Verantwortung sicher waren, welches sie hätte schmelzen lassen.
Von nun an dauerte es nicht mehr lange und jeder von ihnen hatte seinen Schatten abbekommen. Sie hingen wie die Marionetten an den Fäden, niemand, der noch von seinem Platz aufstand, um allein zu laufen. Auch die Wissenschaft nicht. Dort waren die Farben also geblieben: in einem Schatten versteckt und von Wächtern bewacht.
Ja, Volkes hatte sein Spielzeugland mit Menschen drin!
Aber sie fühlten sich nicht wie Menschen, sie fühlten sich wie Maschinen und manchmal, wenn es Nacht war und die Maschinen abgestellt waren, flüchteten sie aus dieser Schattenwelt wie Geister. Sie trafen sich auf einem staubigen Pfad, der hinunter zum Hafen führte und an einem großen Palettenstapel endete, oder aber sie liefen hier hinauf zum Birkenwäldchen, welches die Schule, die Universität und den ganzen Campus einkreiste. Beide Orte waren geheim, denn sie wichen von der Linie ab und die Wächter kannten sie nicht.
Für die Orte, die die Wächter kannten, hatten sie ihre eigene Sprache entwickelt, eine Geistersprache sozusagen, mit der die Wächter nichts anzufangen wussten.
Meistens erzählten sie sich dann die Geschichte vom Amulett der Elite, weil die Geschichte ihnen Mut machte und ihnen Hoffnung gab, da sie in einer Zeit spielte, in der es noch keine Wächter gegeben hatte und die Farben noch da gewesen waren.
Und so soll es sich zugetragen haben, dass eines Tages ein Junge und ein Mädchen in das Städtchen kamen. Sie waren die besten Schüler des gesamten Landes. Jetzt sollten sie an der Universität in Wettstreit um das Amulett der Elite treten, denn nur einer von ihnen konnte der Beste sein. Und nur der Beste war gut genug, um alle anderen führen zu dürfen. Aber es kam anders: Die beiden verliebten sich ineinander. Sie wollten nicht gegeneinander antreten, sondern füreinander. Doch das konnte, nein, durfte nicht sein. Es gab nur das eine Amulett!
Da nahm das Mädchen ihren Jungen an die Hand und sagte: „Mag sein, dass dort oben nur Platz für den Gewinner ist, dem eine ganze Welt von Verlieren zu Füßen liegt, aber ich halte mein Glück in den Händen, weil es sich nicht erstreiten lässt, weil es nicht geblendet von Gold und Jade für jeden zu erreichen ist.“
„Das ist richtig!“, lobten sie die Professoren. „Nur, dass die Liebe keine Wege findet, weil auch sie wie Gold und Jade die Augen blendet, ohne Streit es aber niemals vorwärtsgeht. Das Beste im Menschen will erkämpft werden, sonst bleibt es im Stillstand versteckt. Es braucht die Bewegung, um sichtbar zu werden, um zu leuchten, damit die anderen die Wege finden.“
Aber das Mädchen nahm ihren Jungen noch fester an die Hand und sprach: „Niemand, der andere Wege braucht, die überall hinführen nur nicht zu sich selbst. Es braucht kein Leuchten, es braucht nur das kleine Licht, das in uns allen ist.“
Jetzt schüttelten die Professoren die Köpfe. Sie lachten und meinten: „Junge Frau! Die Wege entstehen nicht von allein. Sie werden von uns erschaffen, denn fliegen können wir noch nicht.“
Doch die beiden Verliebten sahen sich nur in die Augen und waren zum Wettstreit bereit.
Ja sicher, fliegen konnten sie nicht, aber ihren Weg gemeinsam gehen, konnten sie schon. Und sie schienen unschlagbar zu sein, es schien, als würden sie wirklich Flügel haben. Und sie kamen gemeinsam ans Ziel. Hand in Hand.
Nun lachten die Professoren nicht mehr. Denn nur einer konnte der Gewinner sein. Da nahm der Junge sein Mädchen auf den Arm und schritt über einen Graben, der das Ziel war.
Und die Professoren sprachen voll von Erleichterung: „Der Junge soll der Gewinner sein. Er allein trägt fortan das Amulett der Elite, dem sich jeder zu unterwerfen und zu dienen hat im ewigen Wettstreit, der Beste zu werden, um das Amulett einmal selbst in den Händen halten zu dürfen!“
Nun setzte der Junge sein Mädchen wieder auf den Boden zurück. Sie ließen den Graben hinter sich und kamen an einen Haufen aus Steinen, der eine weiße Spitze hatte und eine Treppe in der Mitte, die ihn wie einen Tempel erscheinen ließ. Sie stiegen die Stufen hinauf bis zur Spitze. Und eine ganze Welt von Verlierern tat sich vor ihnen auf.
Da nahmen die zwei das Amulett der Elite, ließen es fallen und traten es mit den Füßen, auf dass es in Tausende Stücke zerbrach. Der Junge machte große Seifenblasen mit seinem Mund, die schillerten wie ein Zauber und in jede von ihnen fand ein Stück des Amuletts seinen Platz. Das Mädchen schickte die Seifenblasen auf den Weg hinunter zum Volk.
Und sie sagte: „Ab jetzt soll jeder ein Teil der Elite sein, denn das Teilen ist die Unsterblichkeit. Aber die Spitze kann das Beste nicht sein, dort oben ganz allein, geschultert von der Masse wird sie einsamer nie sein.“
Und da rief das Mädchen den Seifenblasen hinterher: „Teilet euch zu Millionen und nehmt dabei die Elite mit! Von nun an wird jeder ein Gewinner sein, weil er nicht dagegen kämpft, um füreinander da zu sein.“
Volkes hasste diese Geschichte so sehr, dass es unter Strafe verboten war, von ihr zu erzählen. Aber es hinderte die Menschen nicht, im Gegenteil, es machte die Sache noch spannender.
Was nur war so beängstigend daran, von seinem Platz aufzustehen und von allein zu laufen? Früher, als sie noch klein gewesen waren, hatten sie alle diesen Punkt erreicht, der ihren Müttern Angst machte. Aber niemand von ihnen hatte sich aufhalten lassen.
Und jedes Mal, wenn sie die Geschichte zu Ende erzählt hatten, waren sie sich ein Stück weit sicherer, dass selbst Volkes nicht halten konnte, was sich nicht halten ließ: die Zeit. Denn auch ihre Zeit würde kommen.
So lebten sie also in zwei Welten: einer maschinengleich überwachten und einer aus Träumen gemachten – irgendwo auf der anderen Seite des Meeres, die viel mit Alkohol zu tun hatte. Und wenn sie aus ihrem Rausch erwachten, stellten sie ernüchtert fest, dass sich die Welten immer weiter voneinander entfernten. Wie zwei Sterne, die sich umkreisten, die miteinander verbunden waren, um doch nicht zueinander zu finden.
Das genau war der Punkt, an dem sich die Gewöhnung einstellte und wo der Stillstand begann. Sie durften sich nicht noch weiter voneinander entfernen. Es ging nicht. Sie hätten damit die Welt zerstört.
Selbst Volkes merkte, dass etwas nicht stimmte. Und er reagierte: ließ noch mehr Wächter aufmarschieren, noch mehr Zäune bauen. Er ging sogar soweit, dass er sich selbst aufmachte und das Land bereiste. Aber es war zu spät, die Entfernung unüberbrückbar abgekapselt.
Und plötzlich kam es Max vor, als flögen Seifenblasen durch das Städtchen, die zwar schillerten, die aber ihre Farben für sich behielten. Sie gaukelten ihm eine bunte Welt vor Augen, die wie der Durst war, der immer stärker wurde, weil ein voller Krug zu Boden fiel.
Also fing Max zu laufen an. Er lief den Seifenblasen hinterher, er lief in die Dunkelheit hinein, bis es Nacht wurde und der Mond sich zwischen den Wolken zu verstecken suchte. Er lief und wusste nicht, wohin. Doch Sophie hielt seine Hand, ein Gesetz, das auf immer in Stein gemeißelt stand. War Max auch groß und stark, war es diese kleine Hand, mit der er stets zu sich selber fand.
* * *
Max fühlte das Fliegen und Landen von Sophies Haaren auf seiner Haut. Die Nacht lag schon über dem Birkenwäldchen, der Wind wurde stärker und ein Gewitter zog auf. Das war seltsam. Ein Gewitter so früh im Jahr. Plötzlich traf die beiden ein helles Licht. Ein Donnern schien auf sie zuzukommen, doch wurde es zur Musik aus Stimmen mit einem Rhythmus aus Verachtung. Sophies Atem stockte. Sie zitterte, bis sie erstarrte.
„Die können noch nicht weit sein“, zerhackte eine tiefe Stimme die Luft und schien sich vor das blendende Licht zu schieben.
Es wurden die Silhouetten zweier Wächter sichtbar, scharf abgegrenzt und eingehüllt in den Hauch des Atems.
„Sie müssen ja irgendwo sein!“, fuhr erneut die Tiefe dieser Stimme in die Stille.
Das Klicken eines Feuerzeuges ging. Die Gesichter der beiden Wächter leuchteten auf.
„Wir hätten sofort zugreifen müssen!“
„Nein, hätten wir nicht. Die Sache wäre aufgeflogen.“
„Soll ich die Hunde rufen?“
„Nein! Keine Hunde! Kein Aufsehen!“
Sich entfernende Schritte und das Klappen der Wagentüren. Dann ein Schlag von Dunkelheit, total.
„Wie recht du hattest, Max!“
Sophies Stimme war monoton. Ihre Hilflosigkeit war einer Wut gewichen, die in dieser Finsternis bedrohlich klang.
„Bloß weg hier!“, platzte es aus Max heraus.
Auch seine Angststarre löste sich. Er ertastete Sophies Körper, brachte ihn vor seinem und schob sie zwischen den Betonplatten entlang. Wieder auf der Straße liefen sie in die Stadt zurück. Die wurde noch immer vom Zucken der Blitze überzogen, vom Donner eingehüllt. Sophie mochte die Dunkelheit nicht. Max wusste das. Ihm wehte ein Schwall von Sophies Parfüm in die Nase. Es roch lieblich, blumig. Es roch nach Sommerwiese.
Der Donner wurde leiser und es wurden Schreie hörbar, die prasselten wie Hagel in der Nacht. Das Licht der ersten Straßenlaterne stemmte sich gegen die Dunkelheit. Die Sicht tat gut. Erleichterung ging durch ihre Körper.
„Und jetzt, Max? Was machen wir jetzt?“
Er schnappte ihre Hände, tanzte im Kreis, küsste ihre Wangen, lachte laut und führte sie fest umschlungen die Straße entlang.
Ein Militärlaster überholte sie, wurde langsamer und ließ sich bis auf ihre Höhe zurückfallen, um sie einige Schritte zu begleiten. Max konzentrierte sich auf Sophie. Der Laster wurde wieder schneller. Sein Motor heulte auf und sie standen in einer Wolke aus Abgas. Die Heckplane flatterte halb zugezogen. Es waren müde Gesichter von Wächtern zu erkennen, die zusammengekauert ihre Gewehre umschlungen hielten.
„Ruhig, Sophie! Die haben uns nicht erkannt.“
Sophie blieb stehen und warf einen sehnsuchtsvollen Blick in die Dunkelheit.
„Willst du zurück?“
Sophie sah ihm in die Augen und schüttelte den Kopf. „Nein.“
Sie stand im Laternenlicht. Wie schön sie war! Doch ringsherum war es Nacht und finster auch. Sophie aber leuchtete wie eine Insel der Hoffnung an diesem Ort der Hoffnungslosigkeit. Sie stand einfach nur da und sah ihn an, fragte ihn, ohne Worte zu sagen, als würde der Streifen über ihren Augen zu ihm sprechen: ein helles Muttermal, das seine Farbe ändern konnte.
Sie bogen in die kleine Straße Richtung Hafen ein. Es war ihnen, als wäre noch mehr Stacheldraht verlegt worden, als stünden noch mehr Stahlsperren in der Gegend herum. Die Luft roch rostig. Am Stacheldraht hingen Wassertropfen, die orange im Laternenlicht funkelten, das die ganze Straße ausleuchtete.
Die Schreie kamen näher. Im Hintergrund war das Rauschen des Meeres zu hören. Die Lagerhalle am Pier stand im gleißenden Schein, von den Zuckungen des Blaulichts zerhackt. Sophies schien wie in Trance.
„Volkes hat es wirklich getan!“, sagte sie.
Ihr Streifen auf der Stirn war rot, nein dunkelrot, ja lila sogar.
Und abgesehen von den Sommersprossen, die ihre Nase betupften und mal dunkler und mal heller werden konnten, war es eben dieser schmale Streifen gleich über den Brauen, der so oft ihr Inneres verriet.
Max konnte den Laster erkennen, der sie gerade überholt hatte. Er parkte an der Rampe. Die Wächter stiegen aus und machten sich ans Werk, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes getan, als Menschen zu verhaften, zu treten, zu schlagen und zu demütigen.
Menschen wurden hier verladen wie Vieh. Und alle kannte er sie, jeden einzelnen. Nur Max stand hier in Sicherheit – mit Sophie im Arm. Eine Mischung aus Mitleid und Eitelkeit, das Richtige getan zu haben, stieg in ihm auf, wie ein Drang zum Losrennen, der in Beton gegossen erstarrt war. Er fasste Sophies Schulter und drückte sie fest an sich.
Gegenwehr konnte er keine erkennen. Die Leute ließen sich bereitwillig auf die Ladefläche des Lasters heben, begleitet vom Schweigen der sie umringenden Menge.
Als beide an der Halle ankamen, war der Spuk vorüber. Durch das Hallentor konnte Max eine Gruppe von Studenten erkennen, umringt von Wächtern. Stille lag über dem Hafen. Es roch brenzlig. Einige Flammen flackerten noch in der Ferne. Aber die Lage schien ruhig zu sein.
* * *
Sophie wirkte noch immer wie in Trance, als sie sagte: „Die Häscher haben, was sie wollten.“
„Nein, haben sie nicht“, rief Max laut in die Halle hinein, sodass er selbst vom Widerhall seiner Stimme überrascht war. Alle drehten sich um und starrten sie ihn an. Ein Raunen ging durch die Luft.
„Max – du?“
„Ja – ich!“
„Wir dachten, ihr seid …“
Ein Wächter steckte dem Redner die Spitze seines Schlagstocks unter das Kinn.
Sie sahen sofort zu Boden, als plötzlich Volkes hinter ihnen hervortrat. Er kam einen Schritt näher. Und dann noch einen, und immer langsamer werdend, meinte er: „Euch habe ich verschont, als Zeichen meines guten Willens. Es gibt keinen Grund für euren Widerstand. Das alles ist Einbildung, eine Fata Morgana in euren Köpfen.“
Volkes stand jetzt direkt vor Max und Sophie.
Max war erstaunt. Volkes kam nur selten in das Städtchen. Er wirkte müde, ja alt. Seine Zähne waren schlecht. Er machte eine Handbewegung. Die Halle leerte sich, bis die beiden mit ihm allein waren. Nur ein kleiner Junge blieb zurück.
Viele dieser Burschen waren noch halbe Kinder, und doch wirbelten sie schon zwischen den Wächtern herum, einer Schar Küken gleich. Immer an Mamas Seite. Eine uniformierte Einheits-Mama, sozusagen, die wie Milch substituiert wurde, bis hin zur totalen Entwöhnung. Erst dann waren sie Waisenkinder mit Familie, die sich nicht anderes vorstellen konnten, als einmal Wächter zu werden, um Volkes dienen zu dürfen.
„Sicher – alles nur Einbildung mit dem Geruch nach verbranntem Menschenfleisch!“, zischte es aus Sophie hervor.
Volkes’ Augenschlag traf sie mit derartiger Wucht, dass sie zuckte.
Doch sein sonst so starker Körper wirkte angeschlagen. Die braun gebrannte Haut glänzte im Hauch aus Schweißtröpfchen, die sich im Flackern der Flammen spiegelten. Das Ganze wirkte merkwürdig auf Max. Solch ein brutales Vorgehen hatte er Volkes mit seinen Wächtern nicht zugetraut, obwohl das Heer seiner Wächter inzwischen unvorstellbar groß geworden war. Sie waren überall und nirgends. Eine Armee aus Schatten der Gleichheit, unsichtbar, doch immer da. Wie diese Soldaten, die man in einen Bottich mit flüssiger Schokolade getaucht hatte. Wer konnte jetzt noch sagen, wo Soldat und wo Schokolade war? Und was blind machte, war gefährlich. Man wähnte sich in Sicherheit, sodass Sophie meinte, sie bräuchte keinen, um beschützt zu werden. Aber das stimmte nicht. Sie fand nicht einmal alleine nach Hause, wenn man sie irgendwo zurückgelassen hatte. Und sie tat alles für Schokolade, egal ob fest oder weich, wenn sie denn nur süß war.
„Sieh dich doch um! Die haben alles verbrannt. Sie haben getreten und geschlagen. Ist das eine Fata Morgana?“
„Ja, das ist eine Fata Morgana, Sophie. Weder ich noch die Wächter schlagen die eigenen Leute. Der Kampf, den ich führen muss, gilt nicht euch. Und das wisst ihr. Es ist der Kampf gegen die, die uns zerstören wollen, die kommen, um sich in unseren Köpfen breitzumachen und die dann unser Denken und Handeln bestimmen. Solange, bis wir schließlich auf uns selbst losgehen, um uns zu vernichten.“
Volkes war immer ein gut aussehender Mann gewesen, der von sanftem Gemüt sein konnte. Ein Mann, dem man sich ohne zu zögern anvertraute, weil sein Lächeln ansteckend war und der Blick seiner Augen Verständnis entgegenbrachte, auch wenn keine Worte gesprochen wurden. Bisher war es ihnen nie in den Sinn gekommen, sich vor Volkes zu fürchten. Ihnen war doch klar, dass Volkes in einer anderen Welt lebte, die mit der ihren nichts zu tun hatte. Wenn sich beide Welten nicht berührten, konnte nichts schiefgehen. Wovor hätten sie auch Angst haben sollen?
„Uns v… vernichten“, stotterte Sophie trotzend. „Mich will niemand vernichten. Dich vielleicht?“
„Nicht nur mich. Auch dich und Max. Uns! Sie verhalten sich wie Bazillen. Bazillen aus Wahnsinn gemacht. Sie sind klein und unauffällig, ohne Geschmack, mit fehlendem Geruch. Sie heften sich an jeden, machen keinen Unterschied, ob König oder Bettler.“
Volkes hatte keinen Zugang zu Sophies Welt, sodass es an ihr nichts auszusetzen gab. Denn im Handeln war sie seine treueste Anhängerin, nur ihr Denken blieb ihm fremd.
Sophies Streifen auf der Stirn wurde wieder rot. Sie holte tief Luft.
„Ja, das wissen wir doch, Volkes“, kam Max ihr zuvor, „du kennst Sophie! Sie kann es nicht leiden, wenn man sie beschützen will. Sie ist schon ein großes Mädchen.“
Ein Lächeln huschte über Volkes Gesicht, das er aber sofort in ein Korsett voll Strenge presste, ohne jedoch verhindern zu können, dass ihm ein Hauch von Mitgefühl entwich.
„Sie ist eben ein Mädchen, Volkes. Sie hat Sorge wegen deiner Strenge. Sie will dir weder Probleme machen noch Widerstand vom Zaun brechen. Sie mag den Geruch von verbranntem Menschenfleisch nicht und kann Gewalt nicht ausstehen.“
Volkes strahlte. „Ja, ja, die Sophie. Sie wird immer unser kleines Mädchen bleiben. Wunderschön. Doch ist auch Gewalt im Spiel, damit sich die Schönheit entfalten kann. Aber euch würde ich niemals Gewalt antun. Das wisst ihr doch, oder?“
Sophies Rot stieß auf die gekreidete Wand der Ohnmacht. „Volkes“, flüsterte sie, „weißt du denn, wer infiziert ist und wer nicht, wenn die Bazillen so klein sind, dass sie keiner sieht?“
Volkes rief den Jungen zu sich heran. Der kam näher und streckte Max sein Händchen entgegen. Das Gesicht ölverschmiert starrten seine Augen riesig. Aber er schwieg.
Der Junge ging los und Max folgte ihm. Noch immer roch es verbrannt. Noch immer wackelten einige Flammen in der Dunkelheit der Halle. Sie kamen an die Stelle, wo Wächter die Verwundeten verbunden hatten, die sie selbst zu Verwundeten gemacht hatten. Reste der Verbände lagen herum. Sie waren noch frisch und blutverschmiert.
Das also sollte Volkes’ Geschichte von den eigenen Leuten sein, ging es Max durch den Kopf. Er sah einige Fetzen Kleidung auf dem Boden liegen. Und eine Uhr. Ein Brillenglas auch.
Am Ende der Rampe standen drei Fässer Altöl, an deren Stutzen jeweils eine Handpumpe baumelte, die im Licht der Flammen blitzten. Die Fässer hingegen wirkten dreckig und stumpf. Der Junge schob seinen zerrissenen Hemdsärmel bis über die Schulter und ließ einen Arm in einem der Fässer verschwinden.
Zunächst konnte Max gar nichts erkennen. Er sah nur eine fließende schwarze Masse, die sich durch Abtropfen zu formen begann: zum Ärmchen des Jungen und dann die Hand dazu, an deren Finger etwas noch Kleineres sichtbar und schließlich glänzend wurde.
„Das ist ein Stück vom Amulett der Elite!“, rief Max erstaunt aus.
Der Junge nickte heftig und seine Augen wirkten jetzt noch größer.
„Wie kommt ein Stück vom Amulett der Elite in ein Fass mit Altöl?“, wollte er von dem Kleinen wissen.
Für einen Moment ging der Blick des Kleinen in die Ferne der Halle und es umgab ihn dabei der gleiche Stolz, wie ihn Max auch von Sophie her kannte.
Dann begann der Junge, mit einem Putzlappen das Öl vom Amulett zu wischen. Mit einer Vorsicht, die fast schon zärtlich, ja unterwürfig wirkte.
„Wie in Gottes Namen kommt das Amulett …“, hakte Max noch mal nach.
Doch der Junge hob nur die Schultern und legte ihm das glänzende Amulett in die Hände. Sein Gesicht, die Hände und Arme waren ölverschmiert, die Kleidung zerrissen, aber er strahlte und verschwand, ohne dass er je ein Wort gesagt hätte.
Volkes und Sophie eilten herbei. Max drehte sich um und übergab das Amulett an Sophie.
„Nun – Sophie?“
Volkes Stimme klang, als wäre sie in einen Abgrund gefallen.
„Kannst du mir sagen, was euer Heiligtum in einem Fass mit Altöl macht?“
„Nein, kann ich nicht. Aber du, Volkes, du kannst es sagen. Wer, wenn nicht du?“
Volkes schien unberührt. Schuldgefühle kannte er nicht und ihre Anwürfe erreichten ihn nicht. Doch es war, als müsse er sich zur Strenge zwingen: „Sophie! Wo bist du?“, wurde Volkes lauter und fing dabei ihren Blick ein, der mit einem Ruck im Hier und Jetzt aufschlug. „Es ist ein Stück Gold, Sophie, das du bei jedem Juwelier um die Ecke kaufen kannst. Und jetzt, wo du es in den Händen hältst, bist du nichts anderes geworden. Du bist weder unsterblich noch hast du Flügel. Es ist nur ein Stück Gold, weiter nichts!“
Sophies Augen wurden seltsam leer, als würde sie entschwinden.
„Der Rest der Geschichte ist in deinem Kopf. Die Bazillen des Wahnsinns sind es, die dich glauben lassen, das Amulett der Elite würde Flügel verleihen.“
Volkes stand kerzengerade da und blickte Beifall haschend um sich, als würde er ringsum von anhimmelnden Wächtern bewundert und das, obwohl keine Wächter in der Halle waren.
Und was die Geschichte des Amuletts betraf, so erzählten sich die Leute auch, dass Volkes Großvater gar keine Wächter und sein Vater nur wenige Wächter gehabt hatte.
Aber das interessierte Volkes nicht. Mehr noch, er meinte, das wäre Schwäche gewesen. Die wahre Größe erwachse durch Kontrolle, nur sie gäbe die Sicherheit, um wachsen zu können. Und Volkes hatte sich das Ziel gesetzt, eines Tages größer als sein Großvater und Vater zusammen zu sein. Dabei übersah er die Gefahr, dass sich Größe oft ins Unübersichtliche verlor. Was, wenn sich seine Wächter selbst mit den Bazillen des Wahnsinns infiziert hatten? Womöglich würden sie krank, weil Volkes Größe nichts mit der Wahrheit zu tun hatte und sie litten zeit ihres Lebens am Fieber der Rastlosigkeit.
Sophie hielt das Amulett der Elite in ihren Händen. Ein gleißender Schein von Schönheit.
Wusste sie eigentlich, dass sie selbst ein Kristall war? Und dass nicht einmal Volkes willens war, einen Kristall zu zerbrechen?
Max hingegen wäre von Volkes zerbrochen worden wie eine überflüssige Flasche. Denn ganz bestimmt hatte Volkes auch seine Schwierigkeiten mit dem Sehen. Er ließ sich von diesem Kristall blenden, egal, ob er dabei draufging oder nicht. Sophie hatte einmal erklärt, dass sich niemand vor dem Tod zu fürchten brauche, eigentlich gäbe es gar keinen Tod. Der Tod und das Leben seien ein und dasselbe, so wie auf der einen Seite das Licht auf- und auf der anderen unterginge, weil die Erde rund war.
Sogar der Hohe Rat der Wächter hatte das Amulett der Elite nie zu Gesicht bekommen. Es war einer Sage gleich, die schon zu Zeiten von Volkes’ Großvater erzählt worden war. Damals hatte das Amulett der Elite den Segen für eine bessere Zeit verkündet, hatte für einen noch besseren Anführer gestanden. Jetzt war es zum Fluch der Gegenwart geworden. Vielleicht mochte das der Grund dafür sein, dass Volkes die Geschichte vom Amulett vor den Wächtern geheim hielt, denn sie erzählte von der Macht des Wissens und diese Macht sollte nicht die der Wächter sein.
Und die Leute sagten zudem, dass Volkes Großvater ein Held gewesen war, weil er unter die Menschen gegangen war und mit ihnen geredet hatte, dass er beliebt gewesen war, dass er keine Zuchthäuser errichten lassen und sich nicht vor seinen Nachbarn gefürchtet hatte. Gerade das Letzte war allerhand. Kaum einer mochte es glauben, denn schon eine Generation später, war eine Freundschaft mit den Nachbarn undenkbar geworden.
So war es auch Max als Kind erzählt worden. Wer aus dem Land entkommen wolle, müsse Flügel haben und nach oben hinaus. Es gäbe nur diese Richtung.
Schon damals hatte er sich gefragt, warum Menschen fliegen können müssen, um zu leben. Normal fand er das nicht, denn es hieß, zu Volkes’ Vater aufzuschauen und ihm zu folgen, dabei nicht nach rechts oder links zu sehen. Zu Hause zu sein in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter, ohne zu wissen, wer sie eigentlich waren. Nachbarn, die niemand kannte. Nachbarn, mit denen jeder fliegen musste, aber deren Böden, deren Häuser keiner betreten durfte. Denn das war nicht erwünscht. Fragen nach der Herkunft interessierten keinen. Die Persönlichkeit eines jeden entfaltete sich erst im Fluge. Niemand, der noch Boden unter den Füßen hatte, eine Spur hinterließ, verwurzelt war. Ein Leben wie bei den Ameisen, wo die einzelne nichts gezählt hatte.
Oh ja, das wussten sie schon als Kinder: Menschen mussten Flügel haben.
„Nein, Flügel verleiht das Amulett keine“, sagte Sophie, „aber Kraft!“
Volkes’ Züge wurden noch ernster.
„So, Kraft!“, brüllte er los. „Deine Kraft ist Einbildung, Sophie. „Aber mit mir nicht! Ich lasse mich durch eure Spinnerei nicht verrückt machen!“
Volkes Gesichtsfarbe verkehrte sich von rot zu lila. An seinen Mundwinkeln klebte Spucke.
„Ich verstehe euch nicht. Ihr habt alles bekommen: Bildung, Arbeit, seid in Familien groß geworden, könnt wählen, ob ihr Wissenschaftler oder Wächter werden wollt. Die Menschen weltweit beneiden euch dafür. Und – was macht ihr?“
Volkes trat dicht an Sophie heran.
„Was macht ihr?“
Die Spucke riss von seinen Mundwinkeln ab und flog durch die Gegend.
„Ihr huldigt einem Stück Gold, als sei es euer Lebenselixier. Das ist doch krank! Krank, krank!“
Der Widerhall der Schreie tobte durch die Halle.
„Das ist keine Gewalt, Sophie“, fuhr Volkes mit leiser Stimme fort, nachdem er sich wieder beruhigt hatte. „Es ist Heilung für uns alle. Und die Medizin ist manchmal bitter und das Genesen tut weh! Habt ihr das nicht schon bei euren Eltern gelernt? Selbst Flügel würden euch da nicht helfen.“
Dabei wäre Max gerne einmal zu Sophies Eltern geflogen. Einfach so. Nur um sie kennenzulernen. Aber Sophies Eltern hatte er niemals gesehen. Und er hatte Sophie auch niemals seine Mutter vorgestellt. Selbst für Max war das schwer erklärbar, weil eigentlich nichts dagegensprach. Doch nein. So etwas machte keiner. Max nicht und Sophie auch nicht.
Max wusste aber, dass Sophies Vater Astronom war. Und er bewunderte ihn, ohne dass er ihn kannte. Wobei, etwas kannte er ihn schon, denn Max hatte in der Zeitung einen Artikel gelesen, in dem er berichtete, wie er einen Planeten in einem anderen Sternensystem entdeckt hatte. Sophie konnte damit nicht viel anfangen. Sterne langweilten sie. Aber Max war begeistert.
Vielleicht lag es daran, dass Max auch gerne einen Vater gehabt hätte. Er hatte seine Kindheit mit seiner Mutter allein verbracht und er stellte es sich toll vor, wäre es anders gewesen. Dabei war seine Mutter immer sehr fürsorglich gewesen. Sie hatte ihn immer geschützt. Und dennoch, seine fehlende Bereitschaft zum Risiko, das Weglaufen vor den Dingen hatten ihn zum Läufer werden lassen.
Ganz anders sein Vater, den er zwar nicht wirklich kennengelernt, da er kurz nach seiner Geburt einen Unfall hatte, der ihm aber weit über seinen Tod hinaus mit seinen Ideen in Erinnerung geblieben war. Man sagte, sein Vater hätte nahezu zu allem eine unkonventionelle Idee gehabt, wie die Dinge anders und besser gemacht werden könnten. Es hieß, dafür wäre er im ganzen Land bekannt gewesen, auch bei Volkes’ Vater, der ihn hin und wieder als Berater zu sich gerufen hatte. Und man sagte weiter, dass manche seiner Ideen weit über das Ziel hinausgeschossen seien, soweit, dass sie den Horizont der Regierenden überschritten und als gefährlich gegolten hätten. Und insgeheim sagte man sogar, der Unfall seines Vaters wäre kein Unfall gewesen, nein, da wäre nachgeholfen worden – was seine Mutter hätte fast verstummen lassen, auf ewige Zeit.
Nun ja, Max war noch zu klein gewesen. Und die Leute haben sich viel zu erzählen. Einiges mochte stimmen, anderes nicht. Seine Mutter meinte, dass es Gerüchte seien, pietätlose Gerüchte - so etwas gehöre sich nicht.
Volkes stand noch immer kerzengerade. Aber sein Gesicht war friedlich.
„Diesmal habe ich euch verschont. Nicht nur weil ihr gesund seid. Nein, weil ihr stark seid. Ihr könnt es allein schaffen. Und ihr braucht dafür das Amulett der Elite nicht.“ Er lachte voller Hochmut. „Für die anderen gibt es kein Amulett. Noch nie hat es jemand gesehen. Es gibt nur eine Geschichte!“
„Und der Junge?“, wollte Sophie wissen.
„Was für ein Junge?“ Volkes badete in einer Woge aus Macht. „Der Junge ist noch gesund. Für ihn ist es die Geschichte von einem Stück Gold, das in einem Fass mit Altöl lag. Um den Jungen braucht ihr euch also nicht zu sorgen. Allein um euch solltet ihr in Sorge sein.“
Max und Sophie konnten es kaum fassen. Bisher hatte Volkes alle die verhaften lassen, die es auch nur gewagt hatten, vom Amulett der Elite zu erzählen. Und nun hielten sie etwas in ihren Händen, was es eigentlich nicht gab. Es gab nur eine Geschichte, an die sie glaubten. Der Glaube war es, der diese Geschichte besonders machte und nicht das Stück Gold, das in ihr steckte.
* * *
Sophie wirkte verstört. Das Gewitter war vorüber und die beiden liefen zurück durch das Birkenwäldchen, dem Wohnheim entgegen. Hoch über ihnen thronte die Schule im fahlen Mondlicht. Für Sophie war die Schule wie ein Berg der Heiligkeit. Aber mal davon abgesehen, dass es sich hier tatsächlich um die einzige Erhöhung weit und breit handelte, die nämlich genau 91 Meter über Meeresspiegel erreichte, hatte sie nichts Heiliges an sich. Die Schule war ein nichtssagender Neubaukasten, hinter dem sich ein noch größerer Neubaukasten – die Universität – anschloss. Beide waren sie grau und hässlich.
Manchmal, wenn es regnete und die Düsternis über das Städtchen hinweg zog, waren auch die Schule und die Universität wie verschluckt, wie aufgelöst. Der Berg stand dann ganz allein da und sah aus wie eine grüne Nase auf grauem Grund. Was ihm auch seinen Namen eingebracht hatte. Er wurde Hoppelnase genannt.
Auf Max’ Haut fühlte es sich schon an wie Frühling. Aber nein, ganz sicher war er sich nicht. Es lag noch Schnee vereinzelt in schattigen Ecken übriggeblieben, der ihn daran erinnerte, wie diese Düsternis von der Hoppelnase bis in das Städtchen hinabgestiegen war. Und auch jetzt im fahlen Mondlicht schien es ihm wie eine Reise in die Vergangenheit. In eine Zeit vor dem quadratischen Neubau, vor der quadratischen Ordnung. Das war komisch. Nicht, weil die Neubauten fehlten, nein, weil alles um ihn herum bunt erschien, wenn auch etwas verblast, so doch bunt, obwohl er inmitten in der Düsternis stand.
Das aber wirkte gespenstisch auf ihn. Denn da waren diese Seifenblasen, die mehr und mehr spürbar wurden und die ihn nie wieder loslassen sollten. Ja, Max fühlte sich, wie in einer Blase gefangen. Auch Sophie war in einer gefangen. Und Volkes. Und Volkes Vater. Alle waren sie in Seifenblasen gefangen und betrachteten die Welt. Jeder auf seine Weise.
Das also sollte die Antwort sein, warum Menschen fliegen können mussten. Da war sich Max sicher. Sie fühlten sich in den Seifenblasen alleingelassen, brauchten Flügel und wollten nach oben hinaus, wollten gemeinsam fliegen und den Boden unter den Füßen verlieren.
Für Sophie war dieser Ort des Fliegens die Schule. Anders jedenfalls konnte Max es sich nicht erklären, warum Sophie oft auch nachmittags die Hoppelnase hinaufstieg. Sie setzte sich auf die Stufen der Eingangstreppe und las ein Buch. Auch im Winter, wenn es kalt war. Von dort aus hatte sie einen guten Ausblick hinunter auf das Städtchen. Gleich am Fuße standen das Wohnheim, die Sporthalle, Mensa und Wächterbaracken. Solange Volkes’ Vater geherrscht hatte, war es nur eine einzige Baracke gewesen, aber als Volkes an die Macht gekommen war, hatten sie begonnen, den gesamten Berg grau zu umfrieden.
Hinter den Sportanlagen folgte der weitläufige Park bis an den Hafen. Obwohl der Hafen eher eine Fabrik zu sein schien, mit Häusern, Hallen, Kränen und vielen Fahrzeugen. Er war so groß, dass er die Hälfte des Städtchens umfasste und das Meer auf Abstand hielt. Strand gab es nicht, nur Beton und Stahl. Gummireifen sollten die Bootsleiber vor der Härte des Stahls schützen.
Sophie übrigens mochte das Meer, weil es grenzenlos war. Und wenn sich ihre Augen von den Buchseiten lösten, um auszuruhen, konnte sie auch landeinwärts über das Städtchen sehen. Da gab es die alten Häuser, die einmal bunt gewesen waren, bevor sie verblasten, und es gab die neuen Häuser, die grauen, quadratisch ausgerichteten. Es gab sogar zwei Kirchtürme. Die dienten aber nur als Museen, weil die Religion schon lange tot war. Und Straßen mit Bäumen gab es natürlich auch. Dahinter gab es nichts mehr. Alles verlor sich in einer nicht enden wollenden Weite aus Feldern und Wiesen, die von einer Fernstraße und einer Eisenbahnlinie zerschnitten wurden, die gerade auf den Ort zuliefen, sich dann teilten, ihn einschlossen und am Hafen zusammentrafen.
Die Lehrer fanden es nicht gut, dass Sophie die Nachmittage auf der Hoppelnase verbrachte. Und Max fand es auch nicht gut. Die Lehrer duldeten Alleingänge ihrer Schüler nicht, alles hatte in Gruppen zu erfolgen. Und Max hätte Sophie lieber in seiner Nähe gewusst.