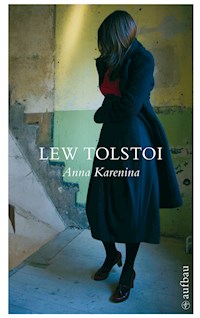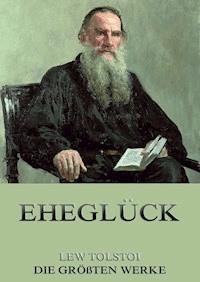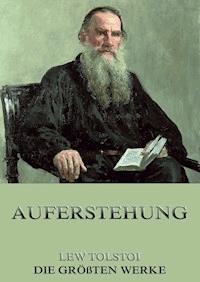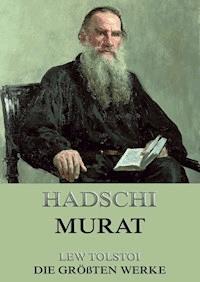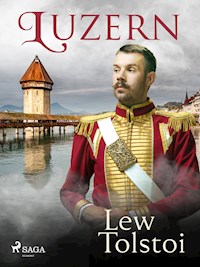0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band 'Volkserzählungen' enthält mehrere kürzere Prosastücke des russischen Schriftstellers Lew Tolstoi: Die drei Tode, Der Schneesturm, Albert, Luzern, Polikei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LUNATA
Volkserzählungen
Lew Tolstoi
Volkserzählungen
© 1913 Lew Tolstoi
Originaltitel Narodnye rasskazy
Aus dem Russischen von Alexander Eliasberg,
Hermann Röhl, Karl Nötzel
© Lunata Berlin 2021
ISBN: 9783752674958
Herstellung und Verlag: BoD - Books on Demand, Norderstedt
Inhalt
Die drei Tode
Der Schneesturm
Albert
Luzern
Polikei
Die drei Tode
1
Es war Herbst. Auf der Landstraße fuhren in schnellem Trab zwei Equipagen. In der vorderen Kutsche saßen zwei Frauen: die eine, die Dame, war hager und bleich, die andere, das Dienstmädchen, hatte glänzende rote Wangen und eine volle Figur. Ihre kurzen trockenen Haare drängten sich unter dem verschossenen Hut hervor, und die rote Hand im zerrissenen Handschuh brachte sie immer wieder hastig in Ordnung. Die hohe, mit einem bunten Tuch bedeckte Brust atmete Gesundheit; die flinken schwarzen Augen verfolgten bald durch das Wagenfenster die dahinschwindenden Felder, bald blickten sie scheu auf die Herrin, bald schweiften sie unruhig über die Ecken der Kutsche. Vor der Nase des Dienstmädchens schaukelte der ans Gepäcknetz gebundene Hut der Herrin, auf ihren Knien lag ein Hündchen, ihre Füße standen auf einem Berg von Schachteln und trommelten kaum hörbar im gleichen Takte mit dem Rütteln der Federn und dem Klirren der Fensterscheiben.
Die Dame hielt die Hände im Schoß gefaltet, hatte die Augen geschlossen und wiegte sich schwach in den Kissen, die man ihr hinter den Rücken geschoben hatte; sie hüstelte hohl mit geschlossenem Mund, wobei sie jedesmal das Gesicht verzog. Auf dem Kopfe trug sie ein weißes Nachthäubchen und darüber ein leichtes hellblaues Tuch, dessen Enden um ihren zarten blassen Hals geschlungen waren. Ein gerader Scheitel, der unter dem Häubchen verschwand, teilte das blonde, ungewöhnlich dünne, pomadisierte Haar; die weiße Haut dieses breiten Scheitels schien eigentümlich trocken und leblos. Die gelbliche Haut lag schlaff auf den feinen und schönen Umrissen des Gesichts und hatte an den Wangen und Backenknochen rote Flecken. Die Lippen waren trocken und unruhig, die dünnen Wimpern waren seltsam gerade, und der Reisemantel fiel auf der eingefallenen Brust in geraden Falten herab. Obwohl die Augen geschlossen waren, drückte das Gesicht der Dame Müdigkeit, Gereiztheit und gewohntes Leid aus.
Der Lakai saß zurückgelehnt auf dem Bock und schlummerte; der Postillion trieb mit kurzen Schreien das stattliche, schweißtriefende Viergespann an und blickte sich ab und zu nach dem andern Kutscher um, der auf dem Bocke des zweiten Wagens saß und seine Pferde mit den gleichen Schreien antrieb. Auf dem kalkigen Straßenschmutz liefen gleichmäßig und schnell die parallelen breiten Spuren der Wagenräder. Der Himmel war grau und kalt, feuchter Nebel lagerte auf den Feldern und Wegen. Im Innern der Kutsche war es dumpf und roch nach Kölnischem Wasser und Staub. Die Kranke warf ihren Kopf in den Nacken und öffnete langsam die Augen. Die großen Augen waren glänzend und von einer schönen, dunklen Farbe.
»Schon wieder!« sagte sie, indem sie nervös mit ihrer schönen hageren Hand einen Mantelzipfel des Dienstmädchens wegschob, der kaum ihren Fuß berührt hatte; ihr Mund zuckte dabei schmerzvoll zusammen. Matrjoscha raffte mit beiden Händen die Schöße ihres Mantels auf, erhob sich auf ihren kräftigen Beinen und rückte etwas weiter. Ihr frisches Gesicht errötete. Die schönen dunklen Augen der Kranken verfolgten gespannt alle Bewegungen des Mädchens. Die Dame stemmte sich mit beiden Händen gegen den Sitz und wollte gleichfalls etwas hinaufrücken, doch ihre Kräfte versagten. Ihr Mund krümmte sich, und ihr ganzes Gesicht wurde durch den Ausdruck ohnmächtiger, gehässiger Ironie verzerrt. »Wenn du mir wenigstens helfen wolltest! . . . Ach, jetzt ist es nicht mehr nötig! Ich kann schon selbst; leg mir aber um Gottes willen nicht immer deine Päckchen hinter den Rücken! . . . Laß es sein, wenn du es nicht verstehst!« Die Dame schloß die Augen, hob dann wieder die Lider und warf dem Dienstmädchen einen schnellen Blick zu. Matrjoscha starrte sie an und biß sich in die rote Unterlippe. Ein schwerer Seufzer drang aus der Brust der Kranken und ging in einen Hustenanfall über. Sie wandte sich ab, verzog das Gesicht und griff mit beiden Händen an die Brust. Als der Anfall vorüber war, schloß sie wieder die Augen und saß unbeweglich da. Beide Equipagen fuhren durch ein Dorf. Matrjoscha steckte ihre volle Hand unter dem Tuche hervor und bekreuzigte sich.
»Was gibts?« fragte die Herrin.
»Eine Station, gnädige Frau.«
»Ich frage dich, warum du dich bekreuzigst!«
»Es ist eine Kirche, gnädige Frau.«
Die Kranke wandte sich zum Fenster und begann sich langsam zu bekreuzigen, mit weit geöffneten Augen auf die große hölzerne Kirche starrend, um die die Kutsche herumfuhr. Die Kutsche und die Kalesche hielten gleichzeitig vor der Station. Aus der Kalesche stieg der Gatte der kranken Dame und der Arzt. Sie traten an die Kutsche heran.
»Wie fühlen Sie sich?« fragte der Arzt, ihren Puls befühlend.
»Nun, meine Liebe, bist du nicht müde?« fragte der Gatte französisch. »Willst du nicht aussteigen?«
Matrjoscha nahm alle Päckchen zusammen und drückte sich in eine Ecke, um die Herrschaften in ihrem Gespräch nicht zu stören.
»Immer dasselbe,« antwortete die Kranke. »Ich möchte nicht aussteigen.« Der Gatte stand noch eine Weile da und ging dann in das Stationsgebäude. Matrjoscha sprang aus der Kutsche und lief auf den Fußspitzen durch den Schmutz zum Tor.
»Daß es mir schlecht geht, ist noch kein Grund für Sie, nicht zu frühstücken,« sagte die Kranke mit einem schwachen Lächeln zum Arzt, der vor dem Wagenfenster stand.
›Niemand kümmert sich um mich‹, fügte sie in Gedanken hinzu, als der Arzt sich mit leisen Schritten vom Wagen entfernte und dann in großer Hast die Stufen des Stationshauses hinauflief. ›Ihnen geht es gut, und um alles übrige kümmern sie sich nicht. O mein Gott!‹
»Nun, Eduard Iwanowitsch,« sagte der Gatte oben im Stationsgebäude zu dem Arzt, sich mit vergnügtem Lächeln die Hände reibend, »ich habe den Esskorb heraufbringen lassen. Was halten Sie davon?«
»Ich bin dabei,« antwortete der Arzt.
»Wie geht es ihr eigentlich?« fragte der Gatte seufzend, indem er die Stimme senkte und die Augenbrauen hochzog.
»Ich habe Ihnen ja schon gesagt: sie wird unmöglich bis nach Italien kommen; ich zweifle sogar, daß sie Moskau noch erreicht. Besonders bei diesem Wetter.«
»Was soll ich tun? Ach mein Gott! Mein Gott!« Der Gatte bedeckte die Augen mit der Hand. »Gib her!« wandte er sich zum Diener, der mit dem Esskorb hereinkam.
»Sie hätten eben zu Hause bleiben müssen,« entgegnete der Arzt und zuckte die Achseln.
»Sagen Sie mir doch, was konnte ich tun?« entgegnete der Gatte. »Ich habe doch alles versucht, um sie von der Reise abzuhalten; ich habe ihr die Kosten vorgehalten, ich habe von den Kindern, die wir allein zurücklassen mußten, und von meinen Geschäften gesprochen – sie will nichts hören. Sie malt sich das Leben im Ausland aus, als ob sie gesund wäre. Und ihr die Wahrheit über ihren Zustand sagen hieße sie töten.«
»Sie ist ja schon so gut wie tot, das müssen Sie selbst wissen, Wassili Dmitritsch. Der Mensch kann nicht ohne Lungen leben, und neue Lungen wachsen nicht nach. Es ist ja wirklich sehr traurig und schwer, was kann man aber tun? Unsere Aufgabe kann nur darin bestehen, daß wir ihr das Ende möglichst leicht gestalten. Hier ist viel eher ein Seelsorger am Platze.«
»Ach mein Gott! Versetzen Sie sich doch in meine Lage; Wie kann ich mit ihr von ihrer letzten Stunde sprechen? Mag kommen, was will, ich kann es ihr nicht sagen. Sie wissen ja selbst, wie gut sie ist . . .«
»Versuchen Sie doch, sie zu überreden, noch bis zum Winter, bis wir Schlittenbahn haben, zu warten,« sagte der Arzt und schüttelte bedeutungsvoll den Kopf. »Unterwegs kann ja leicht eine Verschlimmerung eintreten . . .«
»Aksjuscha, he, Aksjuscha!« schrie auf der schmutzigen Hintertreppe die Tochter des Stationsaufsehers, indem sie sich eine Jacke über den Kopf warf. »Wir wollen uns die Gutsherrin von Schirkino ansehen; man sagt, sie werde wegen ihrer Brustkrankheit ins Ausland geführt. Ich habe noch nie eine Schwindsüchtige gesehen.«
Aksjuscha sprang herbei, und beide Mädchen liefen Hand in Hand vor das Tor. Als sie an der Kutsche vorbeigingen, verlangsamten sie die Schritte und blickten durch das herabgelassene Fenster hinein. Die Kranke wandte den Kopf nach ihnen um; als sie aber ihre Neugier bemerkte, runzelte sie die Stirn und wandte sich wieder ab.
»Gott der Gerechte!« sagte die Tochter des Stationsaufsehers, hastig den Kopf wegwendend. »Was war sie doch für eine Schönheit, und was ist aus ihr geworden! Es ist sogar entsetzlich! Hast du sie gesehen, Aksjuscha, hast du sie gesehen?«
»Ja, so mager ist sie!« bestätigte Aksjuscha. »Wir wollen noch einmal vorübergehen, als ob wir zum Brunnen gingen. Siehst du, sie hat sich weggewandt, aber ich konnte sie noch sehen. Sie tut mir so leid, Mascha!«
»Und wie schmutzig es ist!« entgegnete Mascha, und beide liefen zum Tore zurück.
Die Kranke dachte: ›Ich muß wohl wirklich grauenhaft aussehen! Wenn ich nur so schnell wie möglich ins Ausland kommen könnte! Dort werde ich mich bald erholen.‹
»Nun, wie geht es dir, meine Liebe?« fragte der Gatte, der wieder zur Kutsche kam. Er hatte noch einen Bissen im Munde.
›Immer dieselbe Frage!‹ dachte die Kranke; ›und er selbst ißt!‹
»Es geht,« murmelte sie durch die Zähne.
»Weißt du, meine Liebe, ich fürchte, die Reise wird dir bei diesem Wetter nicht gut tun; auch Eduard Iwanowitsch ist derselben Ansicht. Wollen wir nicht lieber umkehren?«
Sie schwieg ärgerlich.
»Das Wetter wird ja einmal besser werden, wir werden Schlittenbahn bekommen; inzwischen kannst du dich ja auch erholen, dann könnten wir alle zusammen fahren.«
»Verzeih! Hätte ich auf dich schon früher nicht gehört, so wäre ich jetzt längst in Berlin und ganz gesund.«
»Was soll man tun, mein Engel? Du weißt ja selbst, daß es unmöglich war. Wenn du jetzt noch einen Monat warten wolltest, könntest du dich bedeutend erholen, ich würde auch mit meinen Geschäften fertig werden, und wir könnten auch die Kinder mitnehmen . . .«
»Die Kinder sind gesund, und ich nicht.«
»Begreife doch, meine Liebe, bei diesem Wetter! Wenn unterwegs eine Verschlimmerung eintritt . . . so ist man wenigstens zu Hause . . .«
»Warum ists zu Hause besser? … Meinst du, ich soll lieber zu Hause sterben?« antwortete die Kranke gereizt. Doch das Wort ›sterben‹ hatte sie offenbar erschreckt, und sie warf dem Gatten einen flehenden und fragenden Blick zu. Er schlug die Augen nieder und schwieg. Der Mund der Kranken verzerrte sich plötzlich wie bei einem Kinde, und Tränen stürzten ihr aus den Augen. Der Gatte bedeckte sein Gesicht mit dem Taschentuch und trat schweigend beiseite.
»Nein, ich will doch fahren!« sagte die Kranke, die Augen gen Himmel richtend. Sie faltete die Hände und begann unzusammenhängende Worte zu flüstern. »Mein Gott! Wofür?« murmelte sie, und die Tränen flossen noch unaufhaltsamer. Sie betete lange und inbrünstig, doch der Schmerz und das Gefühl von Beklemmung in ihrer Brust blieben unverändert, der Himmel, die Felder und die Straße blieben ebenso grau und trüb, und der herbstliche Nebel senkte sich immerzu gleichmäßig, ohne dichter oder durchsichtiger zu werden, auf den Straßenschmutz, auf die Dächer, die Kutsche und die Schafpelze der Kutscher, die unter lautem, vergnügtem Geplauder die Räder schmierten und die Pferde vorspannten . . .
2
Die Kutsche war angespannt, aber der Postillion ließ noch auf sich warten. Er war in die Kutscherstube gegangen. In der Stube war es heiß, dumpf, finster und schwül, es roch nach Ausdünstungen vieler Menschen, frisch gebackenem Brot, Kohl und Schafpelzen. Einige Fuhrknechte standen in der Stube herum, am Ofen machte sich die Köchin zu schaffen, und auf dem Ofen lag auf mehreren Schaffellen ein Kranker.
»Onkel Fjodor! He, Onkel Fjodor!« sagte der junge Postillion, der im Schafpelz, mit der Peitsche im Gürtel in die Stube trat und sich dem Kranken zuwendete.
»Was willst du vom Fjodor, du Taugenichts?« rief einer der Fuhrknechte. »Du weißt ja, daß man auf dich dort bei der Kutsche wartet.«
»Ich will ihn um seine Stiefel bitten; meine sind zerrissen«, erwiderte der Bursche, indem er das Haar zurückwarf und an den Handschuhen, die im Gürtel steckten, nestelte. »Schläft er gar? He, Onkel Fjodor!« wiederholte er, zum Ofen tretend.
»Was gibts?« fragte eine schwache Stimme, und ein ausgemergeltes, rotbärtiges Gesicht beugte sich über den Ofenrand. Eine große, hagere, bleiche, behaarte Hand bemühte sich, den Pelz über die eckige Schulter zu ziehen, die von einem schmutzigen Hemd bedeckt war. »Gib mir zu trinken, Bruder . . . Was willst du?«
Der Bursche reichte ihm den Wasserkrug.
»Weißt du, Fedja,« sagte er verlegen, »weißt du, du brauchst wohl deine neuen Stiefel nicht mehr; gib sie mir, du wirst sie doch wohl nie tragen.«
Der Kranke senkte den müden Kopf zum glasierten Tonkrug, tauchte den dünnen herabhängenden Schnurrbart in das dunkle Wasser und trank in schwachen, doch gierigen Zügen. Sein wirrer Bart war unsauber, und die eingefallenen trüben Augen blickten mit Mühe auf den Burschen. Nachdem er getrunken hatte, wollte er die Hand heben, um die feuchten Lippen abzuwischen, doch er hatte nicht die Kraft dazu und wischte sich den Mund am Ärmel seines Filzmantels ab. Er blickte schweigend und schwer durch die Nase atmend dem Burschen in die Augen und schien alle seine Kräfte zu sammeln.
»Hast du sie vielleicht schon jemand versprochen?« fuhr der Postillion fort. »Das wäre schade. Denn siehst du: draußen ist es naß, und ich muß fahren. Da dachte ich mir: ich will halt den Fedja um seine Stiefel bitten, er braucht sie wohl nicht mehr. Vielleicht brauchst du sie doch, sag es nur . . .«
In der Brust des Kranken begann es zu kollern und zu röcheln; er beugte sich vor, ein dumpfer Hustenanfall, der nicht recht zum Ausbruch kommen wollte, würgte ihn.
»Wozu soll er denn noch die Stiefel brauchen?« begann plötzlich die Köchin mit keifender Stimme durch das ganze Zimmer zu schnattern. »Schon den zweiten Monat kommt er nicht vom Ofen herunter. Du hörst doch, wie er hustet! Es tut mir auch selbst in der Lunge weh, wenn ich es nur mit anhöre. Was soll er noch mit den Stiefeln anfangen? In neuen Stiefeln wird man ihn doch nicht begraben! Es wäre aber schon längst Zeit, Gott verzeihe mir die Sünde! Du hörst doch, wie er sich quält! Man sollte ihn in eine andere Stube bringen oder sonstwohin! In der Stadt soll es Krankenhäuser für solche Leute geben. Hier hat er aber eine ganze Ecke eingenommen und rührt sich nicht vom Fleck; darf denn das sein? Er nimmt nur den andern den ganzen Raum weg. Und da verlangt man von mir auch noch Sauberkeit!«
»He, Serjoga! Geh auf deinen Posten, die Herrschaften warten!« rief der Oberpostillion durch die Tür herein.
Serjoga wollte schon gehen, ohne die Antwort abzuwarten, doch der Kranke gab ihm während des Hustenanfalls mit den Augen zu verstehen, daß er antworten wolle.
»Nimm dir die Stiefel, Serjoga«, sagte er, als er den Husten unterdrückt und ein wenig ausgeruht hatte. »Doch hör, einen Stein sollst du mir kaufen, wenn ich einmal tot bin,« fügte er heiser hinzu.
»Danke, Onkel, ich nehme also die Stiefel, und den Stein werde ich dir, so wahr Gott lebt, kaufen.«
»Ihr habt es gehört, Kinder,« konnte der Kranke noch sagen. Dann beugte er sich wieder zurück und bekam einen neuen Hustenanfall.
»Ist schon recht, wir haben es gehört,« bestätigte einer von den Kutschern. »Geh doch hin, Serjoga, auf deinen Bock, da kommt schon wieder der Ober gelaufen. Du hast doch die kranke Gutsfrau von Schirkino zu fahren.«
Serjoga warf schnell seine zerrissenen, ihm viel zu großen Stiefel ab und schleuderte sie unter die Bank. Die neuen Stiefel Fjodors paßten ihm ausgezeichnet. Während er zur Kutsche ging, bewunderte er sie an seinen Beinen.
»Das nenn ich Stiefel! Komm, ich will sie dir schmieren,« sagte ein Kutscher, der mit dem Teerpinsel in der Hand vor der Kutsche stand, während Serjoga auf den Bock kletterte und die Zügel in die Hand nahm. »Hat er sie dir umsonst gegeben?«
»Bist du vielleicht neidisch?« entgegnete Serjoga, indem er sich erhob und die Schöße des Mantels an den Beinen zurücklegte.
»Laß mich in Ruhe! Los, meine Lieben!« rief er den Pferden zu, holte mit der Peitsche aus, und beide Wagen mit ihren Insassen, Koffern und Reisetaschen rollten schnell über die nasse Landstraße dahin und verschwanden im grauen Herbstnebel.
Der kranke Kutscher war in der dumpfen Stube auf dem Ofen liegen geblieben. Es gelang ihm nicht, sich ordentlich auszuhusten; schließlich drehte er sich mit großer Mühe auf die andere Seite und wurde still.
In der Kutscherstube war bis zum Abend ein Kommen und Gehen, man aß zu Mittag – den Kranken hörte man nicht. Vor Nacht kroch die Köchin auf den Ofen, beugte sich über seine Füße hinüber und holte sich einen Schafpelz.
»Sei mir nicht böse, Nastassja!« sagte der Kranke. »Ich werde dir bald deinen Ofen räumen.«
»Es ist schon gut, ich hab ja nichts gesagt,« murmelte Nastassja. »Was tut dir weh, Onkel? Sags doch!«
»Das ganze Innere tut mir weh. Gott weiß, was das ist!«
»Dir tut wohl auch die Kehle weh, wenn du hustest?«
»Alles tut mir weh. Mein Tod ist gekommen, das ist es. Ach, ach, ach!« stöhnte der Kranke.
»Du mußt dir die Beine so zudecken,« sagte Nastassja, indem sie vom Ofen kletterte und dabei dem Kranken den Mantel über die Beine zog.
Nachts brannte in der Stube ein schwaches Nachtlicht. Nastassja und etwa zehn Fuhrknechte schnarchten auf dem Fußboden und auf den Bänken. Der Kranke allein schlief nicht: er röchelte schwach, hustete und wälzte sich hin und her. Gegen Morgen wurde er ganz still.
»Einen merkwürdigen Traum habe ich heute nacht gehabt«, sagte die Köchin, als sie sich in der Morgendämmerung aus dem Schlafe reckte. »Mir träumte, Onkel Fjodor stieg vom Ofen herunter und ging hinaus, um Holz zu hacken. ›Laß mich, Nastassja,‹ sagte er, ›ich will dir helfen.‹ Und ich sagte zu ihm: ›Du willst Holz hacken, wo du so krank bist?‹ Er nimmt aber die Axt und hackt so schnell, daß die Späne nur so fliegen. ›Was,‹ sage ich zu ihm, ›du bist doch krank gewesen?‹ ›Nein,‹ sagt er, ›ich bin gesund.‹ Und wie er mit der Axt ausholt, wird mir ganz angst und bange. Ich schreie auf und erwache. Ist er am Ende gestorben? Onkel Fjodor! He, Onkel!«
Fjodor gab keine Antwort.
»Ist er vielleicht doch tot? Man muß einmal nachsehen«, sagte einer von den Kutschern, die eben erwachten.
Die magere, mit rötlichen Haaren bedeckte Hand hing kalt und bleich vom Ofen herunter.
»Man muß es dem Aufseher melden. Er scheint wirklich tot zu sein«, sagte der Kutscher.
Fjodor hatte weder Verwandte noch sonst jemand: er stammte aus einer fernen Gegend. Man begrub ihn am nächsten Tage auf dem neuen Kirchhof hinter dem Wäldchen, und Nastassja erzählte noch mehrere Tage nacheinander allen, die es hören wollten, den Traum, den sie gehabt, und daß sie die erste gewesen, der es am Morgen eingefallen war, nach Fjodor zu sehen.
3
Der Frühling war gekommen. In den nassen Straßen der Stadt rieselten zwischen den kotdurchsetzten Eisklumpen hurtige Bächlein; die Farben der Kleider und die Stimmen der Leute auf den Straßen schienen ungewöhnlich hell. In den Gärtchen hinter den Zäunen schwollen die Knospen der Bäume, und die Zweige wiegten sich kaum hörbar im frischen Winde. Überall flossen und tropften durchsichtige helle Tropfen . . . Die Spatzen piepsten und flatterten mit ihren kleinen Flügeln. Auf der Sonnenseite, auf Zäunen, Häusern und Bäumen war alles voller Bewegung und Licht. Der Himmel, die Erde und die Herzen der Menschen waren von einer fröhlichen, jugendfrischen Stimmung erfüllt.
In einer der Hauptstraßen war vor einem großen herrschaftlichen Hause auf dem Fahrdamm frisches Stroh ausgebreitet; im Hause lag dieselbe Kranke, die ins Ausland reisen wollte, im Sterben.
Vor der geschlossenen Tür des Krankenzimmers standen der Gatte und eine ältere Dame. Auf dem Sofa saß ein Geistlicher; er hatte die Augen gesenkt und hielt in den Händen das Beichttuch, in das etwas eingewickelt war. In einer Ecke lag in einem großen Lehnstuhl eine Greisin, die Mutter der Kranken, und weinte bitterlich. Neben ihr hielt ein Dienstmädchen ein sauberes Taschentuch bereit, um es ihr zu geben, wenn sie danach verlangte; ein zweites Dienstmädchen rieb der Alten die Schläfen und blies ihr unter die Haube auf dem greisen Kopf.
»Nun, der Heiland helfe Ihnen, liebe Freundin!« sagte der Gatte zu der älteren Dame, mit der er vor der Tür stand. »Sie hat ja solches Vertrauen zu Ihnen; Sie verstehen es so gut, mit ihr zu sprechen: versuchen Sie doch, es ihr zu sagen, meine Liebe, gehen Sie doch zu ihr hinein!« Er wollte ihr schon die Tür öffnen, die Cousine hielt ihn aber noch zurück, drückte das Tuch einige Mal an die Augen und schüttelte den Kopf.
»So, jetzt sieht man wohl nicht, daß ich geweint habe?« fragte sie. Dann öffnete sie selbst die Tür und trat ins Krankenzimmer.
Der Gatte war stark erregt und schien gänzlich verstört. Er wollte zuerst auf die Greisin zugehen; als ihn aber nur noch wenige Schritte von ihr trennten, kehrte er um, ging durch das Zimmer und näherte sich dem Geistlichen. Der Geistliche blickte ihn an, hob die Augenbrauen und seufzte. Auch sein dichtes, leicht ergrautes Bärtchen hob und senkte sich.
»Mein Gott! Mein Gott!« sagte der Gatte.
»Was soll man machen?« sagte seufzend der Geistliche, und seine Augenbrauen und das Bärtchen hoben und senkten sich wieder.
»Auch Mamachen ist hier!« sagte der Gatte fast verzweifelt. »Sie wird es nicht überwinden. Denn wie sie sie liebt und wie sie an ihr hängt . . . ich weiß wirklich nicht. Hochwürden, wenn Sie wenigstens versuchen wollten, sie zu beruhigen und ihr zuzureden, daß sie von hier fortgehe.«
Der Geistliche erhob sich vom Sofa und ging auf die Greisin zu.
»Ein Mutterherz kann wahrlich niemand ergründen,« sagte er, »doch Gott ist barmherzig.«
Über das Gesicht der Greisin ging plötzlich ein Zucken, und sie bekam einen Anfall von hysterischem Schluchzen.
»Gott ist barmherzig,« fuhr der Geistliche fort, als sie sich etwas beruhigt hatte. »Ich will Ihnen sagen: in meiner Gemeinde war ein Kranker, mit dem es noch viel schlimmer stand als mit Maria Dmitrijewna; und was glauben Sie? Ein einfacher Kleinbürger hat ihn in kürzester Zeit mit Kräutern gesund gemacht. Und dieser selbe Kleinbürger hält sich jetzt zufällig in Moskau auf. Ich habe schon mit Wassili Dmitrijewitsch davon gesprochen, man könnte doch versuchen . . . Das wäre immerhin ein Trost für die Kranke. Bei Gott ist alles möglich.«
»Nein, sie wird nicht am Leben bleiben,« sagte die Greisin. »Statt mich zu sich zu nehmen, läßt Gott sie sterben.« Das hysterische Schluchzen wurde so stark, daß sie das Bewusstsein verlor.
Der Gatte der Kranken bedeckte das Gesicht mit den Händen und lief aus dem Zimmer.
Im Korridor stieß er auf seinen sechsjährigen Jungen, der im Galopp dem jüngeren Schwesterchen nachlief.
»Befehlen Sie nicht, daß ich die Kinder zur Mama führe?« fragte die Kinderfrau.
»Nein, sie will sie nicht sehen. Es wird sie zu sehr aufregen.«
Der Knabe blieb einen Augenblick stehen, musterte aufmerksam das Gesicht des Vaters, schlug dann mit dem Fuße aus und lief lustig weiter.
»Sie ist der Rappe, Papachen!« rief der Knabe, auf die Schwester zeigend.
Die Cousine saß unterdessen im andern Zimmer neben der Kranken und suchte sie durch klug berechnete Worte auf den Tod vorzubereiten. Der Arzt stand am Fenster und mischte einen Trank.
Die Kranke saß in weißem Morgenkleid, ganz von Kissen umgeben, im Bett und blickte die Cousine schweigend an.
»Ach, meine Liebe,« unterbrach sie sie plötzlich, »Sie brauchen mich gar nicht vorzubereiten. Halten Sie mich doch nicht für ein Kind. Ich bin eine Christin. Ich weiß alles. Ich weiß, daß ich nicht mehr lange zu leben habe, und ich weiß, daß ich jetzt in Italien wäre, wenn mein Mann früher auf mich gehört hätte; dann wäre ich vielleicht, oder sogar bestimmt, gesund. Das haben ihm alle gesagt. Jetzt ist aber nichts zu machen. Gott hat es offenbar so gewollt. Wir alle haben viele Sünden, ich weiß es; ich hoffe aber auf Gottes Barmherzigkeit: es wird allen verziehen werden, ja, ich bin davon überzeugt. Ich bemühe mich jetzt, mein Innerstes zu erforschen. Auch ich hatte viele Sünden auf dem Gewissen, meine Liebe. Doch wieviel habe ich dafür gelitten! Ich war immer bestrebt, meine Leiden geduldig zu ertragen . . .«
»Soll ich also den Geistlichen hereinrufen, meine Liebe? Wenn Sie die heiligen Sakramente empfangen, wird es Ihnen sicherlich leichter werden,« sagte die Cousine.
Die Kranke neigte zustimmend den Kopf.
»Gott sei mir Sünderin gnädig!« flüsterte sie.
Die Cousine ging hinaus und winkte dem Geistlichen.
»Sie ist ein wahrer Engel!«sagte sie mit Tränen in den Augen zu dem Gatten. Der Gatte begann zu weinen, der Geistliche ging ins Krankenzimmer, die Greisin war noch immer bewußtlos, und im ersten Zimmer wurde es vollkommen still. Nach fünf Minuten kam der Geistliche zurück, nahm sich das Beichttuch von der Schulter und strich sich mit der Hand das Haar zurück.
»Gott sei Dank, sie ist jetzt ruhiger,« sagte er, »sie wünscht Sie zu sehen.«
Die Cousine und der Gatte gingen hinein. Die Kranke weinte still in sich hinein, die Augen auf das Heiligenbild gerichtet.
»Gratuliere zum Empfang der heiligen Sakramente, meine Liebe!« sagte der Gatte.
»Hab Dank! Wie wohl ich mich jetzt fühle, welch unbegreifliche Süße ich empfinde!« sagte die Kranke, und ein leises Lächeln spielte um ihre seinen Lippen. »Wie Gott barmherzig ist! Nicht wahr? Er ist barmherzig und allmächtig!« Sie richtete ihre tränenvollen Augen wieder mit heißem Flehen auf das Heiligenbild.
Dann schien sie sich auf etwas zu besinnen. Sie winkte den Gatten näher zu sich heran.
»Du willst niemals tun, worum ich dich bitte«, sagte sie mit schwacher Stimme.
Der Mann reckte den Hals und hörte ihr gespannt zu.
»Was denn, meine Liebe?«
»Wie oft habe ich dir gesagt, daß die Ärzte alle miteinander nichts verstehen; es gibt aber einfache Frauen aus dem Volke, die die schwersten Krankheiten heilen . . . Hochwürden hat mir eben von einem Kleinbürger erzählt . . . laß ihn holen.«
»Wen, meine Liebe?«
»Mein Gott, er will mich nicht verstehen! . . .« Die Kranke verzog das Gesicht und schloß die Augen.
Der Arzt trat an sie heran und ergriff ihre Hand. Der Puls wurde merklich schwächer und schwächer. Er winkte dem Gatten mit den Augen. Die Kranke bemerkte es und sah erschrocken auf. Die Cousine wandte sich weg und begann zu weinen.
»Weine nicht, quäle nicht dich selbst und mich,« sprach die Kranke, »das nimmt mir meine letzte Ruhe.«
»Du bist ein Engel!« sagte die Cousine, ihr die Hand küssend.
»Nein, küsse mich hier, nur den Toten küßt man die Hand. Mein Gott! Mein Gott!«
Am selben Abend war die Kranke eine Leiche, und die Leiche lag im Sarg im Saal des großen Hauses. Im großen Zimmer saß hinter verschlossenen Türen ganz allein der Küster und las näselnd und eintönig die Psalmen Davids. Das helle Licht der Wachskerzen in den hohen silbernen Leuchtern fiel auf die bleiche Stirn der Entschlafenen, auf ihre schweren wächsernen Hände und auf die gleichsam versteinerten Falten des Bahrtuches, unter dem sich die Knie und die Fußspitzen unheimlich abzeichneten. Der Küster las eintönig, ohne ein Wort zu verstehen, und die Worte hallten seltsam durch den stillen Raum und erstarben. Ab und zu klangen aus einem entfernten Zimmer Kinderstimmen und Kinderschritte herüber.
»›Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie‹«, lautete der Psalm. »›Du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du lässt aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und erneuerst die Gestalt der Erde. Die Ehre des Herrn ist ewig.‹«
Das Antlitz der Verstorbenen war streng und majestätisch. Weder auf der klaren kalten Stirn noch auf den fest geschlossenen Lippen regte sich etwas. Sie war ganz Spannung. Aber verstand sie wenigstens jetzt diese erhabenen Worte?
4
Einen Monat später ragte auf dem Grabe der Entschlafenen eine steinerne Kapelle. Auf dem Grabe des Kutschers war aber noch immer kein Stein, und nur hellgrünes Gras sproß aus dem Hügel, dem einzigen Merkzeichen eines vergangenen Menschenlebens.
»Du begehst eine Sünde, Serjoga,« sagte einmal die Stationsköchin, »wenn du dem Fjodor den Stein nicht kaufst. Du sagtest immer, es ist Winter. Warum hältst du aber jetzt nicht dein Wort? Ich war ja dabei und habe es gehört. Er ist dir schon einmal im Schlafe erschienen; wenn du den Stein nicht kaufst, so kommt er wieder und würgt dich.«
»Ich weigere mich ja nicht«, entgegnete Serjoga. »Ich werde den Stein kaufen, wie ich es gesagt habe; ich werde einen für anderthalb Rubel kaufen. Ich habe es nicht vergessen, aber man muß ihn auch hertransportieren. Sobald wieder eine Gelegenheit in die Stadt ist, will ich ihn kaufen.«
»Du sollst ihm wenigstens ein Kreuz setzen. Hör auf mich!« mischte sich ein alter Kutscher ins Gespräch. »Es ist wirklich nicht schön. Seine Stiefel trägst du doch!«
»Wo soll ich denn ein Kreuz hernehmen? Aus einem Holzscheit kann ich es doch nicht zimmern!«
»Was redest du von einem Holzscheit? Nimm die Axt, geh am frühen Morgen in den Wald, hau eine kleine Esche um, und da hast du das Kreuz. Sonst müßtest du dem Waldhüter einen Schnaps geben; doch wo soll das hinaus, wenn man ihm wegen jeder Kleinigkeit Schnaps geben wollte? ... Neulich hab ich eine Deichsel zerbrochen, hab mir eine ausgezeichnete neue gemacht, kein Mensch hat es gesehen.«
Am frühen Morgen vor Sonnenaufgang nahm Serjoga die Axt und ging in den Wald.
Auf Bäumen und Gräsern lag die kalte matte Decke des noch immer fallenden, von der Sonne beleuchteten Taues. Im Osten wurde es ganz allmählich hell, und das schwache Licht spiegelte sich in den leichten Wölkchen, die das Himmelsgewölbe umlagerten. Kein Grashälmchen unten am Boden, kein Blättchen in den höchsten Wipfeln der Bäume regte sich. Die Stille des Waldes wurde nur zuweilen von einem Flügelschlag im Dickicht oder von einem Rascheln am Boden gestört. Ein seltsamer, der Natur fremder Ton erklang plötzlich am Waldessaum und erstarb gleich darauf. Und wieder wurde der Ton vernehmbar, und er wiederholte sich gleichmäßig unten am Stamme eines der unbeweglichen Bäume. Einer der Wipfel erbebte ganz ungewöhnlich, seine saftigen Blätter flüsterten etwas, und eine Grasmücke, die auf einem der Zweige gesessen hatte, flatterte pfeifend zweimal auf und setzte sich, mit dem Schwanz wippend, auf einen anderen Baum.
Die Axt tönte unten dumpfer und dumpfer, saftige weiße Späne flogen auf das taubedeckte Gras, und durch die Schläge ließ sich ein leises Knarren vernehmen. Der Baum erzitterte am ganzen Körper, beugte sich nieder, richtete sich gleich wieder auf und schwankte erschrocken auf seinen Wurzeln. Für einen Augenblick wurde alles still, doch der Baum neigte sich wieder, in seinem Stamm krachte es, und er stürzte, die Äste brechend und die Zweige senkend, mit dem Wipfel auf die feuchte Erde. Die Axthiebe und die Schritte verstummten. Die Grasmücke flog pfeifend einige Zweige höher hinauf. Ein Zweig, den sie mit ihren Flügeln gestreift hatte, wiegte sich eine Weile hin und her und erstarb dann wie die anderen mit allen seinen Blättern. Die Bäume ragten nun schöner und freudiger mit ihren regungslosen Zweigen in den neuen Raum.
Die ersten Sonnenstrahlen schossen durch die leichten Wolken und durcheilten Himmel und Erde. In den Talgründen braute der Nebel, im Grase blinkte diamanten der Tau, durchsichtige weiße Wölkchen eilten über den immer blauer werdenden Himmel und verzogen sich. Im Dickicht regten sich Vögel, und sie zwitscherten wie weltvergessen etwas Seliges; saftige Blätter flüsterten freudig und ruhig in den Wipfeln, und die Zweige der lebendigen Bäume rauschten langsam und majestätisch über dem toten gesunkenen Baume.
Der Schneesturm
1
Gegen sieben Uhr abends verließ ich, nachdem ich Tee getrunken, die Poststation, deren Name mir entfallen ist; ich weiß nur, daß es im Gebiete der Donkosaken, irgendwo in der Nähe von Nowotscherkask war. Als ich mich, in Pelz und Wagendecke gehüllt, neben Aljoschka in den Schlitten setzte, war es schon dunkel. Hinter dem Stationsgebäude schien es warm und windstill. Obwohl es gar nicht schneite, war kein einziger Stern zu sehen, und der Himmel schien im Vergleich mit der weißen Schneefläche, die vor uns lag, ungewöhnlich tief und schwarz.
Als wir die dunklen Silhouetten der Windmühlen, von denen die eine unbeholfen ihre großen Flügel bewegte, und das Dorf hinter uns hatten, bemerkte ich, daß der Weg beschwerlicher und schneereicher wurde; der Wind begann mir heftiger in die linke Seite zu blasen, die Mähnen und die Schweife der Pferde auf die Seite zu wehen und den von den Kufen und Hufen aufgewühlten Schnee trotzig emporzuwirbeln und davonzutragen. Das Schellengeläute klang leiser, ein kalter Luftstrom drang mir durch irgendeine Öffnung im Ärmel in den Rücken, und ich mußte an den Rat des Stationsaufsehers denken, die Reise lieber aufzugeben, um nicht die ganze Nacht ohne Weg umherzuirren und vielleicht noch zu erfrieren.
»Daß wir uns nur nicht verirren!« sagte ich zum Fuhrknecht. Da er mir aber keine Antwort gab, stellte ich meine Frage deutlicher: »Werden wir die Station erreichen, Kutscher? Werden wir uns nicht verirren?«
»Gott weiß!« gab er mir zur Antwort, ohne den Kopf zu wenden. »Sie sehen ja selbst, was für ein Gestöber aufsteigt: vom Wege ist nichts zu sehen. Herrgott!«
»Sage mir doch lieber, ob du mich zur nächsten Station zu bringen hoffst oder nicht«, fragte ich weiter. »Werden wir hinkommen?«
»Wir werden wohl hinkommen müssen«, sagte der Fuhrknecht; er sprach noch weiter, ich konnte ihn aber im Winde nicht verstehen.
Ich hatte keine Lust, umzukehren; doch auch die Aussicht, die ganze Nacht bei Frost und Schneesturm in diesem Teil des Donkosakenlandes, einer völlig nackten Steppe, umherzuirren, schien mir wenig verlockend. Außerdem gefiel mir mein Kutscher nicht recht, obwohl ich ihn im Finstern nicht genau sehen konnte, und ich hatte zu ihm kein Vertrauen. Er saß genau in der Mitte des Bockes und nicht seitwärts, wie Kutscher sonst zu sitzen pflegen; er war von übermäßigem Wuchs, seine Stimme klang träge, und auf dem Kopfe hatte er keine richtige Kutschermütze, sondern eine ihm viel zu große, die immer hin und her rutschte; auch kutschierte er nicht auf die richtige Art: er hielt die Zügel mit beiden Händen wie ein Lakai, der aushilfsweise die Stelle des Kutschers vertritt; doch der Hauptgrund meines Misstrauens war, daß er sich ein Tuch um die Ohren gebunden hatte. Mit einem Worte: der ernste, gekrümmte Rücken, der vor mir ragte, wollte mir nicht gefallen und verhieß mir nichts Gutes.
»Ich bin dafür, daß wir umkehren,« sagte Aljoschka, »es ist gar nicht so lustig, sich in der Steppe zu verirren!«
»Gott im Himmel! Dieses Schneegestöber! Ich kann den Weg nicht sehen, der Schnee hat mir die Augen verklebt ... Gott im Himmel!« brummte der Fuhrknecht.
Wir waren noch keine Viertelstunde gefahren, als der Fuhrknecht die Pferde halten ließ, die Zügel Aljoschka übergab, die Beine mit großer Mühe aus dem Schlitten herauszog und sich auf die Suche nach dem Weg machte; unter seinen schweren Stiefeln knirschte der Schnee.
»Was gibts? Wo gehst du hin? Haben wir etwa den Weg verloren?« fragte ich; der Fuhrknecht gab mir aber keine Antwort: er hielt den Kopf vom Winde, der ihm in die Augen peitschte, weggewandt und entfernte sich vom Schlitten.
»Nun, hast du den Weg gefunden?« fragte ich, als er zurückgekehrt war.
»Nein, nichts«, sagte er unwirsch und ärgerlich, als ob ich schuld daran wäre, daß er den Weg verloren hatte; er steckte die Beine wieder langsam in den Vorderteil des Schlittens und ergriff mit seinen hartgefrorenen Handschuhen die Zügel.
»Was werden wir nun tun?« fragte ich, als der Schlitten sich wieder in Bewegung gesetzt hatte.
»Was sollen wir tun? Wir werden aufs Geratewohl weiterfahren.«
Nun fuhren wir in kurzem Trab weiter, offenbar ganz ohne Weg, bald durch tiefen Pulverschnee, in dem der Schlitten zu einem Viertel versank, bald über eine spröde nackte Eisdecke.
Obwohl es recht kalt war, schmolz der Schnee auf meinem Mantelkragen sehr rasch; das Gestöber über der Erde wurde immer stärker, und von oben begann es einzelne trockene Flocken zu schneien.
Es war klar, daß wir Gott weiß wohin fuhren; denn als wir auch noch eine weitere Viertelstunde gefahren waren, hatten wir keinen einzigen Werstpfahl gesehen.
»Nun, was glaubst du,« fragte ich wieder den Kutscher, »werden wir die Station erreichen?«
»Welche Station? Zurück werden wir wohl kommen können, wenn wir die Pferde frei laufen lassen: sie werden uns schon zurückbringen; doch auf die nächste Station werden wir kaum kommen ... Wir werden dabei höchstens den Tod finden.«
»Wir wollen dann doch lieber umkehren«, sagte ich. »Was sollen wir auch riskieren...«