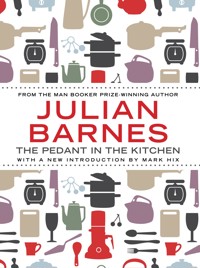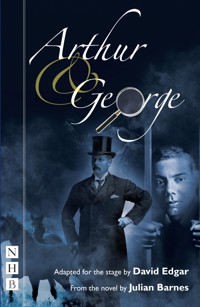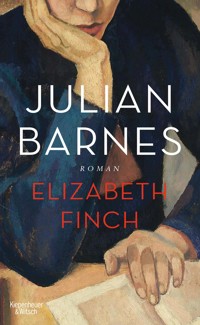9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie sicher ist Erinnerung, wie unveränderlich die eigene Vergangenheit? Tony Webster muss lernen, dass Geschehnisse, die lange zurückliegen und von denen er glaubte, sie nie mehr hinterfragen zu müssen, plötzlich in einem ganz neuen Licht erscheinen. Als Adrian Finn in die Klasse von Tony Webster kommt, schließen die beiden Jungen schnell Freundschaft. Sex und Bücher sind die Hauptthemen, mit denen sie sich befassen, und Tony hat das Gefühl, dass Adrian in allem etwas klüger ist als er. Auch später, nach der Schulzeit, bleiben die beiden in Kontakt. Bis die Freundschaft ein jähes Ende findet. Vierzig Jahre später, Tony hat eine Ehe, eine gütliche Trennung und eine Berufskarriere hinter sich, ist er mit sich im Reinen. Doch der Brief eines Anwalts, verbunden mit einer Erbschaft, erweckte plötzlich Zweifel an den vermeintlich sicheren Tatsachen der eigenen Biographie. Je mehr Tony erfährt, desto unsicherer scheint das Erlebte und desto unabsehbarer die Konsequenzen für seine Zukunft. Ein Text mit unglaublichen Wendungen, der den Leser auf eine atemlose Achterbahnfahrt der Spekulationen mitnimmt. »Wie Barnes allmählich die Selbstzensur in den Erinnerungen seines pensionierten Protagonisten Tony Webster bloßlegt, beweist seine ganze Meisterschaft.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Julian Barnes
Vom Ende einer Geschichte
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, 1946 geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograph, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Preise erhielt, u.a. den David-Cohen-Prize, liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor, darunter die Romane »Flauberts Papagei«, »Eine Geschichte der Welt in 10½ Kapiteln« und »Darüber reden«. Julian Barnes lebt in London.
Gertraude Krueger, 1949 geboren, lebt als Dozentin und freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson Wesley, Jhumpa Lahiri und E. L. Doctorow.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Adrian Finn in die Klasse von Tony Webster kommt, schließen die beiden Jungen schnell Freundschaft. Sex und Bücher sind die Hauptthemen, mit denen sie sich befassen, und Tony hat das Gefühl, dass Adrian in allem etwas klüger ist als er. Auch später, nach der Schulzeit, bleiben sie in Kontakt. Bis die Freundschaft ein jähes Ende findet.
Vierzig Jahre später, Tony hat eine Ehe, eine gütliche Trennung und eine Berufskarriere hinter sich, ist er mit sich im Reinen. Doch der Brief einer Anwaltskanzlei, verbunden mit einer Erbschaft, erwecken plötzlich Zweifel an den vermeintlich sicheren Tatsachen der eigenen Jugend. Je mehr Tony erfährt, desto unsicherer scheint das Erlebte und desto unabsehbarer die Konsequenzen für seine Zukunft.
Ein Text mit unglaublichen Wendungen, der den Leser auf eine atemlose Achterbahnfahrt der Spekulationen mitnimmt.
»Wie Barnes allmählich die Selbstzensur in den Erinnerungen seines pensionierten Protagonisten Tony Webster bloßlegt, beweist seine ganze Meisterschaft« Süddeutsche Zeitung
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: The sense of en ending
Copyright © Julian Barnes 2011
All rights reserved
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger
© 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Nick Vaccaro/Getty Images
ISBN978-3-462-30525-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Teil eins
Teil zwei
Für Pat
Teil eins
Ich erinnere mich in ungeordneter Reihenfolge an:
die schimmernde Innenseite eines Handgelenks;
aufsteigenden Dampf aus einem Spülbecken, in das lachend eine heiße Bratpfanne geworfen wird;
Spermaflatschen, die um ein Abflussloch in einem hohen Haus kreisen und dann ganz hinuntergespült werden;
einen widersinnig stromaufwärts brausenden Fluss, dessen Wogen und Wellen von den Strahlen mehrerer Taschenlampen verfolgt und erleuchtet werden;
einen anderen Fluss, breit und grau, bei dem ein steifer Wind die Wasserfläche aufwühlt und die Strömung verbirgt;
längst erkaltetes Badewasser hinter einer verschlossenen Tür.
Dieses letzte Bild habe ich nicht wirklich gesehen, aber am Ende ist das, was man in Erinnerung behält, nicht immer dasselbe wie das, was man beobachtet hat.
Wir leben in der Zeit – sie trägt und sie prägt uns –, aber ich hatte immer das Gefühl, sie nicht recht zu verstehen. Und damit meine ich nicht die Theorien, dass sie bisweilen kehrtmacht und rückwärts läuft oder womöglich anderswo in einer Parallelausgabe existiert. Nein, ich meine die ganz gewöhnliche, alltägliche Zeit, die, wie uns sämtliche Uhren versichern, regelmäßig vergeht: tick-tack, klick-klack. Was ist glaubwürdiger als ein Sekundenzeiger? Und doch lehren uns schon die kleinsten Freuden und Schmerzen, wie geschmeidig die Zeit ist. Manche Gefühle lassen sie schneller, andere langsamer vergehen; zuweilen scheint sie abhandenzukommen – bis sie dann schließlich wirklich abhandenkommt und niemals wiederkehrt.
Ich habe kein besonderes Interesse an meiner Schulzeit und denke nicht nostalgisch daran zurück. Doch in der Schule fing alles an, darum muss ich kurz auf einige Vorfälle eingehen, die sich zu Anekdoten ausweiteten, zu annähernden Erinnerungen, die dann die Zeit zu Gewissheiten verzerrte. Wenn ich mir der tatsächlichen Ereignisse nicht mehr sicher sein kann, so kann ich wenigstens getreu wiedergeben, welche Eindrücke sie hinterlassen haben. Ich werde mein Bestes tun.
Wir waren ein Dreigespann, und dann kam er als Vierter dazu. Wir hatten nicht mit einer Erweiterung unseres kleinen Kreises gerechnet: Cliquen und Paarungen hatten sich vor langer Zeit gebildet, und in Gedanken stellten wir uns bereits vor, wie wir der Schule ins Leben entflohen. Er hieß Adrian Finn, ein großer, schüchterner Junge, der anfangs kaum aufschaute und seine Ansichten für sich behielt. Die ersten ein, zwei Tage beachteten wir ihn nicht weiter: An unserer Schule gab es keine Willkommenszeremonie, geschweige denn das Gegenteil, die rituelle Bewährungsprobe. Wir nahmen einfach zur Kenntnis, dass er da war, und warteten ab.
Die Lehrer zeigten mehr Interesse an ihm als wir. Sie mussten herausfinden, wie es um seine Intelligenz und Disziplin stand, abschätzen, wie gut seine Vorbildung war und ob sie ihn zum »Stipendiumskandidaten« aufbauen könnten. In jenem Herbst hatten wir am dritten Tag Geschichte bei Old Joe Hunt, der sich in seinem dreiteiligen Anzug verkniffen-leutselig gab und dessen Herrschaftssystem darauf beruhte, dass er für ausreichende, aber nicht ausufernde Langeweile sorgte.
»Nun, Sie werden sich erinnern, dass ich Sie um vorbereitende Lektüre zur Herrschaft Heinrichs des Achten bat.« Colin, Alex und ich warfen uns kurze Blicke zu und hofften, die Frage werde nicht wie die Fliege beim Angeln auf einem unserer Köpfe landen. »Wer möchte uns mit einer Charakterisierung dieser Zeit dienen?« Bei unseren abgewandten Blicken konnte er sich sein Teil denken. »Also dann vielleicht Marshall. Wie würden Sie die Herrschaft Heinrichs des Achten beschreiben?«
Unsere Erleichterung war größer als unsere Neugier, denn Marshall war ein vorsichtiger Nichtwisser, dem der Einfallsreichtum wahrer Ignoranz fehlte. Er forschte erst nach möglicherweise in der Frage verborgenen Fußangeln, bevor er schließlich eine Antwort fand.
»Es herrschte Unruhe, Sir.«
Ein Ausbruch kaum verhohlenen Grinsens; selbst Hunt lächelte beinahe.
»Könnten Sie uns das wohl näher erläutern?«
Marshall nickte langsam und verständnisinnig, überlegte noch eine Weile und beschloss, jede Vorsicht in den Wind zu schlagen. »Ich würde sagen, es herrschte große Unruhe, Sir.«
»Dann eben Finn. Kennen Sie sich in diesem Zeitalter aus?«
Der Neue saß eine Reihe vor mir auf der linken Seite. Er hatte keine erkennbare Reaktion auf Marshalls Schwachsinnigkeiten gezeigt.
»Eigentlich nicht, Sir, tut mir leid. Allerdings gibt es eine Denkrichtung, der zufolge man über jedes historische Ereignis – selbst den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, zum Beispiel – im Grunde nur sagen kann, es sei ›etwas geschehen‹.«
»Ach wirklich? Tja, dann wäre ich wohl arbeitslos.« Nach einigem kriecherischem Gelächter verzieh uns Old Joe Hunt unsere Ferienfaulheit und klärte uns über den polygamen königlichen Schlächter auf.
In der nächsten Pause ging ich auf Finn zu. »Ich bin Tony Webster.« Er sah mich argwöhnisch an. »Toller Spruch vorhin bei Hunt.« Er schien nicht zu wissen, worauf ich anspielte. »Darüber, dass ›etwas geschehen‹ sei.«
»Oh. Ja. Ich war ziemlich enttäuscht, dass er nicht weiter darauf eingegangen ist.«
Das war nicht das, was ich erwartet hatte.
Noch ein Detail, an das ich mich erinnere: Wir drei trugen zum Zeichen unserer Verbundenheit die Armbanduhr mit dem Zifferblatt an der Innenseite des Handgelenks. Natürlich war das eine affektierte Marotte, aber vielleicht auch mehr. Sie ließ die Zeit wie etwas Persönliches, ja Geheimes erscheinen. Wir erwarteten, dass Adrian diese Angewohnheit bemerken und sich zu eigen machen würde; aber das tat er nicht.
Am selben Tag – oder vielleicht auch einem anderen – hatten wir dann eine Doppelstunde Englisch bei Phil Dixon, einem jungen Lehrer, frisch aus Cambridge. Er nahm gern zeitgenössische Texte mit uns durch und provozierte uns manchmal mit unerwarteten Äußerungen. »›Geburt, Koitus und Tod‹ – darauf läuft, wie T.S. Eliot sagt, alles hinaus. Gibt es Stellungnahmen dazu?« Einmal verglich er einen Shakespeare-Helden mit Kirk Douglas in Spartacus. Und ich weiß noch, wie er, als wir über die Lyrik von Ted Hughes sprachen, professoral den Kopf schief legte und murmelte: »Natürlich fragen wir uns alle, was wohl passiert, wenn ihm mal die Tiere ausgehen.« Manchmal redete er uns mit »Gentlemen« an. Selbstverständlich vergötterten wir ihn.
An jenem Nachmittag teilte er ein Gedicht ohne Titel, Datum oder Name des Verfassers aus, gab uns zehn Minuten und wollte dann unsere Eindrücke hören.
»Fangen wir mit Ihnen an, Finn? Einfach ausgedrückt, was meinen Sie, worum es in diesem Gedicht geht?«
Adrian schaute von seinem Tisch auf. »Eros und Thanatos, Sir.«
»Hmm. Weiter.«
»Sex und Tod«, fuhr Finn fort, als verstünden womöglich nicht nur die Blödmänner in der hinteren Bank kein Griechisch. »Oder Liebe und Tod, wenn Ihnen das lieber ist. Jedenfalls um das erotische Prinzip und den Konflikt mit dem Todesprinzip. Und was aus diesem Konflikt folgt. Sir.«
Vielleicht wirkte ich stärker beeindruckt, als Dixon gut für mich fand.
»Webster, erhellen Sie uns weiter.«
»Ich dachte, das ist einfach ein Gedicht über eine Schleiereule, Sir.«
Das war auch so ein Unterschied zwischen uns dreien und unserem neuen Freund. Wir waren grundsätzlich auf Verarschung aus, außer wenn es uns ernst war. Ihm war es grundsätzlich ernst, außer wenn er auf Verarschung aus war. Es dauerte eine Weile, bis wir dahinterkamen.
Adrian ließ sich in unsere Gruppe hineinziehen, ohne zu erkennen zu geben, dass er das gewollt hätte. Vielleicht hatte er es gar nicht gewollt. Er änderte auch seine Ansichten nicht, um sie mit unseren in Einklang zu bringen. Beim Morgengebet stimmte er vernehmlich in die Responsorien ein, während Alex und ich nur stumm die Lippen bewegten und Colin sich der satirischen Masche bediente, enthusiastisch zu brüllen wie ein Pseudo-Zelot. Wir drei hielten Schulsport für einen kryptofaschistischen Plan zur Unterdrückung unseres Sexualtriebs; Adrian trat dem Fechtclub bei und trainierte Hochsprung. Wir waren offensiv unmusikalisch; er brachte seine Klarinette in die Schule mit. Wenn Colin über die Familie herzog, ich mich über das politische System lustig machte und Alex philosophische Einwände gegen die Wahrnehmbarkeit der Realität vorbrachte, behielt Adrian seine Meinung für sich – zumindest am Anfang. Er schien an etwas zu glauben. Wir auch – nur wollten wir selbst bestimmen, woran wir glaubten, statt zu glauben, was uns vorgegeben wurde. Daher unser reinigender Skeptizismus oder was wir dafür hielten.
Die Schule lag im Zentrum von London, und wir reisten jeden Tag aus unserem jeweiligen Stadtbezirk an, wobei wir von einem Herrschaftssystem ins andere übergingen. Damals war alles schlichter und klarer: weniger Geld, keine elektronischen Geräte, wenig Modediktat, keine Freundinnen. Nichts konnte uns von unseren Pflichten als Mensch und Sohn ablenken, und die bestanden darin, zu lernen, Prüfungen zu bestehen, mithilfe dieser Qualifikationen eine Arbeitsstelle zu finden und sich dann eine Lebensweise anzueignen, die auf nicht bedrohliche Weise erfüllter war als die unserer Eltern und deren Beifall fand; dabei würden sie diese Lebensweise insgeheim mit ihrem eigenen früheren Leben vergleichen, das einfacher und somit von höherem Wert gewesen wäre. Natürlich wurde nichts davon je ausgesprochen: Der vornehme Sozialdarwinismus der englischen Mittelschicht wirkte immer im Verborgenen.
»Alles alte Arschlöcher, die Eltern«, beklagte sich Colin eines Montags in der Mittagspause. »Wenn man klein ist, findet man sie in Ordnung, und dann merkt man, dass sie genauso sind wie …«
»Heinrich der Achte, Col?«, schlug Adrian vor. Allmählich gewöhnten wir uns an seine ironische Art wie auch daran, dass sich diese Ironie jederzeit gegen uns richten konnte. Wenn er uns neckte oder zur Ernsthaftigkeit aufrief, nannte er mich Anthony; aus Alex wurde Alexander und der nicht verlängerbare Name Colin zu Col verkürzt.
»Meinetwegen könnte mein Dad ruhig ein halbes Dutzend Frauen haben.«
»Und unglaublich reich sein.«
»Und von Holbein gemalt werden.«
»Und den Papst in die Wüste schicken.«
»Gibt es einen besonderen Grund, warum sie AAA sind?«, erkundigte sich Alex bei Colin.
»Ich wollte, dass wir alle zusammen auf den Jahrmarkt gehen. Sie meinten, sie müssten am Wochenende im Garten arbeiten.«
Okay: Alte Arschlöcher. Außer für Adrian, der sich unsere Schmähungen anhörte, aber nur selten mit einstimmte. Und doch hatte er, wie uns schien, mehr Grund dazu als andere. Seine Mutter hatte sich vor Jahren aus dem Staub gemacht und es seinem Dad überlassen, mit Adrian und seiner Schwester zurechtzukommen. Das war lange, bevor der Ausdruck »alleinerziehend« in Gebrauch kam; damals hieß das »zerrüttete Verhältnisse«, und außer Adrian kannten wir niemanden, der aus solchen kam. Das hätte ihm reichlich Stoff für existenziellen Zorn liefern sollen, aber irgendwie klappte das nicht; er sagte, er liebe seine Mutter und habe Achtung vor seinem Vater. Insgeheim begutachteten wir drei seinen Fall und entwickelten eine Theorie: Der Schlüssel zu einem glücklichen Familienleben bestehe darin, dass es keine Familie gebe – zumindest keine, die zusammenlebe. Nach dieser Analyse beneideten wir Adrian nur noch mehr.
Damals hatten wir die Vorstellung, wir würden in einer Art Pferch gefangen gehalten, und warteten darauf, ins Leben entlassen zu werden. Und wenn dieser Moment käme, würde unser Leben – und die Zeit selbst – an Fahrt gewinnen. Wie sollten wir auch wissen, dass unser Leben ohnehin begonnen hatte, dass mancher Vorsprung bereits gewonnen, mancher Schaden bereits angerichtet war? Und dass nach der Entlassung nur ein größerer Pferch auf uns wartete, dessen Grenzen zunächst nicht zu erkennen waren?
Vorerst waren wir bücherhungrig, sexhungrig, leistungsorientiert und anarchistisch. Alle politischen und gesellschaftlichen Systeme erschienen uns korrupt, doch als Alternative ließen wir nichts als hedonistisches Chaos gelten. Adrian aber trieb uns dazu, an die Anwendung des Denkens auf das Leben zu glauben, an die Vorstellung, dass Handeln von Prinzipien geleitet sein sollte. Bis dahin hatte Alex als der Philosoph unter uns gegolten. Er hatte Sachen gelesen, die wir zwei anderen nicht gelesen hatten, und konnte zum Beispiel plötzlich verkünden: »Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.« Colin und ich dachten eine Weile stumm über diesen Gedanken nach, dann grinsten wir uns an und redeten weiter. Doch als Adrian kam, vertrieb er Alex von dieser Position – besser gesagt, er bot uns andere Philosophen zur Auswahl. Wenn Alex Russell und Wittgenstein gelesen hatte, so hatte Adrian Camus und Nietzsche gelesen. Ich hatte George Orwell und Aldous Huxley gelesen; Colin hatte Baudelaire und Dostojewski gelesen. Ich übertreibe nur ganz leicht.
Ja, natürlich waren wir prätentiös – wozu ist die Jugend sonst da? Wir gebrauchten Ausdrücke wie »Weltanschauung« und »Sturm und Drang«, sagten mit Vergnügen »Das ist philosophisch evident« und versicherten uns gegenseitig, Grenzüberschreitung sei die oberste Pflicht der Fantasie. Unsere Eltern sahen das anders, für sie waren ihre Kinder unschuldige Wesen, die plötzlich einem verderblichen Einfluss ausgesetzt waren. So nannte Colins Mutter mich seinen »schwarzen Engel«; mein Vater gab Alex die Schuld, als er mich bei der Lektüre des Kommunistischen Manifests erwischte; Alex’ Eltern hatten Colin im Verdacht, als sie Alex mit einem Krimi der knallharten amerikanischen Schule ertappten. Und so immer weiter. Bei Sex war es genauso. Unsere Eltern glaubten, wir würden einander so korrumpieren, dass wir zum Schreckgespenst ihrer schlimmsten Träume würden: ein unverbesserlicher Onanist, ein liebreizender Homo, ein unbekümmert schwängernder Wüstling. Um unseretwillen fürchteten sie die engen Bande pubertärer Freundschaft, das Raubtiergebaren fremder Männer in Eisenbahnzügen, die Reize von Mädchen der falschen Sorte. Wie weit ihre Ängste doch über unsere Erfahrungen hinausgingen.
Eines Nachmittags ließ uns Old Joe Hunt, als wollte er auf Adrians frühere Herausforderung zurückkommen, die Ursachen des Ersten Weltkriegs erörtern – insbesondere das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand und die Verantwortung des Mörders dafür, das Ganze in Gang gesetzt zu haben. Damals waren wir fast alle Absolutisten. Wir wollten Ja oder Nein, Lob oder Tadel, Schuld oder Unschuld – oder, im Fall von Marshall, Unruhe oder große Unruhe. Wir wollten, dass ein Spiel mit Sieg oder Niederlage endete, nicht mit einem Unentschieden. Daher war der serbische Revolverheld, dessen Name mir längst entfallen ist, für manche zu hundert Prozent persönlich verantwortlich: Nimmt man ihn aus der Gleichung heraus, wäre der Krieg nie geschehen. Andere machten zu hundert Prozent die historischen Kräfte verantwortlich, die die feindlichen Nationen auf einen unausweichlichen Kollisionskurs geführt hätten: »Europa war ein Pulverfass, das jeden Moment explodieren konnte« und so weiter. Anarchischere Geister wie Colin argumentierten, alles werde vom Zufall regiert, die Welt existiere in einem Zustand fortwährenden Chaos, und nur ein primitiver Erzähltrieb, der zweifellos auch bloß ein Überbleibsel der Religion sei, wolle im Nachhinein dem, was hätte geschehen können oder auch nicht, Bedeutung überstülpen.
Hunt nickte nur kurz zu Colins Versuch, alles zu unterminieren, als sei morbider Unglaube eine natürliche Begleiterscheinung der Pubertät und werde sich mit der Zeit auswachsen. Zu unserem Ärger führten Eltern und Lehrer uns ständig vor Augen, dass auch sie einmal jung gewesen und darum zu einer Meinung befugt seien. Es ist nur eine Phase, behaupteten sie beharrlich. Das wächst sich aus; das Leben wird euch schon beibringen, was Realität und Realismus ist. Doch damals weigerten wir uns anzuerkennen, dass sie jemals wie wir gewesen seien, und wir wussten, dass wir das Leben – und die Wahrheit und die Moral und die Kunst – sehr viel klarer erfassten als diese kompromittierten alten Herrschaften.
»Finn, Sie haben noch gar nichts gesagt. Dabei haben Sie diesen Ball ins Rollen gebracht. Sie sind sozusagen unser serbischer Attentäter.« Hunt schwieg kurz, um die Anspielung wirken zu lassen. »Wären Sie so freundlich, uns an Ihren Gedanken teilhaben zu lassen?«
»Ich weiß nicht, Sir.«
»Was wissen Sie nicht?«
»Nun, streng genommen kann ich nicht wissen, was es ist, das ich nicht weiß. Das ist philosophisch evident.« Er legte eine dieser winzigen Pausen ein, in der wir uns wieder einmal fragten, ob das subtiler Spott war oder eine Ernsthaftigkeit, die uns anderen zu hoch war. »Ja, ist nicht das ganze Tamtam darum, wen man wofür zur Verantwortung ziehen kann, so etwas wie Drückebergerei? Wir wollen einem Einzelnen die Schuld geben, um damit alle anderen reinzuwaschen. Oder wir geben einer historischen Entwicklung die Schuld, um damit Einzelne freizusprechen. Oder alles ist ein einziges anarchisches Chaos, mit denselben Konsequenzen. Mir scheint, es gibt – gab – da eine Kette individueller Verantwortlichkeiten, die samt und sonders notwendig waren, aber die Kette ist nicht so lang, dass jeder einfach die Schuld auf den anderen schieben kann. Nun könnte mein Bestreben, etwas oder jemanden zur Verantwortung zu ziehen, natürlich eher Zeugnis meiner eigenen Denkungsart als einer unvoreingenommenen Analyse des Geschehens sein. Das ist doch ein Kernproblem der Geschichtsschreibung, nicht wahr, Sir? Die Frage der subjektiven gegenüber der objektiven Interpretation, die Notwendigkeit, die Geschichte des Geschichtsschreibers zu kennen, damit wir verstehen, warum uns gerade diese Version unterbreitet wird.«
Es trat Schweigen ein. Und nein, er war nicht auf Verarschung aus, ganz und gar nicht.
Old Joe Hunt schaute auf die Uhr und lächelte. »Finn, in fünf Jahren gehe ich in den Ruhestand. Und ich stelle Ihnen mit Vergnügen eine Empfehlung aus, falls Sie meine Nachfolge antreten möchten.« Und auch er war nicht auf Verarschung aus.
Eines Morgens verkündete der Direktor den in der Aula versammelten Schülern und Lehrern in dem düsteren Ton, den er bei Schulverweisen und katastrophalen Sportniederlagen anschlug, er habe eine traurige Nachricht für uns, und zwar sei Robson aus der Oberstufe Naturwissenschaft am Wochenende verstorben. Während ergriffenes Gemurmel einsetzte, erzählte er uns, Robson sei in der Blüte der Jugend dahingerafft worden, sein Hinscheiden sei ein Verlust für die gesamte Schule, und wir seien alle symbolisch bei der Beerdigung zugegen. Eigentlich alles, nur nicht das, was wir wissen wollten: wie und warum und, falls es etwa Mord war, durch wen.
»Eros und Thanatos«, bemerkte Adrian vor der ersten Unterrichtsstunde des Tages. »Thanatos hat mal wieder gesiegt.«
»Robson war nicht gerade ein Eros-und-Thanatos-Kandidat«, wandte Alex ein. Colin und ich nickten zustimmend. Wir wussten das, weil er einige Jahre in unserer Klasse gewesen war: ein ordentlicher, fantasieloser Junge, der ein völliges Desinteresse an allem Künstlerischen gezeigt hatte und seinen Weg getrottet war, ohne jemandem etwas zuleide zu tun. Jetzt hatte er uns etwas zuleide getan, weil er sich mit seinem frühen Tod einen Namen gemacht hatte. Die Blüte der Jugend, na ja: Der Robson, den wir gekannt hatten, war eine unscheinbare Pflanze gewesen.
Von einer Krankheit, einem Fahrradunfall oder einer Gasexplosion war nicht die Rede gewesen, und ein paar Tage später verlautete durch Gerüchte (alias Brown aus der Oberstufe Mathe), was die Obrigkeit nicht verlauten lassen konnte oder wollte. Robson hatte seiner Freundin ein Kind gemacht, sich auf dem Dachboden erhängt und war erst nach zwei Tagen gefunden worden.
»Ich hätte nie gedacht, dass er weiß, wie man sich erhängt.«
»Er war in der Oberstufe Naturwissenschaft.«
»Aber man braucht doch einen speziellen Laufknoten.«
»Nur im Kino. Und bei echten Hinrichtungen. Es geht auch mit einem ganz normalen Knoten. Dauert nur länger, bis du erstickst.«
»Wie stellen wir uns seine Freundin vor?«
Wir erwogen die uns bekannten Möglichkeiten: spröde Jungfrau (nunmehr Exjungfrau), aufgetakeltes Ladenmädchen, erfahrene ältere Frau, verseuchte Hure. Die erörterten wir, bis Adrian unser Interesse in eine andere Richtung lenkte.
»Camus hat gesagt, Selbstmord sei die einzig wahre philosophische Frage.«
»Von Ethik, Politik, Ästhetik, dem Wesen der Wirklichkeit und allem anderen abgesehen.« Alex’ Erwiderung hatte eine gewisse Schärfe.
»Die einzig wahre Frage. Die grundlegende Frage, aus der sich alle anderen ableiten.«
Nach ausführlicher Analyse von Robsons Selbstmord kamen wir zu dem Schluss, dieser Selbstmord könne nur in einem arithmetischen Sinn als philosophisch gelten: Da Robson sich anschickte, die Menschheit um ein Wesen zu vermehren, hatte er sich ethisch verpflichtet gefühlt, die Zahlen auf diesem Planeten konstant zu halten. Doch in jeder anderen Beziehung befanden wir, Robson habe uns – und das ernsthafte Denken – verraten. Er hatte unphilosophisch, ichbezogen und unkünstlerisch gehandelt: mit anderen Worten, falsch. Und mit seinem Abschiedsbrief, in dem Gerüchten (wiederum Brown) zufolge nur »Tut mir leid, Mama« stand, war unserer Meinung nach ein ungeheures Bildungspotenzial verschenkt worden.
Vielleicht wären wir nicht so hart mit Robson ins Gericht gegangen, wäre da nicht eine entscheidende, unumstößliche Tatsache gewesen: Robson war so alt wie wir, er war nach unseren Maßstäben nichts Besonderes, und doch hatte er sich nicht nur hinterrücks eine Freundin angeschafft, sondern auch unbestreitbar Sex mit ihr gehabt. Altes Arschloch! Warum der und wir nicht? Warum hatte keiner von uns auch nur die Erfahrung gemacht, wie man dabei scheiterte, sich eine Freundin anzuschaffen? Durch so eine Demütigung hätten wir zumindest an Lebensweisheit gewonnen und etwas gehabt, mit dem wir hätten negativ prahlen können (»Tja, ›pickeliger Trottel mit dem Charisma eines Turnschuhs‹, hat sie wortwörtlich gesagt«). Durch unsere Lektüre großer Literatur wussten wir, dass Liebe und Leid untrennbar zusammengehören, und wir hätten uns mit Vergnügen in ein bisschen Leid geübt, wenn das mit der stillschweigenden, vielleicht gar logischen Verheißung einhergegangen wäre, dass die Liebe nun nicht mehr lange auf sich warten lasse.
Das war auch so eine Angst, die uns quälte: dass es im Leben anders zugehen könnte als in der Literatur. Unsere Eltern, zum Beispiel – waren die etwa Stoff für die Literatur? Die dürften doch bestenfalls als Beobachter und Zuschauer Verwendung finden, Teil eines gesellschaftlichen Hintergrunds, vor dem sich reale, wirkliche, bedeutsame Dinge abspielen könnten. Zum Beispiel? All das, worum es in der Literatur ging: Liebe, Sex, Moral, Freundschaft, Glück, Leid, Verrat, Ehebruch, Gut und Böse, Helden und Schurken, Schuld und Unschuld, Ehrgeiz, Macht, Gerechtigkeit, Revolution, Krieg, Väter und Söhne, Mütter und Töchter, der Einzelne gegen die Gesellschaft, Erfolg und Versagen, Mord, Selbstmord, Tod, Gott. Und Schleiereulen. Natürlich gab es auch Literatur anderer Art – theoretische, selbstreferenzielle, weinerlich autobiografische –, aber das war alles nur Trockenwichserei. Wahre Literatur handelte von psychologischen, emotionalen und gesellschaftlichen Wahrheiten und stellte sie in den Handlungen und Überlegungen der Protagonisten anschaulich dar; der Roman handelte von der Entwicklung eines Charakters im Laufe der Zeit. Jedenfalls hatte Phil Dixon uns das so beigebracht. Und der einzige Mensch – von Robson abgesehen –, in dessen Leben es bisher etwas annähernd Romanwürdiges gab, war Adrian.
»Warum hat deine Mama deinen Dad verlassen?«
»Weiß ich nicht genau.«
»Hatte deine Mama einen anderen?«
»War dein Vater ein Hahnrei?«
»Hatte dein Dad eine Geliebte?«
»Weiß ich nicht. Sie haben gesagt, ich werde das verstehen, wenn ich älter sei.«
»Das versprechen sie einem ständig. Erklärt’s mir doch jetzt, sag ich immer.« Allerdings hatte ich das nie sagen müssen. Und soweit ich wusste, gab es in unserem Haus keine Geheimnisse, zu meiner Beschämung und Enttäuschung.
»Vielleicht hat deine Mama einen jungen Liebhaber?«
»Woher soll ich das wissen? Wir treffen uns nie bei ihr. Sie kommt immer nach London.«
Da war nichts zu machen. In einem Roman hätte Adrian nicht einfach alles so hingenommen, wie es ihm vorgesetzt wurde. Wozu war eine literaturwürdige Situation gut, wenn der Protagonist sich nicht so benahm, wie er es in einem Buch getan hätte? Adrian hätte herumschnüffeln oder sein Taschengeld sparen und einen Privatdetektiv anheuern sollen; vielleicht hätten wir uns alle vier auf die Suche nach der Wahrheit begeben sollen. Oder hätte das nicht nach Literatur, sondern eher nach einem Kinderbuch ausgesehen?
In der letzten Geschichtsstunde vor den Ferien wollte Old Joe Hunt, der seine lethargischen Schüler durch die Tudors und Stuarts, die Viktorianer und Edwardianer, den Aufstieg des Britischen Empire und dessen anschließenden Niedergang geleitet hatte, dass wir auf all diese Jahrhunderte zurückblickten und uns an Schlussfolgerungen versuchten.
»Vielleicht beginnen wir mit der scheinbar einfachen Frage: Was ist Geschichte? Fällt Ihnen dazu etwas ein, Webster?«
»Geschichte ist die Summe der Lügen der Sieger«, antwortete ich etwas zu rasch.
»Ja, ich habe befürchtet, dass Sie das sagen würden. Nun gut, solange Sie im Auge behalten, dass sie auch die Summe der Selbsttäuschungen der Besiegten ist. Simpson?«
Colin war besser vorbereitet als ich. »Geschichte ist ein Sandwich mit rohen Zwiebeln, Sir.«
»Warum das?«
»Sie stößt einem immer wieder auf, Sir. Sie rülpst. Das haben wir dieses Jahr andauernd gesehen. Immer dieselbe Geschichte, immer dasselbe Schillern zwischen Tyrannei und Rebellion, Krieg und Frieden, Wohlstand und Verarmung.«
»Muss ja ein ziemlich dickes Sandwich sein, meinen Sie nicht auch?«
Wir lachten viel länger als nötig, ein Anfall von Schuljahresendhysterie.
»Finn?«
»›Geschichte ist die Gewissheit, die dort entsteht, wo die Unvollkommenheiten der Erinnerung auf die Unzulänglichkeiten der Dokumentation treffen‹.«
»Ach ja? Wo haben Sie das her?«
»Lagrange, Sir. Patrick Lagrange. Ein Franzose.«
»Wie der Name schon sagt. Würden Sie uns freundlicherweise ein Beispiel geben?«
»Robsons Selbstmord, Sir.«
Das löste ein hörbares Schnappen nach Luft und verwegenes Hälserecken aus. Doch Adrian genoss bei Hunt wie bei allen anderen Lehrern eine Sonderstellung. Wenn wir anderen eine Provokation versuchten, wurde das als kindischer Zynismus abgetan – wieder etwas, das sich bald auswachsen würde. Adrians Provokationen dagegen wurden als unbeholfene Suche nach der Wahrheit aufgenommen.
»Was hat der mit unserem Thema zu tun?«