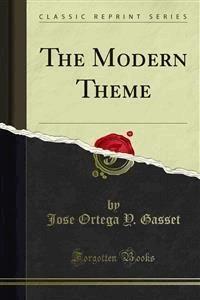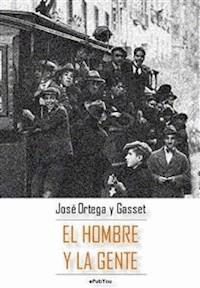Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ernst Robert Curtius sagte über José Ortega y Gasset: "Er ist vielleicht der einzige Mensch in Europa, dem es gegeben und gemäß ist, mit der gleichen Intensität des Interesses, der gleichen Sicherheit des Urteils, dem gleichen Glanz der Formulierung über Kant wie über Proust, über Debussy wie über Scheler zu sprechen. Zwischen vorgeschichtlichen Kulturen und kubistischer Malerei scheint es nichts zu geben, was diesen Kritiker nicht interessierte." Das Buch "Vom Menschen als utopischen Wesen", das im Europa Verlag erstmals im Jahre 1951 erschien, versammelt vier Essays, die Curtius' Urteil begründen: Ideen und Glaubensgewißheiten, Insichselbst-Versenkung und Selbstentfremdung, Glanz und Elend der Übersetzung und Ideen für eine Geschichte der Philosophie. Ob Ortega von den Phänomenen des Denkens und Glaubens, der Selbstversenkung und -entfremdung ausgeht oder von der Geschichte der Philosophie: nach wenigen Sätzen ist er in den Tiefen der Problematik und - wie er meint - des wesentlich utopischen Charakters des menschlichen Tuns. Er öffnet dem Leser die Augen für Einsichten und Zusammenhänge, die ihm bis dahin, wenn nicht fremd, so doch nicht klar bewußt waren. " Das Schicksal - das Privileg und die Ehre - des Menschen ist es, niemals ganz zu erreichen, was er sich vornimmt und bloßer Anspruch, lebende Utopie zu sein. Immer schreitet er der Niederlage entgegen, und schon ehe er in den Kampf eintritt, trägt er die Wunde an der Schläfe." (Ortega y Gassett)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jose Ortega y Gasset
Vom Menschenals utopischem Wesen
Vier EssaysMit einer Einführungvon Eberhard Straub
Titel der Originalausgabe: Ideas y creencias
Aus dem Spanischen von Dr. G. Kilpper und Dr. G. Lepiorz Erstveröffentlichung im Europa Verlag AG Zürich, 1951
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe Europa Verlag AG Zürich, 2005 Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung,
Vervielfältigung (auch fotomechanisch) und Verbreitung, der elektronischen Speicherung auf Datenträgern oder in Datenbanken, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg
der Datenübertragung) vorbehalten.
www.europa-verlag.ch
Umschlaggestaltung: Bayerl & Ost
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN 3-85665-513-1
Zur Einführung
Eberhard StraubZur Einführung
Während des Ersten Weltkrieges hatte sich die Vorstellung von Europa als geistig gesicherter Selbstverständlichkeit aufgelöst. Zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Geschichte faßten die Europäer einen Krieg untereinander als erbitterten Kulturkampf auf. Selbst die heftigen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den Konfessionskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts hatten die gesellschaftliche Einheit Europas nicht erschüttern können. Die internationale Aristokratie und wer ihr diente, Maler, Musiker, Gelehrte oder Dichter, die vornehme Welt und deren Interpreten waren nicht dazu übergegangen, einen perfekten Kavalier allein nach seinem Glaubensbekenntnis zu beurteilen oder gar zu verurteilen. Religion wurde zur Privatsache, die schönen Sitten, adeliger Anstand und guter Geschmack blieben eine verbindliche und öffentliche, eine vor-staatliche, gesellschaftliche Macht, die ihre Grundsätze gefälliger Lebensformen in einem langen Abwehrkampf zu behaupten wußte.
Um 1900 mußte ein europäischer Gedankenaustausch nicht eigens organisiert werden. Trotz lebhaft konkurrierender Nationalismen kannte sich der Adel der Herkunft, des Geistes und der etwas zweifelhafte des Geldes untereinander, besuchte sich oder setzte in zahllosen Briefen ein imaginäres Gespräch fort. Ein Netz von Freundschaften, erotischen Passionen oder zwanglosen Bekanntschaften hielt dieses „vergesellschaftete" Europa zusammen, dem am unteren Ende die Internationale der Arbeiterschaft entsprach, die ihre Aufgabe darin erkannte, sich diesem Europa der Europäer einzufügen. Diese Welt zerbrach an den wechselseitigen politischen und ideologischen Schuldzuweisungen im »Großen Krieg" und wurde zur »Welt von Gestern".
Jose Ortega y Gasset, 1883 geboren, Sohn eines liberalen Zeitungsverlegers, wuchs in die damals noch gemeinsame Lebenskultur hinein und wurde – nach Reisen durch Europa und Studienjahren in Leipzig, Berlin und Marburg – 1911 Professor für Philosophie in Madrid. Ihn bekümmerte das »Europa desocializado" nach 1918, das fragmentierte, ungesellige, erschöpfte Europa, dessen Nationen sich weiterhin mißtrauten. Zusammen mit Benedetto Croce, Paul Valery, Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss oder dem Prinzen Karl Anton Rohan setzte er sich für eine schöpferische Restauration des Begriffes Europa ein, nicht als bloßer Gedanke oder blasse Idee, sondern als eine Lebensmacht, die befreiend und versöhnend unter den einander fremd gewordenen Nationen wirken sollte. Damit wurde Jose Ortega y Gasset zu einer europäischen Zelebrität. Mit seiner Ausdrucksfreude wollte er die Europäer wieder zu einer „alegría intelectual", einer geistigen Anmut, überreden, die er bei ihnen seit dem Kriege so sehr vermißte.
Das bedeutete, „vigencias colectivas" zurückzugewinnen oder neu zu entwickeln: Prinzipien und Überzeugungen, die ein Zusammenleben ermöglichen und die die mit sich selbst beschäftigten Nationen von sich ablenken und auf unterbrochene Zusammenhänge verweisen würden. Die Europäer, ohne Verständnis füreinander, hatten, wie Ortega beklagte, ihre wichtigste, oft bewährte Fähigkeit eingebüßt, auch nach einem langen Krieg zu einem tatsächlichen Frieden zu gelangen. Diese Fähigkeit setzte eben die von ihm vermißte Besinnung auf grundsätzliche Gemeinsamkeiten voraus, was auch bedeutete, den Feind als einen gleichberechtigten Konkurrenten anzuerkennen, nach dem Krieg nicht an das zu erinnern, was während des Krieges geschehen war, und davon abzusehen, nach der Kriegsschuld zu fragen und den Besiegten als Schuldigen bestrafen zu wollen. Ortega hielt an den alteuropäischen Gewohnheiten fest, wie sie sich seit 1648, seit dem Westfälischen Frieden, durchgesetzt hatten. Die Pariser Vorortverträge – von Versailles, Saint-Germain, Neuilly und Trianon – und der Völkerbund schufen keine neue Ordnung, wie Ortega den Alliierten vorwarf, sondern versetzten Europa in einen Zustand des latenten Bürgerkrieges und damit in eine Vorkriegszeit, die in einen weiteren europäischen Krieg überleiten würde. Ortega hatte im neutralen Spanien während des Krieges mit den Alliierten sympathisiert, nach dem Krieg galt seine Sympathie jedoch den Besiegten und allen Benachteiligten einer für ihn haltlosen Unordnung, die vor allem die Franzosen ängstlich als Ordnung gewahrt wissen wollten.
Regionale Egoismen oder Bedürfnisse, wie die Sicherheit Frankreichs, interessierten Ortega jedoch nicht. Ihn beunruhigte die Krise Europas insgesamt. Die autoritären Regime, die bald nach 1918 in vielen Staaten errichtet wurden, hielt er nicht für die Ursache, sondern für ein Symptom der Unruhe und der Unsicherheit, die Europa aus dem Gleichgewicht gebracht hatten. Als Spanier ließ er sich nicht von dem Schlagwort „der Untergang des Abendlandes" beeindrucken. Spanien, einst die erste Weltmacht, war auch die erste europäische Nation, die 1898 gleichsam aus dem Zentrum der Welt an deren Rand gedrängt worden war, als es nach dem Krieg mit den USA seine letzten Besitzungen in Amerika und Asien verloren hatte. Das Schicksal der Spanier, eines sterbenden Volkes, wie es hieß, interessierte damals die übrigen Europäer nicht sonderlich, die sich in ihren Staaten so sicher wähnten wie die Götter Wagners in Walhall. Es gab genug Skeptiker, die davor warnten, die eigene Gefährdung zu unterschätzen, die von „decadence" sprachen und Europa als ein Reich am Ende eines allmählichen Verfalls betrachteten, das prunkend seine Spätantike erlebte, während am Horizont schon die Barbaren auftauchten. Doch solche Katastrophenstimmungen konnten die Gewißheit nicht erschüttern, es herrlich weit gebracht zu haben. Die Spanier allerdings waren hellhörig für kulturkritische Melancholien und politischen Weltschmerz. Viel zu sehr mit dem Scheitern ihrer Geschichte beschäftigt, faßten sie vor dem Krieg ihre Glücklosigkeit jedoch nicht unbedingt als ein Vorspiel einer gesamteuropäischen Krise auf.
Als die Parole Oswald Spenglers nach 1918 unter den Europäern zündete, erinnerte Ortega daran, daß der „Untergang des Abendlandes" nur mit erheblichem Lärm die Zweifel hinsichtlich der Stellung Europas in der Welt verstärkte, die schon um 1900 längst bekannt waren, aber nicht ernst genug genommen wurden. Das gehörte eben zu der Frivolität und Verantwortungslosigkeit, die er bei den Eliten diagnostizierte. Diese trieben Europa in den Krieg und gaben es der moralischen Verwahrlosung anheim, welche es jetzt schwer machte, einen Ausweg zum allgemeinen Nutzen zu finden. Ortega, ein eminenter Historiker unter den Philosophen, suchte immer in der Vergangenheit nach den Ursachen von Phänomenen, die ihn irritierten oder erstaunten. Aber er neigte nicht dazu, die Geschichte als etwas Geschehenes zu überschätzen. Nicht was Völker gestern waren oder unternahmen, halte sie zusammen, wie er immer wieder bemerkte, sondern was sie morgen gemeinsam machen werden. Denn Nationen seien Arbeitsgemeinschaften, die in die Zukunft wirken wollten, weil sie sich Ziele setzten, jeweils von den Herausforderungen des Tages dazu genötigt, um nicht unter dem Druck der Vergangenheit vom rechten Wege abgelenkt zu werden. Leben entwickele sich als Zusammenleben bei der Bewältigung gemeinsamer Aufgaben. Das gelte für Personen wie für Nationen und deren Austausch im gemeinsamen Europa.
Im staatlich-nationalen Rahmen hängt Ortega zufolge alles davon ab, ob die Eliten leisten, wozu sie bestimmt sind: die diffusen Energien zu bündeln und sie auf Zwecke auszurichten, welche die Gesellschaft dynamisieren und sie davor bewahren, in Routine zu erstarren, sowie das nationale Leben dauernd in Bewegung zu halten, ungestört durch unnützes Erinnern und vergeblichen Streit. Die Eliten vermitteln zwischen der Nation und dem Staat – so Ortega –, sie verdeutlichen der Nation ihren Willen und verhelfen dem Staat dazu, seinen Willen mit dem der Nation in Übereinstimmung zu bringen, so daß eine Nation sich konstituiert in der täglichen Bereitschaft, Herausforderungen gemeinsam anzunehmen und sich in dem, was alle angeht, nicht durch Sonderbestrebungen beirren zu lassen. In Spanien gab es schon vor der Niederlage von 1898 eine heftige Diskussion über Eliten, die ihrer Bestimmung, wie es hieß, nicht genügten, das authentische Spanien gar nicht kannten und eigennützig, korrupt und geistlos jede Lebensregung erstickten. Statt Spanien zu erneuern, nutzten sie dessen Schwächezustände zu ihrem Vorteil aus. Der junge Ortega kannte diese Vorwürfe.
In Der Aufstand der Massen übertrug er später die innerspanische Kritik auf europäische Zusammenhänge. Die Massen verbitterten ihn gar nicht so sehr. Ihn ärgerte vor allem die Unfähigkeit und der mangelnde Wille der Gelehrten, Journalisten, Politiker oder Unternehmer, der Leistungseliten oder Führungskräfte, sich über das Niveau des Durchschnitts zu erheben, was sie allein dazu befähigen würde, die unbestimmten Bedürfnisse der Massen zu domestizieren und zu rationalisieren, sie vernünftigen Zwecken dienstbar zu machen. Ortega verstimmte es, daß sich die Eliten in ihrer Mittelmäßigkeit von der Masse gar nicht unterschieden, vielmehr selber nur Teil von ihr waren und daher gar nicht geeignet zu politischer, geistiger und moralischer Führung. Er warf weniger den Massen vor, daß sie sich in den Vordergrund drängten und die Protagonisten der Handlung übertönten, als vielmehr den zur Führung Unfähigen, daß sie den Massen erst zu Bedeutung verhalfen, um dann deren Wünsche für ihre eigenen Absichten auszunutzen. Darin sah er die große moralische Krise, in die Europa, wenn es sie nicht überwand, die übrige Welt hineinziehen würde, weil diese gewohnt war, sich nach dem Beispiel Europas zu richten. Denn seit Jahrhunderten habe Europa der Welt Aufgaben und Pflichten zugeteilt und sie damit geordnet. Die Welt könne nur in Unordnung stürzen, sobald Europa sich unfähig erweise, seiner Rolle weiterhin zu genügen.
Ortega hatte nichts dagegen, unter Umständen Europa neuen Weltmächten und deren Eliten unterzuordnen. Aber er sah keine rettenden Mächte am Horizont. Die USA waren Ortega zufolge noch gar nicht in der Zeit, in welcher Geschichte sich entwickelt, angekommen, sondern nur damit beschäftigt, ihren Raum, eine vorgeschichtliche Sphäre, zu organisieren, sich in ihm zurechtzufinden. Die Amerikaner waren für ihn primitive, vor-zeitliche Wesen, trotz der Technik, die sie als europäische Maske gebrauchten, um ihre Kindlichkeit und Leidensferne, ihre Unerfahrenheit mit dem Leben nicht ungeschickt zu verbergen. Von Amerika war nichts zu erwarten und nichts zu befürchten. Es galt ihm nur als Widerhall der alten Welt und als Ausdruck fremder Lebendigkeit, soweit sich Leben dort überhaupt zu erhalten und zu steigern vermochte. Ganz in Übereinstimmung mit Hegel interessierte sich Ortega überhaupt nicht für die USA, die noch nicht in der Welt als Geschichte, in der sich die Vernunft entfaltet, angekommen waren. Die Europäer hatten genug damit zu tun, mit der Weltvernunft in Übereinstimmung zu bleiben, was sie der Mühe enthob, sich Gedanken über die Amerikaner zu machen.
Europa sei ganz auf sich selbst verwiesen, auf sein innerstes Leben, wie auch jedes Individuum bei der Bemühung, in der Vielfalt des Lebens das eigene zu realisieren und damit zu der Wirklichkeit zu gelangen, die sich ihm nur in seinem ureigenen Lebensdrama zu erkennen gebe. Ortega zweifelte nicht daran, daß die Existenz Europas in der großen Krise, die plakativ als "Untergang des Abendlandes" beschworen wurde, in äußerste Gefahr geriet. Ihn packte deshalb der Zorn über unwürdige Eliten, die vor den Ansprüchen der Zeit versagten. Zugleich aber betrachtete er die Krise – wie Goethe einst die Französische Revolution – als „Kinderkrankheit", die durchlaufen werden mußte. War sie überwunden oder überstanden, dann würde Europa nach manchen Veränderungen zu einer neuen und glücklichen Gestalt finden. Ortega, der davon überzeugt war, daß das Ende der Neuzeit angebrochen sei, erwartete deshalb in der „Post-Moderne" die Metamorphose des Nationalstaates, des auffälligsten Erzeugnisses der Neuzeit. Die europäische Unruhe, in der sich nationale Nervositäten bis zur Hysterie steigerten, führte er darauf zurück, daß der Nationalstaat für die Europäer zu eng geworden sei. So weit fortgeschritten, wie sie nun einmal seien, wollten sie sich aus ihren beengenden Begrenzungen befreien, blieben aber vorerst ihren Nationen, die sie doch nur hemmten, weiter verhaftet, weil sie noch keine begeisternde, sämtliche Energien belebende Vorstellung von Europa besäßen.
Aus den fürchterlichen Wirren aber, in denen es sich zu verlieren drohe, werde Europa herausfinden und in der künftigen Union der europäischen Staaten die Nation erkennen. Dann werde es wieder den historischen Rang einnehmen, den ihm die Geschichte zugewiesen habe. Damit tröstete Ortega sich und seine Zeitgenossen 1938, nachdem er die spanische Republik verloren gegeben und sich in die »vorgeschichtliche" Welt, nach Amerika, nach Argentinien, zurückgezogen hatte, um dann ab 1941 doch an der Küste Europas, in Portugal, während der weiteren Zusammenbrüche auszuharren, die er als Voraussetzung einer Metamorphose der Gesellschaften und Staaten auffaßte. Als er im Oktober 1955 starb, hatten sechs europäische Staaten den Weg hin zu einem künftigen Europa als einem Vaterland eingeschlagen, in dem die regionalen Vaterländer »aufgehoben" waren. Ortega hatte also nicht vergeblich gelehrt und gelebt. Gerade in der frühen Bundesrepublik galt dieser spanische Europäer als Autorität, als Mut machende Kraft. Seine ungeduldige Ablehnung von behaglicher Mittelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit irritierte nicht sonderlich. Sie kam vielmehr sehr gelegen im Kalten Krieg, um den Westen und die Freiheit im Kampf gegen den Sozialismus und den nivellierenden Kollektivismus als überlegene Mächte präsentieren zu können.
Ortega, der so oft mißverstanden worden war, mußte sich auch an dieses Mißverständnis gewöhnen. Er hatte den Sozialismus, den er in Deutschland zuerst kennenlernte, nie als notwendigerweise egalisierende, die unterschiedlichen Niveaus einebnende Macht betrachtet. Ihm imponierte vielmehr der sittlich-asketische Ernst der deutschen Arbeiterschaft und der Sozialdemokratie mit ihrer elitenbildenden Anspruchshaltung, die vom Begeisterten Verzicht, Disziplin, Sachgerechtigkeit, Solidarität und Treue verlangte. Denn mit solchen Sozialisten konnte man einen Staat machen, wie er ihn sich vorstellte, eine neue Ordnung schaffen, welche die Lebensenergien endlich freisetzen würde, die bislang in ihren Wirkungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden. Zu den Enttäuschungen dieses Mannes, der die Republik nur als Mittel auffaßte, um eine ermattete Gesellschaft wiederzubeleben, gehörte, daß die spanischen Sozialisten in der Republik ab 1931 als Doktrinäre am Leben vorbei handelten und sich damit von der Idee, die sie verwirklichen wollten, ebenso entfernten wie von der Republik in der Realität. Denn Ideen lassen sich nicht eins zu eins auf die Wirklichkeit übertragen, wie Ortega unermüdlich betonte. In der Realität entfalte sich das Leben unzähliger Einzelner, die Wirklichkeiten schafften, welche wiederum die Bedingungen für das Entstehen neuer Wirklichkeiten darstellten. Konflikte könnten auftreten, wenn die Einzelnen verschiedene, nicht miteinander vereinbare Wirklichkeiten anstrebten. So entstehe mit dem Bemühen, Ideen „vernünftig" in die Praxis umzusetzen, gleichzeitig viel Irrationales.
Hier beginnt für Ortega die Unvernunft, vor der sich Europa hüten müsse, der Hort der Weltvernunft, die als zeitliche Macht ihren Raum in Europa finde und damit bekunde, wie Zeit zum Raum werde, die Geschichte an einem konkreten Ort zu ihrer Bestimmung komme – Überlegungen, die Schelling, Hegel oder Richard Wagner früher schon beschäftigt hatten. Europa blieb für ihn der Mittelpunkt der Welt und als Vorbild für diese unentbehrlich, wollte sie zu einer sittlichen Größe, zu einer freien Welt werden. Ortegas Enthusiasmus setzte allerdings eines voraus: daß die Europäer sich von allen Illusionen, Fiktionen und Utopien lösten, die ihre Lebenskraft schwächten und sie gegeneinander aufbrachten und in Kriege trieben. Das hieß für ihn, daß die Europäer zum Lebensernst zurückfinden müßten, zu Disziplin und hohen Ansprüchen an sich selbst, nicht um sich nach eigener Laune selbst zu verwirklichen, sondern um zur Freiheit innerhalb einer Ordnung zu gelangen, die notwendig wäre, um den Einzelnen in friedlicher Verbindung mit den Anderen zu halten. Denn von Natur aus sei der Mensch gerade kein geselliges Wesen.
Gesellig werde der Einzelne erst durch das Zusammenleben. Seiner radikalen Einsamkeit, der Grundbedingung seines Daseins, werde er sich bewußt im Zusammenstoß mit den Anderen. Dadurch gelange er zu einem Selbstbewußtsein, entdecke sein »Eigentum", das er gegen die selbstbewußten Energien der Anderen verteidigen müsse, um seine Freiheit zu behaupten. Damit beginne das Drama, das sich im Zusammenleben entwickele, ohne daß dessen Ausgang oder nur Fortgang sicher zu kalkulieren sei. Denn die Menschen blieben einander fremd, sie könnten nur Brücken zueinander bauen, die ihnen aber nicht dazu verhelfen könnten, den Anderen zu durchdringen und »zu verstehen". Der Mensch lebe in einer ihm auferlegten Einsamkeit. Sie werde gemildert durch Bräuche, Sitten oder Übereinkünfte, deren ursprünglicher Sinn dem Menschen in der Regel nicht mehr vertraut sei. Er folge und gehorche ihnen dennoch, weil diese sozialen Mechanismen, durch die überhaupt erst die Menschen sich allmählich zu einer Gesellschaft zusammenfänden, den Umgang erleichterten, Gemeinsames entstehen ließen und das ermöglichten, was die einsamen Einzelnen einander annähere: Liebe und Freundschaft. In beiden Beziehungen strebten die Einzelnen danach, ihre verborgenen inneren Welten möglichst zu verknüpfen.
Die wichtigsten Hilfsmittel seien Gesten und Sprache. Sie taugten jedoch, da sie genormt seien und unpersönliche Übereinkünfte darstellten, nur unzulänglich zur Veräußerlichung der innersten Welt, in der jeder für sich lebe. Ortega hielt es für eine Utopie, daß sich mit Hilfe der Sprache das Unaussprechliche, weil Einzigartige, ausdrücken lasse. Der Mensch werde redend sich selbst zu einem utopischen Wesen. Er müsse ununterbrochen aus sich heraustreten, über sich hinauswachsen, um ein Bild von sich zu entwerfen, das den Anderen beruhige, ihn hilfreich stimme, anziehe oder begeistere. So seien alle damit beschäftigt, eine Vorstellung von sich als Person aufzubauen, und bestrebt, sich diesem Selbstentwurf anzugleichen gemäß dem klassischen Imperativ: Werde, der du bist. Freilich werde es jedem immer nur andeutungsweise gelingen, in dieser Weise zu sich selbst zu finden, so daß sein Ich eine Utopie bleibe. Ortega verglich das Ich mit einem Schiffbrüchigen, der sich an Planken oder anderem tragfähigen Material über Wasser hält und zu immer neuen Ufern getragen, auf unerwartete Inseln gespült oder an einsame Klippen geworfen wird. Ortega zeichnet außerdem das Bild des Wanderers im Goetheschen Verständnis, der immer bereit ist, sich auf das Wagnis des Lebens einzulassen und seinen Wendungen zu folgen.
Der Einzelne müsse beweglich bleiben, weil die Welt als Geschichte sich in dauernder Bewegung befinde und sein Reaktionsvermögen immer wieder beanspruche, bis zur Erschöpfung. Er solle sich jedoch nicht – hier greift Ortega das Bild des Schiffbrüchigen auf – von der Geschichte überwältigen lassen. Weil das Leben sich im Leben vollende, wie Ortega mit Goethe annahm, verwarf er Reduktionen des unerschöpflichen Menschen mittels rationalisierender oder idealisierender Systeme als „lebensfeindlich", weil unwirklich, unhistorisch und utopisch. Alles, was der Fülle des Lebens und dem dramatischen Zusammenleben in der Geschichte Gewalt antut, mißfiel ihm. So bewahrte er sich eine sehr eigenwillige Unabhängigkeit gegenüber fast allen philosophischen Konstruktionen, da sie meist zeitlose Wahrheit und Gültigkeit beanspruchten, die es jedoch in der Geschichte nicht geben kann Als ”Wirklichkeitswissenschaftler" behandelte er jede Wahrheit nur als die Wahrheit einer bestimmten geschichtlichen Stunde, die sich im nächsten Augenblick schon als überholt erweisen wird in der Auseinandersetzung mit den Forderungen einer neuen Zeit, die den Menschen dazu zwingt, sich ständig zu erneuern und sich und seine Stellung in der Welt neu zu überdenken.
Das verlange vom Menschen stete Aufmerksamkeit und Behendigkeit darin, sich der fließenden Zeit anzuschmiegen, ohne sich von ihren trügerischen Wellen überspülen zu lassen und in ihrem Strudel unterzugehen. Was den Einzelnen bedenklich stimmen solle, das gelte erst recht für die »großen Individuen", die Nationen und Staaten, die als Kollektivwesen mit der Koordinierung der vielen Individuen beschäftigt seien und deren »Verfassung" im Zusammenleben prägten. Die »großen Individuen" der Vergangenheit, die Staaten und Nationen, würden wiederum zu einer neuen Einheit verschmelzen, zur Union der vereinigten Einzelstaaten. Die erlebten Katastrophen würden sie einsehen lassen, so hoffte er, daß sie in ihrer Einsamkeit aufeinander angewiesen sind – ähnlich wie die zahlreichen Schiffbrüchigen im letzten Roman des Cervantes. In dieser Erzählung von den Irrungen und Wirrungen zwischen Persiles und Sigismunda und zwischen vielen anderen »Europäern" gelangen alle schließlich ans Ziel, an den symbolischen Ort der Eintracht: nach Rom, den Mittelpunkt der Geschichte und immerwährenden Ort der Erneuerung, der befreienden Verwandlung zu neuem Leben.
Cervantes forderte dazu auf, sich vor der Welt in ihrer Mannigfaltigkeit nicht aus Angst zu verschließen. Ortega folgte dem großen Ratgeber und damit dem Don Quijote, der, gerade als utopisches Wesen scheiternd, dennoch sagen konnte: Ich weiß, wer ich bin. Der edle Ritter von der traurigen Gestalt veranschaulichte für Ortega die conditio humana und war sein großes Vorbild. Ortega wollte sich von der Welt, die ihm, so wie er sie sah, ziemlich unsympathisch war, nicht überwältigen lassen. Auch in den trübsten Momenten Europas ließ sich Ortega von dem dennoch herrlichen Europa mit seinem goldenen Überfluß begeistern. Davon zehrte er, wenn er verzagte, und schöpfte wieder Mut und Kraft, sich auf dieses Europa mitten in der Welt und auf sich selbst einzulassen und damit zum wahren Ziel geistiger Unruhe, zur Freude, zu finden, der Götterfunken versprühenden Tochter aus Elysium. So wollte er humanisierend, befreiend wirken, zur Freude am Dasein überreden. Denn Dasein ist Pflicht, wie er mit Goethe meinte, eine Pflicht, die heitere Weltentsagung mit unablässiger Weltdurchdringung verquickt.
Ihn empörte, wie Cervantes oder Goethe, die moderne Trauer, die den Europäer vorerst lähme und hemme. Er hielt es mit der Aufforderung von Goethes Philemon an Baucis: »Komm nun aber und genieße, / Denn die Sonne scheidet bald", gerade weil er überzeugt war, in Zeiten der Dämmerungen zu leben. Solange noch nicht die vollständige Dunkelheit eingebrochen war, auf die sich unaufhaltsam, wie der Christ glaubt, Welt und Geschichte hin bewegen, verzagte er nicht am Menschen als utopischem Wesen oder, besser, am europäischen Menschen. »Den Menschen" hielt er mit Goethe für einen zoologischen Begriff. In der Wirklichkeit gebe es nur viele voneinander verschiedene Menschen; alle Menschen zusammen würden aber einen Eindruck vom Menschlichen oder vom Menschen geben. Ihm genügte es, den Menschen in Europa dazu zu verhelfen, Mensch zu sein, indem sie Europäer würden. Der Europäer als Mensch, das war für ihn der Einzelne, der entschlossen und klaglos an seinem Traum von sich festhält und damit sich und den anderen Dauer verleiht im »strahlenden Fest der Agonie", aus dem das schiffbrüchige Europa zu einer die ganze Welt erstaunenden Zukunft aufbrechen wird.
Ideen und Glaubensgewissheiten
IDEEN UNDGLAUBENSGEWISSHEITEN
Das spanische Original erschien 1934unter dem TitelIDEAS Y CREENCIASim Verlag der Revista de Occidente, MadridDie Übersetzung besorgte Dr. G. Klipper
I.GLAUBEN UND DENKEN
Die Ideen hat man– in den Glaubensgewißheiten lebt man„An die Dinge denken" und „Mit ihnen rechnen"
Wenn wir einen Menschen, das Leben eines Menschen verstehen wollen, suchen wir uns vor allem ein Bild von seinen Ideen zu machen. Seit der Europäer „historischen Sinn" zu haben glaubt, ist das die elementarste Forderung. Wie sollte auch die Existenz eines Menschen nicht durch seine Ideen und die Ideen seiner Zeit beeinflußt werden? Der Fall liegt ganz klar. Gewiß; doch ist er zugleich auch recht zweideutig; ja, nach meiner Meinung ist es gerade die ungenügende Klarheit über das, was wir eigentlich im Sinne haben, wenn wir nach den Gedanken eines Menschen – oder einer Epoche – fragen, was uns hindert, uns über sein Leben, über seine Geschichte klarzuwerden.
Unter „Ideen eines Menschen" können wir sehr verschiedene Dinge verstehen, so zum Beispiel die Gedanken, die er sich über dieses oder jenes macht, und diejenigen, die sein Nebenmensch sich macht und die er nachspricht und sich aneignet Diese Ideen können die verschiedensten Grade von Wahrheit aufweisen und sogar „wissenschaftliche Wahrheiten" sein, doch bedeuten solche Unterschiede nicht viel für die weit tiefer liegende Frage, die wir jetzt stellen werden. Denn, seien es nun einfache Gedanken des täglichen Lebens oder „wissenschaftliche Theorien" im strengen Sinne des Worts, immer wird es sich um Einfälle handeln, die einem Menschen kommen, seine eigenen oder durch den Nebenmenschen eingeflüsterte. Das besagt aber offenbar, daß der Mensch schon da war, ehe ihm der Gedanke kam und er ihn sich zu eigen machte. Dieser Gedanke entsteht, auf die eine oder andere Weise, im Innern eines Lebens, das vor ihm da war. Nun gibt es aber kein menschliches Leben, das nicht von Anfang an auf gewisse fundamentale Gewißheiten und sozusagen auf ihnen errichtet wäre. Leben heißt, es mit etwas zu tun haben – mit der Welt und mit sich selbst. Aber diese Welt und dieses „Selbst", in dem der Mensch sich vorfindet, erscheinen ihm schon in der Form von Interpretationen, d. h. von „Ideen" über die Welt und über sich selbst.
Hier stoßen wir auf eine andere Schicht von Ideen, die ein Mensch hat, aber wie verschieden von allen jenen, die ihm einfallen oder die er sich zu eigen macht! Diese Grund-„Ideen”, die ich „Glaubensgewißheiten" nenne – man wird schon sehen warum – tauchen nicht eines Tages oder zu einer gewissen Stunde i n n e r h a l b unseres Lebens auf, wir kommen zu ihnen nicht durch einen besonderen Denkakt; es sind mit einem Wort keine Gedanken, die wir haben, noch sind es Einfälle, nicht einmal von jener durch ihre logische Vollkommenheit ausgezeichneten Art, die wir als wissenschaftliche Erkenntnisse bezeichnen. Ganz im Gegenteil: diese Ideen, die im wahrsten Sinn „Glaubensgewißheiten" sind, bilden das Festland unseres Lebens und haben darum nicht den Charakter von Einzelinhalten, d. h. es sind nicht Ideen, die wir haben, sondern Ideen, die wir sind. Ja noch mehr: Gerade weil es fundamentale Glaubensgewißheiten sind, vermischen sie sich für uns mit der Wirklichkeit selbst – sie sind unsere Welt und unser Sein – und verlieren dadurch den Charakter von Ideen, von Gedanken, die uns ebensogut nicht hätten einfallen können.
Hat man einmal den Unterschied zwischen diesen beiden Schichten von Ideen klar erkannt, so leuchtet die verschiedene Rolle, die sie in unserem Leben spielen, ohne weiteres ein. Und damit auch der enorme Unterschied ihres funktionellen Ranges. Von den Gedanken, die uns einfallen und die wir uns zu eigen machen – und ich wiederhole, daß ich dazu auch die strengsten wissenschaftlichen Erkenntnisse rechne –, können wir sagen, daß wir sie hervorbringen, stützen, erörtern, verbreiten, für sie kämpfen, ja sogar imstand sind für sie zu sterben. Was wir aber nicht können, ist ... aus ihnen leben. Sie sind unser Werk und setzen gerade darum schon unser Leben voraus, das sich auf Glaubensgewißheiten gründet, die wir nicht selbst hervorbringen, über die wir uns im allgemeinen nicht einmal Rechenschaft geben und die wir weder erörtern noch verbreiten, noch unterstützen. Mit den Glaubensgewißheiten t u n wir im Grunde überhaupt nichts, wir l e b e n einfach in ihnen. Genau das, was uns niemals mit unseren Einfällen und Vorstellungen geschieht. Die Volkssprache hat mit sicherem Gefühl den Ausdruck „im Glauben sein" gefunden. Und in der Tat: im Glauben ist man, und einen Gedanken hat man und hält ihn aufrecht. Aber der Glaube ist das, was uns hat und uns aufrecht erhält.
Es gibt also Ideen, m i t denen wir uns begegnen – es sind die Einfälle – und Ideen, i n denen wir uns begegnen, die schon da zu sein scheinen, ehe wir anfingen zu denken.
Wenn wir das einmal erkannt haben, überrascht uns, daß die einen wie die andern in gleicher Weise als I d e e n bezeichnet werden. Die Gleichheit der Bezeichnung ist das einzige, was uns hindert, zwei Dinge zu unterscheiden, deren Verschiedenheit uns so klar in die Augen springt, und ohne weiteres die beiden Ausdrücke: Glaubensgewißheiten und Ideen (im Sinne von Einfällen und Vorstellungen) als einander entgegengesetzt zu verwenden.
Das ungereimte Verfahren, eine und dieselbe Bezeichnung zwei so verschiedenen Dingen zu verleihen, beruht indes weder auf einem Zufall noch einer oberflächlichen Unachtsamkeit. Es kommt von einer viel tiefer liegenden Unachtsamkeit, von der Verwirrung zwischen zwei grundverschiedenen Problemen, die nicht weniger verschiedene Arten des Denkens und des Bezeichnens erfordern.
Aber lassen wir jetzt diese Seite der Angelegenheit auf sich beruhen: sie ist zu verworren. Uns genügt es, festzustellen, daß „Idee" ein Begriff aus dem psychologischen Wortschatz ist, und daß die Psychologie, wie jede Einzelwissenschaft, nur untergeordnete Befugnisse besitzt. Die Wahrheit ihrer Begriffe ist durch den besonderen Gesichtspunkt bedingt, der sie feststellt, und gilt nur in dem Horizont, den dieser Gesichtspunkt eröffnet und abgrenzt. Wenn also die Psychologie von etwas sagt, daß es eine „Idee" sei, so nimmt sie nicht für sich in Anspruch, damit das Entscheidendste, das Wirklichste darüber gesagt zu haben. Der einzige Gesichtspunkt, der nicht speziell und relativ ist, ist der des Lebens, aus dem einfachen Grunde, weil alle übrigen sich aus ihm ergeben und nur bloße Besonderheiten von ihm sind. Nun denn: als Lebenserscheinung gleicht die Glaubensgewißheit in nichts dem Einfall und der Vorstellung; ihre Funktion im Organismus unseres Daseins ist grundverschieden und in gewissem Sinn entgegengesetzt. Welche Bedeutung kann im Vergleich damit die Tatsache haben, daß in der psychologischen Perspektive beides „Ideen" sind und nicht Gefühle, Willensäußerungen und dergleichen!
Es empfiehlt sich also, daß wir mit dem Ausdruck „Ideen" nur all das bezeichnen, was in unserem Leben als Auswirkung unserer geistigen Tätigkeit erscheint. Aber die Glaubensgewißheiten sind von völlig anderer, entgegengesetzter Art. Zu ihnen kommen wir nicht durch eine Verstandestätigkeit; sie wirken vielmehr schon in unserem innersten Grunde, wenn wir beginnen, über etwas nachzudenken. Aus diesem Grunde pflegen wir auch nicht ausdrücklich von ihnen zu sprechen, sondern begnügen uns damit, auf sie anzuspielen, wie wir das mit allem zu tun pflegen, was für uns die Wirklichkeit selbst ist. Die Theorien dagegen, auch die wahrhaftigsten, existieren nur, während sie gedacht werden: darum müssen sie auch in eine bestimmte Form gebracht werden.
Hieraus ergibt sich ohne weiteres, daß alles, worüber wir nachdenken, für uns i p s o f a c t o von problematischer Wirklichkeit ist, und in unserem Leben nur einen zweitrangigen Platz einnimmt, wenn wir es mit unseren echten Glaubensgewißheiten vergleichen. An diese denken wir weder jetzt noch später: unsere Beziehung zu ihnen besteht in etwas sehr viel Wirksamerem: sie besteht darin, daß wir mit ihnen r e c h n e n, immer ohne Unterbrechung.
Diese Gegenüberstellung von „an eine Sache denken" und „mit ihr rechnen" erscheint mir von außerordentlicher Wichtigkeit, wenn wir Klarheit in die Struktur unseres menschlichen Lebens bringen wollen. Der Intellektualismus, der die ganze Vergangenheit der Philosophie fast ununterbrochen tyrannisierte, hat verhindert, daß wir uns diesen Unterschied klargemacht haben und hat sogar den Wert der beiden Begriffe in ihr Gegenteil verkehrt. Ich will mich deutlicher erklären:
Der Leser vergegenwärtige sich einmal irgendeine seiner Verhaltensweisen, auch die scheinbar einfachste. Er befindet sich in seinem Haus und entschließt sich, aus diesem oder jenem Grunde, auf die Straße zu gehen. Was kann nun in diesem seinem ganzen Verhalten in Wirklichkeit als g e d a c h t bezeichnet werden, selbst wenn wir dieses Wort in seinem weitesten Sinn verstehen, das heißt als klares und gegenwärtiges Bewußtsein von etwas? Der Leser hat sich Rechenschaft über seine Motive gegeben, über den gefaßten Entschluß, über die Ausführung der Bewegungen, mittels deren er die Türe geöffnet hat und auf die Straße hinabgegangen ist. All das denkt er im günstigsten Fall. Nun aber: auch in diesem günstigsten Fall und so sehr er auch in seinem Gedächtnis nachforscht, wird er in ihm keinen Gedanken entdecken, durch den er festgestellt hätte, daß „es eine Straße gibt". Der Leser hat sich keinen Augenblick die Frage gestellt, ob sie da sei oder nicht. Warum nicht? Wir werden nicht leugnen können, daß es für den Entschluß, auf die Straße hinabzugehen, von einiger Wichtigkeit ist, daß die Straße existiert. In Wirklichkeit ist es sogar das Wichtigste von allem, die Voraussetzung für alles Weitere. Und trotzdem hat sich der Leser gerade mit diesem so wichtigen Faktum überhaupt nicht befaßt, er hat gar nicht daran gedacht, weder um es zu leugnen, noch um es zu bestätigen, noch um es in Zweifel zu ziehen. Soll das heißen, daß das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Straße ohne Bedeutung für sein Verhalten gewesen wäre? Offenbar nicht! Denn wenn er an der Tür seines Hauses entdeckte, daß die Straße verschwunden wäre, daß die Erde an der Schwelle seines Hauses endete oder daß sich vor ihm ein Abgrund aufgetan hätte, würde ihm eine heftige Überraschung bewußt werden. Worüber? Darüber, daß die Straße nicht da ist. Aber sind wir nicht darin übereingekommen, daß er zuvor gar nicht daran gedacht hatte, daß sie da sei, noch sich überhaupt eine Frage nach ihr gestellt hatte? Diese Überraschung zeigt deutlich, bis zu welchem Grad die Existenz der Straße in seinem früheren Zustand und Verhalten wirksam war, d. h. wie weit der Leser mit ihr r e c h n e t e, auch wenn er nicht an sie dachte, ja gerade weil er nicht an sie dachte.