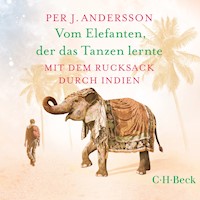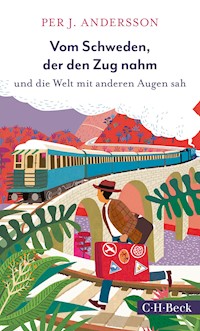
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
In seinem neuen Buch entdeckt der schwedische Bestsellerautor Per J. Andersson die abenteuerliche Welt des Zugreisens. Er begibt sich mit der Eisenbahn zum nördlichsten Zipfel Europas, fährt mit der Dampflok über den Wolken, steigt in den sagenumwobenen "Orientexpress" und verbringt ganze Tage und Nächte im Abteil, wo er kuriose Mitreisende kennenlernt. Sein Buch weckt die Sinne und ist ein Muss für alle Menschen, die beim Reisen gerne etwas erleben - und dabei auch noch das Klima schonen wollen.
Der Schriftsteller Per J. Andersson nimmt uns mit auf die schönsten und abenteuerlichsten Zugstrecken der Welt. Er steigt in den eisigen Polarexpress, entdeckt die mythischen Zugrouten des 19. Jahrhunderts, fährt auf den Spuren Thomas Manns durch die Schweizer Berge, erkundet mit der Bummelbahn und dem Schnellzug so unterschiedliche Erdteile wie Amerika, China und Indien und macht im größten Kopfbahnhof der Welt in Leipzig Halt. Während unzählige bekannte und unbekannte Orte und wundersame Traumlandschaften an ihm vorbeiziehen, lernt er eine Reihe von illustren Figuren kennen, die unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Anderssons neues Buch ist Reiseerlebnisbericht und Manifest für das Zugreisen in einem. Nach der Lektüre bleibt die Erkenntnis: Mit dem Zug reist man besser!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
PER J. ANDERSSON
Vom Schweden, der den Zug nahm
und die Welt mit anderen Augen sah
Aus dem Schwedischenvon Susanne Dahmann
C.H.BECK
Zum Buch
In seinem neuen Buch entdeckt der schwedische Bestsellerautor Per J. Andersson die abenteuerliche Welt des Zugreisens. Er nimmt uns mit auf die schönsten und abenteuerlichsten Zugstrecken der Welt. Er steigt in den eisigen Polar- und den sagenumwobenen Orientexpress, fährt auf den Spuren Thomas Manns durch die Schweizer Berge, erkundet mit der Bummelbahn und dem Schnellzug so unterschiedliche Erdteile wie Amerika, China und Indien und macht im größten Kopfbahnhof der Welt in Leipzig Halt. Während unzählige bekannte und unbekannte Orte und wundersame Traumlandschaften an ihm vorbeiziehen, lernt er eine Reihe von illustren Figuren kennen, die unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Anderssons neues Buch ist Reiseerlebnisbericht und Manifest für das Zugreisen in einem. Sein Buch weckt die Sinne und ist ein Muss für alle Menschen, die beim Reisen gerne etwas erleben – und dabei auch noch das Klima schonen wollen. Nach der Lektüre bleibt die Erkenntnis: Mit dem Zug reist man besser!
Über den Autor
Per J. Andersson ist ein schwedischer Journalist und Schriftsteller. Er ist Mitbegründer von Schwedens bekanntestem Reisemagazin. 2015 wurde sein Buch «Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden» zu einem großen Verkaufserfolg. Bei C.H.Beck erschienen sein Bestseller «Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte» (2018) und sein Indien-Buch «Vom Elefanten, der das Tanzen lernte» (2019).
Inhalt
Vorwort
Der Bahnhof
Die Zeit und die Fahrt
Nimm den Zug in Großbritannien
Der Polarexpress
Nimm den Zug nach Norden
Eisenbahn für alle
Pause auf dem Bahnsteig
Nimm den Zug in die Vergangenheit
Der Orientexpress
Nimm den Zug in den Orient
Auf die Bahn ist kein Verlass, sagte der Zugreisende und flog
Die Sorge, das Unglück und die sexuelle Triebkraft
Bahnfahren mit Kindern
Nimm den Zug in Europa
Fahrpläne
Mit Kindern reisen
Mit dem Fahrrad reisen
Verantwortung für verpasste Züge
Auf dem falschen Gleis
Hohe Berge und tiefe Täler
Nimm den Zug auf die Alpengipfel
Wenn man schläft, steht die Zeit still
Nimm den Zug um die Welt
Die neue Seidenstraße
Nimm den Zug ins Reich der Mitte
Mit der Dampflok über den Wolken
Nimm den Zug in die Teeplantage
Die Begegnung im Abteil
Nimm den Zug in Indien
Der Amerika Express
Nimm den Zug nach Chicago
Die Gleise in den Wilden Westen
Nimm den Zug in den Wilden Westen
Der Zug in die Zukunft
Das Eisenbahnmanifest
Bahnreisetipps und andere Quellen
Reisebüros und Seiten für Zugreisen um die ganze Welt
Bahnunternehmen und Buchungsseiten – Land für Land
Autoreisezüge
Der luxuriöseste Charterzug der Welt
Spannende Gruppenreisen
Noch mehr schöne Bahnreisen
Auf den norwegischen Fjäll- und Fjordzug aufspringen
Auf dem richtigen Gleis im Rheintal
Nimm die französische Bergbahn
Nimm den Zug in den Himalaya
Großartige Reisen im Rest der Welt
Bahnreisen in Film und Literatur
Filme
Bücher
Literaturhinweise
Dank
Vorwort
Großmutter und ich nahmen den Zug. So hat es angefangen. Wir fuhren von Bohuslän, wo meine Familie lebte, zu ihr und Großvater hinauf nach Dalarna. Ich war fünf Jahre alt, und sie war frisch gebackene Rentnerin. Während ihres Berufslebens hatte sie im Bahnhofsrestaurant von Krylbo als Kellnerin gearbeitet und auch in den Zügen nach Stockholm Butterbrote verkauft. Großvater hatte im Stellwerk Waggons und Loks gewechselt und war im Laufe der Zeit Stellwerksmeister und dann Stationsvorsteher geworden.
Wir fuhren mit dem sogenannten Snälltåg. So wurden diese etwas schnelleren Züge in einer Verschwedischung des deutschen Wortes schnell genannt. Nun heißt snäll auf Schwedisch aber nett, und ich glaubte natürlich, die Züge würden so heißen, weil alle, die dort arbeiteten, wie auch meine Großmutter, sehr, sehr nett waren. Irgendwie glaube ich das heute immer noch. Deshalb war ich besonders erstaunt, als ich kürzlich erst lernte, dass das schwedische snäll tatsächlich seinen Wortursprung im deutschen schnell hat, dass das Wort dann aber eine ausgedehnte Bedeutungsveränderung von erst aktiv, lebendig und schnell zu geschickt und brillant durchgemacht hat, um dann zu begabt, klug und am Ende zu nett, freundlich zu werden.
Die Expansion der Eisenbahn hatte dafür gesorgt, dass meine Großeltern ein anderes Leben hatten wählen können, als ihre Eltern es gelebt hatten. Sie hatten die Bauernhöfe in Grytnäs und Jularbo, auf denen sie aufgewachsen waren, verlassen und in den kleinen Ort Krylbo mit dem Bahnknotenpunkt ziehen können, wo sie sichere staatliche Anstellungen im Dienst der neuen Infrastruktur fanden. Als Eisenbahnbedienstete bekamen sie Freifahrten. Sie besaßen niemals ein Auto oder einen Führerschein. Die wenigen Urlaubsreisen, die sie machten, unternahmen sie mit der Bahn. Die Eisenbahn war eine Zukunftsbranche, und sie waren dabei. Auf diese Weise bekamen sie Essen auf den Tisch, wachsenden Wohlstand und eine Zukunft, so dass sie bald aus der engen Mietwohnung ausziehen und sich ein eigenes Haus bauen konnten. Die Eisenbahn schenkte ihnen Sicherheit, die es ihnen auch ermöglichte, vier Kinder großzuziehen.
Früher habe ich nie so gedacht, und es ist auch nichts, worüber wir in der Familie gesprochen haben. Vielleicht weil es selbstverständlich war. Doch je häufiger ich meinen Vater über die verschiedenen Berufe, die meine Vorväter hatten, ausgefragt habe, desto klarer wurde mir, welche entscheidende Rolle die Eisenbahn auch auf seiner Seite der Familie spielte. Einer seiner ersten Jobs war das Rangieren von Güterwaggons, während sein Vater wiederum erst Heizer auf den Dampfloks der Södra Dalarnes Eisenbahn-Aktiengesellschaft war. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wechselte mein Großvater väterlicherseits in die Metallindustrie nach Surhammars bruk – seit 1866 einer der größten europäischen Hersteller von Eisenbahnrädern und -achsen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging er zum Eisenwerk Avesta, das Stehtoiletten aus Blech für die Indian Railways herstellte.
Als ich als Teenager begann, selbständig zu reisen, war es die Eisenbahn, die mich in die Welt hinausbrachte, weil sie einfach, praktisch und vor allem die billigste Alternative war. Wenn es einen Zug gab, dann nahm ich selbstverständlich den. Mit einem preiswerten Jugendticket, das Transalpino hieß, reiste ich über Trelleborg, Sassnitz, Berlin, Prag und Belgrad nach Athen. Von dort nahm ich das Schiff nach Israel, dann ging es mit dem Bus weiter nach Ägypten, bevor ich die Fahrt per Zug von Kairo den Nil herunter bis Luxor fortsetzte. Später reiste ich mit dem Interrailticket durch Europa, besuchte Freunde von früheren Reisen, sprang auf die Fähre nach Tanger und dann in den Zug nach Marrakesch und … ja, ich fühlte mich wie ein echter Kosmopolit.
Nachdem ich in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika gewesen war, begab ich mich nach Osten. Doch nach Asien flog ich. Der Landweg durch den Iran und Afghanistan war zu unsicher geworden. Zu Beginn der Achtzigerjahre gab es aber auch keine Klimadebatte. Die meisten glaubten, die Umweltzerstörung käme durch Benzinabgase, Waschmittel mit Phosphaten, Industrieausstöße und Kernkraftmüll. Wenn es ein Transportmittel gab, das schlecht für die Umwelt war, dann war es das Auto. Das Flugzeug hinterließ nur einen schimmernden Kondensstreifen. Der konnte doch wohl niemandem schaden, oder?
In Indien selbst bewegte ich mich dann fast ausschließlich mit dem Zug. Selbst dort war das Fliegen zu teuer und darüber hinaus ebenso langweilig und anonym wie überall. Der Zug war immer meine erste Wahl.
Die langen Zugreisen, die auch viele Stunden schweigender Betrachtung der Landschaften vor dem Fenster boten, halfen mir, meinen eigenen Gedanken nachzugehen. Einen Gedanken zu Ende zu denken. Sonst wird man ja in seinem Nachdenken so oft unterbrochen.
Zwischen den Zugreisen wurden im Laufe der Zeit die Flugreisen immer zahlreicher, und dies vor allem aufgrund meines Berufes als Reiseschriftsteller. Doch wie die meisten anderen Menschen dehnte auch ich meine privaten Urlaubsflüge ins Ausland aus, als die Preise für ein Flugticket sanken, während gleichzeitig die Zugfahrkarten teurer wurden.
Als die Auswirkungen des Kohlendioxid-Ausstoßes auf das Klima im Zusammenhang mit der Premiere von Al Gores Film Eine unbequeme Wahrheit 2006 und im folgenden Jahr durch einen Bericht des Weltklimarates der Vereinten Nationen IPCC zu einer heiß diskutierten globalen Frage wurden, begann ich, mich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, dass ein Viertel von Europas Kohlendioxid-Ausstoß aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe durch Transporte herrührt, und dass das Auto zwar durchaus der schlimmste Sündenbock ist, aber dass Fliegen und Seefahrt gleich an zweiter Stelle kommen. Ich verkaufte das Auto, fuhr innerhalb Schwedens mehr mit dem Zug, flog aber weiterhin, wenn ich den Rest der Welt besuchte. Es war so unkompliziert und preiswert, und zu reisen und zu schreiben war schließlich immer noch mein Beruf.
Erst als ich kürzlich eingeladen wurde, auf einem Literaturfestival auf Bali über eines meiner Bücher zu sprechen, wuchsen all die kleinen, durch Unmengen von Zeitungsartikeln vermittelten Besorgnismomente zu dem starken Gefühl, dass mit dem Reiseverhalten von mir und meinen Zeitgenossen irgendetwas grundsätzlich nicht stimmte. Das Flugticket nach Bali hin und zurück bedeutet ja fast dreitausend Meilen Flug. Zum ersten Mal riefen all die Umweltfakten, über die ich gelesen hatte – und über die ich selbst Artikel geschrieben hatte –, ein unbehagliches Gefühl hervor. Selbst wenn das Festival zu unschätzbaren Begegnungen mit Schriftstellern aus der ganzen Welt (die wohl kaum durch Skype-Gespräche am Computer hätten ersetzt werden können) einlud, so trug ich doch mit nur einer einzigen derart langen Flugreise zu einem größeren Ausstoß an Treibhausgasen bei, als ich in meinem ganzen Leben durch alle U-Bahnfahrten zur Arbeit produziert hatte. Mir wurde klar, dass ich die Augen nicht mehr vor der Tatsache verschließen konnte, dass ich, der begeisterte Weltreisende, ein Teil des Problems war.
Doch dann erwachten meine Verteidigungsmechanismen zum Leben. So sind wir einfach, wir Menschen. Was spielte es für eine Rolle, ob ich mich noch in jenes Flugzeug dazu setzte oder nicht? Es würde ja in jedem Fall fliegen und seine Treibhausgase ausstoßen, auch wenn ich am Boden blieb. Sofort fühlte sich alles besser an. Doch der bittere Nachgeschmack des schlechten Gewissens kehrte zurück. Also machte ich einen Test im Netz, um zu sehen, wie groß der Kohlendioxid-Ausstoß war, den mein Lebensstil verursachte. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte? Und zu Beginn sah es gut aus, weil ich in einer Wohnung in der Stadt lebe, immer noch kein Auto habe, sondern im Alltag stets zu Fuß gehe, mit dem Fahrrad fahre oder Zug oder U-Bahn nehme. Außerdem esse ich nur wenig Fleisch und kaufe sehr selten neue Kleidung. Das ergab im Test, dass meine Werte nur halb so hoch waren wie die des Durchschnittseuropäers. Ich hatte das Gefühl, aufatmen zu können. Vielleicht war mein Lebensstil sogar vorbildlich? War ich kein Sünder, sondern ein Büßender?
Doch in meinem tiefsten Innern wusste ich, dass das nicht stimmte. Denn bisher hatte ich nur getestet, wie ich den Alltag in meiner Heimatstadt verbrachte. Dann waren da aber noch meine beruflichen Reisen in die Welt, die ich zwar immer öfter mit dem Zug unternahm, aber immer noch auch mit dem Flugzeug.
Ich sah mich gezwungen, ein weiteres Mal zur Verteidigung meines eigenen Verhaltens anzusetzen. Was brachte es schon groß, wenn ich mich veränderte, während die Gesellschaft um mich herum weiter Fleisch und Milch genoss, sich alle zwei Jahre ein neues Handy gönnte, mit ihren Autos rumbrauste und nach London flog, um zu shoppen, und nach Thailand, um in der Sonne zu liegen?
Ist es nicht wichtiger, wenn ich mich in einer Partei, einer Vereinigung oder Kampagne engagiere, anstatt die Klimakrise als etwas zu betrachten, das nur meine eigenen Gefühle betrifft? Ist es nicht besser, wenn ich versuche, die Politik, das System, die Strukturen zu verändern, und in den Sozialen Medien mit meinen Zugreisen angebe, anstatt mich dauernd vor mir selbst zu rechtfertigen?
Denn man kann ja wohl die Verantwortung für das Klima der Erde nicht auf die Schultern einzelner Individuen legen, oder? Ich erinnerte mich an eine Rundfunksendung mit einem Philosophen, dem die Frage gestellt wurde, ob es nicht Heuchelei sei, als Parlamentarier darauf hin zu arbeiten, das Klima zu retten, und im Privatleben weiterhin zu fliegen und Auto zu fahren. Der Philosoph antwortete zu meinem Erstaunen, dass es nicht moralisch verwerflich sein müsse, eine Sache zu propagieren, aber eine andere zu tun. Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, die den Flugzeugtreibstoff steuerfrei gestellt hat und auf eine Weise aufgebaut ist, dass viele Menschen gar nicht ohne Auto auskommen. In diesem System sitzen wir Bürger fest, und es reicht schon aus, politisch aktiv zu sein, um die Struktur zu verändern. Dann noch zu verlangen, dass jedermann auch in seinen persönlichen Bedürfnissen vorbildhaft auftritt, ist für den einzelnen Bürger des Guten zu viel. Der Philosoph im Radio gab mir also Argumente an die Hand, eine Sache zu sagen und eine andere zu tun, so dass ich mich nicht als Handlungsreisenden in Sachen Doppelmoral betrachten musste.
Doch ganz so einfach ist es nicht. Der Rechtfertigungsversuch, dass das Flugzeug ohnehin fliegt, auch wenn ich eine andere Reiseform wähle, ist sogar nachgerade bescheuert. Ein Gedankensalto. Und das Argument des Philosophen, dass man lieber an einer Systemveränderung arbeiten sollte, anstatt sein eigenes Verhalten zu ändern, ist rational und logisch, aber man kann doch nicht einfach die Gefühle ignorieren, welche durch all die neuen Informationen über den Klimawandel verursacht werden.
Um meinen inneren Konflikt zwischen der Neugier auf die Welt und der Sorge ums Klima zu lösen, kam ich darauf, dass ich wohl beides tun muss. Ich muss sowohl dafür sorgen, dass die Frage politisch wird, als auch öfter den Zug nehmen. Und mir wurde klar, dass dies das perfekte Gegenmittel gegen die höchst belastende Kombination aus krankhafter Reiselust und Klimaangst ist. Ich heile zwei Krankheiten und löse ein moralisches Dilemma – alles mit einem Schlag. Denn selbst ich möchte abends in dem Gefühl einschlafen, nicht die Hauptursache des Problems zu sein, sondern ein Teil der Lösung.
Doch wenn man den Klimaforschern zuhört, dann scheint es bald keine Rolle mehr zu spielen, welche Strategie wir wählen. Die Zeit der Scham ist vorbei. Jetzt ist Panik angesagt. Das zumindest hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg gesagt, als sie 2019 vor den Mächtigen der Welt auf dem Wirtschaftsgipfel von Davos und vor dem Umwelt- und Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments in Straßburg sprach. Und das findet auch David Wallace-Wells, Redakteur beim New York Magazine und Autor der jüngst herausgegebenen Streitschrift Die unbewohnbare Erde. Die immer extremeren Wetterverhältnisse der letzten Jahre haben dazu geführt, dass Wissenschaftler, die bisher versuchten, in ihren Schlüssen ausgeglichen und vorsichtig zu sein, immer alarmierender klingen. Der Bericht des IPCC im Herbst 2018 erhielt den Spitznamen Weltuntergangsbericht, und ein Abgeordneter der UNO verglich ihn mit einem «ohrenbetäubenden, durchdringenden Feueralarm aus der Küche». Die Botschaft der Wissenschaftler war, dass es an der Zeit sei, richtig Angst zu haben. Je länger wir warteten, desto schlimmer werde es. «Panik kann einem kontraproduktiv vorkommen, aber wir haben einen Punkt erreicht, an dem Alarmismus und Katastrophendenken von entscheidendem Wert sind …», schreibt Wallace-Wells. Und was kann schon ein stärkeres Gefühl der Eile erzeugen als eben Angst?
Auf diese Weise können auch unsere höchst privaten Gefühle eine Hilfe auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft sein. Scham ist ein Gefühl, das uns meldet, wenn wir unsere eigenen Taten in Relation zu anderen Menschen stellen müssen, wenn wir nicht nur uns selbst, sondern auch ihnen gegenüber Verantwortung haben. Im Grunde geht es auch darum, dass wir es richtig machen wollen. Das Bedürfnis des Menschen, sich in seiner Herde sozialverträglich zu verhalten, ist eine Urkraft. Im Guten wie im Bösen. Die psychologische Eigenschaft kann sowohl destruktive wie konstruktive Kräfte in Gang setzen.
Was in den Augen der Gesellschaft ethisch korrekt ist, ist kein Naturgesetz, sondern verändert sich mit neuem Wissen und neuen Erkenntnissen. Zunächst war das Fliegen ein erstrebenswerter Luxus und Eitelkeit (etwas, wonach alle strebten), dann wurde es ein Massenobjekt (etwas, was alle taten), und jetzt ist es mit Scham belegt (etwas, wovon eine wachsende Gruppe Reisender meint, es verringern zu müssen). Vor einigen Jahren wurden Zugreisen über den Kontinent als anachronistisch betrachtet, etwas, was nur radikale Umweltfuzzis und grauhaarige Nostalgiker unternahmen. Jetzt ist es der neueste Schrei in der jungen urbanen Mittelschicht.
Haltungen können sich schnell ändern. Da muss man nur an all die Verhaltensweisen denken, die vor nicht langer Zeit ethisch okay waren, es aber nicht mehr sind. Autofahren ohne Sicherheitsgurt, Kinder züchtigen, damit sie gehorchen lernen, Elefanten schießen, um aus den Zähnen Klaviertasten zu machen, und im Auto rauchen, obwohl kleine Kinder auf dem Rücksitz sitzen.
Doch die Bewegung, das Reisen, das Unterwegs-Sein, das Überschreiten von physischen und seelischen Grenzen, das darf nicht verdammt werden. Sich niemals von seinem Heimatort wegzubegeben, ist kein Ideal, sondern eher ein Schreckensszenario. In der Diskussion darum, dass man weniger fliegen sollte, klingt leider manchmal durch, die moralisch höchste Variante sei die, immer zu Hause zu bleiben.
Warum reisen wir? Ich habe lange eine Antwort auf diese einfache, aber zutiefst philosophische Frage gesucht. Der Schriftsteller Tomas Lofström, der lange für die Reisezeitschrift Vagabond geschrieben hat, die ich 1987 gegründet habe, hat es so formuliert, dass «das Reisen mit all dem zusammenhängt, was uns zum Homo Sapiens macht: Neugier, Streben nach ‹sinnlosem› Wissen, der Wille, den Intellekt zu bilden, über den Horizont zu schauen, das Weltbild zu erweitern und Chaos in Ordnung zu verwandeln». Bewegungslosigkeit ist die Mutter von Eingeschränktheit und Intoleranz. Mangelnder Kontakt zu Menschen, die nicht so sind wie wir, verringert das Verständnis für das Andere. Ich kam zu dem Schluss: Siehst du eine Grenze, dann überquere sie! Daran glaube ich immer noch. Doch nun mit dem Zusatz: Achte um der Erde Willen darauf, dich nachhaltiger fortzubewegen.
Mein Beruf als Reiseschriftsteller gibt mir sowohl die Verantwortung als auch die Macht, andere Reisende dazu zu veranlassen, ihr Reiseverhalten zu ändern. Diese Macht möchte ich darauf verwenden, uns von Restaurantwaggons, Nachtzügen, großartigen Ausblicken und spannenden Begegnungen in Abteilen träumen zu lassen. Öfter den Zug zu nehmen und die Flugreisen für die Gelegenheiten aufzusparen, wenn es keine andere Alternative gibt, sich fortzubewegen. Weniger, aber dafür größer angelegte Reisen zu unternehmen. Und zu erkennen, dass wir mit dem Zug die Möglichkeit haben, auf dem Weg ans Ziel Halt zu machen, nicht nur einmal, sondern zwei-, drei-, viermal, und auf diese Weise mehr Orte kennenzulernen als nur einen.
Doch wie verändert man die Reisegewohnheit derjenigen, die sich keinen Deut um die Klimaveränderungen scheren? Cecilia Solér, die an der Universität Göteborg über Konsumgewohnheiten forscht, meint, dass es schwerere Geschütze braucht als nur angstmachende Berichte und faktenbasierte Aufklärung der Gesellschaft. Wir müssen schlicht die sozialen Normen angreifen, die unsere Reisegewohnheiten steuern. Sie nennt als Beispiel die Bilder der Werbung und der Reisejournalistik von türkisfarbenem Meer mit der glücklichen Familie am tropischen Strand. Gut durchtrainiert, ohne Probleme, gutaussehend. Eine idealisierte Identität, die mit einem Produkt verbunden wird, in diesem Fall einer Reise in ein fernes Land mit warmem Meer und schönen Stränden.
«Je mehr wir davon sehen, desto mehr reisen wir», sagte Cecilia Solér.
Um die Menschen stattdessen in den Zug zu bringen, muss man den Kern angreifen, will sagen, die Norm, also das Bild von der glücklichen Familie am türkisfarbenen Meer. Und nach und nach macht der Traum eine halbe Drehung und handelt immer noch von den begehrenswerten Reisen und der Begegnung mit anderen Kulturen, aber auch davon, dass es nicht mehr cool ist, mit dem Flugzeug in die Welt hinauszufliegen. Die Veränderung, meint Cecilia Solér, erzeugt man mit mehr imagetauglichen Bildern in Reiseartikeln und Annoncen von beneidenswert glücklichen Familien an Bord eines Zuges auf dem Weg in die Welt hinaus.
Kurz gesagt ist es meine Verantwortung als Reiseschriftsteller, die Entwicklung in die richtige Richtung zu drehen.
Während ich mich dem Bahnsteig des Stockholmer Hauptbahnhofs nähere, wo schon viele meiner Reisen begonnen haben, summt es in meinem Kopf von all den idiomatischen Wendungen und Redensarten, die mit Zügen zu tun haben. Zwei Jahrhunderte lang hat die Eisenbahn auch unsere Sprache geformt: Auf dem richtigen Gleis sein. Aufs Abstellgleis geraten. Der Zug ist abgefahren. Pünktlich wie die Eisenbahn. Ich verstehe nur Bahnhof. Denn jetzt gilt es, auf den Zug aufzuspringen, damit uns die Sache nicht entgleist. Denn es ist höchste Eisenbahn! Wir müssen die Notbremse ziehen. Dann sehen wir vielleicht irgendwann Licht am Ende des Tunnels. Doch die Hauptsache ist, dass wir, wie die Briten sagen, back on track sind.
Der Bahnhof
Im schimmernden Schein der Geschäfte ziehen Reisende mit klappernden Rollkoffern vorbei. Auf dem Weg zum Bahnsteig sind metallisch klingende Lautsprecherdurchsagen, elektrisch surrende Lastenautos und dumpf brummende Schnellzugloks zu hören. Es riecht nach Parfüm, gegrilltem Essen und Kaffee. Die Reisenden haben entweder Kopfhörer in den Ohren oder schauen im Gehen auf ihre Handys, oft auch beides. Jeder befindet sich in seiner Welt, weit entfernt von den Seh- und Geräuscheindrücken der Umgebung.
Wie anders war das noch vor hundert Jahren! Die Gerüche und Geräusche müssen so viel stärker und aufdringlicher gewesen sein. Kohlenqualm, Asbest, heißes Eisen und Lederkoffer. Die Dampfloks prusteten, pfiffen und stöhnten. Die Hufe der Pferde klapperten, und die Zugreisenden schleppten schwere und sperrige Koffer oder Holzkisten mit Eisenbeschlägen.
Genau so eine Kiste für Reisende hatte ich zu Hause stehen. Lange haben wir Dinge hineingelegt, die unsere Tochter bekommen sollte, wenn sie von zu Hause auszöge, doch früher einmal hatte sie meiner Großmutter gehört und war mit Kleidern, Handtüchern und Bettlaken vollgepackt gewesen, als sie in den Zwanzigerjahren den Zug von Västerås nach Stockholm nahm, um als Dienstmagd bei einer Oberschichtfamilie in einer Villa in Bromma anzufangen.
Diese Art Holzkiste schleppte man nicht so einfach über die Bahnsteige. Wie stellte man das dann an? Zum Glück der Reisenden konnte man das Gepäck aufgeben, was bedeutet, dass man, um einen Begriff aus der Welt des Fliegens zu benutzen, die Koffer eincheckte, die dann in einem besonderen Gepäckwagen transportiert wurden. Und brachte man sie selbst an Bord des Zuges, dann gab es Träger, die sich auf dem Weg vom Zugwaggon zum wartenden Pferdewagen oder Auto um das Gepäck kümmerten. Ich weiß nicht, ob meine Großmutter sich einen Träger geleistet hat. Vermutlich wurde sie abgeholt und bekam Hilfe beim Tragen durch die Familie, bei der sie dann arbeiten sollte.
Die Eisenbahn veränderte nicht nur die Landschaft, sondern auch die Stadt. Die Poststationen, von denen aus die Vorgänger der Züge, die Pferdepostkutschen starteten, waren ein natürlicher Teil der Stadtkerne, die innerhalb der mittelalterlichen Ringmauern lagen und unmerklich mit dem Stadtgelände verschmolzen. Die Pferdekutschen klapperten über die Gassen mit Kopfsteinpflaster zu den Verteilungslokalen und Poststationen, die oft in Wirtshäusern mit Namen wie Hotel Zur Post, Post-Hotel oder De La Poste untergebracht waren.
Die neuen Eisenbahnstationen hingegen wurden außerhalb der Stadtmauern errichtet. Das ist nicht verwunderlich, denn die Gleise passten nicht in die Gassen der alten Stadtkerne, wenn man nicht ganze Viertel abriss. Die Städte wuchsen, und um die Bahnhöfe wurden neue Wohnungen und Fabrikanlagen gebaut. Obwohl dies die neuesten und modernsten Viertel waren, wurden sie von Adel und Bürgertum mit einer Mischung aus Furcht und Verachtung betrachtet. Selbst wohnte man lieber in älteren Häusern und Palästen innerhalb der Stadtmauer oder auf Herrenhöfen weiter draußen auf dem Lande. Die Parallele zu den heutigen europäischen Großstädten ist deutlich: Die Bahnhofsviertel sind der Gegenpart zu den Beton-Vororten mit Mietskasernen von heute.
Ehe die Bahnhöfe gebaut wurden, dachte man, dass sie ein attraktiver Ort werden würden, der die Stadtbewohner wie ein Wallfahrtsort anzöge. Im Geist des Fortschrittsoptimismus war man überzeugt davon, dass das Moderne eine größere Anziehungskraft haben würde als das Alte. In gewisser Weise wurde es auch so, vor allem in kleineren Ortschaften. Doch in den Großstädten verhielt es sich umgekehrt. Von diesen qualmenden und lärmenden Orten hielt man sich fern. 1855 schrieb Auguste Perdonnet in Traité élémentaire des chemins de fer: «Den Hotels, die am nächsten an den Bahnhöfen liegen, geht es meist schlecht.» Die Viertel um die stolzen Bahnhöfe Europas herum erhielten auf diese Weise einen proletarischen Charakter und schlechten Ruf, waren berüchtigt für Taschendiebstähle und Hehlerei. Hier lagen die Herbergen, in denen Zuhälter und Prostituierte sich einrichteten, und die Bars, in denen eine Mischung aus Reisenden und Arbeitern aß und trank.
Die Bahnhöfe selbst hatten einen industriellen Charakter, doch mit einer feinen Fassade nach außen. In der Gleishalle, die sich nach außen ins Land hinaus wandte, dominierten dicke Holzbalken und große Glaspartien. Die Empfangshalle, die Fahrkartenhalle, also das Bahnhofsgebäude selbst, das zur Stadt gerichtet war, wurde hingegen aus Stein gebaut und bekam verputzte Fassaden und eine neoklassizistische Ausschmückung. Der Stil zur Hälfte Fabrik, zur Hälfte Palast breitete sich schnell über Europa aus, und man kann ihn im Grunde in jedem größeren Bahnhof wiedererkennen. Eine Quelle der Inspiration war ohne Frage der Erfolg der Weltausstellung im Londoner Crystal Palace 1851, welcher der Glasarchitektur zu ihrem kommerziellen Durchbruch verhalf.
Solange es nur wenige Routen gab, waren die ersten europäischen Bahnhöfe anspruchslos, doch im Zusammenhang mit der Verdichtung des Eisenbahnnetzes in den 1840er-Jahren wuchsen die Ansprüche. Die Menge der Gleise, die in die Bahnhöfe einliefen, wurde zahlreicher und damit auch die Anzahl der Bahnsteige. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Kopfbahnhöfe zu einem typischen Bild in Europas Großstädten. Das waren Bahnhöfe, in denen alle Eisenbahngleise endeten und die Züge die Richtung wechseln mussten, wenn die Fahrt fortgesetzt werden sollte.
Der größte Kopfbahnhof der Welt, der Leipziger Hauptbahnhof, ist ein Prachtexemplar. Gebaut 1915 mit einer rechteckigen, palastähnlichen Halle in hellbraunem Stein, groß genug, um ein Kreuzfahrtschiff aufzunehmen, und mit einer Fassade zum Stadtzentrum, die fast genauso breit ist wie der Eiffelturm hoch. Hinter dem Hauptgebäude – das in den Bombennächten im Sommer 1944 zerstört, in den 1950er-Jahren aber wieder aufgebaut wurde – war der Bahnhof mit sechs breiten Stahl- und Glaskonstruktionen versehen, die das Glasdach über den sechsundzwanzig parallel laufenden Gleisen hielten (von denen heute noch dreiundzwanzig vorhanden sind). Dass der Bahnhof solche gewaltigen Proportionen erhielt, als wäre er dazu gemacht, die Welt in Erstaunen zu versetzen, lag nicht vorrangig daran, dass es sich um ein nationales Protzprojekt handelte, wie dies beim Milano Centrale der Fall war. Man baute so groß – knappe 83.000 Quadratmeter –, weil sich die Preußische und die Sächsische Eisenbahngesellschaft den Bahnhof teilten, und jede wollte viel Fläche und einen eindrucksvollen Eingang haben. Aber natürlich auch, weil Leipzig mehrmals jährlich Buch-, Handwerks- und Industriemessen ausrichtete. Während der intensiven Messewochenenden musste man Zehntausende von Besuchern und viele zusätzlich eingerichtete Züge bewältigen.
Die beeindruckende und schlossähnliche Fassade in Leipzig hat ihren Ursprung, ähnlich wie bei im Grunde allen alten Bahnhöfen in Großstädten, in dem Vorhaben, das industrielle Gesicht der Gebäude hinter Ornamenten zu verbergen. Als ob der Mensch nicht gerüstet sei, direkt in die rohe Funktion zu schauen, sondern mit Verschnörkelungen betört werden müsste. Doch obwohl die stilvollen Fahrkartenhallen Palästen glichen, verloren viele Städte durch die Eisenbahn ihren mittelalterlichen Charakter und nahmen eine industrielle, von der modernen Kommunikation geprägte Gestalt an.
Auch auf der anderen Seite des Atlantiks plante man groß und ging verschwenderisch mit Marmor und Messing zu Werke. Die amerikanischen Bahnhöfe im Allgemeinen und der Grand Central Terminal in New York im Besonderen sollten glänzen und die Menschen in Erstaunen versetzen. Der Schriftsteller Tom Wolfe schrieb, sogar die großen Architekten von Griechenland und Rom wären gewiss beeindruckt gewesen, wenn sie nach Manhattan gekommen wären und das schönste Wunderwerk der Eisenbahnwelt mit Skulpturen, Portalen, Dachkonstruktionen und korinthischen Säulen hätten sehen können.
Heute ist man noch einen Schritt weiter und versucht, nicht nur den industriellen Charakter des Bahnhofs, sondern auch seine gesamte ursprüngliche Funktion zu verbergen. Die Neubauten und renovierten Bahnhöfe ähneln heute eher Einkaufsgalerien als den Hallen für Fahrkartenverkauf mit langweiligem Warten, die sie einst waren. Steingewölbe, Skulpturen, Stuckverzierungen und die Deckenhöhe einer Kathedrale werden hinter Gängen aus Glas und Stahl mit niedriger Decke und Reihen von grell beleuchteten Geschäften für Kleider, Elektronik und Gesundheitsprodukte versteckt.
Es überfällt mich oft eine nostalgische Sehnsucht nach einer Zeit, in der die Dinge sein durften, wofür sie gedacht waren, als Bahnhöfe noch Bahnhöfe sein durften und nichts anderes und nicht so tun mussten, als seien sie Einkaufsgalerien mit immer den gleichen Ladenketten, egal, ob man sich auf dem Hovedbanegården in Kopenhagen, dem Berliner Hauptbahnhof oder dem Milano Centrale befindet. Ich habe Lust zu rufen: «Ich brauche kein neues Handy, kein Parfüm und keine neuen Kleider. Ich will hinaus und reisen, ich brauche nur eine Fahrkarte!»
Die Zeit und die Fahrt
Der kleine Zug eilt durch einen Korridor aus Chlorophyll über die Hügel in den Cambrian Mountains. Es ist Frühsommer, und Büsche und Hecken, die in den letzten Wochen im Rekordtempo gewachsen sind, lehnen sich über die Gleise, berühren den Zug mit ihren hauchdünnen, hellgrünen Blättern und verengen die Perspektive, so dass man das Gefühl hat, der Zug führe viel schneller als er es tut. Schon sind wir unten und rollen brummend in eine Landschaft ohne Bäume hinaus, aber mit hellen Kalksteinhügeln, Uferwiesen mit hohem Gras und gelben Sandstränden vor einem stahlblauen Meer.
Ich habe die Cambrian Line in Shrewsbury bestiegen, einem von jenen Bahnhöfen aus rotem und hellbraunem Ziegelstein, die mich an die Frühzeit der Industrialisierung denken lassen. Dieses Gefühl wird noch dadurch verstärkt, dass diese Bahn immer noch nicht elektrifiziert ist. Genau wie auf mehr als der Hälfte von Großbritanniens Eisenbahnstrecken sind hier fossile Treibstoffe am Start. Grollende Dieselloks, die ihren Rauch in kleinen, graublauen Wolken aus dem kurzen Schornstein stoßen. Das ist ein wenig paradox: Das Land, in dem als erstem der Welt Eisenbahnen fuhren, ist eines der langsamsten Europas, wenn es um die Elektrifizierung seines Netzes geht.
Langsam aber sicher verändern sich die Namen der Bahnhöfe und zeigen an, dass wir den englischsprachigen Teil des Königreiches verlassen und tiefer in das kymrisch-sprachige Wales vordringen. Erst kommen wir an Bahnhöfen mit bekannten englischklingenden Namen wie Hanwood, Yockleton und Montgomery vorbei, doch nur wenige Gleiskurven später schon heißt es zungenbrecherisch Talerddig, Llanbrynmair, Glandyfi und Ynyslas.
Der Zug eilt mit seinem dumpf knurrenden Motorengeräusch, biegt nach Süden ab, vorbei an grasenden Schafen, Wiesenblumen und verspielt in klarem Blau, Grün oder Gelb gestrichenen Häusern. In den Wagen strömt der Duft von Meersalz und nassem Stein. Das ziegelsteinschwere, rußige, verbrauchte Industrie-England um Liverpool, Manchester, Leeds und Sheffield kommt einem weit entfernt vor. Zum Dröhnen der Steinschwellen tuckern wir in etwas hinein, was Mittelerde, dem Traum J. R. R. Tolkiens vom ländlichen Paradies mit Wiesen und niedrigen Häusern mit Schilfdach gleicht.
Die Endstation heißt Aberystwyth. Dort wandere ich auf der Terrace Road zum Meer hinunter. Ein Pier mit einem Pub und einer Spielhalle, eine Universität im gotischen Stil und Bed-and-Breakfast-Unterkünfte mit Namen wie Sunnymead, Glengower und Queensbridge. Alles schreit förmlich nach wohlhabender Bürgerlichkeit und harmonischer Ferienzeit. Vielleicht habe ich zu viele britische Fernsehserien aus ländlichen Gebieten gesehen, denn ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass solche Idylle unter ihrer glatten Oberfläche auch etwas Böses und Schreckliches verbergen müsse. Vielleicht einen Mord mit einer Leiche in einem Güterwaggon der Vale of Rheidol Railway, der Schmalspurbahn hinauf zu den alten Bleigruben in Devil’s Bridge oberhalb der Küstengemeinde?
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Dampfmaschine bereits erfunden, ebenso wie die Spinning Jenny. Billige Rohstoffe kamen mit Segelschiffen von den Kolonien über das Meer nach Europa. In Großbritannien hatten die Schornsteine begonnen zu rauchen, es schnurrten die Räder, die Arbeiter schufteten und die Waren wurden in Massen produziert. Eigentlich stand der Ausbreitung der Industrialisierung in alle Welt hinaus nur eins im Weg: der Wagen mit Zugtier, die veraltete Methode, Menschen und Waren zwischen Häfen, Dörfern, Städten und Fabriken hin und her zu transportieren; dieselbe Technik, die man schon anwandte, als das Römische Reich in seiner Blüte stand und Jesus geboren wurde.
Ein paar tausend Jahre lang war die technische Entwicklung minimal gewesen. Von Ochsen und Pferden auf verschlungenen und unebenen Wegen gezogene Karren und Wagen waren immer noch die schnellste Art, sich auf der Landstraße fortzubewegen. Das ging nicht nur langsam vonstatten, es war auch unbequem, unsicher und teuer. Ein Zugtier kann nicht unbegrenzt lange arbeiten. Wer auf dem Landwege auf der Strecke Stockholm – Malmö, Paris – Bordeaux oder Berlin – München, drei Strecken von jeweils ungefähr 600 Kilometern Länge, reisen oder eine Ware transportieren wollte, musste eine Reisezeit von mindestens acht Tagen und acht Pferdewechseln an acht verschiedenen Wechselstationen entlang der Route einkalkulieren. Dennoch wurde die Zeit im vorindustriellen Europa als das geringste Problem angesehen. Schlimmer stand es um die Kosten. So viele Pferdewechsel waren teuer, weshalb nur die Wohlhabendsten sich das leisten konnten. Alle anderen mussten wandern und ihr Gepäck selbst tragen.
Die Infrastruktur auf dem Lande war kurz gesagt «bis dahin das schwächste Glied in der Kette der Kapitalistischen Emanzipation von den Schranken der organischen Natur», wie es der deutsche Historiker und Philosoph Wolfgang Schivelbusch in seinem Klassiker Geschichte der Eisenbahnreise ausdrückt. Der Verkehr auf den Wasserwegen war dem Transport über Land in Bezug auf die Geschwindigkeit seit Urzeiten überlegen gewesen. Vom frühen Kolonialismus des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Segeltechnik den Verkehrsbedürfnissen während aller Expansionsphasen Europas ausreichend Genüge getan. Doch jetzt war das Bedürfnis gewachsen, sowohl Menschen wie Waren auch zu Lande zu transportieren. Der Kapitalismus trieb die Entwicklung der im 18. Jahrhundert erfundenen Dampfmaschine und etwas später auch der Dampflok an.
Der Engländer Thomas Gray war einer der größten Eisenbahn-Enthusiasten seiner Zeit, der intensiv nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch im restlichen Europa propagierte, den Passagierverkehr mit dem Zug in Gang zu bringen. Sein großes Werk war Observations on a general iron rail-way, ein Buch, das während der Jahre 1820–1825 in fünf überarbeiteten Ausgaben erschien. Er schrieb, dass «die übertriebenen Preise, die der Allgemeinheit für den Transport von Waren und Personen mit Pferd und Wagen abverlangt werden, in erster Linie (…) von den enormen Kosten der Pferdezucht verursacht werden …»
Der Preis für Hafer war nämlich hoch. Ein Pferd zu unterhalten, kostete ebenso viel Futter, wie acht Arbeiter an Essen konsumierten, stellte der Volkswirtschaftler Adam Smith fest und führte den Gedanken wie folgt fort: Wenn eine Million Pferde, die für den Warentransport benutzt werden, dank der Mechanisierung durch neue Eisenbahnen ihrer Aufgaben entledigt werden könnten, ja, dann würden Lebensmittel für acht Millionen Arbeiter zur Verfügung stehen.
Es gab jedoch auch weitblickende Denker, die erkannten, dass es bei den fossilen Brennstoffen ein Nachhaltigkeitsproblem gab. Der französische Ingenieur Pierre-Simon Girard, Mitglied in der Académie des Sciences, kommentierte die in England stattfindende Diskussion über Pferdestärke versus Dampfkraft dahingehend, dass die Dampfkraft zwar durchaus ökonomischer sei, dass aber der Brennstoff, den die Maschinen benötigen, also die Kohle, früher oder später ausgehen würde. Der «Brennstoff» der Pferde, soll heißen, organische Naturprodukte, hingegen könnte Jahr für Jahr neu erzeugt werden, weshalb er niemals ausgehen würde. Die Natur sorge jedes Jahr für neuen Brennstoff.
Auf der anderen Seite, so antworteten die Verteidiger der neuen Technik, sei die animalische Kraft, also die Einsatzfähigkeit des Pferdes, begrenzt und könne über ein gewisses und sehr beschränktes Maß hinaus nicht gesteigert werden. «Es sind die größten Anstrengungen zur Beschleunigung der Postbeförderung unternommen worden, ohne dass es doch möglich gewesen wäre, eine Schnelligkeit von zehn Meilen in der Stunde zu überschreiten, und schon das nur zu dem Preis, die animalische Kraft derart zu brechen, dass man es nicht ohne die schmerzvollsten Gefühle mitansehen kann, während man doch auf der Liverpool-Eisenbahn mit größter Leichtigkeit eine durchschnittliche Fahrt von fünfzehn Meilen die Stunde aufrecht erhalten kann», schrieb der britische Ingenieur Nicholas Wood, Autor mehrerer Standardwerke über Technik.
Der Postweg, der einst von einzelnen Postboten erledigt wurde, war in den Jahren vor der Erfindung der Eisenbahnen durch ein System bewerkstelligt worden, in dem man entlang der Wegstrecke die Pferde wechselte oder die Poststücke an Läufer, Reiter oder Kutscher übergab. Auf diese Weise erreichte man erhebliche Schnelligkeit, doch war man immer noch an die physischen Leistungsgrenzen gebunden, selbst wenn man die gemeinschaftliche Anstrengung mehrerer Menschen und Pferde benutzte.
Für ein zukunftsorientiertes Großbritannien war die animalische Kraft ein hoffnungsloser Anachronismus. Man verlangte nach der mechanischen Kraft. In James Adamsons Sketches of our information as to rail-roads von 1825 werden die Unterschiede zwischen Pferd und Maschine wie folgt beschrieben: «Das Tier bewegt sich nicht regelmäßig und kontinuierlich fort, sondern auf eine unregelmäßig schwankende Weise, bei der der Körper gehoben und gesenkt wird, wenn die Glieder die Lage wechseln (…) Während der Bewegung wird der Körper mit jedem Schritt gehoben und gesenkt; dieses unaufhörliche Anheben der Masse ist es, das einen solchen Widerstand für unsere Bewegung erzeugt, dass deren Geschwindigkeit gesenkt und so zögerlich wird (…) Mit einer Maschine entstehen diese Nachteile nicht. Die Lokomotive rollt regelmäßig entlang der glatten Schienen der Bahn, vollkommen ohne von ihren eigenen Bewegungen gebremst zu werden, und das ist, neben dem wirtschaftlichen, einer ihrer großen Vorteile, verglichen mit der animalischen Kraft.»
Solange die Eroberung des Raumes an die tierische Kraft gebunden war, hielt sie sich innerhalb der Grenzen des physischen Leistungsvermögens der Tiere. Die Dampfkraft hingegen stand für etwas, das unbegrenzt und unermüdlich war. Keine animalische Kraft, so schrieb Thomas Gray, könne «unserem Berufsverkehr eine solche einheitliche und regelmäßige Beschleunigung verleihen wie die Eisenbahn». Dank der Eisenbahn könne der Mensch sich in seinem Reisen von der «organischen Bindung» befreien. Schiffe folgten Wind und Wasserströmen, während Reisende zu Land den natürlichen Unebenheiten der Landschaft folgten und entweder von ihrem eigenen Leistungsvermögen oder dem der Tiere eingeschränkt wurden. Wir könnten die Pferde dazu bringen, uns zu gehorchen und die Richtung zu ändern, schneller oder langsamer zu laufen, doch die existierende Bewegungsmenge könnten wir weder erhöhen noch vermindern.
Es war schwer, sich ganz von dem organischen Denken freizumachen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Lokomotive «Eisenpferd» und «Dampfpferd» genannt wurde, und dass man die Kraft, die aus Motoren und Mechanik gewonnen wurde, in Pferdestärken maß – was in manchen Fällen heute immer noch so ist, obwohl nur wenige Menschen noch eine Vorstellung davon haben, wie viel ein Arbeitspferd ziehen kann. Tatsächlich war es der Dampfmaschineningenieur James Watt, der die Einheit Pferdestärke erfand, um seinen Zeitgenossen pädagogisch die genaue Anzahl an Pferden vor Augen zu führen, deren Arbeit durch seine neuen Dampfmaschinen ersetzt werden könnte. Watts’ Pferdestärke war (und ist) ungefähr 50 Prozent kraftvoller als man es seiner Meinung nach von einem Arbeitspferd in kontinuierlicher Arbeit verlangen konnte, weil die Maschine endlos, ohne ausruhen zu müssen, maximale Leistung zeigen könne.
Ironischerweise war es der Ingenieur Watt, welcher die Maschinenkraft mit dem Pferdevergleich erklärt hatte, nach dem lange nach seinem Tod die heute geltende physikalische Größe Energie pro Zeiteinheit benannt wurde. (Falls jemand es wissen möchte: eine Pferdestärke entspricht ungefähr 0,73549875 Kilowatt).
Es war dem Menschen immer unmöglich sich vorzustellen, wie etwas Neues und noch Unbekanntes sich entwickeln wird. Als die allerersten Eisenbahnen vor bald zweihundert Jahren in England unterwegs waren, konnte man nur schwer sagen, wie es damit weitergehen würde. Wenn dies der Anfang war, wie sah dann das Ende der Entwicklung aus, wenn man sich nun überhaupt ein Ende vorstellen konnte? Würde jede Wiese von einer Eisenbahn durchkreuzt werden, in Rauch gebettet und in mechanischen Lärm getaucht?
Sowohl die Loks wie auch die Maschinen wurden ja mit angezündeter Steinkohle betrieben, die Wasser aufheizte, das wiederum zu Dampf und Rußpartikeln wurde. Das klang nicht nur ohrenbetäubend, sondern war auch ziemlich schmutzig. Es gab viele Anzeichen dafür, dass die Züge zusammen mit den Fabriken große Veränderungen des ökologischen Systems hervorrufen würden. Die an Steinkohle und Eisenerz reiche Grafschaft Staffordshire im Schnittpunkt zwischen Liverpool, Manchester, Sheffield und Birmingham erhielt bald die wenig schmeichelhafte Bezeichnung The Black Country. Gruben, Gießereien, Stahlwerke, Glas- und Ziegelfabriken und dahinschnaubende Dampfloks trugen zu einer der ersten größeren Umweltzerstörungen durch den Menschen bei. Die Verbrennung von Kohle erzeugte einen umfassenden Kohlendioxid-Ausstoß. Außerdem war der Rauch voller Schwefel und Quecksilber, was sich auf Natur und Mensch schnell zerstörerisch auswirkte. Mit den Maschinen hielt eine braunere, schmutzigere, grauere und härtere Welt Einzug.
Natürlich gab es auch Vorteile, sonst hätte die Industrialisierung niemals solch einen Schwung entwickelt und die Züge wären nie ins Rollen gekommen. Die Fabriken schufen Wohlstand, und die Eisenbahnen ermöglichten schnelle und effektive Transporte. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten Arbeiter und Angestellte im Zentrum der Stadt arbeiten, aber an deren Peripherie wohnen und die Strecke jeden Tag zurücklegen. Die Eisenbahn schuf die Vororte.
Sich auf Eisenschienen und mit Dampfkraft fortzubewegen, machte die Fahrt billiger und damit allgemein erschwinglicher. Gleichzeitig bedeutete die Zugreise, dass alle Passagiere am industriellen Prozess teilhatten. Das war vor allem in der Zweiten und Dritten Klasse bemerkbar, die zu Anfang mehr Güterwaggons glich, in denen der industrielle Ursprung noch deutlich zu spüren war. In der Ersten Klasse bestanden die Waggons anfänglich aus aufmontierten alten Postkutschen und erinnerten an die Salons des Adels und des Bürgertums.
Schnell ging es, fand man. So schnell, dass die Ortszeit, die man bisher am Auf- und Untergang der Sonne maß und die sich von Dorf zu Dorf unterschied, synchronisiert werden musste. Wie sollte man sonst Fahrpläne drucken? Rhythmus und Routinen der Eisenbahn veränderten das Gefühl für Zeit und Raum. Pünktlichkeit wurde zu einem neuen Ideal, ebenso wie Schnelligkeit. Mit den Eisenbahnen kamen die Telegrafie und das Telefon, die Post und die das ganze Empire umfassenden Tageszeitungen – drei zu jener Zeit superschnelle Kommunikationsmittel.
Mit dem Zug schuf der Mensch eine neue Dimension der Wirklichkeit. Auf dem europäischen Kontinent wurde es möglich, an ein und demselben Tag in einem Land zu frühstücken, im zweiten zu Mittag zu essen und im dritten zu Abend zu speisen, während man über Tageszeitungen, Telefon und Telegrafie an dem teilhatte, was fast zur gleichen Zeit an einem vierten Ort hinter den sieben Bergen geschah. Es fühlte sich an, als wäre es möglich geworden, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
Als die Züge Mitte des 19. Jahrhunderts in immer mehr Ländern Europas zu rollen begannen, wuchs auch gleichzeitig das Gefühl der Entfremdung. Langsam aber sicher entfernten wir uns von unserem organischen Ursprung. Die Eisenbahn mit den Schienen und den Zügen wurde eine maschinelle Einheit, deren Funktion es war, natürliche Hindernisse zu überwinden. Die verschlungenen Transportwege wurden zu geraden Strecken ausgerichtet. England wurde bald von Eisenbahnstrecken durchschnitten, die sich im Unterschied zu den Landwegen nicht um Äcker, Senken und Anhöhen herumschlängelten und hinunter in Täler oder über Wasserläufe führten, sondern die sich durch all das hindurchbohrten und darüber erhöhten, als bewegten sie sich in einer eigenen Welt.
«Man kann sie [die Eisenbahn] definieren als das technische Mittel, Newtons Erstes Gesetz der Bewegung zu operationalisieren. Dieses Gesetz lautet: ’Corpus omne sola vi instita uniformiter secundum lineam rectam in infinitum progredi, nisi aliquid extrinsecus impediat [‹Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird›]», schreibt Wolfgang Schivelbusch. Mehrere Darstellungen von frühen Zugreisen beschreiben die Eisenbahn und die Landschaft, die sie durchkreuzt, als weit voneinander entfernte Welten. Sie schildern, wie die Eisenbahn die natürlichen Formen der Natur aufhebt. Der Zugreisende befindet sich auf diese Weise in «einer anderen Welt», wie es im Reiseführer The railway companion beschrieben wird, der 1833 in London erschien, nur drei Jahre nach der Einweihung der ersten regulären Zugverbindung der Welt in Mittelengland.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den englischen Eisenbahnen betrug zu Beginn zwischen dreißig und fünfundvierzig Stundenkilometer. Das klingt in den Ohren eines modernen Menschen ziemlich langsam, doch war es dreimal so schnell wie die Postkutschen. Viele Autoren grübelten darüber nach, was diese «Schnelligkeit» wohl mit der Seele des Menschen machte. Der zeitliche Gewinn mit dem Zug wurde in mehreren Texten aus der Zeit als eine Verkleinerung des Raumes beschrieben.
Die Annahme, dass plötzlich in ganz England Eisenbahnstrecken gebaut werden würden, veranlasste die Londoner Zeitschrift Quarterly Review zu der Formulierung: «Das würde bedeuten, dass selbst bei den derzeitigen moderaten Reisegeschwindigkeiten die gesamte Bevölkerung des Landes bildlich gesprochen ankommen und ihre Lehnstühle zeitlich betrachtet zwei Drittel näher an den warmen Herd der Hauptstadt rücken würde.»
Das neue, schnelle Fahrtmittel erzeugte das Gefühl einer Aufhebung der traditionellen Kontinuität und Balance zwischen Zeit und Raum. Und allein der Gedanke, dass der Zug jederzeit einen Menschen quasi augenblicklich von dem Ort, an dem er sich befand, an einen entfernten Ort befördern konnte, ließ den deutschen Schriftsteller Heinrich Heine in seinem Exil in Paris ausrufen: «Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden; vor meiner Tür brandet die Nordsee.»
Um auszuprobieren, wie es sich anfühlt, auf jener Eisenbahnstrecke unterwegs zu sein, die für die Jungfernfahrt des ersten regulären Passagierwaggons der Welt mit Dampflok diente, nehme ich den Zug zurück nach Shrewsbury, dessen Bahnhof wie eine archäologische Ausgrabungsstätte anmutet. Das Gebäude ist modernisiert worden, aber das Alte ist noch da, in Schichten um Schichten von Portalen und Mauern in rot verrußtem, gesprungenem Ziegelstein. Nichts scheint weggenommen worden, sondern immer nur dazu gebaut zu sein, so dass man die Wurzelverästelungen bis hin zum Ursprung von Stahl, Kohle und Ziegelstein verfolgen kann.
Dann steige ich um und begebe mich nach Liverpool, um dort den Regionalzug nach Manchester zu besteigen. Doch die Fahrt auf dieser Strecke ist nichts für einen Infrastrukturarchäologen wie mich, denn hier fährt man in Zügen aus schimmerndem Stahl, mattem Komposit und glänzendem Plastik in hellen Pastellfarben – typische Alltagszüge für pendelnde Studenten, Arbeiter und Beamte, die in keiner Weise noch an die legendäre Strecke, auf der sie unterwegs sind, erinnern. Das ist der Tiefpunkt meiner Reise. Umso historischer fühlt sich alles an, als wir Manchester Victoria erreichen, den stattlichen Bahnhof von 1844 mit korinthischen Säulen und einer großen Uhr als Königskrone auf dem Dach.
Hier besteige ich den Zug nach Cork, wo ich im Institute of Railway Studies Oliver Betts treffe. Irgendwie ist es, als könne nur ein Land wie Großbritannien, die Heimat des Trainspotting auf Erden, ein solches Institut beherbergen. Gemeinsam mit dem National Railway Museum residiert das Institut in den ehemaligen Eisenbahnhallen aus hellbraunem Ziegelstein hinter dem Bahnhof von York, der genau wie der in Manchester aus den 1840er Jahren stammt.
Oliver nimmt mich auf eine Runde durchs Museum mit, um mir die weltweit bestbestückte Sammlung von Zug-Artefakten zu zeigen. Hier findet sich der Nationalstolz der Briten: The Mallard, die zierliche stromlinienförmige Dampflok, deren Design vom Sportwagenbauer Bugatti inspiriert ist. Sie legte im Juli 1938 mit 203 Stundenkilometern den Weltrekord hin und machte die Briten stolz – nicht zuletzt deshalb, weil sie damit den bisherigen Rekord von nur 200,4 Stundenkilometern brach, den die Deutsche Reichsbahn mit ihrer Lok 002 der Baureihe 05 hielt. Das war vier Monate nach der Annexion Österreichs durch das nationalsozialistische Deutschland eine wichtige, wenn auch friedliche technologische Machtdemonstration.
Ich habe mich immer mehr für das Reisen mit dem Zug als für die Züge selbst begeistert. Überall in der Welt, aber vor allem in Großbritannien, gibt es eine andere Kategorie Enthusiasten, die vor allem an den Zügen interessiert sind. Sie abonnieren Zeitschriften wie The Railway Magazine, Classic Trains, Rail Express und Locomotives International, sind Mitglied in Vereinen, deren Mitglieder an richtigen Dampfloks herumschrauben oder in ihren Garagen an Modelleisenbahnen bauen. Die Liebe zu den Maschinen und Fahrzeugen treibt sie manchmal hinaus in Gleisanlagen, Bahnhöfe und Wagenhallen, um mit derselben Leidenschaft Loks und Waggons zu beobachten, wie Ornithologen Vögeln auflauern. Als ich mit Oliver herumlaufe, lasse ich mich ein wenig von seiner Begeisterung anstecken. Vielleicht, weil die Materie auch etwas über die Gesellschaft ringsum aussagt.
Zum Beispiel, wenn er mich zu der riesenhaften Dampflok mitnimmt, die von Sun Yat-sen, dem chinesischen Revolutionär und Begründer der Kuomintang, in Großbritannien bestellt wurde. Er stürzte 1911 die letzte kaiserliche Dynastie in China. Die ungeheuer große Lok sollte dazu benutzt werden, im Geiste des Volkes die Eisenbahnstrecken der Republik aufzubauen. Doch nun ist sie zurück in ihrem Herstellerland und kann hier im Museum besichtigt werden.
Oder als wir dastehen und uns den ersten Hochgeschwindigkeitszug, den japanischen Shinkansen, ansehen. Hier steht nämlich ein Originalexemplar. Der Zug sieht aus wie ein Jetflugzeug aus damaliger Zeit und wurde zur Olympiade in Tokio 1964 in Betrieb genommen. Das war kein Zufall, sondern sagt viel über die Rolle aus, die Züge und Eisenbahnstrecken als nationale Prestigeobjekte spielten.
Wir schließen die Lokrunde mit einem weiteren britischen Objekt des Stolzes ab: einer Kopie von The Rocket, der vom britischen Ingenieur George Stephenson konstruierten Dampflok, die 1829 ein von der Liverpool–Manchester Railway arrangiertes Wettrennen gewann. Doch auch Schweden hätte fast einen vorderen Platz in der Weltgeschichte der Eisenbahnen belegt. Denn die Lok des schwedisch-amerikanischen Erfinders John Ericsson The Novelty belegte den zweiten Platz. Nun war es also Stephensons Erfindung, die zum globalen Vorbild dafür wurde, wie eine Dampflok konstruiert sein sollte, und ihr wurde daraufhin auch die Ehre zuteil, Waggons mit Reisenden zwischen Liverpool und Manchester zu ziehen.
Schon am ersten regulären Verkehrstag, dem fünfzehnten September 1830, geschah das erste Unglück. Als der von der Lok Northumbrian gezogene Zug am Bahnhof in Parkside anhielt, um Wasser nachzufüllen, stiegen die Passagiere aus, um sich die Beine zu vertreten. Unter ihnen war der Investor und Parlamentsabgeordnete William Huskisson. Während des Zwischenstopps winkte der Herzog von Wellington Huskisson zu sich, der über die Gleise eilte, um den Waggon des Herzogs zu besteigen. Da näherte sich der entgegenkommende, von The Rocket gezogene Zug auf dem anderen Gleis. Ein Ruf war zu hören:
An engine is approaching. Take care, gentlemen!
Alle Reisenden hatten die Warnung wahrgenommen und verließen daraufhin die Gleise – alle außer Huskisson, der nun Panik bekam und hin und her über den Bahndamm eilte. Im letzten Augenblick versuchte er, in Wellingtons Waggon zu steigen, verlor aber den Halt, fiel hin und blieb liegen. Es war zu spät, um vor der herannahenden The Rocket noch aufzustehen. Der Parlamentsabgeordnete wurde unter den Zug gezogen, der über seine Beine rollte.
«Das hier überlebe ich nicht. Bringt meine Frau her und lasst mich sterben», soll Huskisson gesagt haben, wie er schwer verletzt dort lag.