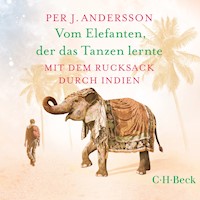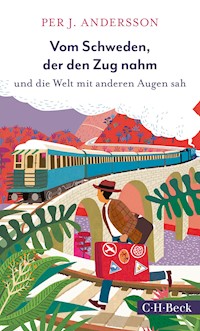Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte E-Book
Per J. Andersson
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
In seinem neuen Buch berichtet der Bestsellerautor Per J. Andersson von seiner großen Leidenschaft, dem Reisen. Dabei erzählt er bezaubernde Geschichten, entführt in fremde Welten und zeigt, warum das Reisen ein Bedürfnis ist, das in jedem von uns schlummert. Eine gefährliche Lektüre für Menschen mit festem Wohnsitz – und eine wunderbare Inspiration für alle, die es in die Welt hinauszieht. Reisen bildet und es öffnet die Augen. Man entdeckt neue Geräusche, Gerüche und Gebräuche und erblickt die Welt aus ungewohnten Perspektiven. Wer reist, ist nicht borniert und engstirnig. Wer weiß, wie es in anderen Weltgegenden aussieht, hat keine Angst vor dem Fremden. Per J. Andersson reist abseits der ausgetretenen Pfade. Er wandert durch Berge, schlendert durch Basare und Slums, fährt mit dem Bus durch Indien und trampt durch Europa – immer auf der Suche nach spannenden Begegnungen, neuen Eindrücken und dem, was unserem Leben Sinn verleiht. Sein Buch ist ein grundsympathischer Reiseverführer, der Mut macht aufzubrechen, um in der Ferne zu sich selbst zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Ähnliche
PER J. ANDERSSON
Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte
REISEN IN DIE FERNE UND ZU SICH SELBST
Aus dem Schwedischen übersetzt von Susanne Dahmann
C.H.BECK
Zum Buch
In seinem neuen Buch berichtet der Bestsellerautor Per J. Andersson von seiner großen Leidenschaft, dem Reisen. Dabei erzählt er bezaubernde Geschichten, entführt in fremde Welten und zeigt, wie man aufbricht, um in der Ferne zu sich selbst zu finden. Eine gefährliche Lektüre für Menschen mit festem Wohnsitz – und eine wunderbare Inspiration für alle, die es in die Welt hinauszieht.
Zu reisen ist ein Bedürfnis, das in jedem von uns schlummert. Reisen bildet und öffnet die Augen. Man entdeckt neue Geräusche, Gerüche und Gebräuche und erblickt die Welt aus ungewohnten Perspektiven. Wer reist, ist nicht borniert und engstirnig. Wer weiß, wie es in anderen Weltgegenden aussieht, hat keine Angst vor dem Fremden. Per J. Andersson reist abseits der ausgetretenen Pfade. Er wandert durchs Gebirge, schlendert durch Basare und Slums, fährt mit dem Bus durch Indien und trampt durch Europa – immer auf der Suche nach spannenden Begegnungen, neuen Ein- drücken und dem, was unserem Leben Sinn verleiht. Sein Buch ist ein grundsympathischer Reiseverführer, der Mut macht aufzubrechen. Denn wer reist, hat mehr vom Leben.
Über den Autor
Per J. Andersson ist ein schwedischer Journalist und Schriftsteller. Er ist Mitbegründer von Schwedens bekanntestem Reisemagazin. 2015 erschien sein Bestseller «Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden», der sich bisher insgesamt mehr als 350.000 Mal verkauft hat.
Inhalt
Vorwort
Warum bin ich nicht zu Hause geblieben?
Die Nomaden
Endlich unterwegs
Zug, bring mich fort!
Die Wanderer
Kreuz und quer über einen herumirrenden Planeten
Mit der Schildkröte an der Leine
Zurückkehren und bewahren
Der erloschene Stern
Die Tramper
Eine Reise zurück in der Zeit
Frei und rastlos
Einmal um die Stadt
Traumpfade
Die Verwandlung der Reisenden
Die verrückten Reisenden
Sicherheit
Wieder zu Hause
Dank
Zweiundzwanzig Reisebeschreibungen, die Lust aufs Vagabundieren machen
«Erst wenn wir uns verirren, fangen wir an, uns selbst zu verstehen.»
Henry David Thoreau
«Allein in einer unbekannten Stadt aufzuwachen, gehört zu den angenehmsten Erlebnissen, die es gibt. Man ist vom Abenteuer umschlossen.»
Freya Stark
«Ich hasse Urlaube. Ich hasse sie. Ich habe im Urlaub nie Spaß. Ich kriege nichts getan. Die Leute sitzen da und entspannen sich, aber ich will mich nicht entspannen. Ich will was sehen.»
Paul Theroux
Vorwort
Bis vor dreizehntausend Jahren waren wir Nomaden. Die Wanderlust steckt uns in den Genen. Sich über den Horizont hinaus bewegen zu wollen, ist ein ererbter Trieb, eine kollektive Ur-Erinnerung. Reisen zu wollen, ist universell.
Unser Bedürfnis nach Abwechslung ist groß. In der alten schwedischen Bauerngesellschaft zog man im Frühsommer hinaus in die spartanisch eingerichtete «Sommerküche» auf der anderen Seite des Hofgrundstücks. Die Veränderung war nicht sehr groß, und manchmal betrug der Abstand vielleicht nur fünfzig Meter, aber es genügte, um das Gefühl eines einfacheren und freieren Daseins zu erleben. Bei den jährlichen Reisen der Bauernfamilie zu Herbstmarkt und Kirchweih ging es auch nicht nur um praktische Bedürfnisse und Pflichten, sondern einfach darum, einmal etwas anderes zu sehen.
Wenn wir aber die Welt schon nicht mit eigenen Augen sehen können, dann muss die Welt zu uns kommen. Die ersten Bücher, die der Mensch geschrieben hat, waren Reisebeschreibungen, die dazu dienen sollten, die Sehnsucht derer zu lindern, die nicht reisen konnten, weil sie an Familie, Heim und Acker gebunden waren, oder weil sie zu alt, krank oder körperlich eingeschränkt waren. Die ältesten Texte der Literaturgeschichte – das Gilgamesch-Epos, die Odyssee, Abrahams Wanderungen im Alten Testament und die Abenteuer der Brüder Pandava in der Mahabharata – handeln sämtlich von ausgedehnten Reisen.
Laut der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen UNWTO unternehmen die Bewohner der Welt jedes Jahr ungefähr eine Million Auslandsreisen. Rechnet man die Urlaubsreisen innerhalb des eigenen Landes noch dazu, dann steigt diese Zahl um ein Vielfaches. In den letzten Jahren sind oft die Nachteile des Reisens betrachtet worden. Die Beeinträchtigung der Umwelt durch das Fliegen werden wir nicht leugnen können, doch das muss unsere Reiselust nicht bremsen. Können wir nicht weniger fliegen und öfter den Zug oder die Fähre wählen – oder vielleicht sogar Wanderschuhe oder Fahrrad?
Das Reisen in Regionen jenseits unseres Horizontes schützt uns davor, das eigene Volk zu überhöhen. Man lernt, dass die Welt gar nicht so seltsam ist, wie sie einem vorkam, als man noch zu Hause in seinem Kämmerlein saß und über sie nachgrübelte. Vorurteile entstehen aus Mangel an Information und Kommunikation, ganz gleich, ob es dabei um den Nachbarn nebenan geht oder um die Ureinwohner Australiens. Je mehr Kontakt wir zu dem Unbekannten haben, desto weniger müssen wir phantasieren, und das hält die Dämonen auf Abstand, die der wichtigste Brennstoff für Rassismus sind.
Es ist leicht, ein Misanthrop zu werden, wenn unser einziger Kontakt zur Welt aus den Nachrichten besteht, die uns die Medien ins Wohnzimmer bringen. Es ist doch überall nur Elend, und die Menschen sind dumm, denken wir, warum sollen wir uns darum scheren? Da ist es am besten, man bleibt zu Hause in seinen sicheren vier Wänden. Doch wer reist, der erkennt, dass alles gar nicht so schlimm ist, wie es uns die Schlagzeilen in den Tageszeitungen weismachen wollen, und dass es selbst an den problematischsten Orten Glück und Schönheit gibt. Das Reisen lehrt uns, dass nicht nur der Platz auf Erden, auf dem wir selbst uns niedergelassen haben, als normal und sicher betrachtet werden kann. Vielleicht ist das Reisen die wirkungsvollste Methode, das eigene Bild von der Welt zu erweitern, denn die Nachrichten in den Medien greifen schließlich immer zu kurz und sind oft losgelöst vom historischen Kontext; deshalb beschreiben sie nur selten, wie es an den Tagen aussieht, wenn keine Naturkatastrophe passiert oder wenn die Parlamentswahlen vorüber sind oder die Waffen verstummen.
Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass wir nicht nach Kambodscha, in die Mongolei oder irgendein anderes fernes Land reisen müssen, um eine andere Kultur zu erleben. Auch in Dänemark, Polen, Deutschland, Spanien und weiteren Ländern auf unserem Kontinent können wir Reiseerfahrungen machen, die uns neue Erkenntnisse über das Leben schenken. Doch dafür braucht man Kontakt zur Wirklichkeit. Und Zeit.
Ist denn alles Reisen schön? Längst nicht. Viele von uns werden schließlich gezwungen, wegzugehen, um Armut, Krieg und Unterdrückung zu entfliehen. Andere wiederum reisen, um Freunden und Nachbarn zu imponieren, als würden sie einen Wettkampf im Erleben bestreiten. Und dann gibt es diejenigen, die aus finanziellen, sozialen oder politischen Gründen überhaupt keine Möglichkeit haben, zu reisen.
Darüber hinaus gibt es noch alle diese nationalen Grenzen mit Pass- und Visumregeln, von denen die Völker getrennt werden. Wir dürfen nie vergessen, dass wir zu einer privilegierten Gruppe gehören: Wer in Schweden lebt, kann ohne Visum in einhundertsechsundsiebzig Länder der Erde reisen, wer Deutscher ist, sogar in noch mehr. Es wird kaum erstaunen, dass Menschen mit afghanischem, pakistanischem, irakischem, somalischem und syrischem Pass die meisten Schwierigkeiten haben, sich frei in der Welt zu bewegen.
Nicht alle Urlaubsreisen führen zu neuen Erkenntnissen und gesteigertem Engagement. Ein All-inclusive-Urlaub am Mittelmeer kann unter Umständen sehr schön und notwendig sein, doch hat man, wenn man nach Hause kommt, wohl kaum das Gefühl, im Ausland gewesen zu sein, weil die Begegnungen mit anderen Menschen, abgesehen von Kellnern und Reinigungspersonal im Hotel, nur sporadisch waren – wenn es sie überhaupt gab. Wenn wir nur in abgeschlossene Touristenreservate reisen, wo die einzige einheimische Bevölkerung, die wir treffen, Hotelangestellte und Verkäufer sind, Menschen, bei denen wir lediglich etwas bestellen, mit denen wir um Preise verhandeln oder von denen wir uns Service erwarten, dann kann eine solche Reise unter Umständen unsere Vorurteile sogar noch verstärken.
Die Touristenreklame behauptet, uns in einen Geisteszustand jenseits des Alltags versetzen zu können. Sie lockt uns mit einer Flucht aus Trivialitäten, grauem Dasein und Leiden. Manchmal verspricht sie sogar einen schöneren Partner und nettere und zufriedenere Kinder. Auch wenn wir das nicht glauben, wenn wir sogar wissen, dass die Beziehungsprobleme nicht verschwinden und die Kinder nicht aufhören werden, miteinander zu streiten, nur weil wir wegfahren, hoffen wir dennoch, dass auf der nächsten Reise die sorglose Traumwelt der Werbung für uns in Erfüllung gehen wird. Wir erwarten, dass die Wirklichkeit verdrängt und die Probleme unsichtbar gemacht werden.
Das Reisen ist nämlich eine Art und Weise, jenseits vom Zwang der Arbeit und vom Kampf ums Überleben nach einem Sinn des Lebens zu suchen. In nur wenigen anderen menschlichen Aktivitäten ist der Ehrgeiz, den Zustand zu erreichen, den Aristoteles eudaimonia nannte, das wahre Wohlergehen und Wohlbefinden, so groß, wie wenn wir reisen.
Das Problem ist nur, dass der Traum vom Paradies, um den es im kommerziell verpackten Tourismus oft geht, in den allermeisten Fällen auch ein Traum bleibt. Was die Touristenreklame mit schön gestalteten Hotelfoyers und großen Pools verspricht, ist ein fast außerirdisches Erlebnis, frei von menschlichen Beschwerden. Nun gut. Aber schon bei unserer Ankunft an dem Ort, der in der Werbung so verführerisch abgebildet wurde, werden wir enttäuscht. Das Buffet im Restaurant kommt einem vielleicht schon am zweiten Abend eintönig vor. Die heruntergewehten Palmblätter und halb verrotteten Kokosnüsse stehen zwar für tropische Schönheit, aber sie sehen auch gammelig aus, wie sie da unordentlich über den Sandstrand verstreut liegen. Die Wärme, von der wir an einem dunklen und kalten Wintertag geträumt haben, führt dazu, dass wir uns jetzt verschwitzt, kurzatmig und beengt fühlen, und das Plastikband – Identifikationszeichen des All-inclusive-Touristen – scheuert am Handgelenk. Und auch wenn man im Traum vom Paradies gelandet ist, klingt doch der Tonfall innerhalb der Reisegesellschaft unverändert scharf.
Doch auch dort gibt es das Glück. Aber dafür muss man den Liegestuhl verlassen, sich vom Hotel wegbegeben und in die Wirklichkeit eines anderen Menschen eintauchen. Am besten wäre es, wenn die Reise nicht frei von Überraschungen bleibt. Paradoxerweise kann der Weg zum Glück kürzer sein, wenn man Enttäuschungen erlebt und genötigt wird, die Prioritäten zu verändern und zu improvisieren.
Nehmen Sie einfach irgendeinen Bus oder mieten Sie ein Auto und fahren Sie in die Berge, aufs Land hinaus oder in die nächste richtige Stadt, genehmigen Sie sich einen türkischen Kaffee oder eine Scheibe Wassermelone mit den alten Männern oder Frauen im Schatten unter der Platane. Eine Begegnung mit einem Menschen hilft, einen politischen Konflikt anders einzuordnen, ein Restaurantbesuch inspiriert zu einem neuen Kocherlebnis, der Spaziergang in einem botanischen Garten macht Lust auf neue Büsche im eigenen Garten – und eine Safari zu vom Aussterben bedrohten Tieren veranlasst einen vielleicht, in einen Naturschutzverein einzutreten.
Wenn die Reise lang war, dann besteht die Chance, dass man sich beim Nachhausekommen wie neugeboren fühlt. Ein Monat auf Reisen kann sich wie ein ganzes Jahr anfühlen. Man erlebt mehr Eindrücke pro Minute, das Leben ist intensiviert. Für die Freunde, die zu Hause geblieben sind, scheint die Zeit dagegen stillgestanden zu haben. Das ist die reinste Zauberei.
Menschen, die das Reisen verabscheuen, gehören oft zu denen, die leicht gestresst und nervös werden, wenn unvorhergesehene Dinge geschehen. Außerdem regen sie sich über die Idioten auf, die es natürlich überall gibt, anstatt diese einfach zu ignorieren und nach anderen, netteren Menschen Ausschau zu halten. Der neugierige Reisende hingegen ist gezwungen, die Fähigkeit zu entwickeln, sich schnell anzupassen und andere Normen und neue soziale Zusammenhänge zu erfassen.
Es ist gut, wenn wir nicht alles, was die Autoritäten uns weismachen wollen, für bare Münze nehmen. Aber es ist nicht gut, wenn das kritische Denken in die schlecht gelaunte Erwartung übergeht, dass mit Sicherheit alles schiefgehen wird. Dann verwandelt sich die Unzufriedenheit in pathologische Teilnahmslosigkeit und Eingeschränktheit.
Ursache der Krankheit: Reisemangel. Medikation: Reisen auf eigene Faust in fremde Kulturen. Der heilende Effekt gegen krankhaften Missmut tritt ein, wenn wir unsere Sicherheitszone verlassen und entdecken, dass das Leben auch sehr gut funktioniert, wenn wir nicht die volle Kontrolle haben. Sich anderen Kulturen auszusetzen kann bedeuten, einmal den festen Boden unter den Füßen zu verlieren und darauf zu vertrauen, dass schon alles gut werden wird.
Zu reisen heißt, sich neuen Geräuschen, Gerüchen und Sitten auszusetzen und trotz anfänglicher Unsicherheit und Verwirrtheit herauszufinden, wie man sich verhalten soll. Zu reisen heißt, zu lernen, dass ein und dasselbe Problem mehrere verschiedene Lösungen haben kann, und sich eine innere Ruhe zu verschaffen, damit man später keinen Nervenzusammenbruch mehr bekommt, wenn die S-Bahn mal zehn Minuten Verspätung hat oder wenn der Arbeitsplatz umorganisiert wird.
Unveränderlichkeit höhlt die Seele aus. Neue Aussichten aber schenken neue Perspektiven. Indem wir reisen, schärfen wir unser Wahrnehmungsvermögen und werden aufmerksamer sowohl für den Zustand der Welt als auch für unsere Umgebung zu Hause. Plötzlich empfinden wir etwas für Dinge, die uns bisher gleichgültig waren. Plötzlich sehen wir, was bisher unsichtbar war.
Warum bin ich nicht zu Hause geblieben?
Als ich das erste Mal einem echten Reisenden begegnet bin, war ich vierzehn Jahre alt. Mein Vater und ich saßen auf einer griechischen Insel in einem Strandlokal im Schatten, als er auftauchte. Der Reisende, der älter war als ich, aber jünger als mein Vater, trank mit einem Strohhalm Kaffee aus einem hohen Glas und grüßte auf Englisch mit einem seltsamen Dialekt. Ich wunderte mich, dass er nicht wie wir Badehosen trug, sondern gekleidet war, als wolle er zu einer Expedition in den Dschungel aufbrechen: kariertes Hemd, khakifarbene Shorts, graue Wollstrümpfe und schwarze Wanderstiefel, die viel zu warm wirkten für den Sommer am Mittelmeer. Neben dem Barhocker im Sand stand sein Rucksack, auf dessen Klappe eine Stoff-Flagge genäht war. Ich wusste nicht so recht, was für ein Typ das war, und wagte nicht, den Mund aufzumachen. Als Papa fragte, wohin er unterwegs sei, sagte er, er wisse noch nicht genau, aber auf jeden Fall würde er hier nicht bleiben, sondern weiter auf eine andere Insel reisen und dann in ein anderes Land.
Ich hörte erstaunt zu. Für mich bedeutete Reisen, an einen Ort zu fahren, dort eine Weile zu bleiben, und sich dann wieder nach Hause zu begeben. So machten wir das und alle anderen Touristen auf der Insel ebenso. Ich hörte, was er sagte, verstand auch das meiste von seinem lustigen Englisch, kapierte aber trotzdem nicht, was er meinte. Ich lebte in dem Glauben, dass man von A nach B und dann zurück nach A fahren müsse. Aber dieser Reisende redete davon, dass er von A nach B nach C nach D nach E … und so weiter und so fort fahren würde, um dann erst viel später wieder nach A zurückzukehren. Vorausgesetzt, dass er sich nicht am Ort B niederlassen und dort ein neues Leben beginnen würde. Die Möglichkeit gäbe es nämlich auch, sagte er. Der Reisende, der aus Neuseeland stammte, würde sehr lange nicht nach Hause zurückkehren.
Er erzählte, dass in seiner Schule neben der schwarzen Tafel in seinem Klassenzimmer eine Weltkarte gehangen hatte, auf der Neuseeland und Australien in der Mitte lagen und nicht ganz unten in der rechten Ecke, so wie wir das in Europa gewohnt sind.
Auf der neuseeländischen Karte hatte sich rings um sein Heimatland ein fast unendlicher Ozean ausgebreitet, und erst an ihren Rändern waren die großen Kontinente zu sehen.
«Wenn ich diese Weltkarte ansah, dann fühlte ich mich so einsam», sagte er als Erklärung dafür, dass er sich jetzt auf der anderen Seite der Erdkugel am Strand einer griechischen Insel befand.
Bald würde er den Bus zum Hafen nehmen und dann mit dem Schiff die Insel verlassen. Er würde die Kontinente an den Außenrändern seiner Weltkarte erkunden.
Erst viel später begriff ich, was seine Entdeckungsreise nach Europa bedeutete: Mit neuen Perspektiven kann das, was man sein ganzes Leben lang als Zentrum des Universums verstanden hat, an die Peripherie verschoben werden, während das, was früher am Rande lag, ins Zentrum rückt. Damals habe ich das nicht begriffen, aber später wurde mir klar, dass ich bei der Begegnung mit dem Reisenden aus Neuseeland auch in meine eigene Zukunft geschaut habe.
Schon bald war ich gezwungen, zum Alltag nach Hause zurückzukehren, in die Oberschule im roten Ziegelsteingebäude, zu den menschenleeren Vorortstraßen, zum Herbstdunkel, der Stille, der Geruchlosigkeit. Er aber hatte noch ein halbes Jahr des Reisens vor sich in einer Welt, in der das Leben pulsierte. So jedenfalls fühlte es sich an, wenn ich meine nächste Zukunft mit der seinen verglich. Gleichzeitig war es, als würde eine Tür, die bis dahin verschlossen gewesen war, geöffnet. Obwohl ich erst vierzehn Jahre alt war und noch nicht allein verreisen konnte, begann ich insgeheim Pläne zu schmieden.
Vor mir sah ich die Weltkarte, so wie ich sie kannte. Als Kind hatte ich es geliebt, in Atlanten zu blättern, und erinnerte mich an mein Erstaunen, dass Grönland so riesig aussah, während Schweden ungefähr genauso groß wie Indien wirkte. Konnte das stimmen? Ich maß mit meinem Lineal. Doch, in meinem Atlas war der Weg von Smygehyk nach Treriksröset – die Strecke vom äußersten Süden Schwedens bis zum nördlichsten Punkt des Landes, die Nils Holgersson auf seiner Reise berühmt gemacht hat – genauso lang wie der zwischen Nord- und Südspitze Indiens. Wie konnte dann in Indien eine halbe Milliarde Menschen leben, während wir in Schweden nur acht Millionen waren? Das war mir unbegreiflich.
Viel später erst lernte ich, dass dieser Atlas, der auf einem Regalbrett über meinem Bett stand, auf die Prinzipien des Flamen Gerardus Mercator von 1569 gegründet war. Mercators Übersetzung der sphärischen Form der Erde in eine flache rechteckige Karte hatte zur Folge, dass die Länder nahe der Pole langgezogen und die Länder um den Äquator zusammengeschoben wurden. Heraus kam eine Karte, in der es so aussieht, als würden Europa, Nordamerika und Russland die Welt dominieren. Aber all das wusste ich damals noch nicht.
Hätte ich, wie ich da in meinem Bett lag und in Mercators Atlas blätterte, um die laufende Debatte über Kartenproportionen gewusst, dann hätte ich mir vielleicht stattdessen die neu erschienene Weltkarte besorgt, die eine radikal andere Perspektive bot: «Die wahren Proportionen der Erde» des deutschen Kartografen Arno Peters von 1974. Auf der waren die Ausmaße eines jeden Landes in korrekten Proportionen eingezeichnet.
Als ich dann später schließlich Arno Peters’ Atlas zu sehen bekam, war es, als würde ich eine Welt betrachten, die im Spiegelkabinett unterwegs war. Schweden war kurz und dick, Afrika und Indien dagegen waren langgezogen und schlank. Ich sah das mit gemischten Gefühlen. Es wirkte, als seien die Kontinente nasse Kleider, die in der Arktis auf einen Kleiderhaken gehängt worden waren. Obwohl ich mich von meinem alten Atlas zutiefst betrogen fühlte, konnte ich das neue Weltbild doch nicht richtig akzeptieren. Es blieb nichts anderes übrig, als die Karten beiseitezuschieben und die Welt mit eigenen Augen zu sehen.
Plan A war, im Schlafsaal einer Jugendherberge zu wohnen, Plan B, in einem Schlafsack in einem Park zu übernachten. Nach Hause eingeladen zu werden und auf dem Sofa von jemandem schlafen zu dürfen, war ein erstrebenswertes Upgrade, denn da sparte man schließlich Geld und erlebte noch etwas Besonderes. In einigen Ländern gab es spottbillige Hotels, die konnte man auch nehmen.
Ein großer Unterschied zum Reisen von heute ist, dass damals nur sehr wenig vorherbestimmt war. Noch in den Achtzigerjahren lief man, wenn man an einen neuen Ort kam, erst einmal herum und suchte nach einer Unterkunft. Das war kein notwendiges Übel, sondern machte Sinn und war genauso selbstverständlich, wie man heute zu Hause am Küchentisch sitzt und eine Reise auf Monate hinaus detailliert vorausplant.
Ich war kein Extremreisender, vielmehr reisten damals alle jungen Menschen so. Die Erwachsenen, Etablierten und alle anderen, die eine Reise im Voraus planten, um sich vor Überraschungen zu schützen, das waren die Ausnahmen. Und natürlich all die Reicheleutekinder, die flogen, ins Restaurant gingen und in schicken Hotels wohnten. Ich war nicht neidisch. Als frischgebackener Rucksacktramper hatte ich eine klare Vorstellung, dass ich die Welt nicht so sehen wollte, wie sie sein sollte, sondern wie sie tatsächlich war und wie ich sie deshalb auch erleben wollte. Die Touristen, die sich mit einem Liegestuhl und einem Swimmingpool begnügten und kaum wussten, wo sie gewesen waren, konnten einem leid tun!
Unsere Kritik hatte aber auch etwas Selbstgefälliges. Wir, die selbständig reisten, waren gern mal arrogant und sahen auf alle herab, die Paket- und Gruppenreisen buchten. Wer waren wir, dass wir das Bedürfnis der breiten Allgemeinheit nach einer Weile entspannender Gedankenlosigkeit und Sonne auf der Nase kritisierten?
Manchmal war die Wirklichkeit auch furchteinflößend. Als ich die Aeroflot-Maschine bestieg, die mich über Moskau und Taschkent nach Neu-Delhi bringen sollte, empfand ich zunächst keine Furcht. Gewiss, meine Mutter hatte mir die Zeitungsartikel über Bombenattentate und Guerillaaktivitäten in Punjab und Assam gezeigt, aber diese Gegenden würde ich ja nicht besuchen. Ich war voller Zuversicht. Doch als wir über den Himalaya flogen und ich davon erwachte, dass eine rote Morgensonne in die Kabine schien, kam die Angst.
Jetzt war ich dem furchteinflößenden Morgenland ganz nahe. Nur noch eine Stunde bis dahin. Ich wusste gar nichts. Was sollte ich in Indien tun? Was würde passieren, nachdem ich gelandet war? Wo würde ich wohnen? Mit wem würde ich reden? Wohin würde ich dann reisen? Ich hatte keine Ahnung. Aber vor allem machten mir meine Vorstellungen von Menschengedränge und Armut Angst. Ich sah auf die schachbrettartigen Felder zehntausend Meter unter mir hinunter und stellte mir die Not vor, die da herrschte. Alle Bilder vom Elend und der Misere, die ich jemals gesehen hatte, kehrten jetzt zurück und wurden vor meinem inneren Auge abgespielt. Ich dachte an die mageren Äcker und die fremden Kulturen, die Religionen und die Sprachen, von denen ich nichts wusste – und redete mir ein, dass ich, ein privilegierter Einfamilienhaus-Teenager aus Västerås, ein unerfahrener westlicher Mittelklassespross, das alles niemals würde verstehen können. Doch es gab kein Zurück.
Meine Beine zitterten. Im Magen ein dumpfes Gefühl. Warum war ich nicht zu Hause geblieben? Worauf hatte ich mich eingelassen?
Die Nomaden
Vor sechs Millionen Jahren kletterten unsere Vorväter von den Bäumen herunter. Seitdem hat sich die Menschheit während großer Teile ihrer Geschichte in Bewegung befunden, ist umhergezogen, hat gejagt und gesammelt, hat als Nomaden gelebt. Das Dorf, die Idee von einer festen Siedlung, ist eine neue Erfindung. Es sind erst dreizehntausend Jahre, seit wir aufgehört haben zu wandern und begannen, Getreide anzubauen.
Kein Wunder, dass uns der Mangel an Bewegung ab und zu wie ein Phantomschmerz ereilt und die Sehnsucht nach dem Nomadenleben aufflammen lässt. Die Erinnerung an jenes Leben gibt sich nicht nur in der Wanderlust zu erkennen, sondern auch im Gefühl innerer Ruhe und Geborgenheit, die uns erfüllt, wenn wir uns auf den Rücken eines Reittieres setzen.
November 1996. Durch den Rann von Kachchh und die Thar, die große Wüste an der Grenze zwischen Indien und Pakistan, wandern viele nomadisierende Völker, die auf der Suche nach Wasser und Vegetation ihre Herden über Sanddünen, Salzsteppen und Schotterebenen treiben. Hier in der Wüste, die zwischen der pakistanischen Region Sindh und den indischen Teilstaaten Gujarat und Rajasthan geteilt ist, schaukele ich auf der Suche nach der Nomadenseele des Menschen auf einem Kamelrücken.
Der Monsunregen, der kurz vor meiner Ankunft niedergegangen ist, war der beste seit zwanzig Jahren. Die Hirse wächst fruchtbar, die Akazienbäume schlagen neu aus, in den Sanddünen sprießt Gras.
«Ich hätte nicht gedacht, dass die Wüste so grün sein kann», sage ich zum Kameltreiber, der über meinen Mangel an Wissen nur seufzt und mit den Schultern zuckt.
Unsere Kamele, die Holzwagen mit mächtigen Ballonreifen ziehen, schwanken knarrend über die Sandebene, auf der nur Australischer Babul (eine Akazienart) und kleine stachelige Büsche mit fetten, lilafarbenen Blättern – das Heidekraut der Wüste – die beiden trockenen Jahre überstanden haben. Der fest zusammengepresste Boden ist wie mit Puderzucker von ein paar Zentimetern leichtem Sand bedeckt, der in kleinen Wölkchen aufstiebt, wenn wir die Sandalen absetzen. Der Sand dringt in alle Poren, zwischen den Zähnen knirscht es.
In Birendaria, Misariado, Ludia und den anderen Dörfern in Banni, diesem Teil des Rann von Kachchh, kann niemand seine Nahrung anbauen. Weder Hirse noch Linsen noch Weizen haben eine Chance. Das merke ich, als ich eine Nacht bei den Brüdern Tabha im Dorf Misariado wohne. Sie sind Schuhmacher und Daliten – unberührbare Hindus einer niedrigen Kaste. Die Männer bewegen sich über weite Entfernungen, wenn sie ihre Ziegen weiden, während die Frauen zu Hause sitzen und Decken und mit Spiegelchen verzierte Kleidung in satten Farben besticken, die sie in Regalen in ihren Hütten stapeln und später mit staatlicher Unterstützung auf großen Textilmessen im Land oder auf dem örtlichen Markt in der Stadt Bhuj verkaufen. Die Einkünfte dieser von Mahatma Gandhi inspirierten Dorfindustrie, kadigram udyog, ermöglichen ihnen ein Leben, das zwar sehr verschieden von dem der aufstrebenden Mittelschicht ist, aber dennoch scheinbar keine notwendigen Dinge des Daseins vermissen lässt.
Die Großfamilie Tabha wohnt um einen Hof aus getrocknetem, gesprungenem braunen Lehm, der eine dumpfe Akustik erzeugt: Alle Laute scheinen runde Ecken zu bekommen. Familie Tabha wohnt seit mehreren Generationen hier. Sie haben keinen Strom. Niemand in der ganzen Familie kann lesen oder schreiben. Nach Einbruch der Dunkelheit versammeln sich die Männer ums Feuer, rauchen bidis (kleine, handgerollte Zigaretten) und erzählen Geschichten, während die Frauen in der Küche ausruhen und die Kinder im weißen Schein der Petroleumlampen in den Schlafhütten spielen.
Morgen werde ich den Bus über die weite, flache Salzkruste nach Bhuj hinein nehmen. Dort werde ich ein Flugzeug besteigen, das mich binnen einer Stunde nach Bombay bringt. Am selben Abend werde ich dann im Café Mondegar sitzen und zwischen indischen Mittelschicht-Jugendlichen, die fließend Englisch sprechen und mit Handys ausgestattet sind, kaltes Bier trinken, während die Verlockungen der Großstadt und die Bollywood-Lichtreklamen in der Nacht funkeln. Aber jetzt bin ich noch in der Wüste, am funkenstiebenden Feuer auf dem Hof. Ich bitte meinen Dolmetscher, Fota Tabha, den ältesten der Brüder – «vielleicht ist er sechsundfünfzig Jahre alt, aber keiner weiß es genau» –, zu fragen, ob schon mal jemand aus der Familie von Misariado in die Stadt gezogen ist. Und damit meine ich die staubige Bezirkshauptstadt Bhuj und nicht das Swinging Bombay.
«Nein», sagt er, der in der Hocke sitzt und an seiner eifrig glühenden Zigarette zieht. «Keiner in meiner Generation, keiner in der meiner Eltern und auch keiner in der Generation meiner Großeltern. Nicht soweit ich mich erinnere. In die Stadt ziehen wir nicht.»
Er nimmt einen langen Zug.
«Morgen wandern wir nach Westen und suchen Büsche und Blätter, die unsere Ziegen fressen können, aber zur Dämmerung sind wir wieder zurück ums Feuer.»
Seine Gesichtszüge und seine Art, die Worte auszusprechen, strahlen eine Ruhe aus, die mich ungeheuer neidisch macht.
Dieselbe Wüste, zwei Jahre zuvor, vierhundert Kilometer weiter nördlich.
«Haa, moooaaa!», ruft Vishnaram und bringt die Kamele auf Trab. Die Tiere falten ihre sorgfältig eingezogenen Beine auseinander, heben ihre schlangenähnlichen, fleckigen Hälse zur Sonne und knurren verärgert. Es ist ein dumpfes, gedämpftes Gurgeln von ganz tief unten, als würde der Laut tief unten im Magen festsitzen, ein Märchengeräusch. Endlich ist die Karawane unterwegs.
Wir reiten im mahlenden, schaukelnden Schritt des Passgangs über eine sich unaufhörlich verändernde Wüstenlandschaft. Rote, steinige Schieferebenen. Sandige, trockene Bachläufe. Hellbraun aufgesprungene Erde – das Symbol für Trockenheit und Elend. Zehn Zentimeter hohes Monsun-Wollgras schimmert wie Silber in der flachen Nachmittagssonne. Weiche, geriffelte Sanddünen, mit Flecken von raschelnden Büschen und rollenden Steppenläufern, die sich wie der Wind, die Tiere und die Menschen nach Westen bewegen.
Das Einzige, was man hier hört, ist das Klappern des Kochgeschirrs, das Schwappen in den Wasserkanistern, das Knarren der Ledersättel und daneben die runde, kurzangebundene Unterhaltung der Kamelführer auf Rajasthani. Ich reite zusammen mit Vishnaram, und als er etwas in meinen Nacken murmelt, glaube ich, dass er mit mir spräche. Doch plötzlich antwortet Rupa Ram, der auf dem Kamel zehn Meter vor uns reitet. Die Wüste ist von einer ungeheuren Akustik: Die Laute klingen gedämpft und weich, als hätte man Baumwolle in den Ohren, und gleichzeitig messerscharf. Wie auf der Savanne. Wie auf dem Meer. Wie auf einem schwedischen Fjäll.
Plötzlich, in einer Windbö, hören wir bellende Hunde, wir sehen aber weder Hunde noch Menschen oder ein Dorf. Wir hören das Kling-Klang-Klong von Blechglocken lange, ehe wir der Schafherde begegnen. Und dann die seltsamen Pistolenschüsse, die, wie sich nach einem halbstündigen Ritt über eine Kante, um einen Hügel und durch ein Sandmeer zeigt, von Jungen stammen, die mit scharfem Peitschengeknall die Krähen von den im Monsun gereiften Hirseäckern vertreiben.
Es hat in der Wüste geregnet. Endlich! Rinnsale des lebensnotwendigen, lebenspendenden Wassers sind in den Sand geflossen. Die Dämme haben sich gefüllt. Der Wasserspiegel in den Brunnen hat sich erhöht. Und jetzt: Samen, die viele Jahre im Sand gelegen haben, wachsen und sprießen. Die Wüste grünt.
Der Weg ist von Wanderdünen versperrt. Ein Pfad teilt die Grassteppe. Unsere nachmittagsmüden Kamele schwanken sachte und stur vorwärts. Hinter uns kommen vier Männer auf rennenden Kamelen heran, sie wollen überholen. Sie sitzen rittlings, ohne sich festzuhalten, und sehen unbekümmert und lustvoll aus. Einer von ihnen zündet sich eine Zigarette an und fragt, woher wir kommen, erhält eine Antwort, betrachtet uns prüfend, und plötzlich nehmen sie alle Tempo auf, reiten schnell um uns herum und verschwinden hinter einer Erhebung, als hätten sie ein Gaspedal, das sie durchdrücken können. Wie ein Spiel. Ein Tanz.
Und Jais Almer, die Wüstenfestung, ist vor vielen Stunden schon hinter dem Horizont versunken, sie ist nicht mehr zu sehen. Als wäre sie nur ein Traum oder ein Trugbild von früher gewesen.
Gemächlich in meinem Sattel mit Steigbügeln aus Hanfseil schaukelnd, werde ich durch den größten zusammenhängenden Wüstengürtel der Erde getragen. Hier zogen einst die Handelskarawanen hindurch. Von Delhi durch die Thar bis zu den Märkten in Damaskus, Memphis (das heutige Kairo), Ancyra (Ankara) und Byzantium (Istanbul). Ihre Kamele waren vollgepackt mit Dukaten, gold- und silberverzierten Stoffen und später dann Pfeffer und Kardamom. Mehr als tausend Jahre, ehe Marco Polo, Vasco da Gama und Ferdinand Magellan das Meer in dem Glauben überquerten, neue Handelswege zu öffnen, ritt bereits ein steter Strom interkontinentaler Geschäftsreisender zwischen Asien und Europa hin und her. Die Gewürzstraße nach Indien war verbunden mit der Seidenstraße nach China und dem Straßennetz der Römer in Europa, hunderttausend Kilometer zog sie sich vom chinesischen Shanghai im Osten bis zum spanischen Cádiz im Westen.
Vor fünftausend Jahren begann der Mensch, das Kamel zu domestizieren, nachdem man erkannt hatte, dass die Fähigkeit, Fett als Energiereserve im Höcker zu lagern, es widerstandsfähiger gegen die Trockenheit machte als andere Lastentiere. Die Kamele trotten ruhig weiter ohne zu trinken, wenn der Mensch schon nahe daran ist, zu verdursten. Die Körper der Kamele sind so gut darin, Wasser aus dem Futter zu saugen, dass ihr Urin zähflüssig wird, und ihr Kot so trocken und spröde herauskommt, dass die Beduinen ihn sofort anzünden und als Brennmaterial verwenden können. Gleichzeitig können Kamele unglaubliche Mengen von Wasser in sich hineinschütten, ohne, wie wir Menschen, an Salzmangel zu leiden.
Die Menschen der Eisenzeit in Somalia, Arabien und Baktrien (das heutige Afghanistan, Usbekistan und Tadschikistan), die als Erste Kamele gezähmt haben, erkannten diese einzigartigen Eigenschaften der Tiere natürlich. Und noch heute haben in den Wüstengebieten sowohl die Sesshaften wie auch die Nomaden Nutzen davon. So wie das Volk der Rabari, das jahrtausendelang mit Kamelen durch die indische Wüste gewandert ist und das so heißt wie das, was seine Angehörigen tun – Rabari bedeutet «der, der draußen lebt», und das tun sie auch, wenngleich sie im Laufe der Zeit zu Semi-Nomaden geworden sind. Im Sommer, wenn der Monsunregen kommt und ihren Tieren ausreichend Trinkwasser bringt, sind sie sesshaft, und im Winter, wenn kein Tropfen Regen fällt, wandern sie.
Jedes Jahr kommen sie in der Zeit zwischen dem mageren Sommergrün und dem knochentrockenen Winter mit Hunderttausenden anderer Menschen und Kamele auf dem südlichsten Tiermarkt der Welt am Rande der Stadt Push Kar zusammen, wo eine Woche lang im Schatten sanft gerundeter Höcker ein frenetisches Bieten, Feilschen und Kaufen vonstatten geht.
Ich erreiche dieses Wüstenspektakel in der Morgendämmerung, als die Kamele auf der staubigen Sandebene ihre Augen mit den langen Wimpern aufschlagen, ihre Schlangenhälse zum Himmel strecken und direkt ins Universum hinaus brüllen. Sie klingen, als wäre der Teufel mit Kopfschmerzen aufgewacht: ein dumpfes, furchtsames und gleichzeitig hysterisches Gurgeln. Danach erwacht das erste Megafon. Dann ertönt noch eines und noch eines. Einfachen Blechtrichtern aus mattem Aluminium entströmt indische Popmusik in höchster Lautstärke. Eine Viertelstunde nach Sonnenaufgang ist der ganze Marktplatz ein Inferno aus verschiedenen Lauten, und die Ohren dürfen erst wieder ausruhen, wenn siebzehn Stunden später die Mitternachtsglocke läutet.
Sie sind zu Pferd gekommen, gewandert oder in schrottreifen Bussen über die Weiten der Wüste aus den Dörfern in der Umgebung des Teilstaates Rajasthan gefahren. Viele haben Kamele, Kühe, Stiere, Pferde und Esel dabei, andere kommen, um sich einen Rausch zu genehmigen, auf dem Wanderjahrmarkt Spaß zu haben oder das Getümmel zu betrachten.
Wenn alle Kameltransaktionen des Tages abgeschlossen sind, beginnt das Fest. Das mit einem Mopedmotor betriebene Riesenrad dreht sich und blinkt. Die kleinere, handgewebte Schiffschaukel quietscht und knarrt.
Während der Fest- und Markttage herrschen Frieden und Freude. Doch im restlichen Jahr gibt es häufig Konflikte zwischen sesshaften Bauern und wandernden Nomaden. Ich schaue über den Sandozean hinaus, sehe Kamelsilhouetten vor dem rotlilafarbenen Abendhimmel und denke darüber nach, warum die Halb-Nomaden die sesshaften Bauern so provozieren. Es ist nicht ungefährlich, als Nomade unterwegs zu sein, das wissen nicht nur die wandernden Schäfer in der indischen Wüste. Im Laufe der Geschichte sind Wanderer und Sesshafte immer wieder in Konflikt geraten. Schon im Schöpfungsmythos im Ersten Buch Mose wird im vierten Kapitel beschrieben, wie Eva zwei Söhne zur Welt bringt: Abel, den Schafhirten und Nomaden, und Kain, den sesshaften Bauern.
Der Unterschied ihrer Lebensbedingungen führt zum Streit: «Es begab sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes; und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer; aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebärde verstellte sich.»
Gott hatte also mehr Freude an der Gabe des Nomaden als an der des Bauern. Der Bauer wird daraufhin eifersüchtig und schlägt den Nomaden tot. So geschieht, zumindest nach der Bibel, der erste Mord der Menschheit.
Seitdem haben die wenigen Menschen auf der Erde, die weiterhin als Nomaden leben, die Sesshaften gestört. Aber was ärgert uns denn so an ihnen? Die Nomaden begehren doch nichts anderes als das Recht, zu einer bestimmten Zeit im Jahr ein bestimmtes Gebiet zu durchqueren. Wanderten die Nomaden über den Besitz der Bauern und haben ihn niedergetrampelt? Waren die Bauern vielleicht neidisch auf den beweglichen Lebensstil der Nomaden? Die Problemlösung der Sesshaften bestand darin, die Nomaden entweder in Bauern zu verwandeln oder dafür zu sorgen, dass man sie nicht sehen musste. Wie es der polnisch-jüdisch-britische Soziologe Zygmunt Baumann ausdrückte: «Unnötig, unerwünscht, alleingelassen – wo ist ihr Platz? Die kürzeste Antwort lautet: außer Sichtweite.»
Was dem einen Sicherheit bedeutet, stellt für den anderen eine Bedrohung dar. Denn gleichzeitig empören sich die Nomaden über die Vorstellung der Sesshaften, dass man Erde besitzen könne. Für einen Nomaden bedeuten politische Grenzen und die Idee des Grundeigentums eine Form von Wahnsinn.
Die Epizentren des Nomadenlebens auf der Welt waren schon lange vor den Tagen des Alten Testamentes die Savannen in Ostafrika, die Steppen in Zentralasien und die Wüsten in Nordafrika, dem Nahen Osten, China und Indien. Skythen, Hunnen, Kimmerer, Turkmenen und Mongolen; Tuaregs, Massai, Beduinen – und Rabari. Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen – und Kamele. Zelte, Jurten und Windfänger. Flaches Brot ohne Hefe, das «ungesäuerte Brot», das in der Bibel erwähnt wird, weil man schnell weiterwandern würde und das Aufgehen der Hefe nicht abwarten konnte, und das Geschichtenerzählen am Feuer unter dem Sternenhimmel, weil die Dunkelheit jede andere Aktivität unmöglich machte.
Seit wir sesshaft geworden sind, betrachten wir die Angehörigen der Minderheiten, die weitergewandert sind, als suspekte Figuren. Die Geschichte von dem in Europa am meisten verachteten Volk beginnt vor tausend Jahren, als der Kriegskönig Mahmud seine stattliche Burg Ghazni im heutigen Afghanistan verlässt. Mahmud reitet nach Südosten und greift die hinduistischen Königreiche Meerut, Mathura und Gwalior auf der nordindischen Ebene und Somnath am Ufer des Indischen Ozeans an. Er unterwirft die lokalen hinduistischen und buddhistischen Herrscher und macht sie zu Vasallen, er zwingt die Einheimischen in seine Armee, nötigt ihnen eine neue Religion auf und plündert ihre Tempel.
In Indien erzählt man heute noch in den Schulen von dem schrecklichen Muslim Mahmud, der einen Hammer nahm und das vergoldete Lingam des Tempels Somnath, das Symbol für die Kraft des hinduistischen Gottes, zerschlug. Die Reste davon schaffte er nach Hause nach Ghazni, wo sie zum Bau der neuen Freitagsmoschee benutzt wurden.
Doch eine Gruppe Inder in der mittelalterlichen Wüsten- und Ackerbaulandschaft verweigerte die Unterwerfung und begann stattdessen zu wandern. Vermutlich gehörten die Wanderer der Kriegerkaste Kshatriya an, die in ihren örtlichen Gesellschaften respektiert und stolzer sowie weniger geneigt waren, sich anzupassen als ihre Landsleute. Vielleicht haben sie sich deshalb entschieden, nach Westen zu fliehen, um den neuen muslimischen Herrschern zu entkommen.
Viele hundert Jahre wanderten ihre Nachkommen nach Westen. Sonnengetränkte Wüsten wichen raschelnden Mais- und Weizenfeldern. Auf den Wanderungen und in den Zeltburgen begegneten sie anderen Nomaden, die nach Westen gewandert waren. Einige von ihnen waren vor Krieg geflohen, während wieder andere der Armut und Unterdrückung durch das Kastensystem entkommen wollten. Sie waren wandernde Gesellschaften, die verschiedene Dialekte aus unterschiedlichen Sanskritsprachen wie Hindi, Punjabi und Rajasthani benutzten. Sie verstanden einander und wurden allmählich in ihren neuen Lebensumgebungen als eine einheitliche Volksgruppe betrachtet.
Einige von ihnen landeten in Ägypten und dann auch in Andalusien und auf Kreta (dort wird ihre Ankunft 1322 erwähnt). Andere – vermutlich die meisten – kamen nach Anatolien, wo die Männer bei den örtlichen armenischen Fürsten Arbeit fanden.
Irgendwann zogen sie weiter nach Westen und verdingten sich als Soldaten, Schmiede, Handwerker und Musiker, die eine wehmütige und heulende Flöten- und Saitenmusik mit Wurzeln in der indischen Wüste spielten. Doch mit den Jahren wurden Turbane gegen Filzhüte getauscht, Sari gegen Kleider und Saiteninstrumente wie die Kamaicha und Raavan hatha gegen Gitarre und Geige. Doch der Kalbelia-Tanz, der seine Wurzeln in der Wüste von Rajasthan hat, lebte auch auf der Fahrt nach Westen weiter – das Klatschen mit den Händen, die winkenden Bewegungen mit hochgehaltenen Händen und die zuckenden und rotierenden Bewegungen mit dem Oberkörper.
In Rumänien war ihr unsteter Lebenswandel verdächtig, man hatte sich aber von ihrer handwerklichen Geschicklichkeit abhängig gemacht. Deshalb begann man im 14. Jahrhundert, die Wanderer aus dem Osten einzufangen und sie zu zwingen, wie Sklaven unter Feudalherren und Klöstern zu leben. Doch für die, welche immer noch frei waren, ging die Flucht weiter nach Westen und nach Norden. Im Protokoll eines Stockholmer Ratsbeschlusses von 1512 wird eine Gruppe Fremder beschrieben, die am Sankt Michaelstag, dem 29. September, in die Stadt gekommen war. Es waren nicht viele, nicht mehr als dreißig Familien, sie bedienten sich einer Sprache, die noch niemand je zuvor gehört hatte, und man vermutete, dass es sich um Pilger handele. Religiöse Wanderer mussten mit Respekt empfangen werden, sie sollten Almosen bekommen und eine Herberge. Das gebot die Sitte. Zu wandern, um sich Gott zu nähern, war legitim, während das Wandern aufgrund von Arbeitsmangel oder Armut suspekt erschien.
Sie bekamen eine Herberge in der Sankt Laurentii-Stube, und der Stadtrat schenkte ihnen zwanzig Mark. Der schwedische Reformator und Theologe Olaus Petri schreibt in seiner «Swensk Cröneka»: «Im selben Jahr, in dem Herr Sten [Sture der Jüngere] Hauptmann geworden, kam eine Ansammlung von dem Volk, das von dem einen Land zum nächsten fährt, und die man Tattare nennt, hierher ins Land und nach Stockholm; zuvor waren sie nie hier gewesen.»
Aus der Gastfreundschaft wurde jedoch schnell Feindseligkeit. Schon 1515 wurden sie aus der Stadt vertrieben. Im Ratsprotokoll von Stockholm steht, dass «die Tattare nirgends innerhalb der Stadtmauern bleiben und stören dürfen, und dies wegen ihrer Schurkenhaftigkeit». Damals war die Eroberung des christlichen Konstantinopel durch die muslimischen Türken gerade erst sechzig Jahre her. Deshalb war die Angst, dass der Islam sich ausbreiten könnte, sehr groß. Gustav Vasa beschuldigte dann die Nomaden, türkische Spione zu sein, und erließ den Befehl, dass alle Männer aus dieser wandernden Volksgruppe getötet werden sollten.
Zunächst hatte man geglaubt, dass es sich um Ägypter handeln würde, doch schon bald vermutete man, dass sie zu den Tataren gehören würden, einem türkischen Volk, das an verschiedenen Orten in Russland und Zentralasien lebte. Deshalb wurden sie in Schweden «Tattare» genannt.
Die Nomaden aus Indien tauchten an verschiedenen Orten in Europa auf und wurden entweder vertrieben, weil sie ständig in Bewegung waren und deshalb als bedrohlich betrachtet wurden, oder angelockt, weil sie so geschickte Metallschmiede und Schnitzer waren. Doch meist ging es nicht gut aus. Es war, als wären sie ein für alle Mal aus der Gemeinschaft der Sesshaften hinausgewandert. Diese nannten sie auf Spanisch, Französisch und Englisch weiterhin Ägypter (gitanos, gitanes, gypsies), während man auf Griechisch, Italienisch, Deutsch und Schwedisch ein anderes Wort benutzte, nämlich zingani, zingari, Zigeuner, zigenare von dem griechischen Wort atsinganos, was so viel bedeutet wie «der keinen Kontakt mit jemandem haben will».