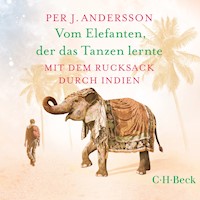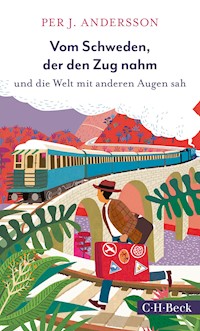Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr um dort seine große Liebe wiederzufinden E-Book
Per J. Andersson
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Alles, was man zum Glück braucht, ist Vertrauen und ein Fahrrad 1975 lernt Pikay in Neu-Delhi durch Zufall die junge Schwedin Lotta kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Als Lotta zurück nach Schweden geht, setzt sich Pikay kurz entschlossen auf ein altes Fahrrad und fährt ihr hinterher … Diese Geschichte erzählt vom unglaublichen Schicksal des kastenlosen Pradyumma Kumar, genannt Pikay. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, kennt er nur Extreme: Mal wird der talentierte Porträtzeichner von Indira Gandhi eingeladen, sie zu malen, mal muss er hungern und schläft auf der Straße. Eines Abends taucht neben seiner Staffelei ein blondes Mädchen auf – und eine unglaubliche Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang. Als Lotta zurück nach Schweden geht, stehen die Chancen schlecht für die beiden – wäre da nicht ein altes Fahrrad. Damit macht sich Pikay auf den Weg, um die 7.000 km von Asien nach Europa zurückzulegen. Auch zahlreiche Rückschläge können ihn nicht aufhalten, bis er schließlich tatsächlich in der Heimat Lottas ankommt, einer völlig anderen Welt … Um das Happy End gleich zu verraten: Heute sind die beiden seit über 35 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und leben auf einem alten Bauernhof in der Nähe von Borås. »Pikays Lebensgeschichte ist ein großartiger Pageturner.« Svenska Dagbladet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Ähnliche
Per J. Andersson
Vom Inder, der auf dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr um dort seine große Liebe wiederzufinden
Eine wahre Geschichte
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Per J. Andersson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Per J. Andersson
Per J. Andersson ist Journalist und Schriftsteller mit Schwerpunkt Indien. Er ist Mitbegründer von Schwedens bekanntestem Reisemagazin Vagabond und ist in den letzten 30 Jahren mindestens einmal jährlich nach Indien gereist.
Susanne Dahmann war nach dem Studium der Skandinavistik, Geschichte und Philosophie in Vertrieb und Lektorat eines Sachbuchverlags tätig. Seit 1993 arbeitet sie als freie Übersetzerin in Marbach am Neckar.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Alles, was man zum Glück braucht, ist Vertrauen und ein Fahrrad
1975 lernt Pikay in Neu-Delhi durch Zufall die junge Schwedin Lotta kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Als Lotta zurück nach Schweden geht, setzt sich Pikay kurz entschlossen auf ein altes Fahrrad und fährt ihr hinterher … Diese Geschichte erzählt vom unglaublichen Schicksal des kastenlosen Pradyumma Kumar, genannt Pikay. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, kennt er nur Extreme: Mal wird der talentierte Porträtzeichner von Indira Gandhi eingeladen, sie zu malen, mal muss er hungern und schläft auf der Straße. Eines Abends taucht neben seiner Staffelei ein blondes Mädchen auf – und eine unglaubliche Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang. Als Lotta zurück nach Schweden geht, stehen die Chancen schlecht für die beiden – wäre da nicht ein altes Fahrrad. Damit macht sich Pikay auf den Weg, um die 7.000 km von Asien nach Europa zurückzulegen. Auch zahlreiche Rückschläge können ihn nicht aufhalten, bis er schließlich tatsächlich in der Heimat Lottas ankommt, einer völlig anderen Welt … Um das Happy End gleich zu verraten: Heute sind die beiden seit über 35 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und leben auf einem alten Bauernhof in der Nähe von Borås.
»Pikays Lebensgeschichte ist ein großartiger Pageturner.« Svenska Dagbladet
Inhaltsverzeichnis
Karte
Die Prophezeiung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Die Verwandlung
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Neu-Delhi – Panipat – Kurukshetra – Ludhiana – Amritsar
Amritsar – Kabul (fast) – Amritsar (wieder) – Kabul (endlich)
Kabul – Sheykhabad – Ghazni – Daman – Kandahar
Kandahar
Kandahar
Dilaram – Herat – Islam Qala
Islam Qala – Taybad – Farhadgerd – Maschad – Boynurd – Azadshahr – Sari
Sari – Amol – Teheran
Teheran – Qasvin
Qasvin – Zanjan – Täbris
Täbris – Marand – Dogubayazit – Erzerum – Ankara – Istanbul
Istanbul – Wien
Wien – Passau
Passau – München – Hamburg – Puttgarden – Rödby – Kopenhagen
Helsingborg – Göteborg – Borås
Kapitel 39
Die Heimkehr
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Nachwort
Bildteil
Bildnachweis
Die Prophezeiung
Seit dem Tag, an dem ich in einem Dorf im Dschungel geboren wurde, ist mein Leben vorbestimmt.
Es war Winter und kurz vor dem Neujahrstag der Engländer, der immer noch gefeiert wurde, obwohl sie zwei Jahre zuvor abgezogen waren. Normalerweise regnete es nicht um diese Jahreszeit, doch in jenem Jahr hatte sich der Nordostmonsun länger über den Küsten von Orissa aufgehalten. Aber schließlich hatte es doch aufgehört zu regnen, auch wenn die dunklen Wolken immer noch die bewaldeten Hügel rechts und links des Flusses verbargen, sodass man meinte, es beginne schon zu dämmern, obwohl erst Vormittag war.
Doch dann brach die Sonne hervor und überstrahlte das Dunkel.
In einem Korb in einer der Hütten des kleinen Dorfes lag ich, die Hauptperson dieser Geschichte, immer noch namenlos. Ich war gerade erst geboren, und meine Familie stand um mich versammelt und betrachtete mich neugierig. Der Astrologe des Dorfes war auch zur Stelle und musterte mich, der ich im Zeichen des Steinbocks und am selben Tag wie der Prophet der Christen geboren war.
»Da«, sagte einer meiner Brüder, »seht ihr?«
»Was?«
»Da, über dem Baby!«
Alle sahen den Regenbogen, der sich in den vom Fensterloch einfallenden Lichtstrahlen zeigte.
Der Astrologe wusste, was das bedeutete.
»Wenn er groß ist, wird er mit Farbe und Form arbeiten.«
Schon bald breitete sich ein Gerücht im Dorf aus. Ein Regenbogenkind, sagte einer. Eine große Seele, ein Mahatma ist geboren, sagte ein anderer.
Ungefähr eine Woche später verirrte sich eine Kobra in die Hütte. Sie erhob sich über dem Korb, in dem ich, arglos ob der Gefahr, lag und schlief, und spannte ihre muskulösen Halsschilde auf. Als meine Mutter die Schlange erblickte, glaubte sie zunächst, sie hätte zugebissen, und ich sei schon tot. Während die Schlange aus der Hütte kroch, lief sie zum Korb und entdeckte, dass ich lebte. Ich lag still da, betrachtete meine Finger und schaute mit meinen dunklen Augen ins Nichts. Ein Wunder!
Die Schlangenbeschwörer im Dorf erklärten, die Kobra sei in die Hütte gekommen und habe ihre Halsschilde aufgespannt, um mich vor dem Regen zu schützen, der direkt über meinem Korb durch ein Loch in der Decke fiel. Es hatte in den letzten Tagen stark geregnet, und das Wasser war durch das Dach der Hütte gedrungen. Die Kobra ist göttlich, und das schützende Verhalten der Schlange war ein Zeichen Gottes an die Menschen. Der Astrologe nickte zustimmend, als die Schlangenbeschwörer mit ihrer Darlegung fertig waren. So ist es, bestätigte er. Da gab es nichts zu deuten.
Ich war kein gewöhnliches Baby.
Danach war wieder der Astrologe an der Reihe. Seine Aufgabe war es, aufzuschreiben, was in meinem Leben geschehen würde. Mit einem angespitzten Holzstift ritzte er in ein Palmblatt: »Er wird sich mit einem Mädchen verheiraten, das nicht aus dem Stamm, nicht aus dem Dorf, nicht aus dem Bezirk, nicht aus der Provinz, nicht aus dem Bundesland und auch nicht aus unserem Land stammt.«
»Du musst nicht nach ihr forschen, sie wird dich aufsuchen«, sagte der Astrologe und sah mir geradewegs in die Augen.
Mama und Papa konnten erst nicht sehen, was der Astrologe in das Blatt geritzt hatte. Erst mussten sie die Flamme einer Öllampe unter einen mit Butter eingeriebenen Messingständer halten und den Ruß, der sich bildete, in die Kerben des dicken, porösen Blattes fallen lassen. Da trat der Text deutlich hervor. Jetzt musste der Astrologe nichts mehr vortragen, denn sie konnten selbst lesen: »Deine zukünftige Ehefrau wird musikalisch sein, einen Dschungel besitzen und im Zeichen des Stiers geboren sein«, stand dort in runden, kringeligen Oriya-Buchstaben.
Seit jenem Tag, an dem ich anfing zu verstehen, wovon die Erwachsenen redeten, gehören das Palmblatt mit der Prophezeiung und die Erzählung von dem Regenbogen und der Kobra zu meinem Leben. Alle waren überzeugt davon, dass meine Zukunft schon festgelegt sei.
Ich bin nicht der Einzige, der eine Prophezeiung erhalten hat. In den Sternen steht die Zukunft eines jeden Kindes von der Stunde an, in der es geboren wird, geschrieben. Meine Eltern glaubten das, ich glaubte es, als ich aufwuchs, und in mancher Hinsicht glaube ich es bis heute.
Sein ganzer Name lautet Jagat Ananda Pradyumna Kumar Mahanandia.
In diesem Namen ist viel Freude. Jagat Ananda bedeutet allgemeine Freude, und Mahanandia heißt große Freude. Und eigentlich stimmt es nicht, dass dies sein ganzer Name ist. Der ist noch länger. Wenn man alle Namen zusammenzählt, die er von den Großeltern beider Seiten, von der Stammesgruppe und der Kaste erhalten hat, dann ergibt das einen langen Rattenschwanz von Namen, der insgesamt 373 Buchstaben enthält.
Aber wer kann sich schon 373 Buchstaben merken? Der Einfachheit halber begnügten sich seine Freunde mit zweien der Buchstaben. Die Initialen P (für Pradyumna) und K (für Kumar). Ganz einfach: PK. Oder Pikay, da man die englische Aussprache verwendete.
Doch seine Familie rief keinen dieser Namen, wenn sie das kleine Kind sahen, das so schnell über die Dorfwege lief und so hoch in die Mangobäume kletterte. Der Vater nannte ihn »Poa«, was Junge heißt, die Großeltern sagten immer »Nati« – das Enkel- kind –, und seine Mutter rief ihn »Suna Poa«, Goldjunge, weil seine Haut heller war als die seiner Geschwister.
Seine erste eigene Erinnerung an das Dorf am Fluss und am Rand des Dschungels stammt aus der Zeit, als er drei Jahre alt war. Vielleicht war er auch schon vier. Oder erst zwei. Das mit dem Alter wurde als nicht so wichtig betrachtet. Man scherte sich nicht um Geburtstage. Wer einen Dorfbewohner fragte, wie alt er war, der bekam eine unklare Antwort. Man war ungefähr zehn, um die vierzig, bald siebzig oder ganz einfach jung, mitten im Leben oder sehr alt.
Pikay erinnert sich jedenfalls dunkel, wie er in einem Haus mit dicken Wänden aus hellbraunem Lehm und unter einem Dach aus gelbem Gras stand. Später dann werden die Bilder klarer. Ringsherum lagen die Maisfelder mit ihrem staubigen Kraut, das in der Abendbrise raschelte, und den Gruppen von Bäumen, die dicke Blätter hatten, im Winter schön blühten und im Frühjahr süße Früchte trugen. Und dann war da der kleine Fluss, der in einen großen Strom mündete. Auf der anderen Seite des Flusses erhob sich eine Wand aus Blättern und Ästen. Da begann der Dschungel. Aus dem hörte man manchmal einen wilden Elefanten einen Trompetenstoß abgeben oder einen Panther oder einen Tiger knurren. Noch häufiger sah man die Spuren von wilden Tieren, Elefantenkot und den Abdruck einer Tigerpranke, und man hörte sirrende Insekten und singende Vögel.
Die Waldlichtung war Pikays Horizont, aber seine Welt erstreckte sich über den Horizont hinaus in den Wald hinein. Dort war die Welt zu Ende. Das Dorf und der Wald. Etwas anderes gab es nicht. Der Wald war unendlich, mystisch, geheimnisvoll und gleichzeitig bekannt und vertraut. Er war gleichermaßen ein Abenteuer wie eine Selbstverständlichkeit. Von der Stadt hatte er bis dahin nur reden hören, sie aber nie gesehen.
Im Haus wohnten außer ihm selbst seine Mutter, sein Vater und zwei ältere Brüder. Und dann natürlich die Großeltern väterlicherseits. So verhielt es sich in fast allen Familien. Gemäß der Tradition lebte der älteste Sohn weiter im Hause seiner Eltern, auch wenn er geheiratet und eine eigene Familie gegründet hatte. Shridhar, sein Vater, hielt sich an diese Tradition.
Doch er sah Shridhar nicht oft. Der Vater arbeitete als Postmeister in Athmallik, dem nächsten größeren Ort mit Basar, Teestuben, Polizeistation und Gefängnis. Weil es zu weit war, jeden Tag die zwanzig Kilometer hin und zurück mit dem Fahrrad zurückzulegen, hatte sein Vater sich im Postamt ein Zimmer eingerichtet. Dort schlief er unter der Woche. Doch jeden Samstagabend fuhr der Vater zusammen mit Pikays zwei älteren Brüdern, die in Athmallik die Internatsschule besuchten, mit dem Fahrrad nach Hause zur Familie.
Es fühlte sich an, als wäre er ein Einzelkind. Von seiner Mutter erhielt er viel Aufmerksamkeit. An den meisten Tagen in der Woche waren schließlich nur sie beide und die Großeltern in dem Haus am Waldrand.
Das Dorf sonnte sich auf seiner Lichtung im Wald, der so dicht war, dass das Licht dort kaum bis zum Boden vordrang. Die meisten Häuser sahen gleich aus: runde und eckige Hütten aus braunem getrocknetem Lehm mit grauen Palmblattdächern und Bambuseinzäunungen für Kühe und Ziegen. Neben den Einzäunungen gab es Gemüsegärten und Heuhaufen für die Tiere. Außer den Lehmhütten gab es in dem Dorf noch ein paar von den Briten aus Barmherzigkeit für die Unberührbaren errichtete Ziegelsteinhäuser. Doch die Häuser waren, noch ehe überhaupt jemand hatte einziehen können, im Monsunregen verrottet und standen jetzt verlassen und mit eingefallenen Dächern herum. Und dann hatte das Dorf noch eine Grundschule und ein Haus, das vom Dorfrat für Versammlungen genutzt wurde.
Pikays Mutter pflegte zu sagen, sie wohnten in Indiens größtem Wald und Kondpoda sei das älteste Dorf im Wald. Das Dorf, sagte sie, war sowohl für die Lebenden als auch für die Toten ein Zuhause. Unten am Fluss gab es eine Senke im Sand, die als Kremierungsplatz genutzt wurde. Sie sagte, um Mitternacht würden sich dort die Seelen der Toten versammeln und singen und tanzen. Im Fluss war ein Strudel, in dem ein paar Jahre zuvor zwei frisch verheiratete und schwangere Frauen ertrunken waren. Sie hatte die Leichname am Strand liegen sehen mit stark leuchtenden roten Punkten auf der Stirn und meinte, der Grund dafür, dass die Punkte so schön leuchteten, wäre gewesen, dass die Frauen so reine, unantastbare und keusche Leben geführt hätten. Ihre Augen waren weit offen, als würden sie immer noch nach etwas suchen. Ihre Münder waren auch weit offen, als hätten sie bis zum Schluss um Hilfe gerufen. In Wirklichkeit war es aber so, sagte sie, dass die toten Frauen die Münder weit geöffnet hatten, weil ihre Seelen sie durch den Mund verlassen und vergessen hatten, die Tür hinter sich zu schließen.
Abends, wenn sie neben ihrem Sohn auf der Strohmatte lag, erzählte sie ihm von den Seelen der toten Menschen, von Göttern, Göttinnen und schwarzer Magie. Mit ihren Arm- und Fußringen machte sie rasselnde, gespenstische Geräusche. Pikay schauderte es, mit klopfendem Herzen hielt er den Atem an. Er lauschte: In der Dunkelheit kamen die Geister keuchend und stöhnend näher. Doch dann spürte er den warmen Körper seiner Mutter. Wenn ihr klar wurde, dass sie ihren Sohn erschreckt hatte, umarmte sie ihn tröstend. Vom Glück des nachmittäglichen Spielens im Wald über die Angst im Tal der Toten bis hin zu Mamas beschützendem Arm. Mit diesem Gefühl schlief er ein.
Kalabati selbst hatte keine Angst vor den Toten. Sie glaubte, dass übelwollende Geisterwesen durch ein gesundes Selbstvertrauen auf Abstand gehalten werden konnten. Und das besaß sie. Nur wer an sich selbst zweifelt, ist angreifbar für die Macht der Toten.
»Solange ich mutig bin, kann mir niemand schaden, nicht einmal die Toten«, sagte sie.
Bevor Pikay in die Schule kam, wusste er nicht, was eine Kaste ist. Niemand hatte ihm erzählt, dass die Menschen in vier Kasten und Tausende Unterkasten eingeteilt werden. Er wusste nichts von der viele Tausend Jahre alten Liedsammlung, in der die Entstehung der vier Kasten beschrieben wird. Er hatte keine Ahnung von dem mystischen Urmenschen Purusha, der in vier Teile geteilt wurde. Davon, dass die Brahmanen, also die Priester, aus dem Mund von Purusha gemacht worden waren. Und dass die Kshatriyas, die Krieger, aus den Armen, die Vaishyas, die Kaufleute, Handwerker und Bauern aus den Oberschenkeln und die Shudras, die Arbeiter und Tagelöhner, aus den Füßen entstanden waren.
Ebenso wenig hatte er von den hochgewachsenen und hellhäutigen Indoariern gehört, dem Steppenvolk, das vor 3500 Jahren aus Zentralasien angeritten kam, dem Waldvolk auf der indischen Halbinsel Ackerbau beibrachte, sich selbst zu Priestern, Soldaten und Verwaltern machte und sich in die obersten Kasten einordnete. Oder von dem dunkelhäutigen Waldvolk, der Urbevölkerung, die in den untersten Gruppen landete und zu Bauern, Handwerkern und Bediensteten wurde, so wie die Familie von Pikays Vater, oder von den Jägern, die im Wald blieben und das Stammesvolk genannt wurden, wie die Verwandten auf der Seite seiner Mutter.
Als Pikay erwachsen wurde, fand er immer, dass sich das Kastensystem eigentlich kaum vom europäischen Feudalsystem und der Standesgesellschaft unterschied.
»Nicht sonderlich schwer zu verstehen«, pflegte er zu sagen, wenn die Leute aus dem Westen klagten, dass sie das Kastensystem nicht verstünden.
»Okay, ein bisschen komplizierter vielleicht«, gab er dann manchmal doch zu.
Und dann erzählte er ihnen, wie man in eine Gruppe geboren wird, die Jati (»geboren werden«) genannt wird und wie eine Zunft fungiert. Alle Jati sind Untergruppen zu den vier Hauptgruppen, den vier Varna – einem Sanskritwort, das »Farbe« bedeutet. Die vier Varna sind dasselbe wie die vier Hauptkasten, die in den alten hinduistischen Büchern beschrieben sind.
»Es gibt also nur vier Varna, aber Millionen Jati«, erzählte Pikay.
»Millionen Jati? Wie in aller Welt haltet ihr die denn auseinander?«, fragten dann seine Freunde aus dem Westen, und wenn Pikay antwortete, dass sie das gar nicht könnten, kein Inder könne das, ließen sie das Gesprächsthema immer fallen und redeten von etwas anderem.
Darauf, dass seine eigene Familie zu keiner der vier Varna gehörte, sondern als die »Kastenlosen«, »Unberührbaren« oder »Dalit« klassifiziert war, ging er nur ein, wenn jemand insistierte. Das war schließlich nichts, worauf er wirklich stolz war. Doch Pikays Leben wäre niemals so verlaufen, wenn er nicht zu den Unberührbaren gehört hätte.
Der Vater der Nation, Mahatma Gandhi, wollte den Status der Dalits anheben und nannte sie deshalb »Kinder Gottes«. Pikay fand, das sei eine schöne Formulierung. Gandhi wollte nur das Beste, ihnen einen schönen Namen geben, der ihre Situation erleichtern sollte. Seit Indien von den Briten frei war, klassifizierten die Behörden sie als »scheduled castes« und gewährten ihnen ermäßigte Zugtickets und bestimmte Quoten, damit sie leichter in die Universitäten kommen und in politische Organisationen gewählt werden konnten. Das waren wohlmeinende Anstöße, die den niedrigen Status der Kastenlosen verbessern sollten.
Im Grunde waren alle Voraussetzungen, die ein Ende der Diskriminierung hätte bedeuten können, in Form von Gesetzen geschaffen worden, die dem Unrecht entgegenwirken sollten. Doch ein Gesetz nutzt nur dann etwas, wenn auch danach gelebt wird. Tief in den Köpfen der Menschen saßen die uralten Vorurteile und Werte so fest wie die Teile des Urgebirges.
Die Veränderung musste von innen kommen, aus den Herzen der Menschen, das hat Pikay gelernt.
Seit ihrem zwölften Lebensjahr wollte Lotta nach Indien. Sie erinnert sich noch gut daran: In der siebten Klasse wurde ein Film über den Ganges gezeigt. Der Filmprojektor surrte, und die Sonne ging über dem Fluss auf. Sie erinnert sich an die Sitarmusik, die aus den Lautsprechern schnarrte, an die Glocken, die von einem Tempel her klangen, und an die Pilger, die von den Treppen in den Fluss stiegen, bis ihnen das Wasser bis zur Taille reichte.
Lotta dachte oft daran, dass dieser Schwarz-Weiß-Film ihr erster Kontakt mit Indien gewesen war.
Der Film über den Ganges berührte sie mehr als alles andere, was sie in der Schule erlebte. Nachdem sie den Film gesehen hatten, schrieben alle einen Aufsatz über ihre Eindrücke. Sie schrieb einen langen und gefühlvollen Text.
Eines Tages werde ich dorthin reisen, dachte Lotta.
Sie wollte Archäologin werden. Sie liebte es, in der Erde zu graben und nach Dingen zu suchen. Sie träumte von sensationellen Funden und davon, wie sie das Knäuel der Geschichte zu glatten Fäden entwirren würde. In der Schule fertigte sie aus eigenem Antrieb ein großes Bild von den Pyramiden Ägyptens an und las über den britischen Archäologen Howard Carter, der das Grab des Tutanchamun entdeckt hatte. Der Fluch, der Carter traf, faszinierte sie. Es kitzelte ihr im Bauch, wenn sie las, wie einundzwanzig der Mitarbeiter, die bei den Ausgrabungen dabei gewesen waren, auf seltsame Weise gestorben waren. Solche Mysterien wollte Lotta erforschen.
Als Jugendliche ging sie in die Bibliothek, um Bücher über Ufos auszuleihen, und sie reiste nach Göteborg, um Vorträge über das Leben auf anderen Planeten im Weltall zu hören. Sie abonnierte eine Ufo-Zeitung, von der sie jede Ausgabe von vorne bis hinten durchlas, fest davon überzeugt, dass die Erdenbewohner im Universum nicht allein waren.
Gleichzeitig träumte sie von dem Leben, wie es früher gelebt worden war. Sie stellte sich vor, sie wäre im 16. Jahrhundert geboren und ihre Familie würde in einer Hütte im Wald leben. Das Leben ohne Bequemlichkeiten und technische Geräte. Alles war reduziert, einfach, naturnah.
Seine Mutter war die Einzige, die verstand, wer der kleine Pikay eigentlich war. Sie hieß Kalabati, hatte dunkelblaue Strichtätowierungen im Gesicht, ein Goldherz in der Nase und Goldmonde in den Ohren. Das Einzige, was es heute noch von ihr gibt, ist ein Messingkerzenleuchter in Form eines Elefanten. Das war ihr Lieblingsleuchter. Wenn Pikay den Leuchter betrachtet, wie er jetzt auf dem Kaminsims in dem gelben Haus im Wald steht, dann denkt er an sie.
Im Dorf war es traditionell ihre Aufgabe, anlässlich der jährlichen Feste magische Figuren auf die Hauswände zu malen. Sie hatte den künstlerischen Blick und eine geschickte Hand bei der Malerei. Ihre Künste wurden von allen im Dorf angefragt, sogar von den Brahmanen. Wenn ein Fest bevorstand, stand sie früh auf, bestrich die braunen Lehmwände der Hütte mit Kuhdung und fing an, sie zu dekorieren. Wenn sie mit dem Haus der Familie fertig war, machte sie beim Nachbarn weiter. Am Tag bevor das Fest begann, ging sie zwischen Morgen- und Abenddämmerung von Haus zu Haus und malte Menschen mit schmalen Beinen und Armen, Schlingpflanzen und Blumen mit schlanken Blättern. Die weiße Farbe, die sie auf die terrakottaroten Lehmwände malte, hatte sie aus Reismehl und Wasser selbst hergestellt. Im ersten blassgelben Morgenlicht am Tag des Festes sah man auf allen Dorfhütten schöne Muster. Alles war Kalabatis Werk.
Pikay schaute zu, wenn seine Mutter die Wände bemalte, und fragte sich oft, warum sie niemals auf Papier malte.
Kalabati war im Stamm der Kutia Kondh geboren.
»Unser Stammesvolk, das sind die Nachfahren der dunklen Waldmenschen, die so lange man denken kann hier gewohnt haben, ja, seit Tausenden von Jahren, ehe das Steppenvolk herkam und den Wald abholzte und anfing, Weizen und Reis anzubauen«, erzählte sie Pikay.
»Mit dem Steppenvolk, den Bauern, kamen Krieg und Krankheiten. Das Steppenvolk war es, das die Menschen einteilte in solche, die mehr, und solche, die weniger wert sind. Ehe die Steppenhindus kamen, unterschieden wir nicht zwischen einem Volk und einem anderen. Zu der Zeit war kein Mensch, der in den großen Wäldern wohnte, vornehmer als ein anderer.«
Die Mutter war der einzige Mensch, den er richtig kannte. Der Rest der Familie war ihm mehr oder weniger fremd. Wenn sein Vater und seine Brüder am Samstagabend mit den Fahrrädern aus der Stadt angefahren kamen, um ihren freien Sonntag zu Hause im Dorf zu verbringen, hatte er ein komisches Gefühl im Bauch. Wenn der Vater das Fahrrad an die Hauswand stellte und ihn hochhob, bekam er Angst und fing an zu weinen.
»Weine doch nicht, sieh nur, dein Papa kommt mit Süßigkeiten für dich«, versuchte Kalabati ihn zu trösten.
Dann verstummte er, biss die Zähne zusammen, nahm schluchzend ein zuckerknisterndes Burfi, ein luftiges und feuchtes Gulab jamun oder einen zähen englischen Karamell aus der Hand des Vaters und kroch seiner Mutter auf den Schoß.
Jeden Morgen badete Kalabati ihn im Kondpoda-Fluss. Manchmal gingen sie auch zum großen Strom hinunter, wo es nach den Wildblumen duftete, die am Ufer wuchsen, und nach den runden Fladen aus Kuhdung, die auf der sonnenbeschienenen Böschung zum Wasser hinunter zum Trocknen lagen. Die Mutter ermahnte ihn, vorsichtig zu sein und nicht zu weit raus zu schwimmen, trocknete seinen Rücken mit einem Zipfel ihres Sari ab und rieb ihn mit Kokosöl ein, sodass er im Sonnenschein glänzte. Dann kletterte Pikay auf einen Stein, der von dem rauschenden Wasser glatt geschliffen war, tauchte ein und schwamm und kletterte wieder auf den Stein. Das konnte er eine Ewigkeit lang tun. Er fror niemals und erkältete sich auch nie, weil die dicke Schicht Öl auf der Haut das Wasser abperlen ließ und ihn so lange warm hielt, bis die Sonne höher am Himmel stand.
Im Sommer, kurz vor dem Monsunregen, waren Bach und Fluss fast ausgetrocknet. Der Mahanadistrom hatte an Stärke abgenommen, denn der Hiraku-Damm, der ein paar Tagesreisen mit dem Kanu stromaufwärts gebaut worden war, hatte ihn seiner wilden Wassermassen beraubt. Anfang Juni floss nur noch ein kleines Rinnsal in der Mitte des Flussbetts. Der Wassermangel war eine Geißel für alle im Dorf. Wenn sie im Austausch dafür Strom bekommen hätten, dann hätte das Leiden wenigstens einen Sinn gehabt, doch der Strom, den man im Wasserkraftwerk produzierte, wurde woanders gebraucht. In der Abenddämmerung knisterten immer noch die Holzfeuer, und die Öllampen flammten auf.
Als Fluss und Strom fast ausgetrocknet waren, gruben Kalabati und die anderen Dorffrauen in den großen Sandbänken provisorische Brunnen. Metertiefe Löcher, in die schließlich von den Seiten das Wasser hineinsickerte. Das Wasser trug Kalabati in verbeulten Blecheimern nach Hause. Einen Eimer auf dem Kopf, einen in jeder Hand.
Die Priester meinten, die Gegenwart der Unberührbaren besudele alles, was rein und heilig sei. Wenn Pikay sich dem Tempel des Dorfes näherte, bewarfen sie ihn jedes Mal mit Steinen. In dem Jahr, ehe er in die erste Klasse kam, legte er sich rachedurstig auf die Lauer. Als das Ritual begann und die Priester mit Wasser gefüllte Tonkrüge herbeitrugen, holte er die Steinschleuder heraus, sammelte Steine vom Boden auf, lud und schoss. Ploff! Ploff! Ploff! Langsam begann das Wasser aus den gesprungenen Krügen zu sickern. Die Priester entdeckten ihn und jagten ihn durchs Dorf.
»Wir werden dich töten!«, schrien sie.
Er versteckte sich in einem Gebüsch, das aus Kakteen bestand. Die Stacheln bohrten sich in seinen Körper, und er hinkte blutend nach Hause, um sich von seiner Mutter trösten zu lassen. Er dachte: Sogar die Pflanzen wollen mir übel.
Die Mutter streichelte seinen Rücken und sprach sanft und gut von der Welt. Auch wenn sie wusste, dass sie den Unberührbaren und dem Stammesvolk oft feindlich gegenüberstand. Pikay hatte keine Ahnung, warum die Brahmanen wütend auf ihn waren. Er begriff nicht, warum er sich vom Tempel fernhalten sollte, hatte keine Erklärung für die Steine, die man nach ihm warf. Das alles tat nur weh.
Seine Mutter verbarg die Wahrheit vor ihm und webte Träume und Hoffnungen mit beschönigenden Beschreibungen zusammen.
Wenn die Kinder aus den hohen Kasten Pikay versehentlich berührten, wuschen sie sich schnell im Fluss.
»Warum tun sie das?«, fragte er.
»Weil sie so schmutzig sind, da ist es nur gut, wenn sie mal baden«, antwortete die Mutter. »Die haben wirklich ein Bad nötig! Igitt, was waren die schmutzig!«, wiederholte sie so lange, bis seine Sorgen verschwunden waren.
Kalabati hatte nie in die Schule gehen dürfen, und sie konnte weder lesen noch schreiben. Aber sie wusste vieles andere. Sie konnte eigene Farben herstellen, schöne Muster malen und die Blätter, Samen und Wurzeln der Pflanzen zu wirkungsvoller Naturmedizin mischen.
Ihr Leben war in tägliche Pflichten aufgeteilt. Jeden Tag wurden die Arbeiten zur selben Zeit ausgeführt. Sie stand auf, wenn es noch dunkel war. Ihr Wecker waren die krähenden Hähne und ihre Uhr die Position des Morgensterns am Firmament. Pikay blieb dann noch auf seiner Strohmatte auf dem Boden liegen und hörte, wie sie den Boden, die Veranda und den Hof mit einer Mischung aus Wasser und Kuhdung wischte. Er fand es seltsam, dass sie Kuhkot benutzte, um sauber zu machen, und das blieb lange Zeit eines der Mysterien des Lebens, bis ihm die Mutter erklärte, dass es ein wirkungsvolleres Putzmittel war als das weiße chemische Pulver, das man im Dorfladen kaufen konnte.
Wenn Kalabati das Haus geputzt hatte, machte sie sich auf, um das Maisfeld der Familie zu versorgen und dann im Fluss zu baden. Wenn sie zurückkam, stand sie in ihrem dunkelblauen Sari auf der frisch geputzten Veranda. Ihr nasses, lockiges Haar glänzte in der Morgensonne, wenn sie sachte mit einem Baumwolllappen das Wasser aus den langen Haarsträhnen drückte.
Danach bekam der Tulsibusch mit den wohlriechenden grün-lilafarbenen Blättern Wasser, während sie ein Mantra sang. Dann ging sie zur Küchenecke, tauchte den Zeigefinger in eine schwere Steinschüssel mit zinoberrotem Farbpulver, drückte den Finger mitten auf ihre Stirn und betrachtete sich in dem gesprungenen Spiegel. Sie beugte sich vor und malte sich dicke Kajalstriche um die Augen. Das Kajal hatte sie selbst aus einer Mischung aus Ruß und »Ghi«, einer selbstgestampften konzentrierten Butter, hergestellt.
Wenn sie fertig war, stand Pikay auf, rollte die Strohmatte zusammen und bekam auch einen Punkt mit Kajal mitten auf die Stirn, der ihn gegen böse Mächte schützte, wie die Mutter sagte. Außerdem bekam er etwas Ghi auf die Stirn. Draußen in der Sonne schmolz dann die Butter und lief ihm ins Gesicht. Die Butter war Kalabatis Art, dem Rest des Dorfes zu sagen, dass ihre Familie nicht arm war.
»Es können sich nicht alle Butter und Milch leisten«, sagte Kalabati. »Wir aber schon.«
Sieh nur, die Familie Mahanandia hat so viel Butter, dass sie dem Kind die Stirn hinunterläuft – das, so hoffte Kalabati, würden die Dorfbewohner denken.
Der Körper rein, die Haare gekämmt, Kajal und Butter auf der Stirn. So war Pikay bereit, dem neuen Tag zu begegnen.
Das Stammesvolk, zu dem seine Mutter gehörte, hatte Tausende von Jahren zwischen den Bäumen gejagt und auf den Lichtungen angebaut. Inzwischen stellten die meisten von Kalabatis Verwandten am Ufer des Stroms Ziegel her. Sie sammelten Lehm vom Boden des Flussbetts und formten und brannten Ziegelsteine. Nur Pikays Onkel jagte immer noch. Pikay bekam von ihm eine Pfauenfeder geschenkt, die er mit einer Schnur um seinen Kopf band, um dann durch den Wald zu schleichen und Jäger zu spielen.
Pikay hatte lange geflochtene Haare und war stolz auf seine Zöpfe. Kalabati hatte seine Haare wachsen lassen, weil sie sich in ihrem tiefsten Innern ein Mädchen gewünscht hatte. Er maß gern seine Kraft und benutzte die Zöpfe, um zu zeigen, wie stark er war. Er band sich einen Stein ins Haar, hob ihn vom Boden hoch und rief triumphierend:
»Seht nur, wie stark meine Haare sind!«
Die anderen Jungen, die keine Zöpfe hatten, waren beeindruckt. Sie hatten noch nie etwas Vergleichbares gesehen.
Meist war er nackt und trug nur Armbänder oder Gürtel, an denen weiße Muscheln hingen. Alle Kutia-Kondh-Kinder im Dorf liefen nackt herum. Die Kastenhindus fanden die Stammesleute seltsam. Ihre eigenen Kinder trugen Kleider.
Kalabati verehrte die Sonne und den Himmel, die Affen und die Kühe, die Pfauen, die Kobras und die Elefanten. Sie verehrte den nach Lakritz duftenden Tulsibusch, den Pipalbaum und den Niembaum, dessen Äste wegen seines antibakteriellen Saftes als Zahnbürsten benutzt wurden. Für Kalabati war das Göttliche namenlos. Gott war in allem, was zu sehen war und um sie herum lebte. Mehrere Male in der Woche ging sie in ein Dickicht, wo die Bäume so dicht standen, dass die Äste und Blätter Wände und Dach bildeten. Dort hatte sie Steine und grünes ungestampftes Gras gesammelt, hatte ein wenig Butter ausgelegt und rotes Farbpulver verstreut, und da betete sie zu allem Lebendigen im Wald, aber vor allem zu den Bäumen, die gemeinsam mit der Sonne für das Allergöttlichste standen.
Das Kondh-Volk und die anderen Stämme in den Wäldern Ostindiens hatten sich niemals selbst in Kasten eingeteilt oder eine Unterscheidung zwischen Häuptlingen und Untertanen getroffen. Alle besaßen dasselbe Recht, die Götter zu verehren und die heiligen Dinge zu berühren. Doch dann kam das Volk der Steppe. Kalabati erzählte Pikay, wie sie aus dem Westen kamen und anfingen, Täler und Flussufer zu beackern und dabei die Waldmenschen als primitiv und unzivilisiert zu verachten.
»Am Ende wurden wir gezwungen, uns ihrem Kastensystem zu unterwerfen«, sagte seine Mutter traurig.
Manchmal rebellierten die Waldvölker. Die Briten mussten Truppen schicken, um die Ordnung wiederherzustellen. Doch es war ein ungleicher Kampf, in dem die Aufständischen stets den Kürzeren zogen.
Als Pikay um die zehn Jahre alt war, las er, dass Guerillakrieger, die Naxaliten genannt wurden, begannen, für die Rechte der Stammesvölker zu streiten – ein Konflikt, der sich im Laufe der Jahre verschärfte. Die Armee beantwortete Gewalt mit Gewalt, Blut floss, der Hass brach auf, und die Zeitungen nannten den Konflikt einen Bürgerkrieg. Pikay mochte die Wendung nicht. Er verstand aber, dass viele der Stammesbrüder seiner Mutter alle Hoffnung verloren hatten, als die Bergbaubetriebe und Industrieunternehmen auf der Jagd nach Bodenschätzen ohne zu fragen ihre heiligen Berghügel und -gipfel, Bäume und Büsche zerstört hatten. Erst glaubte er, dass Gewalt die einzige Antwort auf Gewalt sei, doch dann verlor er seinen Hass. Kein Mensch ist so wenig wert, dass er den Tod verdient, nicht einmal ein Unterdrücker und auch kein Mörder. Pikay mochte Mahatma Gandhis Ausspruch, dass die Ideologie »Auge um Auge« die ganze Welt blind mache. Das fasste auch seine Sicht auf die Philosophie des Krieges und die Methoden der Rebellen zusammen.
In den Jahren bis 1947, in denen Indien britische Kolonie war, war Athmallik eines von Indiens 565 Vizekönigreichen. Ein Liliputland, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur vierzigtausend Einwohner hatte. Aber ein »richtiges« Land war es nie: Der König war den Briten untergeordnet und musste, als Indien selbstständig wurde, abdanken, um Platz zu machen für einen modernen Staatsapparat und demokratisch gewählte Politiker.
In Athmallik spricht man immer noch von der Zeit, als die Könige regierten. Für Pikays Familie ist diese Ära mit einem nostalgischen Glanz versehen. Es fing damit an, dass Pikays Großvater den ehrenwerten Auftrag erhielt, für den König im Dschungel wilde Elefanten zu fangen und für den Einsatz am Hof zu zähmen. Seither hatte die Königsfamilie ein Auge auf den Elefantenfänger und seine Kinder und Enkelkinder.
Die Könige in Athmallik stritten nicht mit den Briten. Sie akzeptierten ihre Forderung nach politischer Oberhoheit und Handelskontrolle und nahmen das Angebot, geschützt zu werden, dankbar an. Die Briten belohnten dieses Vertrauen damit, dass sie 1890 ihren indischen Statthalter Mahendra Deo Samant vom Raja, was König oder Fürst bedeutet, zum Maharaja beförderten, was Großkönig bedeutet. Diese Aufwertung war gleichzeitig eine Anerkennung seiner besonders guten Herrschaft in Athmallik.
Als König Bibhundendra 1918 starb, war der Thronerbe erst vierzehn Jahre alt und zu jung, um zu regieren. Der britische Oberst Cobden Ramsay musste interimsweise den Königsthron übernehmen. Ramsay, der von seinen Untertanen der Weiße Raja genannt wurde, regierte sieben Jahre lang den Princely State of Athmallik. Sieben Jahre, die Pikays Großvater die allerbesten nannte.
»Ramsay war nicht, wie andere Engländer, ein Rassist«, sagte Großvater. »Und er scherte sich auch nicht darum, zu welcher Kaste ein Inder gehörte.«
Großvater pflegte zu sagen, dass die Engländer im Gegensatz zu vielen Indern das Beste fürs Gemeinwohl im Auge gehabt hätten, und nicht nur, wie sie sich selbst bereichern könnten.
»Kannst du mir einen einzigen Brahmanen nennen, der einen guten Gedanken an jemand außerhalb seiner eigenen Kaste verschwendet hat?«, lautete seine rhetorische Frage. »Kannst du einen einzigen Brahmanen nennen, der etwas getan hat, das den niedrigen Kasten zugute kommt? Nein, genau! Aber die Briten tun das die ganze Zeit. Sie denken an alle und diskriminieren uns Unberührbare nicht.«
Der König von Athmallik war nicht übermäßig reich. Nicht wie die Maharajas in Rajasthan in Westindien, wo man riesige Paläste und Hunderte von Elefanten, Jagdtrophäen an den Wänden und Schubladen voller Diamanten hatte. Nicht wie der Maharaja, der siebenundzwanzig Rolls Royce besaß, oder ein anderer, der seine Tochter mit einem Fest an einen Prinzen verheiratete, das im Guinness-Buch der Rekorde als die teuerste Hochzeit der Welt aufgeführt ist. Oder wie der, der eine Hochzeit unter seinen Hunden arrangierte, auf der zweihundertfünfzig Hundegäste in von Edelsteinen eingefassten Mänteln auf geschmückten Elefanten sitzend den Bräutigam empfingen, als er mit dem Zug ankam. Ein solches Übermaß gab es in dem Liliput-Reich, in dem Pikay aufwuchs, nicht.
Als Pikay geboren wurde, war der größte Teil des Maharaja-Palastes und der Regierungsgebäude schon verlassen und verfallen. Die Natur hatte kräftige Lianen und Pflanzensprösslinge um die im Monsunregen schimmelnden Wände und die eingefallenen Dächer geschlungen. Der Sohn des letzten regierenden Maharaja von Athmallik hatte den Ort verlassen, als Indien selbstständig geworden war, doch dank seiner erfolgreichen Geschäfte hatte er auf einen stattlichen Herrensitz umziehen können. Dort waren Pikay und seine Familie immer zu einem Plauderstündchen und einer Tasse Tee willkommen gewesen. Als Kind konnte er dort umhergehen und die gerahmten sepiafarbenen Fotografien aus der Kolonialzeit betrachten, die Briten mit Tropenhelm und indische Könige und Prinzen mit Turban zeigten.
Pikays Vater und seine Großeltern glaubten trotz allem an die Götter des Hinduismus. Der Vater vollzog zu Hause sogar hinduistische Rituale. Das tun nicht alle Unberührbaren. Wahrscheinlich war Shridhar in dieser Sache von seinen Kollegen auf dem Postamt beeinflusst, die einer höheren Kaste angehörten. Er hatte sich einen kleinen Altar angeschafft, auf dem Bilder von Lakshmi, der Göttin des Wohlstands, und Ganesha, dem Elefantengott, den man vor schweren Prüfungen und Herausforderungen im Leben anrief, standen. Dazu hatte er eine Statue von Vishnu, dem Erhalter des Weltalls, die von Räucherstäbchen und Öllampen umgeben war. In süße Düfte und den Rauch des Feuers eingehüllt, betete der Vater jeden Tag für sich und seine Familie um ein glückliches Leben zu den Göttern.
Solange kein Brahmane zu sehen war, konnten die Unberührbaren zum Shiva-Tempel des Dorfes gehen. Doch keiner von ihnen wagte sich bis ins Innere des Gebäudes vor, wo die Gottesfigur thronte. Dann würden die Brahmanen Himmel und Hölle in Bewegung setzen, wenn sie das herausbekämen.
Der Dorftempel war der Aufenthaltsort für Schlangen, die niemand zu verjagen oder zu töten wagte, aus Angst, dass dies Unheil heraufbeschwören könnte. Pikay mochte es, dass die Dorfbewohner zu den Schlangen freundlich waren und ihnen Futter gaben. Schließlich war es eine Kobra gewesen, die ihn vor dem Regen geschützt hatte, als er gerade geboren war. Die Schlangen waren den Menschen wohlgesinnt, davon war er überzeugt.
Die Priester brachten den Schlangen jeden Tag Essen, denn sie glaubten, dass Shiva es so wolle. Wenn man durch die Türöffnung spähte, konnte man sehen, dass dort drinnen im Dunkel eine metallisch glänzende Kobra mit aufgespannten Halsschilden stand und den Gott beschützte.
Wurde jemand von einer Schlange gebissen, so brachte man ihn zum Tempel und legte ihn vor dem Eingang auf den Bauch. Der Gebissene erhielt die strenge Anweisung, mucksmäuschenstill zu liegen und an Shiva zu denken. Früher oder später kam die Antwort in Form einer telepathischen Mitteilung des Gottes, und dann erfolgte die Besserung. Das hatte Pikay mit eigenen Augen gesehen. Eines Abends wurde seine Tante von einer Kobra gebissen. Sie ging zum Tempel, legte sich auf die Treppe und betete zum Gott. Dann ging sie nach Hause und schlief. Am nächsten Morgen stieg sie aus dem Bett und erklärte der Familie, sie sei geheilt. Alle waren überzeugt davon, dass es sich dabei um ein Wunder handelte, das Shiva mit seiner kosmischen Kraft bewirkt habe.
Doch Shiva vermochte noch mehr. Eine andere von Pikays Tanten war zwölf Jahre verheiratet, hatte aber immer noch keine Kinder. Sie ging zum Tempel, legte sich auf die Treppe, lag dort vier Tage und Nächte, indem sie meditierte, zu Shiva betete und nichts aß und nicht sprach. Als sie nach Hause zurückkehrte, war sie schwach und erschöpft, und man musste sie zum Tisch geleiten und mit Reis füttern. Aber neun Monate später gebar sie ihr erstes Kind.
Gott war nicht nur im Tempel. In einer Senke mit Kakteen im Maisfeld wohnten die Sat Devi, die Sieben Göttinnen, die von den Göttern des Waldvolks abstammten, aber jetzt auch von den Hindus verehrt wurden. Die meisten schützten und fürchteten die Göttinnen im Maisfeld. Es hieß, dass sie starke Kräfte besäßen. Wenn man sie nicht respektierte, konnte es einem übel ergehen.
Um die Göttinnen freundlich zu stimmen, hielten die Priester, als die Einwohner des Dorfes das Saatgut für die nächste Ernte einsammelten, eine Zeremonie ab. Doch ein Dorfbewohner fing schon an, Samen zu sammeln, ehe die Priester ihr Ritual fertig ausgeführt hatten. Es dauerte nicht lange, da bekam er Fieber und Schmerzen. Seine Beinmuskeln verkümmerten, und am Ende waren die Beine schmal wie dünne Äste. Er wurde nie wieder gesund, sondern musste sich bis ans Ende seines Lebens auf Krücken dahinschleppen. So konnte es einem ergehen, wenn man den Göttinnen trotzte.
An dem schmalen Pfad, der von Osten ins Dorf führte, stand ein mächtiger alter Baum, in dem Fledermäuse und Nachtvögel wohnten, aber Pikays Großmutter war sicher, dass der Baum auch von Hexen bevölkert wurde. Nachts klang es, als würde in dem Baum eine Vogelkonferenz stattfinden, verschiedene Vögel fielen einander ins Wort, und die gellend krächzenden Krähen waren die eifrigsten Redner. Pikay hatte Angst, dass die Krähen eigentlich Menschen sein könnten, die von den schwarzen Magiern in Vögel verwandelt worden waren.
Am Rande des Dorfes war ein Holzwagen geparkt, der während des Sommerfestivals benutzt wurde, um darauf bei der Prozession den schwarzen, den weißen und den gelben Gott herumzuziehen: Jagannath, der Herr der Welt, seinen Bruder Balarama und seine Schwester Subhadra. Auch dies waren die uralten Götter des Waldvolkes, die in der Familie von Pikays Mutter seit Urzeiten verehrt wurden, die aber die Hindus nun ihrer Götterwelt einverleibt und sie so zu den ihren gemacht hatten. Jagannath war von den Hindus zu einer Offenbarung des Vishnu gemacht worden, während die Buddhisten in ihm oft eine Form von Buddha sahen.
Wenn der Herbst kam, war es Zeit für das nächste Götterfest. Da wurde Durga, die Frau des Shiva verehrt. Die Priester opferten Ziegen auf einem Hügel vor dem Dorf, wo die Erde von ihrem Blut rot getränkt wurde. Das Blut, so sagten die Brahmanen, verlieh Durga Kraft, um die Dämonen zu bekämpfen, die die göttliche Ordnung bedrohten.
Die Hindus hatten so viele Götter, fand Pikay immer, und er begriff nie ganz, wie das alles zusammenhing. Doch er spürte die Gegenwart der Götter und scherte sich nicht um die Widersprüchlichkeiten. Als Erwachsener verstand er dann, dass seine Mutter und sein Vater ein gespaltenes Verhältnis zu den Götterfesten gehabt hatten. Sie durften zwar bei der Prozession dabei sein, aber die Götterfiguren oder den Holzwagen, auf dem sie gezogen wurden, nicht berühren. Sie durften beten, doch nicht neben den Angehörigen höherer Kasten und nicht im Tempel. Sie durften die Rituale ausführen, doch am liebsten im Hintergrund, sodass die Brahmanen es nicht mitansehen mussten. Wenn es nach den Priestern gegangen wäre, dann hätten alle Unberührbaren zu Hause gebetet und sich von allem ferngehalten, was rein und heilig war.
Es gibt massenhaft Fernsehserien und Bollywoodfilme über den ständigen Konfliktherd in der indischen Großfamilie: die Spannungen zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Wenn viele Generationen unter einem Dach versammelt sind, kann es natürlich zu Streit kommen. Während die Männer außerhalb der vier Wände die Herren sind, haben die Frauen im Haus das Sagen. Die Schwiegermutter regiert mit eiserner Hand, während die Schwiegertochter ihre eigenen Gewohnheiten mitbringt, die sie von ihrer Mutter geerbt hat. Wie soll das Chapatibrot geschnitten, das Kichererbsencurry gekocht, der Mais geerntet und wie die Kinder erzogen werden?
Pikay war drei Jahre alt und zu klein, um zu bemerken, was vor sich ging, doch seine älteren Brüder haben ihm erzählt, wie die Mutter sich mit der Schwiegermutter überwarf.
Kalabati hatte kürzlich ihr viertes Kind geboren, ein Mädchen, das den Namen Pramodini erhalten hatte und jetzt drei Monate alt war. Doch das neue Baby hinderte die Großmutter nicht daran, zum Angriff überzugehen.
»Deine hochverehrte Frau ist eine Hexe«, sagte sie zu Shridhar.
Und dann wandte sie sich an Kalabati.
»Du kannst nicht länger hier wohnen. Du bringst Unglück über uns.«
Kalabatis Blick verfinsterte sich, doch sie schwieg. Was half es schon zu protestieren? Es war selbstverständlich und völlig außer Frage, dass die Großmutter diejenige war, die bestimmte. Es war das Haus der Großeltern, in dem Pikays Mutter wohnte. Der Einzige, der glaubwürdig hätte protestieren können, wäre Shridhar gewesen, doch er sagte nichts. Er schluckte die Wut, den Verdruss und die Scham herunter und zeigte keine Reaktion.
Schweigen senkte sich über die Familie. Shridhar fuhr, ohne die Ereignisse zu kommentieren, zur Arbeit in die Stadt. Kalabati schwieg beleidigt eine Woche lang, während sie ihre Arbeiten wie gewohnt ausführte. Als eine Woche vergangen und Shridhar zurückgekehrt war, ging Kalabati zu ihrer Schwiegermutter und erklärte, sie habe sich entschieden. Ohne mit einer Träne zu offenbaren, was sie empfand, kündigte sie an, dass sie zu ihren Eltern zurückgehen würde.
»Und ich werde beide Kinder mitnehmen.«
Die Schwiegermutter setzte sich zur Wehr.
»Das Mädchen kannst du mitnehmen, das ist schließlich noch ein Baby, aber der Junge bleibt bei mir.«
Und auch das akzeptierte Kalabati, ohne zu protestieren.
Pikay erinnert sich, dass er weinte, als seine Mutter mit finsterer Miene ihre Sachen packte. Er erinnert sich, dass er mit vor der Brust verschränkten Armen auf der Veranda stand und seine Wangen tränennass waren, als sie die Tasche nahm und mit der kleinen Schwester im Arm durch die Tür hinaus- und die Treppe hinunterging. Er weiß noch, dass sie sich mehrmals umdrehte und ihn ansah, dass er winkte, und dass sie zurückwinkte. Er sieht sie immer noch vor sich, wie sie hinter den Zuckerrohrpflanzen verschwand, und erinnert sich, wie still und leer die Welt sich plötzlich anfühlte.
Seine Mutter und die kleine Schwester waren fort. Da der Vater sechs Tage in der Woche in der Stadt wohnte, waren außer ihm nur noch die Großmutter und der Großvater im Haus.
Er weinte Tage, Wochen, vielleicht Monate. Die Tränen liefen nur so, während die Monsunwolken des Himmels Regenschauer schickten, von denen die hellroten Lehmstraßen scharlachrot wurden und die Strohdächer nach Feuchtigkeit und Schimmel zu riechen begannen. Alles war ein einziger Nebel aus Regen, Tränen und Trauer. Als das Weinen aufhörte, verstummte er. Er hörte auf zu reden und zu lachen, nicht einmal lächeln mochte er noch. Die Tage durchlitt er mit verbissener Miene. Kein Wort entfuhr ihm. Meist saß er allein in einer Ecke und starrte ins Nichts. Dann fing er an, das Essen zu verweigern. Wenn die Großmutter ihm etwas aufzwang, ergab er sich, er hatte keine Kraft, sich zu widersetzen, doch die Bissen mit Reis und Linsengrütze hatten jeden Geschmack verloren. Das Essen, so erinnert er sich, schmeckte nach nichts.
Eines Sonntags kam ein Mann auf einem Fahrrad, der hatte eine Botschaft von Pikays Großeltern mütterlicherseits, die ausrichten ließen, Kalabati ginge es nicht gut. Der Bote erzählte, sie würde ihre Arbeiten nicht mehr verrichten, sondern nur noch dasitzen und weinen. Shridhar nahm den Bescheid entgegen, ohne eine Miene zu verziehen. Dann ging er ruhig und schweigend in den Garten, wo seine Mutter auf dem Acker arbeitete, und nahm sie hinter den Maisbüscheln beiseite.
»So kann es nicht weitergehen!«, schrie er und ließ die monatelang zurückgehaltene Wut heraus.
Sie schwieg.
»Du bist auf dem besten Wege, meine Frau wahnsinnig zu machen!«, fuhr er fort.
Sie schwieg weiter.
Was sollte sie auch sagen? Sie war zu stolz, um zuzugeben, dass sie etwas falsch gemacht hatte. Und in ihrem tiefsten Innern war sie wahrscheinlich überzeugt davon, immer recht zu haben. Sie war standhaft und unbeugsam und verhielt sich, als würde sie die Vernunft und das richtige Gefühl vertreten, während der Rest der Welt verrückt geworden war.
Als Pikays Vater eine Woche später von der Arbeit kam, berichtete er, dass er in der Nähe des Postamtes in Athmallik ein Stück Land gekauft habe.
»Dort«, sagte er, »werden wir in unserem neuen Haus zusammen wohnen.«
»Wer wird dort wohnen?«
»Wir. Nur wir.«
»Wir werden in einem Haus wohnen, in dem sonst niemand wohnt?«, fragte Pikay, der noch niemals von jemandem gehört hatte, der ein Haus ohne eine Großmutter und einen Großvater bewohnte.
»Ja. Das wird unser Haus werden. Nur unseres«, antwortete Shridhar.
Der Regen hatte das Kraut vom Zuckerrohr blank gespült und die rote Erde auf dem Hof in Matsch verwandelt, in dem Kühe und Menschen herumrutschten und die Fahrradreifen tiefe Spuren hinterließen, sodass alles am Ende einem chaotischen Schlachtfeld glich. Finstre Wolken zogen vorüber, und die Landschaft war in Dunkel gehüllt. Die Regenwolken ließen die Dorfbewohner glauben, dass es später am Tag sei, als es wirklich war.
Pikays Vater hob den Jungen auf den Karren, der hinter zwei Ochsen mit glänzendem Fell gespannt war. Der Karren hatte ein Dach aus geflochtenem Bambus, und ganz hinten standen ein paar Lehmkrüge mit Milch von der Kuh von Großvater und Großmutter. Der Kutscher setzte die Ochsen mit der Peitsche in Gang, und das Gespann begann gemächlich durch das Dorf zu knarren.