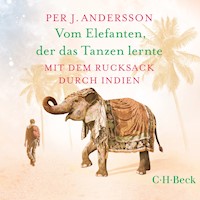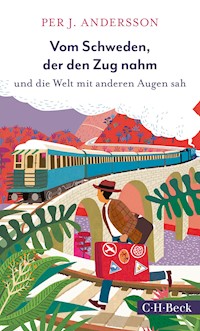12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Keine Region der Erde hat Bestsellerautor Per J. Andersson so intensiv bereist wie Indien. In seinem neuen Buch nutzt er seine jahrzehntelangen Erfahrungen, um uns Leser in dieses zwischen Tradition, Spiritualität und Moderne schillernde Land zu entführen. Ein glänzend geschriebenes, bereicherndes Buch für alle, die nach Indien reisen wollen oder bloß davon träumen.
Indien ist ein Ansturm auf alle Sinne. Farbenfrohe Götterstatuen aus Pappmaché und Stroh, der Duft von Räucherstäbchen, Holzfeuern und Currypfannen. Das Klingeln von hinduistischen Tempelglöckchen und die Laute muslimischer Gebetsrufer. Doch Indien ist auch ein Land, das sich in nur wenigen Jahrzehnten in eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Erde verwandelt hat. Auf seine einfühlsame, sympathische Art porträtiert Per J. Andersson dieses widersprüchliche, faszinierende Land und nimmt seine Leser mit auf eine Abenteuerreise quer durch Indien: zu den Elefanten, die das Tanzen lernten. Ein Buch, das Lust macht, aufzubrechen und eine unbekannte Welt zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
PER J. ANDERSSON
Vom Elefanten, der das Tanzen lernte
MIT DEM RUCKSACK DURCH INDIEN
Aus dem Schwedischen übersetzt von Susanne Dahmann
C.H.BECK
Zum Buch
Indien ist ein Ansturm auf alle Sinne: farbenfrohe Götterstatuen aus Pappmaché und Stroh, der Duft von Räucherstäbchen, Holzfeuern und Currypfannen; das Klingeln von hinduisti-schen Tempelglöckchen, die Laute muslimischer Gebetsrufer und die hypnotischen Klänge von Goa-Techno. Doch Indien hat sich auch in nur wenigen Jahrzehnten in eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Erde verwandelt und ist heute die größte De-mokratie der Welt. Es ist der Elefant, der das Tanzen lernte. Auf seine einfühlsame, sympathi-sche Art porträtiert Bestsellerautor Per J. Andersson dieses widersprüchliche, faszinierende Land und nimmt seine Leser mit auf eine Abenteuerreise quer durch Indien: zu prachtvollen Maharadscha-Palästen und bunten Hindu-Tempeln, mitten in die Megastädte Neu-Delhi und Mumbai, aber auch an entlegenere Orte wie etwa in die südwestliche Provinz Kerala, wo der alte Traum von einer sozialistischen Gesellschaft fortlebt. Ein glänzend geschriebenes, berei-cherndes Buch, das Lust macht, aufzubrechen und eine unbekannte Welt zu entdecken – oder auch bloß davon zu träumen.
Über den Autor
Per J. Andersson ist ein schwedischer Journalist und Schriftsteller. Er ist Mitbegründer von Schwedens bekanntestem Reisemagazin und ein Spezialist für Indien. 2015 wurde sein Buch «Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wie-derzufinden» zu einem großen Verkaufserfolg. Bei C.H.Beck erschien sein Bestseller «Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte» (2018).
Inhalt
Vorwort
1. Wie Indien mein Herz eroberte und mir auch im Herzen blieb
2. Es heißt nicht Mumbai
3. Elefantenritt in die Zukunft
4. Der Kaffeeautomat in Bangalore
5. Rote Politik im grünen Kerala
6. Nachhaltiger Tourismus in God’s own country
7. Familienherrschaft und Befreiung der Frau
8. Das Erbe von Portugiesen und Hippies
9. Als Indien zu Indien wurde
10. Kolonialisten und Freiheitskämpfer
11. Der Zug aus Pakistan
12. Sightseeing im Slum
13. Die blaue Stadt in der großen Wüste
14. Gott ist einer und viele
15. Indiens heiligste Stadt
16. Die Unberührbaren melden sich zu Wort
17. Pikays Wald und die Inseln der Glückseligkeit
18. Das Mosaik der Sprache
19. Bhelpuri in Bombay und Masala Dosa in Chennai
20. Die Bedrohung der Umwelt
21. Wenn die Demokratie obsiegt
22. Bollywood erobert die Welt
23. Literarische Feste und heiße Debatten
24. Die Erinnerung an ein Imperium
25. Ihr sollt uns nicht bemitleiden
26. Der Zweikampf zwischen den beiden asiatischen Riesen
27. Der Elefant mit dem Mikrochip im Ohr
Karte
Vorwort
Es begann alles mit einem Hin- und Rückflugticket mit der Aeroflot von Stockholm nach Neu-Delhi im Jahr 1983. Im Radio liefen Bowies Modern Love und Nenas Neunundneunzig Luftballons, und ich war 21 Jahre alt. Auf dem Rücken hatte ich einen grünen Rucksack, in der Hand ein Heft mit Reiseschecks und im Kopf tausend Erwartungen und Befürchtungen.
Diese erste Indienreise dauerte fünf Monate. Ich machte mich mit einem leeren Blatt auf den Weg und kam … ja, wenn nicht mit einem fertig geschriebenen Buch, so doch zumindest mit einem vollgekritzelten Notizblock zurück, der unbedingt in Erzählungen verwandelt werden musste. Seither bin ich im Grunde jedes Jahr wieder nach Indien zurückgekehrt und habe für schwedische Zeitungen über das Land geschrieben. Ich bin wie besessen davon, den westlichen Lesern Indiens ungeheure Vielfalt von widersprüchlichen Eindrücken zu beschreiben.
Ende der 80er Jahre war ich Mitbegründer des Reisemagazins Vagabond, das viele meiner Indienreportagen veröffentlicht hat, und ich arbeite immer noch zeitweilig als Redakteur dort. Seit der Jahrtausendwende habe ich als freier Journalist unter anderem auch für die Kulturbeilage von Dagens Nyheter, einer der größten schwedischen Tageszeitungen, gearbeitet sowie für das Kulturprogramm Obs im Schwedischen Radio, habe für die schwedische Nachrichtenagentur TT über die indischen Parlamentswahlen berichtet und mehrere Reiseführer und Reportagebücher über das Land herausgegeben, wie zum Beispiel Moderna Indien («Modernes Indien») 2006 und Indien – personlig guide («Indien – ein persönlicher Reiseführer») 2007. Auch meine zwei letzten Bücher Vom Inder, der mit dem Fahrrad nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden (2015) und Vom Schweden, der die Welt einfing und sie in seinem Rucksack nach Hause brachte (2018) handeln zu großen Teilen von Indien.
Mein Interesse für dieses Land mag einem vielleicht etwas schräg vorkommen. Aber warum? Jeder siebte Mensch auf der Erde ist Inder. In naher Zukunft wird Indien die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Und dann wird es umfassenderen politischen Einfluss auf der internationalen Bühne einfordern. Ob wir wollen oder nicht – wir können sicher sein, dass wir von diesem Land in den kommenden Jahrzehnten sehr viel mehr hören werden. Für meine Kinder und Enkelkinder wird das bald bevölkerungsreichste Land der Welt nicht mehr so anonym sein, wie es für meine Generation war.
Indien wird von den Medien immer noch stiefmütterlich behandelt. In Europa sind es nur mehr die Briten, die mit ihrer Vergangenheit als Kolonialherren eine lange Tradition haben, sich für dieses kunterbunte Riesenland in Asien zu interessieren.
Es ist an der Zeit, das zu ändern. Auch die anderen Länder Europas müssen ihren Blick in das Land der aufgehenden Sonne richten.
1. Wie Indien mein Herz eroberte und mir auch im Herzen blieb
Indien ist ein Angriff auf alle Sinne. Farbenfrohe Götterstatuen aus Pappmaché und Stroh, die durch die Stadt getragen werden, während Feuerwerk den Abendhimmel erleuchtet. Tanzende Hochzeitsgäste vor einem weißen Pferd, das vom Bräutigam geritten wird, der einen roten Turban und ein langes, silbern besticktes Hemd trägt. Der Duft von Räucherstäbchen, Holzfeuern und Currypfannen. Das Klingeln von hinduistischen Tempelglocken und muslimische Gebetsrufer.
Als ich 1983 im Alter von 21 Jahren zum ersten Mal nach Indien kam, war ich zunächst neugierig erstaunt, dann hingerissen. Nichts erinnerte dort an die Welt, die ich gewohnt war. Vor dem Flughafen von Neu-Delhi sah ich auf dem Parkplatz ein Meer von Autos – nicht weiter verwunderlich, wären sie nicht allesamt vom selben Fabrikat gewesen, nämlich dem Hindustan Ambassador, mit einer Karosserie, die eine exakte Kopie des Morris Oxford von 1954 war. Ich war nicht nur nach Osten gereist, sondern auch zurück in der Zeit. Das Design von eigentlich allem, was ich sah, erinnerte mich an meine eigene Kindheit. Im Kiosk, in den ich ging, um ein kaltes Getränk zu kaufen, gab es keine westlichen Limonademarken, die wurden nirgends in Indien verkauft, stattdessen bekam ich eine eiskalte Camp Cola Make in India in die Hand. Und die schmeckte ja auch gut. Westliche Moden und Produkte waren abwesend. In den Geschäften und auf den Basaren sah man eigentlich ausschließlich indische Waren. In den Kinos wurden nur indische Filme gezeigt. Im Radio wurde ausschließlich indische Musik gespielt. Im Fernsehen gab es nur indische Programme.
Wenn ich vor meiner Abreise mehr gelesen hätte, dann hätte ich gewusst, dass Indien, was die globalen Markenartikel und den westlichen Kulturimperialismus anging, ein weißer Fleck auf der Karte war. Indien hatte seit der Unabhängigkeit von den Briten 1947 getreu dem Rezept von Mahatma Gandhi auf Selbstversorgung gesetzt. Nur indem man selbst alles produzierte, was man zum Leben benötigte, so die Überlegung, konnte man sich von der kolonialen Vergangenheit und den imperialistischen Strukturen lösen und wirklich frei werden.
Auf den Straßen in den Städten wanderten viele bucklige Kühe mit bunt bemalten Hörnern herum. In den Straßenecken saßen in weiße Gewänder gewickelte Männer und servierten Tee aus großen, verbeulten Aluminiumkannen. In den Dörfern schritten Frauen in roten und gelben Saris mit Wasserkrügen auf den Köpfen. Ja, das war wirklich eine andere Welt für einen 21-jährigen Schweden, der mit geordneter Wohlfahrt in einem Reihenhaus am Rande von Västerås aufgewachsen war.
Meine Nase sog eine Duftmischung aus Rauch von brennendem Holz, stockigem Abflusswasser, Räucherstäbchen, Tageteskränzen und merkwürdigen Kräutermischungen ein. Damals konnte ich die Bestandteile des Duftes allerdings noch nicht benennen. Ich fand nur, dass es anders roch.
Als ich am allerersten Tag mit zitternden Knien mein Hostel verließ und direkt in das indische Gewimmel geriet, merkte ich, wie mich die Menschen mit unverstellter Verwunderung ansahen. Sie taten gar nichts, um ihren Gesichtsausdruck zu verbergen, und ich meinte in ihren Blicken lesen zu können, was sie spürten, wenn sie mich sahen (Erstaunen, Neugier …). Ich sah Männer mit dicken Backen, die frenetisch kauten und hin und wieder Kaskaden von roter Spucke ausspien. Blut!, dachte ich erschrocken, bevor ich in einem Reiseführer, den ich von einem Reisenden im Indian Coffee House auslieh, las, dass ihr Speichel vom Saft der Paan-Blätter und Betelnüsse gefärbt war, die wegen ihrer stimulierenden Wirkung gekaut wurden.
Ich sah Kioske, die Chinos, Shampooflaschen und Zigaretten von Marken verkauften, von denen ich noch nie gehört hatte. Und ich saß auf Holzbänken an kleinen Feuerstellen aus zusammengefügten Ziegelsteinen und trank süßen Tee mit warmer Milch aus roten, ungebrannten Lehmbechern. Ich sah vollbeladene Karren, die von Büffeln gezogen wurden, und Busse, die auf abgenutzten Ballonreifen rollten, Gitter vor den Fenstern hatten und an denen Menschentrauben aus den offenen Türen hingen, während das Gefährt schwarzen Dieselqualm aus dem Auspuff stieß. Überall Konstruktionen kurz vor dem Zusammenbruch: keuchende, rasselnde, dröhnende, klappernde Blechmonster, die wirkten, als würden sie nur von einer einzigen zentralen Schraube zusammengehalten. Ich dachte mir: Wenn sich diese eine Schraube lockerte, dann würden Indiens Straßen von Haufen rauchenden Eisenschrotts und verbrannten Gummis gesäumt sein.
Ich grübelte darüber nach, was das, was ich alles sah, eigentlich bedeutete. Meine Eindrücke waren schwer zu deuten. Drei weiße Striche auf einer Stirn, Kühe mit einem rot und einem blau bemalten Horn, ein fülliger Frauenbauch, der ohne Scheu in der Lücke zwischen verschiedenen Sari-Schichten hergezeigt wurde, weißer Baumwollstoff, um Hüften gewickelt und über schmale Männerbeine herunterhängend. Hohe dunkelblaue Turbane, üppige hennagefärbte Bärte, Männer in der Hocke, die ewig lang an kleinen, erdbraunen, tütenförmigen Zigaretten zogen, die nach verbranntem Gartenkompost rochen, zuckende und rollende Kopfbewegungen, als wäre der Kopf mit einem überbeweglichen Kugellager befestigt, Bewegungen, von denen ich nur schwer entscheiden konnte, ob sie ja oder nein oder nur «ich höre, was du sagst» hießen.
Und dann die Religion. Man musste die Schuhe ausziehen und sich mit nackten Füßen auf dem kalten Steinfußboden dem Gott nähern. Man hörte klingelnde Glocken, sah Hände im Lotusgruß und Steinchen mit brennenden Feuern, die in magischen, S-förmigen Bewegungen vor vielarmigen Göttern mit Rüsseln verschüttet wurden; man spürte fast das Kitzeln des Räucherwerks und des schweren, süßen Blumenduftes. Wie seltsam, dachte ich.
Vor den Schaltern am Bahnhof ringelten sich Schlangen von Männern, ausschließlich Männern. Brust an Rücken, Atem im Nacken, so als gebe es keinen Millimeter Privatsphäre. Jedes Paar Füße das Glied eines riesigen Tausendfüßlers. Dort standen, wie mir schien, nicht Hunderte von eigenständigen Individuen, sondern ein einziger Leib, ein indischer Körper, der erstaunliche Bewegungen machte.
Manchmal verlor ich die Geduld und schrie Taxifahrer, die zweideutig mit dem Kopf wackelten, an. Oder den Touristenstalker, der mich nicht in Ruhe lassen wollte, oder die Männer in den Schlangen, die nicht merkten, dass ich dort stand und um das kleinste bisschen Bewegungsfreiheit kämpfte. Natürlich hätte ich nach Hause reisen und nie wiederkommen können, hätte mein Leben in Europa weiterleben und an Indien als etwas Anderes, Furchterregendes und Beklagenswertes denken können, das fast nicht zu verstehen war. Hoffnungslos anders und exotisch und deshalb nicht der Mühe wert.
Vielleicht herrscht in China ein wenig mehr Ordnung, dachte ich. Vielleicht sollte ich Indien verlassen und stattdessen dorthin reisen. Also ging ich in ein Reisebüro und fragte, was ein Flugticket nach Peking kosten würde. Als ich eine Antwort bekam, drehte ich auf dem Absatz um und kehrte in das chaotische indische Leben zurück. Das konnte ich mir wenigstens leisten.
Doch nach ein paar weiteren Reisewochen erkannte ich, dass sich eigentlich alle meine Erwartungen nach und nach erfüllten. Ich hatte schließlich woandershin reisen wollen, weg von der durchorganisierten Welt zu Hause in Europa, wo der nächste Tag bereits im Kalender geplant ist. Das Leben in Indien, so dachte ich, kam dem Leben auf einem anderen Planeten so nah, wie man ihm auf dieser Erde kommen konnte. Und Indien war voller Eingebungen, Überraschungen, Aha-Erlebnisse und Geheimnisse. Ich war am richtigen Ort angekommen. Jetzt hieß es nur noch, die Eindrücke aufzunehmen. Meine Güte, ich konnte ja wohl kaum erwarten, dass ich schon nach wenigen Wochen alles verstand. Aber ich konnte zumindest aufhören, gegen alles anzukämpfen, und dann mal sehen, was passierte.
Der Kulturschock ließ ab dem Moment nach, in dem ich es wagte, auch mit anderen Menschen als Kellnern, Taxifahrern und Youth-Hostel-Angestellten zu reden. Ich wollte im Laufe des folgenden halben Jahres den indischen Subkontinent durchqueren und die Orte sehen, die Indienreisende normalerweise sehen wollen, was vermutlich nicht die beste Art ist, ein Land kennenzulernen. Meinen Weg zum richtigen Indien und weg vom Touristen-Indien fand ich dann aber in meiner Art zu reisen: mit den indischen Zügen. Es ist der Fluch eines Rucksacktouristen, dass es einen an Orte zieht, wo man hauptsächlich andere Reisende trifft. Doch es ist ein Segen für den Rucksacktouristen, dass er sich die gecharterten Touristenbusse oder Flugzeuge nicht leisten kann, sondern zweiter Klasse zusammen mit der Durchschnittsbevölkerung des Landes im Zug fahren muss.
In den Abteilen der indischen Züge begegnete ich einer anderen Art Menschen als denen, die ich in den ersten Wochen in Neu-Delhi abzuschütteln versucht hatte. Hier traf ich Menschen, die nichts verkaufen, mich nicht gegen Bezahlung durch die Stadt führen oder mich in den Lebensmittelladen ihrer Cousins locken wollten. In den Zügen geriet ich stattdessen mit neugierigen Indern der Mittelschicht in lange Gespräche über das Leben in dem fremden Land. Die Menschen, denen ich begegnete, waren Lehrer, Studenten und Staatsangestellte, Bankleute, pensionierte Militärs und literaturinteressierte Hausfrauen. Wir saßen stundenlang und sprachen über Aussaat, Feldfrüchte, Bollywoodfilme und skandinavische Freizügigkeit, boten einander Erdnüsse und Bananen an und tranken Tee und Sodawasser, während wir an verbrannter roter Erde und gelben Weizenfeldern vorbeifuhren, durch grüne Gummiplantagen rauschten und auf Brücken über breite Flüsse donnerten.
Es gab so viel Allgemeinmenschliches, über das man reden konnte. Eine Erkenntnis war, dass die größte Gemeinsamkeit weder mit Ethnien noch mit Religion zu tun hat, sondern mit Klassenzugehörigkeit und Ausbildung. Die Träume, Werte und Ideen, die mir begegneten, glichen keineswegs immer meinen, doch sie wurden zumindest auf eine Weise und in einer Sprache ausgedrückt, dass ich sie halbwegs nachvollziehen konnte. Das genügte, um mir und meinen neuen indischen Zufallsbekanntschaften aus dem Zug das Gefühl zu geben, dass wir immerhin auf demselben Planeten lebten und dass es deshalb mehr Verbindendes als Trennendes zwischen uns gab.
Das war einfach phantastisch! Ich war in Bewegung und hatte doch die ganze Zeit irgendwen, mit dem ich reden konnte, in einer Sprache, die ich verstand. Andere mutige Reisende, die ich in den einschlägigen Cafés und Hostels traf, hatten als Volontäre in den Kinderheimen von Mutter Theresa gearbeitet oder sich in einem heruntergekommenen Dorf niedergelassen, um konkret etwas gegen die Armut unternehmen zu können. Ich aber blieb Tourist, oder Reisender, wie ich es lieber nannte, und wurde im Laufe der Zeit immer abhängiger von diesen indischen Mittelschicht-Fremdenführern in Zügen (und manchmal in Bussen und auf Fähren), die mich an dem pittoresken, dem touristischen Indien vorbei in den indischen Alltag entführen konnten.
Der indische Zug rollte weiter. Langsam, aber beharrlich. Der Staub wirbelte durch die mit Gittern versehenen Fenster, und die sinkende Sonne sah an dem fremden Horizont aus wie eine Tomate mit verwischten Konturen. Die ziegelsteinroten Waggons mit grünen Kunststoffsitzen trugen mich über die Ganges-Ebene, die Westghats und das Hochland von Dekkan, durch die Indische Wüste hinauf in den Himalaya und im Herzen unbekannter Städte vorbei an wimmelnden Bahnsteigen, von denen ein Lärm aus unbekannten Sprachen aufstieg – bis hin zu der «nicht-indoktrinierten Ungezähmtheit der Sinne, voller unbekannter Geheimnisse und wilder Vorstellungen», wie die Schriftstellerin Arundhati Roy es ausdrückte.
Das andere, das mich erst lockte und dann schockierte, begann nun durch meine Poren zu sickern und Teil meiner selbst zu werden. Das erste, kalte Entsetzen war verschwunden und durch Freude, Vertrauen, Wärme ersetzt. Ich war gefangen und musste erkennen, dass ich begonnen hatte, Indien zu lieben.
Diese Liebe ist trotz der 35 Jahre, die seit meiner ersten Reise vergangen sind, nicht verblasst. Aber es war natürlich auch keine völlig unproblematische Liebe, sondern sie ist vielmehr durch einige tiefe Krisen gegangen. Ich war extrem verärgert und wütend, manchmal außer mir vor Zorn über alles, was so schlecht funktionierte, ich war sauer über den ganzen Betrug und das Blendwerk, die Korruptionsskandale, den Aberglauben, die abgrundtiefen Klassenunterschiede und harten Lebensbedingungen und nicht zuletzt über all die Mittelschichtmenschen, die schweigend die Ungerechtigkeiten akzeptierten und sich nur dafür zu interessieren schienen, wie sie sich selbst bereichern konnten.
Im Grunde bin ich jedes Mal, wenn ich Indien besuchte, mit dem Gefühl nach Hause gereist, dass ich von dem Land die Schnauze voll habe, um dann zu Hause nach wenigen Wochen wieder Sehnsucht zu verspüren. Intensiv und glühend. Und so ist es geblieben. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, stellt sich auch die Wut ein, doch ebenso die Sehnsucht nach der Rückkehr. Indien ist ein Teil meiner selbst geworden. Und mit diesem Buch möchte ich Indien auch zu einem kleinen Teil von Ihnen machen.
2. Es heißt nicht Mumbai
Ich blicke aus dem Fenster des Spice-Jets, der zur Landung auf dem Flughafen von Bombay ansetzt. Die Regenwolken hängen schwer über Hochhäusern, Slums und waldbedeckten Hügeln. Das Flugzeug beschreibt eine Kurve über dem Indischen Ozean, um auf der schmalen Halbinsel zu landen, auf der Indiens größte Stadt liegt. Da sagt der Mann neben mir, der sich zu Beginn des Fluges als «Mister Cucu Godhwani, Geschäftsmann aus Bombay» vorgestellt hat:
«Stellen Sie sich einen Käfig von einmal einem Meter vor. Sie sperren eine Ratte in den Käfig und geben ihr täglich ein Kilo Fressen.»
Ich nicke, denn er ist dabei, eine Art Gleichnis zwischen einem Rattenkäfig und seiner Heimatstadt zu entwickeln.
«Ein Kilo Fressen ist viel für eine Ratte, und sie frisst sich dick und fett», fährt er fort. «Dann lassen sie eine weibliche Ratte dazu, sie paaren sich und bekommen Junge, die ihrerseits groß werden, sich paaren und Junge bekommen. Jetzt haben Sie Hunderte von Ratten in dem Käfig. Doch es gibt immer noch nur ein Kilo Fressen, und der Käfig bleibt einmal einen Meter groß. Was passiert dann? Ist doch klar, sie fangen an, sich um Futter und Raum zu streiten.»
«Genau so», meint Cucu Godhwani, «ist Bombay.»
Wir teilen uns ein Taxi, weil wir in dieselbe Richtung wollen – ich in ein Hotel in Colaba und er in seine Wohnung in Malabar Hill. Der Verkehr fließt zäh auf dem Mahim Causeway, der Straße, die den größten Slum Asiens mit den Mittelklassevororten Andheri und Bandra verbindet, wo die meisten Bollywoodstars leben. An den Ampeln verkaufen barfüßige Slumjungen The World is Flat – die Streitschrift des Amerikaners Thomas L. Friedman für Globalisierung – an wohlmeinende Autofahrer. Es ist, als versuchten die Verlierer des Wirtschaftssystems die Gewinner von der Vortrefflichkeit der Globalisierung zu überzeugen.
Cucu Godhwanis Leben vereint alle Seiten Bombays: Er betreibt eine Lederfabrik im Slum Dharavi, und sein Zuhause liegt im vornehmsten Viertel auf dem Malabar Hill.
«Fühlt sich das nicht schizophren an, täglich zwischen diesen beiden Extremen zu wechseln?», frage ich.
«Nein», antwortet Cucu und beschreibt einen anderen Widerspruch: «Bombays Enge ist die Ursache ständiger Konflikte, doch alle, die Armen wie die Reichen, haben eins gemeinsam, das uns zu Brüdern und Schwestern macht: die Hoffnung, das Glück einzufangen.»
Deshalb ist Bombay im Alltag eine funktionierende Multikultur mit erstaunlich niedriger Kriminalitätsrate, während gleichzeitig die Frustration über die Unzulänglichkeiten des Lebens das wilde Tier plötzlich wecken kann.
Das geschah vor nicht langer Zeit. Bombay war für seine tolerante Harmonie bekannt, während im restlichen Land hin und wieder religiöse Streitigkeiten aufflammten. Doch im Winter 1992 verlor die Stadt ihre Unschuld. Die Krawalle wurden ausgelöst, als in der nordindischen Stadt Ayodhya – nach dem Hindu-Epos Ramayana das Reich von König Rama – eine Gruppe Hindu-Nationalisten eine alte Moschee zerstörte. Die armen Muslime in den Slums von Bombay stürzten sich daraufhin auf ebenso arme Hindus, die wiederum einen zornigen Mob versammelten, der Muslime verfolgte und verbrannte. Die hindu-fundamentalistische Partei Shiv Sena («Shivas Armee»), die seit den 80er Jahren den Kommunalrat in Bombay bestimmte, wurde beschuldigt, die antimuslimischen Stimmungen angeheizt zu haben. Die muslimische Mafia, die bis dahin lediglich säkular agiert und Verbrechen nur der Beute wegen, aber nicht aus religiösen Gründen begangen hatte, schritt nunmehr zur Tat, um die Ehre der Bombay-Muslime zu retten. Eine Reihe von Bombenattentaten wurde gegen Symbole des modernen Indiens verübt: das Hauptkontor von Air India, ein Luxushotel am Flugplatz und den Wolkenkratzer der Börse.
Als der Zorn verraucht und die Feuer in Bombay heruntergebrannt waren, kehrte wieder Normalität ein. Mit einem Gebet an diverse Götter, dass so etwas nie wieder geschehen möge, wurde das friedliche Zusammenleben wiederhergestellt. Am Tag nachdem der hinduistische Mob getobt hatte, waren über 200 indische Freiwilligenorganisationen im Slum vor Ort. Seite an Seite: Geschäftsmänner und Tagelöhner, Muslime, Hindus, Christen und Parsen. Eine Manifestation der Einheit. Denn so funktioniert Bombay, wo die Menschen nach Krawallen oder Bombenattentaten nicht wegrennen, um sich in Sicherheit zu bringen, sondern in das Zentrum der Ereignisse oder Explosionen gehen, um den Betroffenen zu helfen.
Ich denke, vielleicht stimmt doch, was der Schriftsteller Victor Hugo behauptete: dass alle Großstädte schizophren sind.
Cucu Godhwani, der Hindu ist, war auch dort, um betroffenen Muslimen zu helfen. Er sagt, niemand, nicht einmal die schlimmsten Hindu-Chauvinisten, hätte gewollt, dass die Sache derart aus dem Ruder läuft. Im nächsten Atemzug fügt er aggressiv hinzu, wenn die Muslime in ihren Theokratien im Nahen Osten sich weigern, andere Religionen zu tolerieren, warum sollte dann Indien seine 180 Millionen Muslime akzeptieren? Und entwickelt ein Zukunftsszenario, das mir eine Gänsehaut über den Rücken jagt: ein dritter Weltkrieg, auf der einen Seite die Diktaturen dieser Welt mit Muslimen und Chinesen, auf der anderen die Demokratien der Welt mit dem Westen und den Hindus.
Dann sprechen wir, was wie ein absurder Beweis für Victor Hugos These von der schizophrenen Megastadt klingt, darüber, was für ein phantastisch toleranter Ort Bombay trotz allem ist.
Bald werde ich mich auf eine Reise durch ganz Indien begeben, doch ein wenig verweile ich noch in der Stadt, die mich unablässig fasziniert, weil sie so voller Toleranz, Energie, Luxus, Flair und Armut ist. Man fühlt sich auf den Straßen sicher, die Bewohner von Bombay sind, wenn sie nicht zu gestresst sind, oft zuvorkommend. Als ausländischer Besucher begegnet man lächelnden Gesichtern, neugierigen Fragen und macht leicht neue Freunde. Es gibt jede Menge phantastische Restaurants, Cafés, Dachterrassen mit Bars und einem Blick auf das Arabische Meer, Eisbuden mit erstklassigem italienischem Eis, coole Clubs und schöne Artdéco-Kinos. Die Kunstgalerien sind renommiert, die Diskussionen in den Cafés sind spannend, und es ist herrlich, zusammen mit Hunderten schneller Bombay-Bewohner in schicken Sportklamotten am frühen Morgen entlang der Strandpromenade des Marine Drive – oder der Netaji Subhash Chandra Bose Road, wie ihr neuer Name lautet – zu joggen. Kurz gesagt: Man kann in Bombay eine wunderbare Zeit verleben.
Doch auf dem Bürgersteig vor dem Restaurant sitzt eine Familie und späht in den klimatisierten, lichterglitzernden Salon, riecht den Duft von Essen, verspürt Sehnsucht. Bettelt die satten Gäste an, die in die heiße, feuchte Nacht hinaustreten. Verflucht ihr Unglück, weint, fleht, baut Luftschlösser. Und so ist es in der gesamten Stadt: Reichtum und Armut, Seite an Seite und ohne Zäune dazwischen.
Im Herbst, wenn der Monsunregen aufgehört hat, sind die Abende heiß. Wenn die Nachmittagsbrise vom Meer eingeschlafen ist, kommt einem die feuchte Luft zwischen den verfallenden, abblätternden Villen der letzten Jahrhundertwende wie eine Wolldecke in einer Dampfsauna vor. Mein Körper fühlt sich wie ein frisch gebackener Zuckerkuchen an, das Gehirn wie ein frisches Soufflé, dampfend, zitternd. Das Wasser im Rinnstein schimmert wie Öl im gelben Schein der Straßenlaternen. Die Obdachlosen wälzen sich auf ihren Nachtlagern aus Karton. Der Asphalt klebt. Die Hunde jaulen und knurren hinter den Mülltonnen, die oft süßlich nach Verwesung riechen.
Doch an diesem heißen Oktoberabend und an vielen anderen Abenden am Meer in Bombay spürt man, wie die Verzweiflung von Hoffnung übertönt wird. Der flehende Blick der Bettler in den Gassen vergeht, und ihre heiseren, kaum hörbaren Rufe verklingen. Die Reklameschilder werden eingeschaltet. Der Abend erleuchtet, ein Widerschein der reichen Welt. «Intel». «Titan». «Microsoft».
Das Knattern von Mopeds auf dem Colaba Causeway; das Surren der Klimaanlagenkästen vor den Büros auf der Henry Road; Murmeln und Gläserklirren von Leopold’s Restaurant; die Musik aus der CD-Jukebox im Café Mondegar. Jetzt höre ich deutlich: Queens Bohemian Rhapsody. In der verrauchten Luft des fast voll besetzten Pubs dann «Mamma Mia, Mamma Mia» – hinten zwischen den dunkel gebeizten Holztischen auf dem abgenutzten Steinfußboden. Ich bleibe stehen, sehe an den Wänden zu den ewig kreisenden Deckenventilatoren empor. «Salaam Bombay!» («Hallo, Bombay!»). An der Längswand die von den 50er Jahren inspirierten Strichzeichnungen des aus Goa stammenden Illustrators Mario Miranda, die fröhliche, verrückte Menschen darstellen, die essen, trinken und sich vergnügen. An der Bar gibt es London Pilsner, Kingfisher und San Miguel. In der Ecke der Fernseher, wo die aktuelle Folge dieser Woche von Kaun Banega Corepati? («Wer wird Millionär?») läuft. Der Moderator schaut einen der Kandidaten, einen Sikh in blauem Turban und mit einer Brille mit dünnem, intellektuell anmutenden Metallgestell, forschend an: «In welchem der folgenden Züge kann man reisen, ohne reserviert zu haben? Palace on Wheels, Rajdhani Express, Chennai Mail …»
Der Kandidat antwortet korrekt und klettert auf 10.000 Rupien.
Die Halbinsel, auf der Bombay liegt, war ursprünglich eine von einem Fischervolk namens Kolis bewohnte Inselgruppe. Die Portugiesen fanden, die Bucht sei gut geeignet, um einen Handelsplatz anzulegen, und nannten sie Bom Bahia, die schöne Bucht. Im 17. Jahrhundert kamen die Inseln in die Hände der Briten, und der Name wurde zu Bombay.
1996 beschloss die Shiv Sena, diese kosmopolitische und ansonsten so tolerante Stadt Bombay in Mumbai umzutaufen. Das ist Marathi, die lokale Sprache im Bundesstaat Maharashtra, dessen Hauptstadt Bombay ist und in dem die hinduistisch-nationalistische Partei der Shiv Sena aktiv ist. Der Name Mumbai soll von der hinduistischen Göttin Mumba stammen, die wiederum von den Kolis angebetet wurde.
Viele Gruppen in Bombay – Christen, Parsen, Jain, Muslime und nicht zuletzt die Immigranten aus Südindien – weigern sich auch heute noch, den neuen Namen zu akzeptieren. Sie vermuten darin nämlich den Versuch einer ethnischen Gruppe, die hier zuerst wohnte (die «Söhne und Töchter der Erde», die Maratherna), die Stadt auf der Halbinsel im Arabischen Meer für sich zu reklamieren.
«Ich weigere mich, Mumbai zu sagen. Es heißt Bombay», sagt Armin Wandrewala in scharfem Ton und schaut durch das wilde Haar, das ihr vor den Augen hängt.
Wir treffen uns an einem ungewöhnlich heißen Oktobertag in ihrem schuhkartonähnlichen Büro mit klaustrophobisch niedriger Decke, das zwischen zwei Etagen eingebaut ist, als stamme es aus dem Film Being John Malkovich. In den schmalen Korridoren und auf den engen Treppen riecht es nach gebratenem Fisch vom Café Mondegar im Erdgeschoss. Zwischen Papierstapeln und dem Computer auf ihrem Schreibtisch wandert eine Kakerlake, die sie erfolglos mit einem Papier zu fangen versucht.
«Wer Mumbai sagt, verleugnet die kosmopolitische Atmosphäre der Stadt. Es ist unmöglich, Bombay zu einer homogenen Stadt zu machen. Bombay hat schon immer alles und alle akzeptiert – das ist unser größtes Problem und unser kostbarster Schatz.»
Armin Wandrewala ist wie die Stadt, in der sie wohnt, eine Mischung aus mehreren Kulturen. Ausländerin und Einheimische, exotisch und heimatverbunden zugleich. Sie gehört den Parsen an mit ihrem Glauben an den zoroastrischen Gott, hat Vorfahren, die ursprünglich aus dem Iran stammen, die aber, als der Islam stärker wurde, nach Osten und nach Gujarat in Indien flohen. Als Armin klein war, zog die Familie nach Bombay.
Sie müsste sich eigentlich fühlen wie eine Einwanderin ohne Wurzeln, aber dennoch sagt sie, Bombay sei ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihr Leben kreiste lange um das Zuhause im Mittelklasseviertel Malabar Hill und die Arbeit in dem ethnisch und sozial problematischen Hafenviertel Colaba. Sie ist ein Kind ihrer Stadt: beschäftigt, gestresst, viele Eisen im Feuer und leidenschaftlich verliebt in die Stadt, die sie mit geschaffen hat.
«Ich habe etwas beschlossen», verkündet sie, als wir da in ihrem Büro sitzen und schwitzen.
Armin Wandrewala sucht die Kakerlake, die sich hinter der Tastatur verkrochen hat.
«Aufgrund meines crazy Lebensstils habe ich beschlossen, keine Kinder zu haben.»
Armin und ihr Mann sind beide Juristen. Ihre Büros liegen nebeneinander im selben Haus. Jeden Morgen verlassen sie gemeinsam gegen acht Uhr ihr Zuhause, arbeiten den ganzen Tag, essen dann in den Cafés im Viertel um das Büro mit Freunden und fahren nach Hause, um gegen halb elf Uhr am Abend schlafen zu gehen. Sicherheitshalber, falls sie einmal Überstunden machen muss – «ich wohne ja praktisch bei der Arbeit» –, hat sie einen Schrank, ein Bett und einen Schminktisch in ihrem winzigen Büro.
Im Büro kümmert sie sich nicht nur um ihren Job als Juristin mit dem Spezialgebiet Zivil- und Unternehmensrecht, sondern schreibt auch Krimis.
«Das nächste Buch wird in einem Monat fertig sein», sagt sie und schiebt ein paar Papierstapel beiseite, um Platz für das verbeulte Blechtablett zu machen, auf dem Kaffee in weißen Porzellantassen und kleine süße Kuchen stehen.
Sie erzählt, dass sie die Inspiration für ihren nächsten Krimi durch die Forschung bekommen hat, die Professor Olle Lindvall am Institut für Klinische Neurowissenschaften an der Universität Lund in Schweden geleistet und wo er untersucht hat, wie man mit Gehirnzellen von abgetriebenen Föten Parkinson heilen könnte. Armin Wandrewala hat die Globalisierungsdebatte in die Kriminalintrige eingearbeitet: Arme Frauen in Bombay werden schwanger, um ihren Fötus an die wissenschaftliche Forschung im Westen verkaufen zu können. Die Frage ist: Wer besitzt das Patent aufs Leben?
Sie schiebt sich die langen Haare aus dem Gesicht, um sehen zu können, und sucht eifrig nach früheren Krimis, die auf ihrem Schreibtisch unter hohen Stapeln von Laserausdrucken versteckt sind.
«Ich arbeite und schreibe sieben Tage die Woche. Nein, stimmt nicht, sonntags fahren wir ein paar Stunden später ins Büro.»
Ist es denn nicht gefährlich für eine Mittelschicht-Frau, in einer Stadt zu leben, in der zwei Drittel der Bevölkerung in Bruchbuden und Kartons leben und kaum genug zu essen haben?
«Als Frau in Bombay herumzulaufen ist sehr sicher», sagt sie. «Kein Problem. Auf der ganzen Welt gibt es keinen so sicheren Ort.»
An einem Dezembertag zwei Jahre später, als die Meeresbrise angenehm lauwarm ist, stehe ich an ihrem Empfang und warte darauf, dass sie die schmale Treppe von ihrem Büro herunterkommt. Es ist schon eine Stunde nach der vereinbarten Zeit für unser Treffen, als ich endlich höre, wie sie hustend und schniefend von der Zwischenetage heruntersteigt. Sie hat etwas Gejagtes im Blick. Die Haare, die vor zwei Jahren noch wild und zerzaust aussahen, sind nun streng hochgesteckt. Ihr Gesicht wirkt erschöpft.
«Sie müssen wissen», erklärt sie schniefend, «mein Mann ist gestorben.»
Einige Monate zuvor waren Armin und ihr Mann im Urlaub in Sikkim im indischen Himalaya. Armin liebt es zu reisen und schreibt manchmal auch Reiseberichte in indischen Zeitungen. Sie war allein in den Bergen gewandert, doch ihrem Mann war das zu strapaziös gewesen, und er hatte es deshalb im Hotelzimmer langsamer angehen lassen.
«Plötzlich, ohne Vorwarnung …»
Sie schnäuzt sich in ein Papiertaschentuch, versichert aber mit brüchiger Stimme, dass alles okay sei, ihr gehe es gut.
«… ein Herzanfall! Er starb in meinen Armen. Er hat ein stressiges Bombay-Leben gelebt, so wie ich. Und er hat dazu noch geraucht. Der Stress hat ihn fertig gemacht.»
Sie wehrt sich gegen meine tröstenden Worte und sagt mit kräftigerer Stimme:
«Ich komme langsam wieder zurück. Meine laufende Nase … ich bin nur erkältet, deshalb schniefe ich … und ich habe den ganzen Nachmittag Besprechungen gehabt, und in fünf Minuten habe ich wieder eine. Wir können jetzt nicht mehr reden. Das müssen wir verschieben.»
Auf dem Colaba Causeway donnert ein roter Doppeldeckerbus vorbei. Aus der Küche des Café Mondegar ist das Klappern von Geschirr zu vernehmen.
«Aber eins weiß ich», sagt Armin Wandrewala, ehe sie wieder die Treppe hinaufeilt, «er ist ohne Schmerzen gestorben.»
Eine Digitaluhr mit roten Ziffern leuchtet zornig «5.55 PM» über der tausendköpfigen Schlange aus Pendlern in weißen Hemden, die sich sanft in der Nachmittagshitze der unterirdischen Gänge beim Bahnhof Churchgate ringelt.
Der Verkehr auf dem mehrspurigen Marine Drive steht frustriert still, während die Strahlen der Sonne intensiv die rußigen und rissigen Art-déco- und Neubaufassaden anstrahlen, die nach Back Bay gewandt stehen. Rote Doppeldeckerbusse, proppenvoll mit Pendlern mit schweißglänzenden Stirnen und weit, weit entfernten Blicken.
Auf den bröselnden Steinmauern der Strandpromenade, die immer mehr an eine Reihe gotländischer Raukar erinnern, sitzen Hunderte Nine-to-five-Sklaven und betrachten in der einzigen halbwegs kühlen Stunde des Tages den Sonnenuntergang. Eine gestohlene Pause im gehetzten Großstadtleben. Ein salziger und kühlender Wind vom Meer entspannt verbissene Mienen.
Und wieder wird die Reklame eingeschaltet und strahlt vor Hoffnung. «BPL Mobile – Believe in the Best … Welcome to the Wireless World».
Auf der Mauer sitzt ein Mädchen um die zwanzig mit gepuderten Wangen und gezupften Augenbrauen. Sie trägt ein weißes Hemd, schwarze, glänzende Hosen mit Schlag und schwarze Plateauschuhe und spricht in ihr Handy, was sie und ihre Freundinnen heute Abend machen werden. Bewegungen und Worte sind selbstsicher, souverän und voller Erwartung.
Auf dem Bürgersteig vor ihren Füßen rutscht ein etwa zehnjähriges Mädchen vorbei, ihre Beine sind von einer Skelettkrankheit zu Fragezeichen verdreht. Eine glänzende Edelstahlschale hat sie in der Hand. Verfilztes, dreckiges Haar, das an der Stirn klebt. Kleider, Haare und Haut in derselben schmutzig braunen Nuance wie der Bürgersteig und die Schuhsohlen der Abendflaneure. Man sieht sie kaum, hört sie nicht, wenn man sich nicht vorbeugt und genau hinhört. Es gibt sie fast nicht. Trotzdem streckt sie die Metallschale vor. «… Sir!», flüstert sie, ohne einen Hauch der Erwartung. Trotzdem landet eine Zweirupienmünze mit einem Klappern in der Schale. Sie nimmt sie, steckt sie in den Mund, spielt gedankenverloren damit zwischen Zunge und Gaumen, als wäre es ein Bonbon, rutscht dann weiter im Schein noch eines Reklameschildes. «BPL – Connecting the Wirefree Generation».
«Ich bin eine Mischung aus allem», sagt Ashok Banker, wie er da in einem locker sitzenden T-Shirt und Shorts in dem verqualmten Wohnzimmer seiner Zweizimmerwohnung mit dem Riss in der Wand («ein Erdbeben vor ein paar Jahren») im Vorort Khar West sitzt. Der Abend kocht, alles klebt einem am Leib, und der Deckenventilator von Ashok Banker kämpft gemeinsam mit Tausenden Ventilatoren von Bombay gegen die stehende Hitze an.
«Meine Mutter ist Christin, der Vater Hindu. Mama hatte sowohl holländische als auch irische Wurzeln, doch ich selbst bin durch und durch Inder. Voilà!»
Ashok Banker schreibt Chroniken für Zeitungen und Websites und Manuskripte für Seifenopern und Dramen für das indische Fernsehen, daneben schreibt er auch Kriminalromane. Die Intrigen seiner Krimis spielen fast immer in Bombay, so wie The Iron Bra, in dem eine Polizistin die Mafiosi der Großstadt jagt.
Die begehrte Zweizimmerwohnung, in der Ashok Banker mit Frau und zwei Kindern wohnt, hat er von seiner Mutter geerbt.
«Ich könnte mir heute niemals leisten, die Wohnung zu kaufen», sagt er und führt mich herum: das Stockbett der Kinder und das Doppelbett der Eltern nebeneinander im Schlafzimmer, die kleine, aber moderne Küche, das fast leere Wohnzimmer mit einem Computer in der einen Ecke.
«Bombay», sagt er, «ist wie schwarzer Kaffee. Man will ihn nicht, weil er gut ist, sondern weil man ihn braucht. Ich könnte überall wohnen, und doch kann ich hier nicht weg. Hier sind alle Teile Indiens in einem Mikrokosmos versammelt. So frei wie hier ist es nirgends in Indien. Ich muss mich nicht nach irgendeinem religiösen Code kleiden. Hier können Frauen abends allein in Rock und T-Shirt spazieren gehen.»
Durch das offene Fenster: der Bombay-Abend mit dem Lärm von dramatischen Polizeisirenen und wütenden Automotoren. Ashok wirkt ruhig und entspannt.
«Hier ist man frei von der unterdrückenden Tradition. In Bombay», sagt er in seinem wohlartikulierten Englisch und auf seine ebenso gutmütige wie sarkastische Weise, die Welt zu betrachten, «essen sogar orthodoxe Vegetarier Fleisch und trinken sogar Antialkoholiker Alkohol.»
Ein Jahr nachdem ich Ashok Banker kennengelernt habe, bekomme ich zu Hause in Schweden eine Mail. Er berichtet, dass ihm der Durchbruch als Schriftsteller gelungen ist. Er schreibt eine Serie Bücher, die alle zusammen eine Modernisierung des 1800 Jahre alten hinduistischen Epos Ramayana darstellen, und dank eines gutdotierten Verlagsvertrags kann er jetzt mit einem Chauffeur Auto fahren und ein gutes Leben führen. Die Wohnung mit der gerissenen Wohnzimmerwand hat er gegen etwas beträchtlich Schickeres getauscht. Aber Bombay hat er nicht aufgegeben.
Trotz allem ist Bombay nicht, was es einmal war. Die Beamtenelite versucht eine Stadt zu schaffen, in der die Marathen, die 40 Prozent der Bevölkerung von Bombay ausmachen, die politische Macht über alle anderen haben.
«Das Mumbai von heute ist eine andere Stadt als das Bombay, in dem ich aufgewachsen bin», sagt Nilufer Bharucha, die auf einem Lehnstuhl aus dunklem, abgenutztem Holz mit geflochtenem Plastiksitz unter dem ewig kreisenden Ventilator in ihrem Arbeitszimmer in der Universität sitzt.
Sie trägt eine marineblaue Tunika und locker sitzende Baumwollhosen, dazu hat sie einen grünen Schal über die Schultern geworfen.
«In den 70er und 80er Jahren rechnete man damit, dass sich Bombay zur tolerantesten Stadt Indiens entwickeln würde. Ethnische Volksaufstände gab es im Rest von Indien, aber doch nicht hier. Nach den Aufständen zu Beginn der 90er Jahre hat das kosmopolitische Bombay begonnen, Mumbai zu werden – eine homogene Stadt», sagt sie und fragt, ob wir lieber Sprite oder Coca-Cola möchten.
Nilufer Bharucha gehört auch der wirtschaftlich erfolgreichen Minorität der Parsen an. Sie stammt aus einer in Gujarat verwurzelten Familie, die jetzt aber schon seit drei Generationen in Bombay sesshaft ist. Sie ist Professorin für englischsprachige Literatur an der Bombay University und lebt allein ohne Kinder. Sich als Frau für ein aktives Berufsleben zu entscheiden, bedeutet oft, dass man zwischen Familie oder Job wählen muss. Nilufer musste auf Familie verzichten, um Karriere zu machen.
«Es gibt vieles in Bombay, was nicht funktioniert», erklärt sie und putzt ihre staubige Brille mit einem Zipfel ihres Kleides. «Der Wohlstand wächst, doch leider nur im gleichen Takt wie die Slums.»
Und fügt eilig hinzu: «Trotzdem bedeutet Bombay Hoffnung.»
Sie sieht hinaus zu den Studenten, die im Park des schattigen Campus auf den Betonwegen unterwegs sind, und dann sagt sie, wie alle, die nicht in den pechschwarzen Abgrund haben blicken müssen:
«Ich würde nirgends anders wohnen wollen.»
Das Taxi gleitet mit einem metallischen Rasseln durch die Bombay-Dämmerung. Vorbei an den Palmen mit ihren ausgebreiteten Blättern, dem Glockenturm aus hellbraunem Ziegel, den buckligen roten Doppeldeckern, dem Strom von Pendlern, die mit einem Auge auf der Uhr von den Wolkenkratzern am Nariman Point zu den Zügen in die Vororte an der Churchgate Station eilen. Ich höre hier keine traditionelle indische Kakophonie aus Kreaturen, Stimmen und Tempelglocken. Ich höre ein tropisches London, in dem der Verkehr rauscht, während die Menschen schweigen.
Raus auf den Marine Drive und zum Arabischen Meer, das im Sonnenuntergang ockergelb blinkt. Salziger Meeresduft durch die heruntergekurbelte Scheibe. Die Lichter, die eins nach dem anderen auf der anderen Seite der Bucht in Malabar Hill, dem Reichenviertel, angezündet werden. Indische Touristen in mit Federbüschen geputzten, vorbeiklappernden Pferd-und-Wagen-Kutschen. Kinder, geborgen auf dem Schoß von Mama oder Papa, schauen mit großen Augen auf alles, das in der Stadt der Träume, der Filme und der Hoffnung glitzert. Andere Kinder zwischen den Autos auf der mehrspurigen Straße schauen illusionslos in die Taxis, die an der roten Ampel stehenbleiben, und flüstern leise ihr «Sir, eine Rupie, Sir!»
Der Moderator von Kaun Benega Corepati schaut von großen Reklameplakaten für den Fernsehkanal Star Plus auf uns herab, auf arm und reich, kaputt und heil. Er sieht nett aus mit seinem wohlgepflegten Bart und seinen mandelförmigen, sanften Augen.
Er hat eine Frage. An diesem heißen Abend, als der Asphalt der Straßen weich ist und die Luft dicht von feuchter Wärme, fragt der Moderator, wer von uns vielleicht schon heute Abend Lust hat, Millionär zu werden.
3. Elefantenritt in die Zukunft
Dalal Street ist eine unansehnliche Sackgasse im Zentrum von Bombay, wo sich ein moderner Wolkenkratzer aus Glas und Beton hoch über die heruntergekommenen dreistöckigen Häuser aus grauem Ziegelstein erhebt. Auf dieser kleinen, schattigen Straße im alten kolonialen Stadtviertel stehen Gruppen indischer Männer in weißem Hemd und Schlips. Sie rauchen nervös und trinken Kaffee aus Plastikbechern. Über dem Eingang zum Treppenhaus des Wolkenkratzers hängt ein riesiger Plasmaschirm, der Aktienkurse und Börsenindex anzeigt.
Als ich den Männern folge, die nach der Pause zurück in den Eingang des Hochhauses strömen, lande ich in Indiens erfolgreichster Börse, dem Bombay Stock Exchange, der zehntgrößten Börse der Welt. Und wie ich so dastehe und den Fahrstühlen nachschaue, die im Turm verschwinden, kommt es mir folgerichtig vor, dass Indien sich binnen weniger Jahrzehnte von einem hilfebedürftigen Entwicklungsland mit wiederkehrenden Hungerkatastrophen in eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt verwandelt hat.
Bombay ist Indiens Wirtschaftszentrum und Dalal Street ist das Pendant zur Wall Street der USA. Bombay Stock Exchange wurde 1875 gegründet und war Asiens erste Aktienbörse. Heute an zehnter Stelle, wird sie zu den schnellsten gerechnet, da hier jede siebte Mikrosekunde eine Aktie ihren Besitzer wechselt. Der Ort, an dem ich mich in diesem Moment befinde, sollte mit anderen Worten zu den reichsten und modernsten Plätzen des Landes gehören. Doch wenn ich den Blick wende und zurück auf die Straße hinausschaue, dann wird mir klar, dass man noch einen langen Weg vor sich hat, ehe das alte Armuts-Indien der Geschichte angehört.
Indien wird gern mit einem Elefanten verglichen. Groß, klobig und langsam. Während die Entwicklung im Westen und in Südostasien vorwärts raste – dort wird der Fortschritt gern mit einem Tigersprung verglichen –, stampfte Indiens Wirtschaft auf der Stelle oder schaukelte sich bestenfalls langsam voran, unfähig, mit dem eigenen, rasanten Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Im Westen hat man lange verächtlich vom «hinduistischen Zuwachstempo» gesprochen. Indien war der Elefant, der nie vollkommen stehenblieb und auch nicht rückwärts ging, der aber auch nicht schnell vorwärtskam, sondern langsam, aber beharrlich dahinschritt, scheinbar unbekümmert über die schnelle Jagd der anderen. Gleichzeitig wütete nach wie vor das Gespenst der Armut, Klassen- und Kastenhierarchien blieben intakt, die Korruption grassierte und die Bürokratie funktionierte schlecht.
Doch dann kam die Wende, und die begann wie so oft mit einer Krise. Der erste Irakkrieg zu Beginn der 90er Jahre ließ die Ölpreise dramatisch steigen, und die Anzeichen für einen globalen Konjunkturabschwung verdichteten sich. Gleichzeitig war das indische Modell mit hohen Zollhürden und einer streng regulierten Wirtschaft zum Stillstand gekommen. Die Erfinder dieses Modells hatten selbst schon zu zweifeln begonnen und suchten nach neuen Entwicklungschancen. Man sah, wie China sich aus der Armut emporkämpfte und Wohlstand und Modernität anpeilte, während die indische Wirtschaft rote Zahlen schrieb. Die Inflation nahm zu, und die Valutareserven waren praktisch aufgebraucht.
Zunächst einmal musste die indische Regierung einen totalen Wirtschaftskollaps verhindern. Im Juni 1991 beschloss man deshalb, den Protektionismus, sprich, die Idee, innerhalb der Landesgrenzen und hinter hohen Zollschranken alle Waren, die man brauchte, selbst zu produzieren, abzubauen. Nun wollte man sich dem internationalen Handel öffnen. Die Internationalisierung zeigte rasch Wirkung. Die Wachstumsrate nahm Fahrt auf, die Inflationsrate kam zum Stillstand. Die unmittelbare Krise war gebannt.
Und was dann? Die Kritiker befürchteten, dass die Liberalisierungsmaßnahmen die Kluft zwischen den Klassen und die vorhandene Armut noch vergrößern würden, und das in einem Land, wo die Ungleichheit bereits gigantisch war, mit mehr Armen als in jedem anderen Land auf der Erde.
Was geschah? Ja, die Kluft wurde größer. Der Abstand zwischen den Reichsten und den Ärmsten nahm zu. Heute gibt es eine wachsende Gruppe extrem reicher Inder, die dank eines freien Marktes Milliarden Rupien an den Konsumwünschen der wachsenden indischen Mittelklasse verdient hat.
Doch die große Volkszählung des Jahres 2011 zeigte auch, dass dies nicht notwendigerweise auf Kosten der Ärmsten geschehen war. Denn während die Reichen reicher wurden, erhöhte sich auch der Lebensstandard von mehreren hundert Millionen Indern, die sich am untersten Ende der Einkommensskala befunden hatten. Große Gruppen Armer wurden in die untere Mittelschicht gehoben, während die unterste Mittelschicht in die etwas höhere Mittelschicht gelangte, und so weiter. Die gute Nachricht des letzten Vierteljahrhunderts lautet, dass die Armut in Indien rasch zurückgeht. Der Lebensstandard hat sich, von einigen einschlägigen Ausnahmen abgesehen, für nahezu alle Gesellschaftsgruppen verbessert. Allerdings hinken vor allem noch Landbewohner, die niedrigen Kasten angehören, und die Angehörigen der Ursprungsbevölkerung in acht Bundesstaaten Nord- und Ostindiens der Entwicklung hinterher. Die geringste Armutsquote finden wir in den Großstädten im südlichen und westlichen Teil des Landes und ganz oben im Nordwesten im Himalaya.