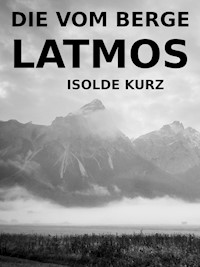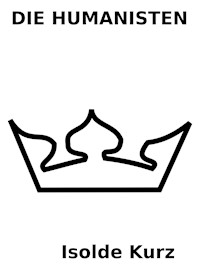Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Von dazumal
Erzählungen
Isolde Kurz
Von dazumal
Erzählungen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-45-4
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Es und ich.
Nachbars Werner
Das Vermächtnis der Tante Susanne.
Werters Grab.
Der Reisesack.
Der Aktiengarten.
Die Reise nach Tripstrill.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Es und ich.
Es gibt eine Gottheit, die von Allen gesucht wird, und die immer unerkannt über die Erde geht. Sie ist von unbegreiflich flüchtiger Substanz, und ihr Wesen zeigt sich nur im immerwährenden Versteckensspielen und sich Verkleiden; ihre wahre Gestalt hat kein Sterblicher jemals gesehen. Menschen und Völker setzt sie in Bewegung und rastet niemals. – Da sie keinen sicheren Namen hat, habe ich sie Es genannt.
Man halte es nicht für Anmaßung, dass ich Es und mich in einem Atem nenne, denn wir beide gehören unzertrennlich zusammen. Habe ich doch Es nie anders als in Verbindung mit mir gekannt und kann mir gar nicht vorstellen, wie Es aussehen würde, wenn ich nicht wäre. Hinwiederum existiere ich nur in Beziehung auf Es, und wenn ich von meinen Erlebnissen reden will, kann ich nicht anders sagen als: Es und ich.
Ich erinnere mich ganz genau: mein erster Begriff, als ich denken lernte, und, noch ehe ich denken konnte, meine erste Vorstellung war Es. Niemand hatte mir je davon gesagt, aber ich wusste, dass Es vorhanden ist, ich hatte diese Kenntnis aus dem Mutterleibe mitgebracht.
Immer, wo es recht merkwürdig und geheimnisvoll aussah, da suchte ich Es. Wenn irgendwo ein rotes Lämpchen brannte, blieb ich stehen, um auf Es zu warten. Hinter dem Zelttuch wandernder Zigeuner saß Es gerne, doch wollte man mir nie erlauben, das Tuch zu lüpfen.
Zum ersten Mal erkannte ich Es leibhaft in der Gestalt eines Kochlöffels. Den hatte ich ganz neu aus der Küche entwendet und in einem Nesselbusch versteckt, denn ich wollte für mich und den Bruder ein Häuschen unter der Erde bauen, zu dem die Großen keinen Zutritt haben sollten. Um es einzurichten brauchte ich verschiedene Dinge, vor allem den bewussten Kochlöffel. Zuweilen zog ich ihn heimlich aus dem Versteck hervor und schwelgte in seinem Anblick. Es war ein Zauberstab, denn sobald ich ihn in Händen hielt, war das Häuschen schon fertig mit vielen niedlichen blitzblanken Sächelchen drin; es hatte ein Dach aus Erde, über dem der Nesselbusch wuchs, und eine ganz kleine Küche, in der ich für mich und den Bruder kochte. Eines Tages aber fand mich die Köchin bei meinem Schatz, ergrimmt entriss sie mir den Löffel, nach dem sie lange gesucht hatte, und augenblicklich versank das Häuschen mit allem was drin war in den Boden. Später wurde mir zwar auf Befehl der Mutter der Löffel zurückgegeben, aber jetzt war er nur noch ein Stück Holz, und ich konnte das wunderbare Häuschen niemals wieder aufbauen.
Ich kann mich nicht mehr an all die vermiedenen Gestalten erinnern, in denen Es danach mir wieder erschien. In verschnürten und versiegelten Schachteln, die der Postbote brachte, war sein Lieblingsaufenthalt, aber regelmäßig beim Öffnen entflog es.
Bei Nacht war Es mir meistens ganz nahe. Ich lag in meinem Bettchen, auf dem Tisch brannte ein Nachtlicht, und die Großen sprachen mit gedämpfter Stimme. Dabei wurde mir seltsam ahnungsvoll zu Mut, und nun begann das Lichtlein zu flackern und gab im Ausgehen ein prasselndes Geräusch von sich, das die Wärterin »spratzeln« nannte. Dieses »Spratzeln« war wie ein Signal, ich wusste: jetzt geht sogleich die Türe auf, und herein kommt Es. Doch im Augenblick, wo das geschah, war ich auch schon eingeschlafen, deshalb konnte ich Es niemals von Angesicht sehen. Aber noch jetzt, wenn es mir gelegentlich beikommt, ein Nachtlicht brennen zu lassen, und ich wache in tiefer Nacht an dem Gespratzel auf, so ist mir’s, als sei jetzt Es soeben durchs Zimmer gegangen.
Unter dem Weihnachtsbaume habe ich Es wohl des öfteren leibhaft sitzen sehen, aber während die Lichter abbrannten, schlich es still hinaus. Dagegen wohnte es in der Woche vor Weihnachten ständig im Hause, nur durfte man es alsdann nicht sehen. Es stak in abgeschlossenen Schubladen, aus denen zuweilen ein Endchen Goldfaden oder ein Fetzen bunten Seidenzeugs heraushing, man ahnte seine Nähe hinter der Schranktür, wo beim Auf- und Zumachen Gold und Silberflitter knisterten, aber wollte man Es durch einen Türspalt oder ein Schlüsselloch belauschen, so wurde man von den Großen ärgerlich weggestoßen.
Geduld, dachte ich, später, wenn ich groß bin, wird Es beständig um mich sein. Dies war eine unumstößliche Gewissheit; wie Es aussehen sollte, fragte ich mich nicht, aber kommen musste Es.
Ein äußerer Umstand gab der Vorstellung mit der Zeit eine bestimmtere Richtung. Ein Freund der Familie, der in Smyrna wohnte, schickte alljährlich um dieselbe Zeit ein Kistchen voll getrockneter Feigen nebst einigen Fläschchen Rosenöl, die mit Goldbuchstaben bemalt waren. In diesem Kistchen zwar wohnte Es niemals, wir wussten zu genau im Voraus, was es enthielt und sogar wie es verpackt war. Aber das Kistchen erregte entzückende Bilder von dem Land, das solche Herrlichkeiten hervorbrachte. Und wenn Es fortan darauf bestand, sich nicht zu zeigen, so tröstete ich mich, es müsse wohl jenseits eines weiten Meeres in Smyrna sein.
Welch ein seltsames Gesicht machen doch zuweilen die Buchstaben, wenn sie zu einem Namen zusammentreten. Es ist als sehe man durch eine unendliche Tiefe in das innerste Wesen der Dinge hinein. Ich nehme es keinem übel, wenn er sich in den wohlklingenden Namen eines Mädchens verliebt.
Ähnlich erging es mir mit Smyrna, und aus tiefer, andächtiger Bewunderung vermied ich es, den Namen zu nennen. Aber jenseits unseres Flusses lag eine Ortschaft, welche Sirnau hieß – ich habe sie, nebenbei gesagt, niemals gesehen. – Um Smyrna nicht zu profanieren, redete ich, wo ich nur konnte, von Sirnau. Den Waldstreifen zwischen jener Ortschaft und dem Fluss nannte man das Sirnauer Wäldchen. Im Sommer führten unsere Wärterinnen uns zuweilen dort hinüber. Der Fluss rann an dieser Stelle ganz seicht über silberhelle Kiesel, die Mädchen brauchten nur ihre Röcke zu schürzen, um hindurch zu waten, uns Kleinen zog man einfach die Kleider aus. Diesen Waldboden betrat ich nie ohne entzückten Schauer, als ob es ein heiliger Grund wäre, denn einige Ähnlichkeit, dachte ich, müsse Sirnau doch mit Smyrna haben. Einmal zeigte man mir dort ein Eichhörnchen, das an einer Eichel knapperte, und alsbald bevölkerte meine Fantasie ganz Smyrna mit Eichhörnchen, die auf schlanken gläsernen Türmen saßen und Feigen herunterwarfen, klare Flüsse, die nach Rosenöl dufteten, rannen daneben, und dies war Es.
Die Strecke bis ins zehnte Jahr war unendlich; als ich einmal die berühmte Null erreicht hatte, kam die ganze Sache ins Rollen. Ich lachte jetzt über Smyrna und die Eichhörnchen, wie ich schon früher über den Kochlöffel gelacht hatte. Ich wusste jetzt, Es ist überall, es kommt nur darauf an, Es zu finden, und dazu braucht es den flüchtigsten aller Renner.
Ach, ich habe manches rasche Roß bestiegen, bin bei Tage und auch bei Nacht in Ebenen und Waldschluchten herumgestreift, aber Es habe ich niemals erjagt. Es war immer auf der Flucht vor mir und wusste sich so zu verstecken, dass ich auch nicht einmal den Saum seines Gewandes fassen konnte. Und wenn Es mir jemals über den Weg lief, so trug es Kleider, in denen ich es nicht erkannte.
Und doch gab es in der kleinen Stadt, wo ich zu Hause war, eine Räumlichkeit, in der es gern verweilte. Der Weg dahin führte über einen hochgelegenen, mit Bäumen besetzten Platz, dessen eine Seite ein lang gestrecktes massives Steingebäude einnahm. Dort stieg man drei Stufen zu einer breiten Haustür hinauf und im Innern zur rechten Hand zwei hölzerne Stufen hinunter, dann fand man sich vor einem niederen Pförtchen. An zwei Abenden der Woche tönten hinter dieser Pforte sonderbare wimmernde und jubelnde Laute, sie kamen vom Stimmen der Violinen her, die Knaben und Mädchen zur Tanzstunde riefen. Mit welchen Ahnungsschauern folgte ich zwölfjährig dem Lockruf der Geigen, wenn sie riefen: Es ist da! Es ist da! – Und Es war wirklich da, der grobgetünchte Saal mit den rohen Holzbänken war ganz von seiner Gegenwart ausgefüllt. Es tanzte auch mit, aber in so unbegreiflich verschlungenen Figuren, dass ich seinen Anblick niemals erhaschen konnte. Es duckte sich in Ecken und heimliche Winkel, schlang sich an den hölzernen Säulen vorüber und wollte meinem Auge niemals Stand halten. Ob es den Andern, die dort tanzten, jemals seinen Anblick gegönnt hat, habe ich nicht erfahren.
Am unglücklichsten war ich an den Sonntagen, denn ich glaubte lange, dies sei die Zeit, wo Es sich am liebsten blicken lasse, weil ich sah, dass auch Andere darauf warteten. Darum zog ich mich jedes Mal festlich an, um Es würdig zu empfangen, aber ausgehen mochte ich nicht, ich wusste schon, Es mischt sich nicht gern unter die Sonntagsmenge, und wenn Es mich finden wollte, konnte es ja eben so gut in meine Wohnung kommen. Aber ich saß viel am Fenster, damit Es wenigstens den Weg nicht verfehle. Solche Sonntage hatten zehnmal so viel Stunden wie ein anderer Tag. Da sah ich dann abends die Leute nach Hause kommen, sie machten sich breit und taten alle, als hätten sie Es gesehen. Und ich meinte, alle Menschen trügen ein hohes, unbegreifliches Glück nach Hause, und ich allein sei leer ausgegangen. Fragte ich aber, was sie erlebt hätten, so antworteten sie, sie hätten Käse gegessen und Bier getrunken und wären sehr vergnügt gewesen.
Vergnügt! Wie habe ich von jeher dieses Wort gehasst. Wo Es nicht ist, wie kann die Seele da Genüge finden. Und wo Es wirklich wäre, welches Wort wäre hoch und tief genug, um ihr Entzücken auszusprechen.
An sonnigen Oster- und Pfingstmorgen, wenn die Glocken zusammenläuten, kann ich mich des Wartens auf Es bis zum heutigen Tag nicht völlig entschlagen.
Wunderliches Ding, dieses Es! Einmal war es gar in ein kleines Kreuzchen aus Bergkrystall eingezogen, nach dem ich eine Zeit lang heftiges Verlangen trug. Dort muss es ihm sogar sehr wohl gewesen sein, denn es wohnte geraume Zeit in dem Kreuzchen. Freilich war es kein gewöhnliches Schmuckstück, sondern stellte in meiner Einbildung zugleich das Südliche Kreuz vor, das mir, seitdem ich im Kosmos gelesen hatte, wie das Bild eines Geliebten in der Seele glühte. Das Kreuzchen wurde mein, aber während es an meinem Halse hing, oder in der Schatulle lag, ging langsam eine sonderbare Veränderung mit ihm vor. Es schwand nämlich immer mehr, nicht an Umfang, sondern an Realität, ich hielt es oft betrübt und zweifelnd in der Hand und begriff nicht, wo es eigentlich hinkam. Man konnte es noch sehen und tasten, aber es war am Ende so gut wie nicht mehr vorhanden.
Von jener Zeit an verstand ich das Märchen vom Teufelsgolde: Die materiellen Güter sind überhaupt keine realen, sie verschwinden, so bald man sie besitzt – nur Es, das wechselvolle, unbegreifliche bleibt immer wesenhaft und gleich verlangenswert.
Wie viel Enttäuschungen, Zorn und Kummer hat Es mir noch fernerhin auf meinem Lebensweg bereitet! Ich will nicht von seiner Tücke reden, dass es sich bisweilen in ein menschliches Gesicht versteckte und mit keiner Gewalt von da zu vertreiben war, bis es eines Tages von selber wieder auszog, – ich wusste nicht wie und warum, nur dass der Mensch plötzlich aussah wie Jedermann. Das Seltsamste und Unheimlichste war, dass Es Menschen und Dingen den Raum versperrte. Die Dinge, die sich für real ausgaben, waren eigentlich gar nicht, und die Menschen, die beachtet sein wollten, waren ebensowenig; sie hatten wie Schatten nur zwei Dimensionen. Es mit seiner übermächtigen Substanz stand immer zwischen mir und ihnen und ließ sie nicht zur Wesenheit durchdringen. Dafür taten sie mir aus Rache manchen Tort, und ich war außer stand, mich gegen sie zu wehren, denn ich glaubte im stillen doch nicht an ihre Realität. Ich glaubte nur an Es, das Unaussprechliche, mir bei der Geburt Verheißene, das jeder Sonntagsmorgen aufs neue versprach.
Ich sah endlich ein, dass ich Es in meinem Vaterland niemals finden würde, und wanderte aus nach Süden. In weißen Marmorpalästen und tiefgrünen Hainen unter der Sonne von Florenz musste Es meiner Meinung nach zu Hause sein. – Aber in Florenz war Es erst recht nicht – wie könnte es auch da sein, wo alles schon vergangen ist – Es ist ja das Niedagewesene, das ewig Künftige. Ich fand nicht einmal die weißen Paläste, von denen ich geträumt hatte, sie waren alle vom Alter geschwärzt und hatten die Farbe des Gesteins und Erdbodens, aus dem sie herauswuchsen. Aber wären sie auch weiß gewesen und ganz so wie ich sie gedacht hatte, – Es hätte ebenso wenig in ihnen gehaust.
Nun standen alle meine Gedanken nach dem Meere. Auf dem Meer ist das Unendliche, auf dem Meer ist Es! – Ach, das Meer war gleichfalls ganz anders, als ich gedacht hatte. Es war nur ein kleiner Ausschnitt des Unendlichen mit Wasser und Himmel und vielen Segeln, die alle sehnlich etwas zu suchen schienen – und dahinter war der Blick versperrt. – Nein, auf dem Meere war Es wieder nicht, wo war Es denn?
Eine weiße Leere, eine glühende Stille umgab mich, in der ich nicht einmal mehr wünschen konnte. Es war mir gänzlich entschwunden und wohnte am fernsten Horizont. Da sagte einst ein alter Schiffer, der mich aus dem Golf von Spezia ins offene Meer hinausruderte: Wenn wir immer so weiterführen, würden wir in Afrika landen.
In diesem Augenblick flog Es voraus und ließ sich jenseits des Meeres in Afrika nieder. So oft ich von nun an ein Schiff in jener Richtung segeln sah, war’s als zöge mich’s an unsichtbarem Bande nach jener fernen afrikanischen Küste mit dem weißen blendenden Sonnenschein und den stillen warmen Nächten, wo das Südliche Kreuz, meine Jugendliebe, am Himmel steht. Aber ich sah ein, dass Es mich doch nur aufs Neue zum besten hatte und dass unter dem Südlichen Kreuz seines Bleibens so wenig sein würde wie unter den Gestirnen der nördlichen Hemisphäre. Es wartete nur, dass ich mich in Bewegung setzte, um vor mir herzuziehen wie der Horizont, ich hätte ihm nach- und nachziehen können rund um die Erde und endlich am alten Fleck wieder ankommen – ich wäre ihm doch nicht um einen Fußbreit näher gerückt. So blieb nichts übrig als sich endlich in der Welt einzurichten, als ob Es gar nicht vorhanden wäre.
Aber Es duldet nicht, dass man sich auf die Dauer seiner entschlage. Es bedarf meiner wie ich seiner bedarf, es kommt zu mir, wenn ich nicht mehr zu ihm komme, es muss mich necken, denn mich necken ist sein Dasein. Ich lasse es an mich herankommen und sein Spiel mit mir treiben, und weiß doch, dass es mit mir spielt. So spielt ein Erwachsenes mit einem Kinde, das es zu täuschen glaubt, aber das Kind ist klüger als der Erwachsene denkt; es tut nur mit, weil es gefällig ist, und weil das Spiel ihm selber Freude macht.
Nun schlendere ich weiter ohne Hast und frage jeden Begegnenden, wie Es für ihn aussehe und wo er Es am liebsten suche. Viele verstehen mich nicht, denn für die Masse der Menschen ist Es von Amtswegen in feste Form gebracht; wozu also danach suchen! Sie holen es am Sonntag morgen aus dem Schrank und wandern damit zur Kirche, und Abends wenn sie Bier getrunken haben, werden sie begeistert und singen die »Wacht am Rhein«. Aber Solche, die mich verstehen, sind um die Antwort nicht verlegen. Der Liebende bringt mir das Bildnis seiner Geliebten – ich sehe dann ein Paar lachender Augen und blitzender Zähne, aber sein Es ist für mich nicht wahrnehmbar – der Bureaukrat denkt an einen Orden, der junge Dichter sieht Es hinter dem Theatervorhang, für den Backfisch trägt es Säbel und Sporen, der Politiker zeigt mir sein Utopien, aber war nicht – zu seiner Zeit – mein hölzerner Löffel eben so viel wert?
Und doch verspottet einer die Träume des andern. Der nüchterne Geschäftsmann lacht über den Idealisten, der einem Hirngespinst von Kunst, Liebe oder Vaterland nachjagt, er wird unter seinen Zahlen grau und ahnt nicht, welch ein hirnverbrannter Fantast er selber ist. Wenn er mit seinen Vollblutpferden vorüberfährt, blickt ihm freilich der naive Fußgänger nach und meint Es in aller Herrlichkeit neben ihm auf den straffen Polstern sitzen zu sehen. Doch der Herr der Equipage weiß, dass Es nicht neben ihm sitzt, weil der Platz ganz leer ist, er muss sogar wissen, dass er selbst im Leeren hinsaust, denn Pferde und Wagen sind bloß für das Auge des Fußgängers vorhanden. Nur tut er nicht dergleichen, sondern lehnt kühl und vornehm zurück, um wenigstens in dem Neid der Einfalt so etwas wie eine dürftige Entschädigung zu finden.
Nein, Es ist nicht in den Dingen, Es ist immer außerhalb. Ist Es darum eine Chimäre? Keineswegs, nur die Dinge sind Chimären.
Es bleibt stets das Gleiche, aber wo es erscheint, da ist es immer neu. Die Wandlungen Wischnu’s sind nichts gegen die seinigen. Für den Säugling kriecht es in eine blecherne Rassel, einem Napoleon geht es in blendendem Glanz auf den russischen Eisfeldern auf, und doch wird es nie weder größer noch kleiner.
So werde ich Es denn niemals mit Augen sehen, mit Händen greifen! Wohnt es vielleicht in jenen unendlichen, dem stärksten Fernglas undurchdringlichen Räumen hinter der Milchstraße?
Nein, es wohnt auch dort nicht, seine Wohnung ist überall und nirgends. Es ist wie der Unsichtbare, von dem Hiob sagt: »Er geht vor mir über, ehe ich ihn gewahr werde und verwandelt sich, ehe ich ihn erkenne.« Wer Es anfasst, dem ist es schon entschwunden. Glaube keiner, sein Nachbar sei glücklicher als er und habe Es gebunden, Es treibt mit Jedem das gleiche Spiel, keiner kommt ihm um Haaresbreite näher als der andere.
Ich habe behaupten hören, es gebe Menschen, die nie auf Es gewartet hätten, die gar nichts wüssten von seinem Dasein. Mir sind solche Päscherähs niemals vorgekommen. Allen, die ich kenne, auch den Ärmsten im Geiste, ist Es einmal in irgend einer Gestalt erschienen.
Wenn der Mensch aufgehört hat, an Es zu glauben, so hat er aufgehört zu leben.
Ich glaube noch an Es – Es ist sogar das Einzige, woran ich glaube, aber ich gehe ihm nicht mehr nach. Ich weiß, es ist immer da, wo ich nicht bin: gehe ich durch die Ebene, so nimmt Es seinen Weg über die Hügel. Wenn ich einmal gestorben bin, so wird Es gewiss kommen und auf meiner Aschenurne sitzen, und das wird ein schöner Augenblick sein; nur schade, dass alsdann niemand mehr da ist, ihn zu genießen.
Nachbars Werner
Meine erste Liebe, so erzählte mir meine Freundin Ada, war unser Nachbarssohn Werner Horst. Ich verehrte in ihm, ohne mir davon Rechenschaft zu geben, mein männliches Ideal, denn ich stand damals zwischen dem fünften und sechsten Jahre, befand mich also in einem Lebensalter, wo man die Liebe bisweilen schon nach der Empfindung, aber nicht dem Namen nach kennt.
Ich hatte schon von Werner reden hören, bevor wir einander begegneten, denn meine Familie wohnte erst seit Kurzem in der Stadt, und die besondere Art, wie die Erwachsenen von ihm sprachen, beschäftigte meine Einbildung.
Mein Vater pflegte nämlich zu sagen: »Der Werner ist ein Junge, aus dem einmal etwas werden kann, aber ich will nicht, dass meine Kinder mit ihm umgehen.«
Und meinem Bruder Erich, der die gleiche Lateinklasse besuchte wie Werner, war es verboten, den Heimweg aus der Schule in seiner Gesellschaft zu machen.
Ganz deutlich erinnere ich mich, wie Werner das erste Mal zu uns kam. Sein Vater hatte ihn mit einem Auftrag an den meinigen geschickt. Seine freie Miene, die glänzenden Augen, mit denen er den Großen so fest ins Gesicht sah, und dass er zwei Jahre älter war als ich, das Alles flößte mir eine mit Scheu gemischte Bewunderung ein. Und als er wieder gegangen war und meine Mutter gegen den Vater bemerkte: »Es ist doch jammerschade um den Werner –« da weiß ich noch ganz genau, dass mir das Herz unruhig zu klopfen begann.
Nachdem der Vater das Zimmer verlassen hatte, nahm ich all’ meinen Mut zusammen und fragte:
»Was hat denn der Werner getan, dass Du sagst: ›Schade?‹«
»O, etwas sehr Hässliches«, war die Antwort, »das kleine Mädchen besser gar nicht wissen sollten: der Werner ist ein Lügner.«
Und sie erzählte mir, dass Werner’s Vater Alles aufgeboten habe, um den Jungen von diesem widrigen Laster zu heilen, aber kein Mittel wollte fruchten. Unzählige Prügel habe er an ihm abgeschlagen, ihn Tage lang im Keller eingesperrt, es sei Alles umsonst gewesen. Das Lügen sei so mit Werner’s Natur verwachsen, dass er es nicht lassen könne. Überhaupt sei er ein Tunichtgut und ein Heimtücker, was man ihm bei seiner offenen Miene gar nicht ansehen würde. Er halte sich immer nur einen Freund unter seinen Kameraden, aus dem mache er dann, was er wolle, setze ihm die größten Albernheiten in den Kopf und verleite ihn zu schlechten, ungezogenen Streichen, bis er ihn eines Tages stehen lasse und sich wieder einen anderen suche. Werner Horst’s Freundschaften dauerten nie länger als ein paar Wochen, aber in diesen paar Wochen mache er auch die bravsten zu ganz ungehorsamen und verdrehten Jungen. Deshalb hätten andere Eltern darauf zu achten, dass er von ihren Kindern fern bleibe.
Ich ging an diesem Tage ganz tiefsinnig umher. – Wie kann man nur lügen, dachte ich bei mir selbst. – Pfui, das muss etwas sehr Schmutziges sein! – Denn ich war ein kleiner Tugendbold und sehr stolz auf meine von den Eltern oft gerühmte Wahrheitsliebe, an der gar nichts Verdienstliches war, da ich als zärtlich gehegtes Hauskind niemals in die Versuchung geriet, mir mit einer Lüge zu helfen.
Daher nahm ich mir vor, den Werner gründlich zu verachten, ihn auch nicht anzusehen, wenn er mir auf der Straße begegnen würde. Aber heimlich musste ich immer an den Missetäter denken. Meine Fantasie irrte beständig um seine mir doch nicht recht klar gewordenen Vergehungen und die Strafen, die er dafür zu verbüßen hatte, herum. Seine Beharrlichkeit im Bösen imponierte mir eben so sehr, wie ich sie verdammte, und so oft ich mir sein schönes, freies Gesicht vorstellte, wurde ich traurig.
Wenn mein Bruder gelegentlich in meiner Gegenwart sagte: »Der Werner Horst ist der Beste in der ganzen Klasse« – so wurde ich rot, ohne zu wissen, warum. Und als ich ihn eines Tages sagen hörte: »Heut’ hat der Werner Prügel bekommen, weil er wieder gelogen hat« – weinte ich im Stillen. Fortan flocht ich allabendlich in mein Nachtgebet die Bitte ein:
»Und, lieber Gott, mache vor Allem, dass der Werner nicht mehr lügt.«
Werner’s Vater war der Rector und Kirchenälteste Horst, dessen Haus dicht an das unsrige stieß. Da drüben fielen zuweilen Szenen vor, über die man bei uns nur flüsternd sprach, denn meine sanfte, immer gütige Mutter, die ich viel zu kurz besessen habe, wollte nicht, dass wir Kinder von hässlichen und traurigen Dingen erführen; sie verheimlichte uns sogar ihren eigenen leidenden Zustand, um uns den Sonnenschein der Kindheit so lange wie möglich ungetrübt zu erhalten. Aber durch des Rectors Dienstmagd Rike, die sich bei unserer Christine das Herz zu erleichtern pflegte, war man von Allem unterrichtet. Der Alte gehörte zu den Stillen im Lande und war der Schrecken der Schulkinder, denen er das Christenthum mit dem Stock einbläute. Nur über seinen Werner hatte er keine Gewalt. Dieser drückte sich, so oft er Gelegenheit fand, um die häuslichen Andachtsübungen und lief am Sonntag in den Wäldern umher. Wenn er dann zum Mittagessen nach Hause kam, erwartete ihn regelmäßig eine Prügelsuppe, worauf er für den Rest des Tages abermals zu verschwinden pflegte, um am Abend mit einer neuen Tracht Prügel begrüßt zu werden. Doch war ihm das Umherstreifen ebenso wenig auszutreiben wie das Lügen. Einmal – aber dies erzählte mir Christine nur mit gedämpfter Stimme und indem sie sich ängstlich umsah, ob Niemand zuhöre – war er sogar mit einer Zigeuner- oder Kunstreiterbande fortgezogen, man wusste nicht wohin, und erst nach mehreren Tagen war der Vater seiner wieder habhaft geworden.
Ich weiß nicht, ob Werner ahnte, wie sehr seine Nachbarin mit ihm beschäftigt war. Jedenfalls nahm er seinerseits von meinem Dasein in schmeichelhafter Weise Notiz, während es sonst bräuchlich war, dass die Mädchen von den Jungen über die Achsel angesehen wurden.
Bei einer festlichen Gelegenheit entspann sich zur Schande meiner Grundsätze unsere Freundschaft.
Die große Frühjahrsmesse führte alljährlich wandernde Curiositäten, wie Schießbuden, Menagerien und dergleichen nach unserer Stadt. Diesmal war auf der großen Festwiese vor den Thoren neben anderen Herrlichkeiten ein Carroussel aufgeschlagen, das den ganzen Tag nicht leer wurde und die Herzen der Jugend mit Begeisterung erfüllte. Ich hatte nie zuvor ein Carroussel gesehen, und das quieksende, kreisende Ding mit seinen Pferdchen und Wägelchen und dem flatternden Wimpel auf dem Zeltdach erregte mein glühendstes Verlangen. Die Mutter schenkte mir ein paar Kreuzer, zog mir ein weißes Kleid mit rosa Bändern an und schickte mich am Sonntag mit Christine auf die Festwiese.
Einen Sonntag wie diesen habe ich nicht wieder erlebt. Die Wiese war so grün, dass man nichts Grüneres sehen konnte; die Sonne schien hell, und die Weiße des leinenen Zeltdaches, worauf die bunten Fähnchen wehten, biss einem fast in die Augen. Aber das Allerschönste war die Musik, die den Rundgang des Carroussels begleitete; die Töne der Sphärenharmonie können einem verstehenden Ohre nicht beseligender klingen als mir das Geschrille jener Jahrmarktsorgel, in das sich das Ächzen der drehenden Mechanik mischte. Noch heute kann ich kein Carroussel herumgehen sehen, ohne eine Weile stehen zu bleiben, und die Töne, die mein Ohr zerreißen, wecken ein fernes, himmlisches Echo in meiner Erinnerung. Doch ließ sich der wonnevolle Tag zuerst für mich bedenklich an. Christine wollte mich in eines der grün lackierten Kütschchen heben, wogegen ich mich sträubte, denn ich verlangte sehnlich nach einem Pferd. Die bäumenden Vierfüßler aber waren alle von den Jungen besetzt, die es als einen Eingriff in ihre Vorrechte betrachteten, dass auch ein Mädchen in den Sattel steigen wollte, und mich überall zurück drängten. Es war eine allgemeine Verschwörung, mich nicht ankommen zu lassen, und unzählige Male musste ich das Carroussel ohne mich abgehen sehen. Ich war ganz trostlos vor Schmerz und Scham, dass man mich nirgends dulden wollte, und es fehlte nicht mehr viel, so wäre ich weinend nach Hause gelaufen. Als das Carroussel wieder einmal still hielt, sah ich einen herrlichen Rappen mit rund gebogenem Hals und wehender, hölzener Mähne mir gerade gegenüber. Ich stürzte darauf zu, griff nach dem Steigbügel, wurde aber alsobald wieder gepackt und zurück gezerrt. Diesmal war es mein eigener Bruder, der mich wegzureißen suchte, doch ich hielt den Bügel fest, und ein gewaltsames Ringen entstand.
»Schäm’ Dich doch, Ada«, keuchte er ganz außer sich – »die Mädchen gehören nicht aufs Pferd, die Mädchen gehören in die Kutschen.«
Nicht dass er das Pferd für sich gewollt hätte, aber als Musterknabe, der er war, konnte er es nicht ertragen, seine Schwester eine Ausnahme machen zu sehen. – Ich war zwar die Jüngere, aber keineswegs erheblich schwächer und wehrte mich wie eine Löwin. Die Umstehenden lachten, der Aufwärter sagte begütigend: »Was macht ihr, Kinder, es ist Platz für Alle! Aufgestiegen! Jetzt fahren wir ab.«
Er hatte gut reden, mein Bruder hielt mich an meinen langen, gelockten Haaren fest. Mit einem verzweifelten Ruck machte ich mich endlich los und ließ ihm mein rosa Band nebst einem Schopf Haare in den Händen. Aber als ich mich umsah, war mein Platz von einem Dritten genommen, und ich erkannte Werner Horst, der eine Hand auf den Bügel des Rappen gelegt hatte. Mein Bruder schnitt mir eine schadenfrohe Fratze und hieß Werner rasch auf den Rappen steigen.
»Warum denn?« sagte dieser ruhig, indem er den Platz frei gab. – »Deine Schwester war ja vorher da.«
»Aber die Mädchen gehören in die Kutschen«, antwortete mein Bruder, indem er mit dem Fuß stampfte.
»Dummheit«, sagte Werner, während ich schon triumphierend im Sattel saß.
Meinem Bruder blieb nichts übrig, als sich im Gewühl davon zu schleichen, nachdem er noch die Faust gegen mich geballt hatte. Werner sprang auf das freie Gäulchen neben dem meinigen, die Musik setzte ein, und fort ging es, als flöge man ins Himmelreich.
Werner nickte vergnügt zu mir herüber und sagte:
»Du bist doch nicht so langweilig wie die andern Mädchen.«
Ich saß strack im Sattel, hielt mit einer Hand die Eisenstange, durch die mein Pferd an dem Gerüste befestigt war, und fühlte mich hoch erhaben über die zahmen Lämmchen in ihren blauen und rosa Kleidchen, die ringsum fein artig zu Vier und Vier in den Kutschen untergebracht waren. Stolz und glücklich blickte ich zu Werner hinüber, der mir auf einmal als ein ganz Anderer erschien. Ich hatte alle Missetaten, deren er angeklagt war, vergessen und sah in ihm meinen Retter und Helden, denn es war mir aufgegangen, dass er sich nur eingemischt hatte, um den bestrittenen Platz für mich zu besetzen.
»Warum sollen die Pferde nicht auch für die Mädchen sein?« fragte ich, um aus seinem Munde die Bestätigung meiner Rechte zu vernehmen.
»Die Pferde sind für Alle, die reiten können«, lachte er.
Also ich konnte reiten! Der Werner hatte es gesagt, und der musste es ja wissen. Ich hob mich noch stolzer im Sattel und fühlte mich so sicher in meinem Amazonenthum, dass ich die Stange los ließ und mich auf meinem Pferdchen frei schwebend erhielt. Die Musik gröhlte, die Kinder schrien und sangen, die Mechanik stöhnte, und wir drehten uns in wirbelnder Eile. Eine Verzückung hatte mich erfasst; mir war’s, als läge die Erde tief unter uns, und wir sausten zusammen furchtlos und selig durch die blauen Lüfte. Auf einmal stand das Carroussel stille, die Musik schwieg, und ein Mann ging herum und sammelte Geld ein. Auch ich reichte ihm ein Geldstück und wollte betrübt herunter gleiten. Aber Werner sagte: »So bleib doch sitzen!« – und ein neuer Wolkenritt begann, so berauschend und so kurz wie der erste. Noch mehrere Male blieben wir beide sitzen, bis all’ unser Geld verritten war, und es war immer noch viel, viel zu kurz gewesen. Zögernd stiegen wir endlich herunter. Das Dienstmädchen war mit einem Soldaten, der sie während dessen angesprochen hatte, verschwunden. Ich befand mich ganz allein in dem Gewühl – allein mit Werner Horst. In meinem Freudenrausch fühlte ich mich ihm so nahe, als wäre er mein Bruder, nur ein besserer, liebevollerer Bruder, denn er zeigte mir keine Missachtung dafür, dass ich ein Mädchen war.
Wir trieben uns eine Zeit lang zusammen auf der Festwiese zwischen den besetzten Tischen und Bänken herum, standen vor dem mit wilden Szenen bemalten Vorhang einer Tierbude, betrachteten voll Interesse das Lager einer braunen Zigeunerbande, die im Freien kochte, und fühlten uns in dem Gedränge unbeobachtet und selig. Endlich, als wir alles wohl beschaut hatten, sagte Werner:
»Jetzt geh’ ich in die Stadt Wasta, willst Du mit?«