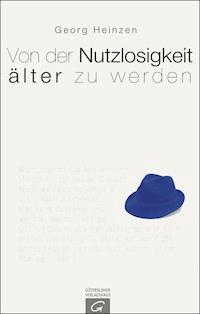9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen den Apo-Opas und der «No-future»-Generation stehen in den 80ern die Dreißigjährigen. Diejenigen, die – voller Pläne und Bildung – es einmal besser haben sollten, die aber am Ende feststellen müssen, dass die Gesellschaft gerade für Pläne und Bildung am wenigsten Verwendung zu haben scheint. Mathias ist einer von ihnen. Er erzählt seine Geschichte – und damit die Geschichte seiner Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Georg Heinzen • Uwe Koch
Von der Nutzlosigkeit, erwachsen zu werden
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Zwischen den Apo-Opas und der «No-future»-Generation stehen in den 80ern die Dreißigjährigen. Diejenigen, die – voller Pläne und Bildung – es einmal besser haben sollten, die aber am Ende feststellen müssen, dass die Gesellschaft gerade für Pläne und Bildung am wenigsten Verwendung zu haben scheint. Mathias ist einer von ihnen. Er erzählt seine Geschichte – und damit die Geschichte seiner Generation.
Über Georg Heinzen • Uwe Koch
Georg Heinzen, geboren 1953 in Düsseldorf, studierte nach einer Maschinenschlosserlehre Germanistik und Geschichte.
Uwe Koch, geboren 1954 in Düsseldorf, arbeitete nach einem Germanistik- und Philosophiestudium in einer Setzerei als Korrektor.
Inhaltsübersicht
Dreißig im digitalen Deutschland
Ich bin nicht Lokomotivführer geworden. Alles ist anders gekommen, als ich gedacht habe. Ich bin auch nicht Präsident geworden oder Urwalddoktor, nicht einmal Studienrat. Eigentlich bin ich gar nichts geworden.
Ich bin nicht Vater, nicht Ehemann, nicht ADAC-Mitglied. Ich habe keinen festen Beruf und kein richtiges Hobby. Mir fehlt alles, was einen Erwachsenen ausmacht, die Aufgaben, die Pflichten, die Belohnungen. Ich bin kein Vorgesetzter und keine Autoritätsperson, ich habe keinen Dispositionskredit und trage keinerlei Unterhaltslasten, außer für mich selbst.
Vormittags bin ich Auslieferungsfahrer. Der Rest des Tages gehört mir. Ich habe viel Zeit. Wenn man mich braucht, um bei einem Umzug zu helfen oder gegen den Aufmarsch der 6. Flotte in Mittelamerika zu demonstrieren, bin ich da. Denn ich habe wenige Termine, die ich versäumen könnte, draußen, in der Welt der Arbeit.
Ich denke oft daran, daß das Leben nicht mehr vor mir liegt. Dabei macht mir mein Alter keine Probleme, denn ich sehe ohnehin wesentlich jünger aus. Ich schaue nicht ängstlich in den Spiegel, wiege mich nicht jeden Morgen aufmerksam und mache abends keine Waldläufe. Doch manchmal habe ich das Gefühl, Zeit zu verlieren, und dieses Gefühl geht mit den Jahren nicht weg wie Pubertätspickel, sondern wird immer stärker.
Ich habe meinem dreißigsten Geburtstag gerade so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie jedem anderen auch, ein paar Freunde eingeladen, nichts weiter. Ich habe nicht an mein Glas geklopft und eine traurige Retrospektive gehalten, ich bin nicht bei der Quiche Lorraine in Tränen über mich ausgebrochen, weil ich schon so viel Leben verbraucht und so wenig gelebt habe. Ich bin nicht sentimental geworden. Denn ich bin viel zu unentschieden, ob ich darüber unglücklich sein soll, daß ich so nutzlos bin, oder mich freuen darf, daß mir das Erwachsensein erspart bleibt und in eine lebenslange Jugendstrafe umgewandelt wird. Und doch spüre ich, was das Alter verändert hat. Vor zwanzig Jahren durfte ich noch auf die Erfüllung aller meiner Träume hoffen. Heute bin ich selbst für sie verantwortlich. Ich muß sie verwirklichen oder aufgeben. Ich rechne, dreißig Jahre, sechzig Jahre, vielleicht neunzig Jahre. Die Uhr läuft wie in einem Taxi, nur ich fahre nicht.
Ich lebe wie all die Jahre vorher. Ich habe den Status eines Studenten. Doch meine Ausbildung ist längst abgeschlossen, ich bin kein Student mehr. Trotzdem fühle ich mich immer noch angesprochen, wenn von der Jugend die Rede ist. Aber ich muß feststellen, daß inzwischen andere gemeint sind, jüngere als ich, die «Sie» zu mir sagen, wenn sie mich nach der Uhrzeit fragen. Die lassen mich mein Alter spüren, denn ich bin aus der Mode gekommen.
Meine Eltern hatten mich für ein besseres Leben vorgesehen. Ich sollte ein erfolgreicher Mann werden. Einer der früh aufsteht und kalt duscht. Der mit beiden Beinen auf der Erde steht, weil er weiß, daß man die Sterne nicht vom Himmel holen kann. Der vernünftig ist und sich in das Unabänderliche fügt. Der für schlechte Zeiten vorsorgt, weil er niemals spürt, in welch schlechten Zeiten er lebt. Aber alles ist anders gekommen, als die Eltern gedacht haben.
Sie hatten mich auf die höhere Schule geschickt. Dort hieß es, wir würden nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen. Aber das Leben, für das ich lernte, wurde gerade abgeschafft. Während ich mich noch mit der «Odyssee» und den Punischen Kriegen beschäftigte, überlegten die Weitsichtigen bereits, wie man die Zeit oder den Atomkrieg in einer Streichholzschachtel unterbringen kann. Während ich mich darauf vorbereitete, gesellschaftlich wichtige Aufgaben zu übernehmen, entfielen diese Aufgaben schon wieder.
Ich bin noch vor der Digitalisierung groß geworden, über und über gebildet mit jenen geistigen Dingen, für die es immer weniger Verwendung gibt. Ich kann keine Computersprache, und die Sprache, die ich gelernt habe, wird in der neuen Wirklichkeit immer weniger gebraucht. Der technische Fortschritt hat mich wieder zum Analphabeten gemacht. Ich bin vom Kreislauf der Angebote ausgeschlossen, seit mein Gebrauchswert gegen Null sinkt.
Meine Eltern hätten sich diese Entwicklung genausowenig träumen lassen wie ich. Doch sie glauben immer noch hartnäckig an meine Zukunft, weil sie auch ihre Zukunft sein soll. Und sie machen sich weiter Sorgen wie all die Jahre, keine vernünftigen Sorgen, Elternsorgen eben, daß ich die Treppe nicht regelmäßig putze oder die Miete zu spät überweise oder beim Demonstrieren festgenommen werde. Sie hoffen, es läge an meiner Unentschlossenheit, daß ich das Richtige noch nicht gefunden habe. Dabei habe ich gar keine Möglichkeit mehr, mich für irgend etwas zu entscheiden.
Ich muß ohnmächtig und kopflastig zusehen, wie sich die billigsten Ideen durchsetzen und die Verantwortungslosesten die Verantwortung tragen. Ich gehöre zu dem lebensunwerten Leben, dem die Arrivierten der freien Marktwirtschaft die Existenzberechtigung absprechen. Ich belaste das soziale Netz mit meinen Forderungen, für die ich kaum Leistungen erbringe. Ich stehe den Tüchtigen im Weg, die ihre Geschäfte um mich herum aufziehen, so daß ich mich mit meinen dreißig Jahren und vierzig Jobs wie ein Hundertjähriger fühle, der zusehen muß, wie um sein Haus herum ein Autobahnkreuz gebaut wird. Ich stehe den Erfolgreichen im Weg, treibe ihre Steuern hoch und mache ihnen ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihren Wohlstand genießen wollen. Und eigentlich könnte ich dieser Gesellschaft zusammen mit den anderen unnützen Essern nur noch den Dienst erweisen, vom Erdball abzuspringen, damit es wieder Parkplätze und freie Wohnungen gibt.
Aber noch lebe ich nicht im Freien. Ich habe ein schönes Zimmer, in das morgens die Sonne scheint, ich trinke Bohnenkaffee und fahre im Sommer nach Italien. Ich habe noch nicht in Mülleimern nach Nahrung gesucht oder in Altglascontainern nach Alkohol. Ich habe ein Krankenscheinheft, und die Kasse zahlt 60 Prozent von jeder Jacketkrone. Doch ein paarmal habe ich mich schon gefragt, ob das Zahngold in meinem Mund mir nicht einmal mehr nützen kann, als mich vor Karies zu schützen.
Ich bin einfach ein paar Jahre zu spät geboren worden. Mein Arbeitsplatz war noch zu vergeben, als ich mit kritischem Bewußtsein und dem festen Willen, die Revolte wichtiger als die Karriere zu nehmen, ein Studium begann, das schon zu nichts mehr führte, bevor ich es beendete. Mit einem optimistischen Bewußtsein wuchs ich in eine Zeit hinein, die sich wieder gewendet hatte, während ich noch zu jung war, das zu begreifen.
Mit dem Gefühl, für vieles geeignet zu sein, muß ich heute feststellen, daß ich für nichts gebraucht werde. Ich verkaufe mich stundenweise, weit unter Wert, erledige untergeordnete Arbeiten. Dabei glaube ich, die Probleme der ganzen Welt lösen zu können, wenn man mich fragen würde. Aber niemand interessiert sich für meine Ansichten.
Ich hatte meine eigenen Ideen von einem sinnvollen und erfolgreichen Berufsleben. Ich wollte nicht nach zwanzig Jahren Lernen ein Abschlußzeugnis entgegennehmen, einen Händedruck, der endgültig letzte Bafög-Scheck würde verrechnet, noch ein Händedruck, ein Besuch beim Friseur, ein Herrenkonfektionsgeschäft: Sitzt wie angegossen, mein Herr, eine Aktentasche, ein Büro, man wechselt aus der Verantwortungslosigkeit in ein System von Verpflichtungen und Belohnungen, tauscht die Träume gegen Sicherheit. Die schöne Zeit der Jugend ist unwiderruflich vorbei. Ich wollte immer anders werden als meine Eltern. Aber ich habe nie gesagt, daß ich gar nichts werden wolle.
Manchmal bin ich des Überflüssigseins so überdrüssig. Und es gibt Tage, da wünsche ich mir, einer von den Ordentlichen, den Vernünftigen, den Normalen zu sein. Dann sehne ich mich nach der felsenfesten Einfalt derer, die sich entschlossen haben, zweifelsfrei mitzumachen, die Gewinner sein wollen und sich freuen können über Tore und Medaillen. Die immer auf der richtigen Seite stehen. Für die auch die Nachrichten gute Nachrichten sind, die mir schon morgens früh den Tag verderben. Warum muß ich immer an den Atomkrieg denken, während die anderen Angst haben, an Raucherkrebs zu sterben oder vom Bus überfahren zu werden? Warum habe ich keine Aufgabe, die mich ablenkt und aus den Träumen zurückholt auf den Boden der Tatsachen? Die Luft mit Stickoxyden anreichern, Arbeitsplätze wegrationalisieren, Asylanten in ihre Heimat zurückführen oder eine Raketenlücke schließen, es wäre mir bisweilen egal. Ich könnte endlich morgens mit einer Aktentasche ins Büro gehen, mein Jackett sorgfältig auf einen Bügel hängen, Kuli und Schreibunterlage parallel ausrichten, dann gäbe es Kaffee, und schon käme ein erster Anruf, und ich sagte «Grewe» ins Telefon. Aber dort, wo ich vormittags aushelfe, habe ich kein Telefon, und zu Hause melde ich mich immer noch mit Mathias Grewe, weil die meisten, die mich anrufen, meine Freunde sind. Allerdings ruft auch mal der Vermieter an, oder mein Zahnarzt erinnert mich, wenn ich den Krankenschein fürs neue Quartal vergessen habe.
Ich möchte einfach mal einen Beruf vorweisen können, wenn man mich danach fragt. Aber was soll ich antworten? Auslieferungsfahrer? Germanist? Ich fühle mich nicht als Auslieferungsfahrer, und unter einem Germanisten stelle ich mir einen Professor vor oder zumindest einen Privatdozenten. Ich aber bin nicht einmal Assistent oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern ein ausgemusterter Student, nichts weiter.
Wenn ich Lehrer wäre, dürfte ich abends durch ein Spalier dankbarer Schüler in meine Kneipe gehen. Oder wenn ich Redakteur bei einem kritischen Fernsehmagazin geworden wäre, würde man mit dem Finger auf mich zeigen und über mich tuscheln, wenn ich auf New Yorks St. Marks Place eine Pina Colada trinken würde.
Andere haben zumindest Kinder. Sie stehen auf dem Stadtteilfest und unterhalten sich, und dann ruft eine Pippi Langstrumpf «Papi, Papi» quer über die Festwiese, und die gesellschaftliche Rolle ist heraus, vor aller Augen. Als Vater wäre ich wenigstens Erziehungsberechtigter, selbst wenn meine Aufgabe darin bestehen würde, die Anträge an das Sozialamt zu stellen. Das gäbe natürlich später noch eine Menge Schwierigkeiten, wenn sie meine Nina in der Schule nach dem Beruf ihres Vaters fragen sollten. Was würde sie dann sagen? Mein Vater hat keinen Beruf, oder: mein Vater ist beinahe Lehrer geworden, aber keiner will ihn. Er ist viel zu Hause, kocht für uns, wäscht, hält die Wohnung sauber, arbeitet in einer Bürgerinitiative, wo er freche Flugblätter entwirft, regt sich über das Radio auf, liest dicke Bücher und bringt mir gerade bei, wie man mit den Ohren wackelt?
Jutta, meine Freundin, möchte auch lieber mit einem Mann beim Frühstück sitzen, der einen interessanten Beruf hat, als mit einem Opfer der Verhältnisse. Trotzdem tröstet sie mich. «So wie dir geht es doch hunderttausend anderen auch», sagt sie. «Na und?» entgegne ich dann gereizt. «Ist mir doch scheißegal, wie es den anderen geht. Das macht mich nicht glücklicher.» Genauso haben früher doch auch meine Eltern geredet. Da mußten immer die Negerkinder oder die Verwandten aus Stralsund herhalten, damit ich begreifen sollte, wie gut ich es eigentlich hatte.
Ich sitze in meiner Küche, die eigentlich Juttas Küche ist. Aber seit ich zu ihr gezogen bin, ist es eben auch meine Küche. Ich sitze auf dem bequemen Sofa, von dem ich mich seit Jahren noch bei keinem Umzug trennen konnte, obwohl es furchtbar schwer ist. Ich trinke Kaffee aus einer großen französischen Tasse mit Silberrand, ermahne die Katze, die Pfoten vom Kühlschrank zu lassen, und denke über mein Leben nach.
Warum, frage ich mich, ist es den Eltern so gehörig mißlungen, ihr Lebensmodell an mich weiterzugeben? Und warum waren alle meine Pläne vom Erwachsensein Träumerei? Warum arbeite ich lieber ungeregelt, als mein Leben für sinnlose Belohnungen herzugeben? Warum gehöre ich nicht zu denen, die sich bereitwillig in das System aus Sicherheit und Abschreckung stürzen? Warum ist alles anders gekommen, als alle gedacht haben, meine Erzieher und ich selbst, nur wegen der Mikrochips und der gestiegenen Ölpreise? Warum bin ich kein guter Deutscher geworden und kein netter Sozialpartner?
Väter und Geschichte
Ich sollte es einmal besser haben als meine Eltern. Wie oft haben sie das gesagt? Und wie drohend hörte es sich immer an, wo es doch so gut gemeint war? Meine behütete, aber strenge Kindheit ist aus diesem Satz zu verstehen, den ich nicht verstand, als ich noch ein Kind war.
Nach allem, was ich beurteilen konnte, bevor ich in das Alter kam, Vergleiche anzustellen, ging es meinen Eltern gut. Wodurch sollte ich sie einmal übertreffen können? Wir hatten eine Musiktruhe mit Zehnplattenwechsler und einen Orientteppich mit Fransen, die Mutter jeden Morgen kämmte. Wir hatten auch schon ein Fernsehgerät, als das noch etwas Besonderes war.
Die Eltern ließen mich kein Unglück spüren, sie verbargen ihre Sorgen vor mir, und Kummer zeigten sie nur, wenn ich ihn verursacht hatte. Was wußte ich von der Vergangenheit, die hinter ihnen lag, was kannte ich von der grauen Vorgeschichte meines Lebens? Sie redeten nicht darüber.
Der Krieg? Der Krieg war schon unendlich weit weg. Alles, was vor meiner Geburt stattgefunden hatte, vermischte sich in meiner Vorstellung zu einer legendären Frühzeit: Ritterburgen, Luftschutzbunker, Kaiser Wilhelm und die Hochzeit der Eltern. In meinen Abenteuern bin ich dem Krieg dann auf den verbotenen Spielplätzen begegnet, wo es nach kalter Asche und scharfem Urin roch. Zwischen geschwärzten Brandwänden, die mit Kiefernstämmen auseinandergedrückt wurden. In geborstenen Bunkern, wo feuchte Gesteinsklumpen an rostigen Moniereisen hingen. Wo die Eltern uns nicht erreichten mit Rufen und Verboten. Ich sah Männer mit Sonnenbrille mitten im Winter und blieb verwundert vor ihnen stehen. Doch ehe ich etwas sagen konnte, hatte Mutter mich am Arm fortgezogen und mir befohlen, still zu sein. Ich sah das Foto von einem Soldaten, der sollte mein Onkel sein und war viel jünger als alle anderen Onkel und Tanten. Daß er gefallen war, erzählte Mutter mit gedämpfter Stimme. Ich verstand es nicht. Ich war schon so oft gefallen.
Mutter erklärte: «Im Krieg fallen Bomben, und alle Leute müssen in den Keller, und Vater ist weit weg, und wir wissen nicht, ob er wiederkommt.» Ich konnte mir nur die Nacht im Keller schrecklich ausmalen. Vater war schließlich auch jetzt meistens weg. Er ging für uns arbeiten und kam spät nach Hause. Und als hätte sie mir zuviel zugemutet, sagte Mutter nach solchen Erinnerungen zu mir: «Nun denk nicht mehr daran.»
Wenn ich sonntags keinen Pudding mehr mochte, sagte Vater: «Euch geht es zu gut.» Und wenn er «euch» sagte, meinte er nicht nur meine kleine Schwester Iris und mich. Zum erstenmal wurde ich bei solchen Gelegenheiten als Vertreter meiner Generation angesprochen. Ich lernte, daß ich ein Kind des Wirtschaftswunders war. Als Nachkriegszeit galten nämlich nur die schlechten Jahre, als sie noch nicht wußten, ob sie den Krieg verloren hatten oder sich befreit vorkommen sollten. Bevor sie sich für beides entschieden hatten, mußte es eine dunkle Epoche gegeben haben, in der es nichts zu kaufen gab, außer auf dem Schwarzmarkt, und das war schon wieder ein Wort, unter dem ich mir nichts vorstellen konnte.
Der Sonntag war der Tag der Familie. Und so wie unsere Nachbarn, die katholisch waren, morgens gemeinsam zur Kirche gingen, gingen wir nachmittags immer in demselben Park spazieren. Dazu setzte Vater seinen Hut auf und hängte sich seine Kodak-Retina um, die in einem braunen Lederetui steckte, und Mutter packte immer ein Päckchen Papiertaschentücher für alle Fälle in ihre Handtasche und zwanzig Pfennig für die Toilettenfrau, weil Iris unterwegs jedesmal zum Klo mußte. Ich ging mit Vater vorneweg. Er erklärte mir die Baumarten und nannte die Namen der Vögel, die wir hörten, und wenn ich ihn danach fragte, hielt er auch ein paar Lektionen über die Anfänge unserer Demokratie. Alle waren gleich gewesen. Jeder hatte mit vierzig Mark begonnen. So war der Staat entstanden, in dem wir lebten. Aber diese einfache Erklärung machte meine Verwirrung nur noch größer, denn inzwischen gab es große Unterschiede zwischen den Menschen. Unsere Nachbarn von gegenüber wohnten in einem eigenen Haus mit einem Balkon, der um die Ecke ging. «Wie wird man reich?» wollte ich wissen, und Vater lächelte, als ob er mir nicht alles erzählte: «Wenn man das Geld für sich arbeiten läßt, ist man reich.» Und ich stellte mir das Geld vor, wie es arbeitete. «In einer Demokratie», sagte Vater, «da entscheidet die Mehrheit über die Minderheit. Aber jeder ist frei und kann tun, was er will, solange er die anderen dabei nicht schädigt.» Und der Staat? «Das sind wir alle, die Regierung und die Bürger. Wir bilden zusammen den Staat.» Den geteilten, man hatte uns etwas weggenommen. Aber Vater sagte auch, er wolle es gar nicht wiederhaben. Er wollte nichts mehr erobern. Er wollte zu Hause bleiben, weil er glaubte, so am wenigsten falsch machen zu können. Alles, was Vater mir mit auf den Weg geben wollte, waren Chancen. Die Geschichte mit den vierzig Mark sollte mir vor Augen führen, daß jeder seines Glückes Schmied ist und daß ich das Recht hätte, etwas von der Zukunft zu erwarten.
Vater hatte Angst um meinen Erfolg. Mutter hatte Angst um mein Leben.
Einmal halfen wir Kinder, einen Lieferwagen aus dem Schlamm unseres Neubauviertels herauszuziehen, und bekamen Negerküsse zur Belohnung. Mutter glaubte die Geschichte nicht und freute sich nicht über die Negerküsse. Sie brachte mir die Angst vor Fremden bei. Ich fürchtete mich nun erst recht davor, in den Keller zu gehen.
Sie spannten den lieben Gott mit in die Erziehung ein, als Hilfspolizisten mit Bereitschaftsdienst rund um die Uhr. Er wurde dort mit meiner Observierung betraut, wo sie nicht mehr hinschauen konnten. So bekam ich ein Gewissen.
Dieser liebe Gott wußte mehr über mich als ich selber, er wußte alles. Er war immer in meiner Nähe, vermutlich hinter meinem Rücken, aber auch im Spiegel konnte ich ihn nicht entdecken. Er war wohl unsichtbar, konnte aber auch im Dunkeln sehen. Sogar im Bett konnte er mich beobachten und auf dem Klo auch. Selbst die Eltern gaben zu, vor ihm Angst zu haben, und sie hatten doch sonst vor niemand Angst, außer vor den Russen. Sie selbst gingen nicht zur Kirche, schickten mich und Iris aber jeden Sonntag hin. Sie beteten auch nicht bei Tisch. Ich betete jeden Abend, sobald das Licht aus war. Ich trug dem lieben Gott alles vor, was die Eltern nicht wissen durften, weil sie es nicht verstanden hätten. Ich hatte oft Angst, sie könnten plötzlich sterben und ich sei schuld daran, weil ich immer so ungezogen war. Ich hatte Angst vor meinem Körper wie die Eltern, die sich immer hinter verschlossener Badezimmertür wuschen. Ich träumte, ich ginge nackt durch die Stadt, und alle lachten über mich.
Ich hatte Angst vor den Erwachsenen. Vor dem Nachbarn, der immer Nachtschicht hatte und unsere schönsten Fußballspiele durch ein Klopfen an die Fensterscheibe beendete. Vor dem Hausmeister, der mich an den Ohren zog, wohin er mich gerade haben wollte, um ein Kaugummipapier aufzuheben. Vor dem unheimlichen Onkel Heiner, der mich hoch in die Luft werfen konnte und mich glücklich machte mit fünfzig Pfennig aus seinem Portemonnaie. Vor Vater, der mit knappen Handbewegungen meiner Mutter Befehle erteilte und schwere Kisten tragen konnte. Der nicht aufessen mußte wie ich und vom Tisch aufstehen durfte, wann er wollte. Die Erwachsenen brauchten sich von niemand etwas sagen zu lassen, sie hatten es besser als ich. Ich wollte gerne groß sein.
Die höchste Macht von allen Erwachsenen besaß Vater. Sein Hoheitszeichen war die braune Aktentasche, an die ich nicht herandurfte. Manchmal mußte er am Wochenende zu Hause arbeiten, dann durfte ich ihn nicht stören. Und wenn er nicht arbeitete, mußte ich auch leise sein, denn dann ruhte er sich von der Arbeit aus.
Vater zeichnete etwas, was nicht schmutzig werden durfte, und benutzte viele Lineale. Manchmal fuhr er mit dem Finger durch ein Gewirr von Linien, die ich so wenig verstand wie Mutters Schnittmusterbogen, und erklärte mir, nach der Zeichnung würde ein großer Kran gebaut, und der Kran würde nach Indien verkauft. Er machte Pläne, lernte ich. Pläne machen war ein schöner Beruf.
Mutter war immer zu Hause. Sie war zuständig für Butterbrote, Heftpflaster und Limonade, und darunter litt ihre Strenge. Vater war selten zu Hause, und wenn er da war, mußte er beweisen, daß er sich auch um die Erziehung kümmerte, und darunter litt seine Milde. Mit Strenge, dachte er, würde er nichts falsch machen können, nicht vor Gott und auch nicht vor der Allgemeinheit. Milde erschien ihm als Risiko, für das er einmal zur Verantwortung gezogen werden könnte, wenn etwas schiefgehen sollte mit meiner Entwicklung.
Liebe zu zeigen, war eine Nachlässigkeit, die sich der Vater nur ganz selten gönnte, nicht nur zu meiner, auch zu seiner Belohnung. Wenn er mich bestrafte, erklärte er, daß er mich trotzdem liebte. Und wenn er mich schlug, beteuerte er, es täte ihm genauso weh wie mir. Aber das konnte ich nicht glauben.
Mutter schien manchmal ein schlechtes Gewissen zu haben, mich zu lieben. Sie übertrug das Strafen dem Vater. Sie vergab Prügel, die nicht sofort ausgeteilt wurden, sondern erst am Abend. Die schlimmste von Mutters Strafen aber war ihr Schweigen, das mich härter traf als Vaters Verlängerungskabel und durch kein Bitten und Betteln zu durchbrechen war.
Vater war der Chef, über uns Kinder, meine Mutter und den Ford Taunus, der wochentags unter einer grauen Regenplane verborgen blieb, weil Vater zu Fuß ins Büro ging. Samstags bei Ausflügen ins Grüne lenkte er ihn, wohin er wollte. Und mußte Iris aufs Klo, kam es vor, daß er nicht anhielt, weil er gerade jemand überholt hatte.
Auf unserer Straße grüßten sich die Väter mit Vornamen. Samstags waren sie eine Gemeinschaft verschworener Bastler an ihren Autos, Herrscher über blitzende Werkzeuge und ein geordnetes System von Schraubendöschen, von denen wir Kinder die Finger zu lassen hatten.
Vater liebte mich so, wie er seine Arbeit liebte. Vielleicht liebte er mich sogar etwas mehr, aber diese Mehrliebe machte ihn wortkarg. Er lenkte den Fluß dieser Liebe in einen Kanal aus Verantwortung und Sorge. Sorge war der Sinn seines Lebens geworden. Die Sorge um die Familie ließ ihn Enttäuschungen vergessen. Die gestohlene Lebenszeit bei der Wehrmacht, die Gefangenschaft in Rußland, die unkorrigierbaren Irrtümer seines Lebens, die freiwilligen Zwangsarbeiten, die tägliche Pünktlichkeit, die unterdrückten Krankheiten und die unendlichen Überstunden wurden sinnvoll durch uns, die Nutznießer. Ich lernte, daß ein erwachsener Mann dazu bestimmt ist, Frau und Kinder zu versorgen.
Über Politik wurde möglichst nicht gesprochen. Aber einmal gab es einen ermordeten Präsidenten. Das ist die erste Geschichte der richtigen Geschichte, an die ich mich erinnern kann. Die Erwachsenen standen alle in unserem Wohnzimmer, meine Eltern, die Nachbarn und sogar der Hausmeister, und sie vergaßen, mich ins Bett zu bringen. Sie standen betreten beieinander und fragten sich leise, was jetzt wohl werden würde. Tage später, als ich die Bilder der schönen Witwe sah, fragte ich, wer das war, der tote Präsident. Und Mutter antwortete: «Er hat uns vor dem dritten Weltkrieg gerettet.» Da bewunderte ich Präsident Kennedy.
Auch als Chruschtschow gestürzt wurde, fürchteten die Eltern, daß es Krieg gebe. Am sichersten schien die Welt zu sein, wenn sich nichts änderte. Aber dann beruhigten sie mich wieder und sagten, daß es wahrscheinlich doch keinen Krieg mehr geben werde, weil beide Seiten die Bombe hätten. Ich wollte wissen, was die Bombe ist, und sie sagten, die Bombe könnte die ganze Welt vernichten und deshalb würde niemand mehr Krieg anfangen. Da war ich froh, daß es die Bombe gab.
Draußen ging die Geschichte weiter, aber die Eltern wollten nicht viel davon wissen. Selbst was sie wählten, hielten sie vor uns Kindern geheim. Wenn sie sonntags zum Wahllokal gingen, waren sie ernst und schweigsam, und ich durfte nicht mit hineingehen, so wie mich meine Mutter auch manchmal vor der Drogerie warten ließ, wenn sie etwas einkaufte.
Alle Themen, bei denen die Eltern die Stimme senkten, wurden für mich interessant, und ich wurde um so neugieriger, je weniger sie davon sprachen. Ihre Geschichten vom Krieg waren bruchstückhaft, wiederholten sich, ergaben kein Bild vom Ganzen. Ihre Erklärungen waren eine Art Kommuniqué, über das hinaus sich alle Beteiligten zum Stillschweigen verpflichtet hatten. So wurde der Krieg, den ich nicht miterlebt hatte, für die Eltern noch einmal zur Prüfung, die sie nicht bestanden. Denn eines Tages war ich groß genug, um an ihren Erklärungen zu zweifeln, und entschlossen, mehr in Erfahrung zu bringen.
Sonntag mittags beim Rollbraten eröffnete ich die Beweisaufnahme. Das Verfahren war öffentlich, denn Iris saß mit am Tisch. Im Internationalen Frühschoppen war über einen fernen Krieg geredet worden, und Mutter hatte den Amerikaner bewundert, weil er so gut Deutsch sprach. Ich hatte meinem Vater gesagt, daß ich nicht in so einen Krieg gehen würde, und schon hatte er sich angegriffen gefühlt und geantwortet, wenn es erst einmal soweit sei, gäbe es keine Kriegsdienstverweigerung mehr, dann würde man an die Wand gestellt. Bei diesem Thema waren wir geblieben, nur Mutter versuchte vergeblich, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, und forderte uns auf, nichts übrigzulassen. Sie wollte Vater vor unseren Fragen bewahren und uns Kinder vor seinen Kriegserlebnissen.
Ich führte das Verfahren nach einer autoritären Prozeßordnung: Wer sich verteidigt, klagt sich an. Vaters erste Einlassung war, daß man von alldem nichts gewußt habe. All das. Die Begriffe blieben ungenau, wie zum Beweis ungenauer Kenntnisse. Als Zeugin rief ich die Mutter auf. Sie bestätigte, daß die Angst groß gewesen sei. Aber vor was, fragte ich, hätten sie Angst gehabt, wenn sie von den Konzentrationslagern nichts gewußt hatten? Die Eltern konnten sich über meine Fähigkeit zu klaren Schlußfolgerungen nicht freuen. Natürlich habe man von den Lagern gehört, aber nicht von der Sache mit den Juden. Die Sache blieb weiter unaussprechlich. Die Beschuldigten verweigerten jede weitere Auskunft mit dem Hinweis: Ihr habt es doch nicht miterlebt. Vater ging zum Gegenangriff über. Er zündete sich eine Zigarre an, nahm einen kräftigen Zug und sagte: «Wenn du damals gelebt hättest, wärst du auch dabeigewesen», während das Streichholz, das er immer noch hochhielt, langsam niederbrannte. Und mit dem Dabeisein meinte er nicht die Kolonnen der Deportierten, nicht die an die Wand gestellten Wehrkraftzersetzer, sondern die Begeisterten, die Denunzianten womöglich, zumindest die Biederen, die die Arme gereckt hatten.
Die Verhandlung wurde unterbrochen. Das Gericht zog sich zur inneren Einkehr in sein Kinderzimmer zurück. Ich hatte es nicht miterlebt. Die Eltern trugen an der Schuld ihrer Zeitgenossenschaft, und ich trug an meiner Nichtzeitgenossenschaft, denn niemals, hoffentlich, würde ich beweisen müssen, daß ich mutiger als sie gewesen wäre. Aber wenn es, wie sie immer wieder behaupteten, keine Schuld aller gab, auch nicht die Schuld, geduldet zu haben, warum wurden sie dann so wütend, wenn ich sie danach fragte?
In der Schule lernte ich von den Geschwistern Scholl und Claus Graf Schenk von Stauffenberg. Einmal gab es eine Feierstunde. Der Direktor lobte die Demokratie, warnte vor der Gewaltherrschaft und rieb sich während seiner Rede nervös die Hände, weil ein Rednerpult, das ihn geschützt hätte, schon als unmodern galt. Das Pflichtpensum der jüngsten Geschichte wurde so verklemmt behandelt wie die Sexualkunde im Religionsunterricht. Dort wollte ich wissen, wie die Liebe geht, und sie antworteten, daß die Liebe etwas Heiliges sei. Hier fragte ich, wie konnte der Krieg geschehen? Und sie erwiderten, er dürfe sich nie wiederholen.
Erst später entdeckte ich hinter diesen offengebliebenen Fragen das Geheimnis der Arbeitsmoral der Väter. Sie sprachen sich von Auschwitz frei, indem sie bis zum Umfallen schufteten. Zeit zu haben, war ohnehin liederlich. Keine Zeit zu haben, hatte schon immer als Entschuldigung gereicht, auch gegenüber den schrecklichsten Verbrechen gleichgültig zu bleiben. So waren die deutschen Sekundärtugenden über den Zusammenbruch herübergerettet worden. Nun fanden die Väter ihr Glück wieder in der Pflichterfüllung, nur diesmal ohne Deutsche Arbeitsfront, in Nyltest und Sandalen, und vielleicht hatten sie wirklich nicht anders gekonnt. Man hatte ihnen beigebracht, daß Pflicht an sich schon etwas Gutes sei und Gehorsam eine Tugend und daß Fleiß einen Menschen auszeichne, gleichgültig, auf was er verwandt wird.
«Warum denn?» fragten später undankbare Kinder wie ich, denen es zu gut ging. Vater konnte mir kein einziges Mal eine richtige Antwort darauf geben. Er spürte wahrscheinlich, daß es ihn aus der Bahn werfen könne, wenn er dieser Frage zu genau nachginge. Er erinnerte mich mit leisem Vorwurf an unseren Wohlstand und fand, nachdem der liebe Gott als zu altmodisch ausgeschieden war, einen neuen Erziehungshelfer: den Kommunismus. Von nun an durfte die DDR an meiner weiteren Entwicklung abschreckend mitwirken. Mein Cousin Thomas in Stralsund etwa hatte große Schwierigkeiten, zur Konfirmation zu gehen. Was bekam ich dagegen alles geschenkt? Onkel Heiner hatte mir eine riesige Armbanduhr mit Datum und Leuchtzifferblatt geschenkt, die meinen linken Arm so sehr herunterzog, daß Mutter befürchtete, ich könnte Haltungsschäden bekommen. Thomas dagegen hatte nicht einmal einen richtigen Konfirmandenanzug, weil es in der ganzen Ostzone nur Jugendweiheanzüge gab. Und Renate, Thomas Mutter, hatte sich über die Camelia-Binden mehr gefreut als über die Pralinen. Dieses letzte Beispiel, das Vater anführte, war Mutter gar nicht recht, denn sie hatte mir noch nicht gesagt, wofür die Binden gebraucht wurden. Jedenfalls freute sich unsere Verwandtschaft in Stralsund über die Pakete, und das bewies wenigstens für die Gegenwart, in der Weltgeschichte auf der richtigen Seite zu stehen.