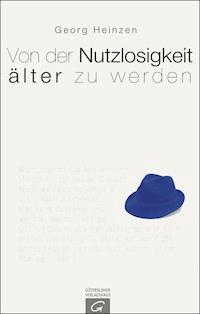
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Kultbuch für die Generation der Träumer, die in die Jahre gekommen ist
Nach dem Sensationserfolg des Kultbuches »Von der Nutzlosigkeit, erwachsen zu werden« ist nun, 25 Jahre später, die Zeit reif für eine Fortsetzung: Die Generation der damals Dreißigjährigen ist gewissermaßen in die Jahre gekommen und fragt sich, was aus ihren Träumen eigentlich geworden ist.
»Werde demnächst 50 und weiß nicht, was ich an dem Tag machen soll. Eine Party? Abhauen? Mir die Kante geben? Wenn ihr Ideen habt, meldet euch!«
Mit diesem Hilferuf in Facebook fängt alles an …
Und so gibt es einen Ort und ein Treffen: Sechs Menschen, sechs Geschichten, sechs Schicksale - eine Generation und ein großes Thema: Was bedeutet es, älter zu werden? In den tragikomischen Meetings der Leidensgenossen entsteht das Portrait einer Generation, die mit der Idee groß wurde, »for ever young« zu sein, und nun mit dem Problem konfrontiert ist, nicht alt werden zu dürfen.
- Die Fortsetzung des Bestsellers aus den achtziger Jahren
- Wunderbar komisch, treffend und nachdenklich zugleich
- Ein erzählendes Sachbuch, das den Nerv einer ganzen Generation trifft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
May you stay forever young Forever young, forever young May you stay forever young
Bob Dylan
1
Werde 50 und weiß nicht, was ich an diesem Tag machen soll. Eine Party? Abhauen? Mir die Kante geben? Wenn ihr Ideen habt, meldet euch!
Mit diesem Hilferuf auf Facebook fing alles an. Dabei gab es bis vor ein paar Wochen einen klaren Plan: Ich würde mit meiner Familie übers Wochenende nach Kreta fliegen, und wir würden zusammen bei »Jorgos« feiern. Während unseres letzten Urlaubs hatte ich mit Jorgos alles besprochen: keine Reden, kein Feuerwerk, keine Musiker, die um Mitternacht auf der Lyra Happy Birthday spielen. Einfach alles so wie immer – gemischte Vorspeisen, Wein aus der Umgebung und gegrillte Dorade, die Jorgos unter Umgehung des Artenschutzabkommens nachts mit seiner Harpune jagt. Und das an einem der wackligen Tische, die Jorgos bei schönem Wetter auf den schmalen Streifen Sand zwischen seiner Taverne und dem Libyschen Meer stellt. Jorgos hatte mir ein Foto gemailt, das seitdem als Bildschirmschoner auf meinem Laptop läuft: ein blauer Tisch, darauf zwei Karaffen mit Essig und Olivenöl, dahinter das glitzernde Meer. Alles war vorbereitet für meinen 50. Geburtstag.
Dann ging die Sekretärin unseres Fachbereichs in die Babypause, und Dorata schob jetzt den Postwagen über den Flur.
Um das ein für alle Mal klarzustellen: Ich liebe meine Frau und bin ihr all die Jahre treu geblieben, seit wir auf der Party des AStA-Frauenreferats zu Because the Night miteinander getanzt haben. Wobei strenggenommen nur Martina getanzt hat. Ich versuchte, irgendwie über die Runden zu kommen. Ich bin ein lausiger Tänzer und dachte, damit wäre ich schon aus dem Rennen. Dann ergriff eine Frau mit kurzen, rotgefärbten Haaren das Mikrofon und rief: »Was macht eigentlich der Schwanzträger hier?!«
Damit war ich gemeint.
Um noch etwas klarzustellen: Es war Martinas Idee, mich auf diese Party anlässlich des Internationalen Frauentags zu schleppen. Ich war der einzige Mann. Okay, dachte ich, während mich lauter Frauen mit kurzen, roten Haaren anstarrten, ihr wollt unter euch bleiben. Kann ich verstehen nach 7.000 Jahren Patriarchat, auch wenn ich es nicht fair finde, dass ausgerechnet ich jetzt den ganzen Ärger abbekomme. Ich trinke nur noch schnell mein Bier aus und gehe.
Aber Martina stellte sich vor mich und sagte: »Du bleibst!«
Ich bin 26 Jahre geblieben und wäre immer noch mit Martina zusammen, wäre sie nicht vor einer Woche ausgezogen. Wegen Dorata. Dabei ist die Affäre mit Dorata längst vorbei. Außerdem war es gar keine richtige Affäre. Eine Affäre, das ist so etwas, was Bill Clinton und Monica Lewinsky im Weißen Haus hatten, wobei Dorata auch eine Praktikantin ist. Wir trafen uns zufällig in der Teeküche unseres Instituts, die zugleich Kopierraum ist. Das Kopierpapier war ausgegangen, weshalb Dorata auf einen Stuhl stieg, um neues Papier aus dem Hängeschrank über meinem Kopf zu holen und mir so Gelegenheit gab, den Schmetterling zu bewundern, der unter ihrem hochrutschenden T-Shirt zwischen ihrem Bauchnabel und dem Bund ihrer Jeans auftauchte.
Eigentlich finde ich Tattoos billig, auch wenn ich mich inzwischen daran gewöhnt habe. Als ich noch jung war, so jung wie Dorata, trugen Tattoos nur Männer, die auf dem Bau arbeiteten, oder Hells Angels. Heute sind alle meine Studenten tätowiert, soweit ich das beurteilen kann. Doratas Schmetterling war nicht schön, die Farbe war an den Rändern verlaufen. In ein paar Jahren sähe der Schmetterling aus wie eine Hautverfärbung, wegen der man sich Sorgen machen müsste. Eine spontane Idee im Urlaub: Man denkt nicht lange nach, die anderen machen es auch, und schon bekommt man einen Stempel aufgedrückt für den Rest seines Lebens. So etwas macht man nur, wenn man nicht über die lebenslangen Folgen solcher Dummheiten nachdenkt, weil das Leben noch vor einem liegt. Diese Unbekümmertheit traf mich in der Teeküche wie ein Fausthieb. Der kleine Schmetterling machte mir schmerzhaft klar, wie viele Jahre zwischen uns lagen. Und ich schämte mich plötzlich, so grau und faltig zu sein. Wobei es weniger mein Alter war, ich bin erst 49, ein Mann in den besten Jahren, sondern Doratas Jugend, die diese Beschämung auslöste. Das bohrende Bedauern, so viele Dinge versäumt oder nicht rechtzeitig erledigt zu haben. Und dieses Gefühl hing mit meinem immer näher rückenden 50. Geburtstag zusammen.
Dabei versuchte ich, die Sache nicht zu hoch zu hängen. Es war einfach nur ein Datum. Das Leben ging weiter. Es war nicht wie Gratis-Software auf einem neuen Computer: Am Morgen nach meinem 50. Geburtstag würde ich nicht wach werden und bestimmte Körperfunktionen wären abgeschaltet, weil sich das Abonnement nicht automatisch verlängert. Hoffte ich zumindest.
Ich sprach mit unserem Rektor, der dieses magische Datum schon hinter sich hatte. Er klopfte mir in der Mensa auf die Schulter, eine Geste, die ich eigentlich hasse, aber jetzt genoss, weil sie klarstellte, wer hier der Ältere war.
»Du wirst erst 50, Thomas, das ist gar nichts. Der 60. Geburtstag, der ist hart. Da wird es langsam ernst.«
Der Rektor kippte die Essensreste in den Abfall und stellte seinen Teller aufs Band, wo er langsam in der Spülmaschine verschwand. Mich erinnerte diese Szene an eine Feuerbestattung, der ich einmal beigewohnt hatte, wo sich der Boden öffnete und den Sarg verschluckte. Ich verstand die Botschaft und joggte am Abend ein paar Runden mehr, als ob ich dem Tod davonlaufen könnte.
Vier Wochen! Nur noch vier Wochen bis zu diesem verdammten Datum – ratterte es in meinem Gehirn.
Als ich vor ein paar Jahren nach einem Burn-out Autogenes Training machte, erklärte der Kursleiter, unsere Gedanken wechselten alle 30 Sekunden ihr Objekt. Bei mir übrigens alle 15 Sekunden, wenn nicht noch schneller. Ziel des Trainings war es, den Monkey Mind dazu zu bringen, einfach mal ein paar Minuten stillzusitzen, statt weiter zum nächsten Ast zu springen. Dies sollten wir durch eine spezielle Atemtechnik erreichen. Ich schaffte es, ganze 60 Sekunden an eine einzige Sache zu denken, meistens war es Sex, bevor meinen Affen das Fell juckte und er weiter durch den Dschungel meiner Synapsen raste. Damit war ich das Schlusslicht im Kurs, wo ich das Gefühl hatte, die Frauen mit den kurzen, roten Haaren von der AStA-Party wiederzutreffen, die jetzt alle weiße Sachen trugen und ihren Monkey Mind die ganze Kursstunde lang auf einem Ast festnageln konnten. Zumindest behaupteten sie das, weshalb ich dort irgendwann nicht mehr hinging.
Jetzt hockte der Affe stundenlang an derselben Stelle meines Hippocampus und ließ sich nicht mal durch ein Champions-League-Finale von dort vertreiben. Was 20 Stunden Autogenes Training nicht geschafft hatten ... Ich konnte mich plötzlich auf eine Sache konzentrieren, auch wenn ich es gar nicht wollte.
Vielleicht nahm ich das alles zu wichtig? Das war doch eine reine Kopfgeschichte. Hätten die Babylonier nicht die Zeitrechnung erfunden, wüsste ich gar nicht, dass ich in einem Monat 50 Jahre alt würde. Ich könnte auch keine Statistik googeln, dass deutsche Männer im Durchschnitt 78,9 Jahre alt werden. Das wären fast 29 Jahre Galgenfrist, mehr als meine Zeit mit Martina. Außerdem, wer weiß, was sich bis dahin noch alles in der Medizin tun wird? Wenn heute Großmütter ihre eigenen Enkel zur Welt bringen, gibt es dann vielleicht ein spezielles Gen, ein Update, und alles fängt noch einmal von vorn an.
Warum hörte ich nicht auf, nächtelang im Internet zu surfen und mir die Kommentare derjenigen anzuschauen, die diese unheimliche Deadline schon hinter sich hatten? Einfach den Ball flach halten. Vielleicht könnte ich mich sogar um meinen 50. Geburtstag herummogeln und ihn ausfallen lassen.
»Du willst deinen 50. Geburtstag nicht feiern?!«
So entschlossen, wie mich Martina damals vor den Feministinnen verteidigt hatte, so entschlossen bestimmte sie jetzt, dass wir meinen 50. Geburtstag richtig feiern würden. Und mit »richtig feiern« meinte sie ein großes Fest. Genau das, was ich nicht wollte. Denn wenn ich mit Freunden und Kollegen feiern würde, wüssten ja alle, dass ich schon 50 wurde.
»Aber du wirst 50!« insistierte Martina, die leicht reden hat, weil vor ihr noch beneidenswerte drei Jahre liegen, bis sie selbst 50 wird.
Was sollte ich tun? Ich konnte meinen 50. Geburtstag nicht einfach aussitzen, so wie man Sylvester nicht ignorieren kann: Man kann natürlich am 31. Dezember um zehn Uhr abends ins Bett gehen und sich die Decke über den Kopf ziehen, weil man nicht mitbekommen will, dass das Jahr vorbei ist. Aber zum Jahreswechsel wird man von den Böllern wieder geweckt, die einem unüberhörbar klarmachen, dass ein weiteres Jahr vom Lebenskonto abgebucht wurde, während man den aktuellen Kontostand gar nicht kennt.
Die Böller waren in meinem Fall die anderen, die mich daran erinnerten, dass ich bald 50 würde. Allen voran Martina. Dabei meinte sie es doch nur gut mit mir. »Du kannst stolz sein auf dein Leben«, wurde sie nicht müde, mich zu trösten. »Deshalb solltest du diesen Freudentag mit all den Leuten feiern, die in deinem Leben wichtig sind.«
An einem Samstagabend saßen wir am Küchentisch, tranken eine Flasche Wein und machten eine Liste: Wer war wichtig in meinem Leben? Meine Eltern, klar, sonst würde es mich nicht geben. Aber meine Mutter ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben, und mein Vater lebt im Altenheim. Er ist dement und hat alles vergessen: seine Frau, seinen Namen, sogar, dass er früher Hals-Nasen-Ohren-Arzt war. Nur mir bei jedem Besuch vorzuwerfen, dass aus mir nichts Vernünftiges geworden ist, hat er seltsamerweise nicht vergessen. Dann gibt es Renate, meine Freundin vor Martina, die dafür verantwortlich ist, dass ich zwei Semester versäumte, weil ich mit der Trennung nicht klarkam und mich jeden Abend betrank. Mein großer Bruder ist auch wichtig. Weil er immer Schulbester war, blieb für mich nur die Rolle des Bösewichts übrig, damit mich meine Eltern überhaupt wahrnahmen. Lauter Leute, die mein Leben verändert haben. Aber wollte ich die sehen? Und die ganzen alten Freunde, Kumpels und Kommilitonen, die einem zufällig auf dem Marienplatz über den Weg liefen – man bleibt stehen, schaut sich an und überlegt, wohin man das Gesicht stecken soll, das so alt und grau geworden ist, seitdem man es zum letzten Mal in der Vorlesung gesehen hat, die der Professor extra auf den Freitagnachmittag gelegt hatte, um uns zu ärgern. Bis einem das Erstaunen des Anderen klarmacht, dass man in einen Spiegel schaut.
Warum sollte ich mir dieses »Hätte dich fast nicht erkannt! « hundertmal an meinem Geburtstag anhören? Die immer wieder neue Erkenntnis, dass wir alte Säcke waren.
Wer war noch wichtig? David, unser Sohn, und Nina, unsere Tochter. Aber David hätte sicher keine Zeit, zu meiner Geburtstagsparty zu kommen, obwohl wir ein gutes Verhältnis haben. David ist Aktivist bei Attac. Da kann es gut sein, dass er an meinem 50. Geburtstag nach Gorleben muss, um den Castor-Transport aufzuhalten. Dafür hat David mein vollstes Verständnis, denn während ich und meine Generation die Ressourcen vernichten, indem wir immer älter werden, kämpft David um die Zukunft des Planeten.
Nina würde ganz bestimmt kommen, allein schon, um allen zu zeigen, dass ihre Zwillinge Anna-Lena und Sophie-Charlotte schon mit zwei Jahren die Kleine Nachtmusik auf der Blockflöte spielen können – für den »Opa«. Ein Wort, bei dem ich immer noch zusammenzucke, auch wenn ich inzwischen Zeit hatte, mich daran zu gewöhnen.
Opas, das sind für mich weißhaarige Männer in grauen Anglerwesten, die bei ALDI genau dann ihre drei Scheiben Brot kaufen, wenn Berufstätige wie ich von der Arbeit kommen. Die im Flieger alle aufhalten, weil sie mit ihren Rollatoren als Erste aussteigen müssen. Die morgens gutgelaunt in mein ICE-Abteil einfallen und auf dem Weg in die Kur schon den ersten Piccolo köpfen, während ich versuche, meine Arbeit zu erledigen, mit der ich diese fidelen Transferleistungsempfänger finanziere. Ein Opa ist jemand, der sein Leben gelebt hat. Einer, der auf den Tod wartet. Ein alter Mann. Aber Nina wurde nicht müde, mich Opa zu nennen. Sie nannte mich schon so, als die Zwillinge noch gar nicht auf der Welt waren, sondern nur als Ultraschallfoto auf ihrem iPhone existierten.
Hey, ich bin letztes Jahr den Berlin-Marathon unter vier Stunden gelaufen – 3 Stunden, 59 Minuten und 20 Sekunden, um genau zu sein. Meine Studenten finden, dass ich eine »coole Sau« bin. Haben sie jedenfalls gesagt, als ich ihnen ihre Bachelor-Zeugnisse überreicht habe. Dorata behauptet, ich sähe aus wie George Clooney. Und selbst meine kritische Ehefrau sagt, ich hätte mich gut gehalten – zumindest war sie dieser Meinung, bis die Sache mit Dorata aufflog. Da meinte sie plötzlich, ich hätte wohl ein Problem mit dem Alter, wenn ich es nötig hätte, mir Bestätigung bei einer Frau zu holen, die meine Tochter sein könnte.
Verkehrte Welt: Während ich vor dem Alter davonlief, konnte Nina nicht schnell genug erwachsen werden. Sie ist erst 24, ein Alter, in dem ich noch in einer WG mit Durchgangszimmer lebte, nur um mich älter zu machen, als ich tatsächlich bin. So wie manche Leute den Tachometer manipulieren, damit weniger Kilometer drauf stehen, als der Motor gelaufen ist. Nur ist es bei mir umgekehrt. Warum macht Nina das? Weil sie unser Erwachsensein verachtet?
Wir haben zwar geheiratet und Kinder in die Welt gesetzt, wobei das ungewollt passierte und nicht Teil eines Befruchtungsplans war wie bei Nina. Wir gehen einer geregelten Arbeit nach, besitzen eine Eigentumswohnung, sind etabliert. Trotzdem freuen wir uns, wenn in einem Land, dessen Namen wir nie zuvor gehört haben, der Diktator stürzt. Wenn geheime Dokumente, deren Inhalt wir nicht verstehen, bei WikiLeaks veröffentlicht werden. Wenn die Lehman-Bank pleitegeht, selbst wenn wir dabei Geld verlieren. Weil wir, wie Nina findet, nicht erwachsen geworden sind.
»Ihr«, und damit meint Nina nicht nur Martina und mich, sondern die Generation der Babyboomer, »lebt immer noch in der verlängerten Pubertät.«
Bis vor kurzem habe ich mich darüber geärgert und gefragt, was wir bei dem Kind falsch gemacht haben. Nina konnte noch nicht laufen, da demonstrierte sie schon auf meinen Schultern gegen Atomraketen. Mit drei Jahren sah Nina ihren ersten Nouvelle-Vague-Film, im Original mit Untertiteln. Aborigines haben ihr den Mythos der Regenbogenschlange erklärt. Einer der Helden aus der Schweinebucht hat sie bei einem Besuch in Havanna auf den Knien geschaukelt. Sie hat unseren Frust aufgesogen, wenn alle vier Jahre der Dicke aus Oggersheim gewann, und unseren Jubel, als Rot-Grün ins Kanzleramt einzog. Wir schleppten Nina mit zu Konzerten der Toten Hosen und zu Aufführungen von Pina Bausch. Wir zeigten ihr, wie man benutzte Joghurtbecher spült und wie viel Spaß es macht, wenn man eine leere Flasche in einen Altglascontainer plumpsen lässt. Wir schickten sie zur Montessori-Schule. In der ersten Klasse saß neben ihr ein Junge mit Down-Syndrom, ihre beste Freundin kam aus dem Kosovo und hatte Vater und Brüder beim Massaker von Srebrenica verloren. Bei »Jorgos« durfte sie so lange aufbleiben, bis wir ins Bett gingen – selten vor Mitternacht. Während ihre Freundinnen Sonntagmorgens mit Disney-Filmen ruhiggestellt wurden, damit die Eltern ausschlafen konnten, las ich ihr das Bolivianische Tagebuch vor. Martina nahm sie mit zu den Vagina-Monologen, damit sie ein unverkrampftes Verhältnis zu ihrem Körper entwickelte. Wir hatten alles getan, dass aus unserer Tochter eine kritisch denkende, unabhängige Frau würde. Aber Nina hatte nichts Besseres zu tun, als mit 21 ein neoliberales Nadelstreifen-Arschloch zu heiraten. Sorry, das stammt nicht von mir, ist O-Ton Martina, als Nina zum ersten Mal ihren neuen Freund Holger mit nach Hause brachte. Holger war zugleich ihr erster Freund, sodass Martina und ich uns schon Sorgen gemacht hatten, ob unsere Tochter vielleicht lesbisch sei.
Das nächste Mal sahen wir Holger auf der Hochzeit in der Wieskirche, wo Martina und ich gar nicht wussten, wie wir uns verhalten sollten. Wir hatten nur standesamtlich geheiratet und waren danach mit dem Rucksack durch Indien gereist.
Neun Monate nach Ninas Traumhochzeit in Weiß mit 500 Gästen – zum Glück mussten wir das nicht bezahlen – wurde ich dann Opa. Was hatten wir falsch gemacht?
Nina war übrigens diejenige in der Familie, die die Idee vom »großen Fest«, mit dem ich meinen 50. Geburtstag feiern sollte, am stärksten vorantrieb. Noch mehr als Martina. Dabei ging es weniger darum, mein Lebenswerk zu würdigen – Nina wollte endlich bei Holgers Familie punkten.
Holgers Eltern leben in einer Villa am Starnberger See. Da muss man ziemlich lange über weißen Kies fahren, der vornehm unter den Reifen knirscht und einem klarmacht, dass der Einzige, der hier sonst noch mit einem Kombi vorfährt, der Gärtner ist. Bei Ninas Schwiegereltern komme ich mir immer vor wie früher, als ich noch studierte und sonntagmittags zum Essen nach Hause fuhr. Es ist steif und förmlich, dabei sind die Eltern von Holger jünger als wir. Sein Vater ist Schönheitschirurg, die Mutter managt einen Aktien-Fonds. Martina und ich finden diese Leute schrecklich und wir fühlen uns unwohl: Jedes Glas Champagner, das wir dort trinken – bezahlt mit dem abgesaugten Fett unglücklicher Frauen, denen die Werbung eingeredet hat, sie seien zu dick. Jeder Happen Sushi – bezahlt vom Schweiß indischer Bauern, die um die Früchte ihrer Ernte gebracht werden, weil Holgers Mutter auf fallende Reispreise wettet.
Auf der Rückfahrt machen wir uns immer lustig über die geschmacklose Einrichtung, die ein Star-Designer ausgewählt hat und den Charme einer Möbelabteilung versprüht.
»Hast du den Baselitz gesehen?« amüsiert sich Martina. »Der steht auf den Füßen.«
»Echt?«
»Sie haben ihn falsch herum aufgehängt!«
Vor lauter Lachen verpasse ich die Autobahnausfahrt. Aber wenn wir dann in unsere Wohnung kommen, werden wir seltsam still. Dabei ist unsere Wohnung sehr schön, Altbau mit hohen Decken im Lehel. Wenn man sich aus dem Küchenfenster weit genug hinauslehnt, wobei man sich am Kühlschrank festhalten sollte, kann man die Isar sehen. Und sie gehört uns, die Wohnung. Die letzte Rate wird in diesem Monat bezahlt.
»Mit 50«, meinte der Bankberater, als wir vor 20 Jahren den Kreditvertrag unterschrieben, »gehört die Wohnung Ihnen. Mietfrei genießen Sie Ihren Lebensabend.«
Damals klang es wie ein Versprechen, heute wie eine Drohung.
Jedenfalls: Wenn wir von den Besuchen bei Ninas Schwiegereltern nach Hause kommen, kommt uns unsere schöne Wohnung plötzlich schäbig vor. Bei uns hängen alle Bilder richtig herum an der Wand, nur sind es die unbekannten Werke von Freunden.
Wir hatten uns damit getröstet, dass wir kulturelles Kapital bilden und an unsere Kinder weitergeben. Jetzt mussten wir feststellen, dass Leute wie Holgers Eltern neben dem richtigen Kapital auch noch kulturelles Kapital angehäuft hatten, auch wenn sie es nicht zu würdigen wussten.
Warum begann ich plötzlich, über diese Fragen nachzudenken? Warum zog ich Bilanz? Warum blieb ich stehen und schaute zurück, anstatt einfach weiter durchs Leben zu gehen? Lag das an dem verdammten 50. Geburtstag, der sich vor mir auftürmte wie die Jahreshauptversammlung eines Unternehmens, wo der Vorstand Rechenschaft darüber ablegen muss, was er mit dem Geld der Aktionäre gemacht hat? Und nun fragte ich mich, ob es nicht ein bisschen wenig Rendite war, was wir unseren Kindern hinterlassen würden: eine Eigentumswohnung und ein kritisches Bewusstsein.
Nina spürte schon lange, dass dieses Erbe nicht reichen würde, um im Global Village auf der Schlossallee zu wohnen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie sich für ihre Eltern schämte. Aber es hätte ihr gefallen, ein einziges Mal ein großes Fest zu feiern und wenigstens für einen Abend mit Holgers Eltern gleichzuziehen. Da war es schon eine herbe Enttäuschung, als ich entschied, keine große Party zu organisieren, sondern mit der Familie nach Kreta zu fliegen und im kleinen Kreis bei Jorgos zu feiern.
»Warum versteckst du dich am Libyschen Meer?« fragte Nina, als ich sie bat, sich das dritte Wochenende im August freizuhalten. »Du kannst doch zufrieden auf dein Leben zurückblicken. «
»Zurückblicken?« brach es aus mir heraus. »Sorry, aber ich bin noch nicht tot!«
Nina hatte es doch nur nett gemeint: dass ich etwas aus meinem Leben gemacht hatte, nachdem es zunächst gar nicht danach aussah. Ich hatte Geschichte studiert, weil ich begreifen wollte, wie der Faschismus entstanden war, und Germanistik, weil mir nichts Besseres einfiel. Als ich endlich mit dem Studium fertig war, stellte ich verwundert fest, dass die Gesellschaft mich nicht brauchte. Ich war auf dem besten Weg, ein »Loser« zu werden, auch wenn es das Wort damals noch gar nicht gab.
Eine Zeit lang schlug ich mich mit Gelegenheitsjobs durch, wie Messestände auf- und wieder abzubauen, womit ich mir schon während meines Studiums den Drink in der Disco und das Ticket nach Thailand finanziert hatte. Wenn mich die Kollegen in der Mittagspause fragten, was das denn sei, ein »Germanist«, und lachten, tröstete ich mich mit der Hoffnung, dass ich bald eine gesellschaftlich wichtige Arbeit machen und dafür viel besser bezahlt würde als sie. Aber aus dem Provisorium drohte ein Dauerzustand zu werden. Es war der Beginn einer neuen Zeit – die neoliberale Revolution. Der Paradigmenwechsel vom Wir zum Ich. Die Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer. Erfolg als Leitwährung und Konsumismus als Religion.
Plötzlich stand vor dem No Future, in dem wir zu London Calling die Fäuste gereckt hatten, ein Türsteher und erklärte: »Chic, no shock!«
Damit meinte er meine abgewetzte Levis, die ich seit dem ersten Semester trug, und meine Turnschuhe, die noch älter waren.
»Spinnst du?« fragte ich den Typen und erwartete, dass die Anderen, die ebenfalls vor der Disco warteten, sich mit mir solidarisieren würden. Wir hatten es geschafft, die Volkszählung zu stoppen, dann würden wir auch diesen lächerlichen Türsteher wegpusten. Ich zitierte Artikel drei des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland: »Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner Turnschuhe«, ich war der Einzige, der lachte, »benachteiligt oder bevorzugt werden.«
Ich erwartete Zustimmung aus der Warteschlange, vielleicht sogar einen kurzen Moment zivilen Ungehorsams, der dem Türsteher klarmachte, dass er auf verlorenem Posten kämpfte. Stattdessen waren die Wartenden der Meinung, ich sollte mich »verpissen«, am besten nach »drüben«. Damals gab es noch die DDR.
Ich ging in eine andere Kneipe. Hier war die Musik nicht so gut, es gab kaum Frauen, und die wenigen Frauen, die da waren, sahen aus wie Männer. Dafür kontrollierte niemand meine Turnschuhe, auf den Tischen lagen Aufrufe, Geld für den bewaffneten Kampf der Sandinisten zu sammeln, und es lief Heavy Metal – als ob aufrichtige Gesinnung und gute Musik nicht zusammen passen würden.
»Das lässt sich unsere Generation nicht gefallen«, erklärte ich ein paar anderen Langhaarigen, die zustimmend mit den Köpfen nickten. »Das No Future ist unser Laden. Hier habe ich meinen ersten Joint geraucht. Hier sah ich zum ersten Mal zwei Frauen, die sich küssten, und ein paar Jahre später zwei Männer, die dasselbe taten. Das No Future ist ein Modell für die Zukunft. Die klassenlose Gesellschaft, versteht ihr?!«
Immer noch nickten meine Zuhörer mit den Köpfen und zwar alle im selben Takt, und ich begriff, dass es weniger Zustimmung zu meinen Thesen war, sondern mit Ozzy Osbourne zusammenhing.
Am nächsten Abend stand immer noch der Glatzkopf vor dem No Future und selektierte das Publikum in die Gruppe, für die sich die begehrte Tür öffnete, und jene, die draußen bleiben mussten wie ich, obwohl ich jetzt eine Stoffhose und schwarze Halbschuhe trug, die mir meine Eltern zur Beerdigung meines Großvaters gekauft hatten.
»Gestern sahst du zwar echt runtergerockt aus, aber es hatte Stil«, kommentierte der Glatzkopf mein neues Outfit. »Heute bist du nur noch peinlich.«
Ich versuchte ein Lächeln und ging. Kein Protest. Keine Mahnwache. Keine Unterschriftenaktion. Unsere ganzen Strategien für eine bessere Welt scheiterten an der geschlossenen Tür einer Disco. Statt dass sich alle Abgewiesenen solidarisierten, schämte sich jeder allein. Wir verzogen uns still und leise und beugten uns der neuen Macht.
An diesem Abend hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich etwas viel Grundsätzlicherem beiwohnte, als dass eine Disco den Dresscode änderte. Die neoliberale Machtergreifung vollzog sich schnell und unumstößlich. So wie das No Future plötzlich nicht mehr allen gehörte, sondern denen, die das Geld hatten, die passenden Klamotten zu tragen und die teuren Cocktails zu bezahlen, die es dort jetzt gab, wurden auf der ganzen Welt Dinge, die bisher öffentliches Eigentum waren wie Eisenbahnen, Strände, Staaten, privatisiert. Alles wurde privatisiert, sogar der Fußball. Während ich mir im Fanblock tapfer den Arsch abfror, gab es über unseren Köpfen plötzlich eine neue Oberschicht. Abgeschirmt hinter Glasscheiben tranken wichtige Männer in Anzügen und schöne Frauen in Abendkleidern Champagner, während wir auf den Stehplätzen alkoholfreies Bier aus Plastikbechern in uns hineinschütteten.
Ironischerweise erwies sich die neoliberale Revolution für mich persönlich als Glücksfall. Denn auch die Zeitungsredaktionen wurden dereguliert. Es wurden keine neuen Leute mehr eingestellt, die Arbeit wurde outgesourced und an die immer größer werdende Gruppe akademischer Tagelöhner wie mich vergeben, die mittags noch an der Uni herumhingen, obwohl sie keine Studenten mehr waren, weil es in der Mensa für zwei Mark ein Dreigängemenü gab.
Ich begann, Filmkritiken für ein Stadtmagazin zu schreiben. Dieses Stadtmagazin, das aus einer Hausbesetzung entstanden war, wurde auch gerade privatisiert. Die ehemaligen Straßenkämpfer verkauften die Rechte an ein überregionales Konsortium. Ich protestierte mit den üblichen Verdächtigen gegen diesen »Ausverkauf von Vielfalt« – im Formulieren von politischen Anklagen war ich wirklich gut. Trotzdem hatte ich keine Skrupel, ein paar Wochen später meinen ersten Scheck entgegenzunehmen – 24 DM für 80 Zeilen über Paris, Texas, den ich langweilig fand, aber trotzdem empfahl, weil ich nicht sofort wieder aus dem Verteiler des Filmverleihs fliegen wollte, nachdem es mich einige Telefonate gekostet hatte, darin aufgenommen zu werden.
Um es kurz zu machen: Weil das Stadtmagazin bald in allen deutschen Großstädten am Kiosk lag und von einer Zentral-Redaktion gelenkt wurde, erschienen meine Filmkritiken bundesweit, was mir einen gewissen Ruf einbrachte. Ich wurde auf Festivals eingeladen und zu Premieren. Irgendwann verstand ich so viel vom Filmemachen, glaubte ich zumindest, dass ich mich fragte, warum ich nicht Drehbücher schrieb.
Mein erstes Drehbuch handelte von drei schwulen Außerirdischen, die ein Raumschiff kapern, um zur Christopher-Street-Day-Parade nach Berlin zu fliegen.
Sechs Monate, nachdem ich das Script mit der Post an ein Dutzend Produktionsfirmen geschickt hatte, erhielt ich einen Anruf. Es war der erste Anruf, bisher waren immer nur standardisierte Briefe zurückgekommen: Leider sehe man keine Möglichkeit, das Script zu realisieren, wobei das nichts mit der Qualität zu tun habe. Wenn ich einen ausreichend frankierten und an mich adressierten Umschlag senden würde, würde man mir mein Drehbuch zurückschicken, sonst würde es vernichtet.
Und jetzt ein Anruf!
Ich traf den Produzenten in der Senator-Lounge des Münchner Flughafens. Er war auf dem Weg nach Los Angeles.
»Was soll ich mit so einer gequirlten Kacke?!« begrüßte er mich.
Ich wollte schon beleidigt abrauschen, als er sagte, das Buch hätte Potenzial, aber ich sollte mir überlegen, ob ich die Außerirdischen brauche. Sei verdammt teuer, so etwas zu produzieren. »Schwul« sei auch nicht so günstig, wenn man eine Freigabe ab 6 Jahren anstrebt. Wenn man aber nicht die ganze Familie ins Kino bekäme, brauche man gar nicht erst anzufangen. Auch Berlin sollte ich vergessen, Berlin sei »totgefilmt«.
Sein Flug wurde aufgerufen. Er klopfte mir auf die Schulter, während ich ihn zum Gate begleitete, und versprach, meine neue Fassung zu lesen, wenn ich sie ihm schicken würde.
Als ich in der Flughafen-Station auf die S-Bahn wartete, überlegte ich, ob es nicht das Beste wäre, mich vor den einfahrenden Zug zu werfen. In diesem Moment hatte ich eine Idee: Wie wäre es mit einem schwulen Polizisten? Den gab es damals noch nicht im deutschen Fernsehen. Und wieder profitierte ich von der Privatisierung, die ich so heftig kritisierte: Während ich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern mit meinem schwulen Cop auf Ablehnung stieß, gingen bei den gerade gegründeten privaten TV-Sendern die Türen für mich weit auf. Ich war wieder in der für mich so typischen schizoiden Situation, dass ich für die dunkle Seite der Macht arbeitete, die ich eigentlich bekämpfen wollte. Deshalb redete ich mir ein, ich wäre ein schreibender Odysseus und meine Filme wären Trojanische Pferde, mit denen ich meine kritischen Inhalte in das Werberahmen-Programm rollen würde. Ein Trugschluss. Es war genau umgekehrt, und ich tröstete mich mit den fetten Schecks, die ich als Schweigegeld betrachtete, bis ich irgendwann begriff, dass es Schmerzensgeld war.
Aber auch in dieser oberflächlichen Welt zwischen Dschungelcamp und Deutschland sucht den Superstar holte mich mein anstehender 50. Geburtstag ein. Bisher konnte ich mich durch coole Sprüche und mein reflexhaft antiautoritäres Auftreten jünger machen, als ich bin. Aber beim letzten Projekt erwischte es mich.
Jahrelang hatte ich mein Geschlecht verleugnet und machte, wie von den Sendern gefordert, »frauen-affines« Programm. Männer kamen nach der Übernahme der Sender durch die Feministinnen nur noch als abwesende Väter, Vergewaltiger oder Weicheier vor. Und ich lieferte, was verlangt wurde. Ich war zu einem Frauenversteher geworden. Trotzdem war die Redakteurin – sie war kaum älter als Nina – der Meinung, meinem Drehbuch würde »irgendetwas fehlen«. Sie sagte mir nicht offen ins Gesicht, ich sei zu alt, aber es gab plötzlich eine Eigenschaft in unserer alternden Gesellschaft, die immer wichtiger wurde: Jugendlichkeit. Also ließ ich mir einen Dreitagebart stehen, trug meine Hemden über der Hose und benutzte Worte wie krass und geil, um mein wahres Alter zu verbergen. Es half alles nichts. Man feuerte mich aus meinem eigenen Projekt und ersetzte mich durch eine junge Kollegin, die mein Drehbuch einem Anti-Aging-Programm unterzog, weshalb ich mir den fertigen Film nicht anschauen wollte, als er direkt nach der Tagesschau lief.
Stattdessen ging ich mit Martina zum Italiener, um ihr meine Affäre mit Dorata zu beichten, die ich inzwischen beendet hatte. Aber dazu kam es nicht. Wir waren bei der Vorspeise,
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2012 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung und Motiv: Suna Lim, Berlin
eISBN 978-3-641-06243-9
www.gtvh.de
www.randomhouse.de
Leseprobe





























