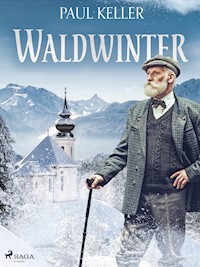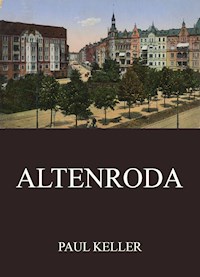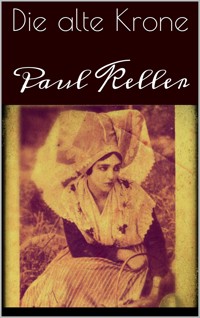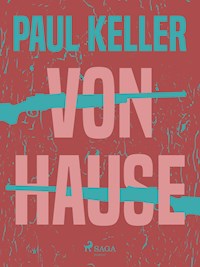
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Von Hause sende ich Euch ein Feldpaketchen, Ihr getreuen Brüder, ein Bündelchen Humor, wie ich es aus meinen Büchern für Euch zusammensuchte. Was kann man Euch denn noch schicken in diesem hungrigen Jahre des Heils 1917? Etwas zu rauchen, etwas zu lachen. Der Humor ist noch nicht beschlagnahmt; er scheint neben dem Wasser und der Luft das einzige zu sein, was in dieser argen Zeit nicht knapp wird. Und schließlich ist ja ein wenig Humor für einen Kriegsmann wohl zu gebrauchen; er vermag vielleicht manchmal den Hunger nach Frieden zu betäuben; er vermag dem Durst nach Freiheit und Liebe auf Minuten die brennende Qual zu nehmen; er vermag in einsamen Nächten und eisigen Stunden etwas zu erwärmen. Deshalb wählte ich Humor für Euch. Wenn er zuweilen ein bißchen wehmütig ist, so ist das seine Art. Vom Kriege erzähle ich Euch nichts. Der Krieg erzählt Euch selbst beide Ohren und die Seele voll." So Paul Keller in der Vorrede zu seinem Band, in dem er humorvolle Passagen aus einer Reihe seiner besten Romane und Erzählbände versammelt hat, unter anderem aus "Das letzte Märchen", "Stille Straßen", "Fünf Waldstädte", "Sohn der Hagar" und "Ferien vom Ich". Was einst dazu gedacht war, den Soldaten in den Schützengräben von Verdun, Arras und an der Somme zumindest ein paar heitere Minuten zu schenken, vermag auch heute noch in manch bitterer Stunde ein Lächeln auf die Lippen des Lesers zu zaubern. Natürlich ist es, darüber hinaus, selbstredend auch eine ideale Lektüre für sonnige Zeiten und überhaupt als Einführung in die humoristische Seite des großen Erzählers Paul Keller wärmstens zu empfehlen!Paul Keller (1873–1932) wurde als Sohn eines Maurers und Schnittwarenhändlers geboren. Zwischen 1887 und 1890 besuchte er die Präparandenanstalt in Bad Landeck und anschließend von 1890 bis 1893 das Lehrerseminar in Breslau. Nachdem er acht Monate als Lehrer im niederschlesischen Jauer tätig war, wechselte er 1894 als Hilfslehrer an die Präparandenanstalt in Schweidnitz. Zwischen 1896 und 1908 war er Volksschullehrer in Breslau. Keller gründete die Zeitschrift "Die Bergstadt" (1912–1931) und schrieb schlesische Heimatromane sowie "Das letzte Märchen", eine Geschichte, in der ein Journalist in ein unterirdisches Märchenreich eingeladen wird, um dort eine Zeitung aufzubauen, und dabei in Intrigen innerhalb des Königshauses hineingerät. Die Namen wie "König Heredidasufoturu LXXV.", "Stimpekrex", "Doktor Nein" (der Oppositionsführer) haben wahrscheinlich Michael Ende zu seinem Roman "Die unendliche Geschichte" angeregt. Zusammen mit dem schlesischen Lyriker und Erzähler Paul Barsch unternahm Keller zwischen 1903 und 1927 zahlreiche Reisen durch Europa und Nordafrika. Zudem führten ihn etliche Lese- und Vortragstourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Tschechoslowakei. Er war 1910 Mitglied der Jury eines Preisausschreibens des Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck für Sammelbilder des Stollwerck-Sammelalbums Nr. 12 "Humor in Bild und Wort". Keller starb am 20. August 1932 in Breslau und wurde auf dem dortigen Laurentiusfriedhof bestattet. – Paul Keller gehörte zu den meistgelesenen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was sich in einer 1931 bei fünf Millionen liegenden Gesamtauflage seiner Bücher widerspiegelt, und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Schriftsteller wie der alte Wilhelm Raabe oder Peter Rosegger schätzten den Autor sehr. Gerade die früheren Werke wie "Waldwinter", "Ferien vom Ich" oder "Der Sohn der Hagar" zeichnen sich durch künstlerische Kraft und Meisterschaft aus. Seinen Roman "Die Heimat" (1903) nannte Felix Dahn "echte Heimatkunst". Seine bekanntesten Werke wurden zum Teil auch verfilmt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
Von Hause
Ein Paketchen Humor aus den Werken
Saga
Von Hause
© 1917 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517390
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Von Hause sende ich Euch ein Feldpaketchen, Ihr getreuen Brüder, ein Bündelchen Humor, wie ich es aus meinen Büchern für Euch zusammensuchte.
Was kann man Euch denn noch schicken in diesem hungrigen Jahre des Heils 1917? Etwas zu rauchen, etwas zu lachen. Der Humor ist noch nicht beschlagnahmt; er scheint neben dem Wasser und der Luft das einzige zu sein, was in dieser argen Zeit nicht knapp wird. Und schliesslich ist ja ein wenig Humor für einen Kriegsmann wohl zu gebrauchen; er vermag vielleicht manchmal den Hunger nach Frieden zu betäuben; er vermag dem Durst nach Freiheit und Liebe auf Minuten die brennende Qual zu nehmen; er vermag in einsamen Nächten und eisigen Stunden etwas zu erwärmen. Deshalb wählte ich Humor für Euch. Wenn er zuweilen ein bisschen wehmütig ist, so ist das seine Art. Vom Kriege erzähle ich Euch nichts. Der Krieg erzählt Euch selbst beide Ohren und die Seele voll. Ich will Euch lustige Geschichten aus der Heimat erzählen, nicht grelle Witze und beissende Satiren, sondern stille Geschichtlein, die ich in friedlichen Stunden schrieb. Es sind lauter Heimatklänge; und wenn sie in Euch widerklingen sollten, findet Ihr wohl, dass die Glocken zu Hause hängen — in Eurer eigenen Jugend.
Möge, Ihr grauen Brüder, mein kleines Paket glücklich bei Euch ankommen und freundlich von Euch aufgenommen werden. Es kommt — — von Hause. Bleibt gesund!
Aber auch Ihr, die Ihr zu Hause geblieben seid, könnt mein Büchlein vielleicht brauchen. Auch Ihr seid hungrig nach Frieden, arm an ruhigem Glück, begierig nach Stille.
Unser ganzes Volk ist im Krieg; viele sind an der Seele verwundet.
So möge nun alles zur Heilung beitragen.
Wo aber ruht unsere Sehnsucht? Wo winkt uns Genesung? Wo wurzelt unsere Kraft und Hoffnung? Zu Hause!
Breslau 9, im März 1917.
Paul Keller.
In den Grenzhäusern
Erzählung aus den schlesischen Bergen
Es war in meinen jungen Jahren. Alle Ferientage war ich oben in den Bergen, die ihren gewaltigen Grenzkamm zwischen Preussen und Österreich hinstrecken an die vierzig Meilen lang. Das ging immer hinüber und herüber in den dunklen Wäldern und langgestreckten Tälern, immer auf einsamen, zeigerlosen Wegen, dass man wirklich oft nicht wusste: Bist du nun noch im Vaterland oder bist du schon im „Ausland“? Denn das Volk ist hüben wie drüben — derb, treuherzig, von derselben Tracht und Sprache und nimmt das Zweimarkstück an Stelle des Guldens diesseits wie jenseits.
An einem trüben Sommerabend kam ich in die „Grenzhäuser“. Die Grenzhäuser lagen noch auf preussischer Seite an einem waldigen Abhang, über dem die Kammlinie aufstieg, an der diesseits das preussische, jenseits das österreichische Zollhaus stand. Drüben über dem Berge das erste böhmische Dorf hiess auch Grenzhäuser. Es war natürlich eine Gemeinde für sich und führte den gleichen Namen nur aus dem einzigen Grunde, weil es eben schwer ist und verdriessliches Kopfzerbrechen macht, immer neue Ortsnamen zu erfinden. In den preussischen Grenzhäusern bestand seit alter Zeit ein Gasthaus, das auf den Namen „Der rote Hahn“ getauft war; als viel später in den österreichischen Grenzhäusern auch ein Wirtshaus entstand, nannte es sein Besitzer „Der blaue Hahn“, weil er ein wenig neuerungssüchtig veranlagt war.
Im „Roten Hahn“ kehrte ich an jenem Sommerabend ein. Ich war sehr durstig und verlangte ein Glas Bier. Der biedere Wirt betrachtete mich und meine grüne Jugend, schüttelte den Kopf und sagte: „Trink’ du lieber a Glas Puttermilch, mei Jüngla; Bier ies fer dich zu stork.“ Ich ärgerte mich sehr über diese Ansprache, denn ich hielt mich bereits für einen jungen Herrn, aber ich bekam nichts anderes als Buttermilch. Eine Weile darauf kam der Wirt wieder an mich heran und forderte mich auf, eine rotscheckige Kuh suchen zu helfen, die sich in den Wäldern verirrt habe. Innerlich war ich empört und sagte mir, es sei eine Frechheit, einen zahlenden Touristen also zu behandeln, denn was ginge mich die rote Kuh des Wirts an; äusserlich machte ich aber nur eine abgespannte Miene und sagte: ach, ich sei so weit gegangen an diesem Tag und sehr müde. Da fasste mich der herkulische Mann an der Schulter: „Na marsch, marsch, tu ni erscht su stupide und zimperlich!“ und schob mich zur Tür hinaus. Es nutzte nichts, ich musste dem barfüssigen Hüterjungen und einer Magd die verlorene rote Kuh suchen helfen. Ich tat es mit tiefem Ingrimm und beklagte es, in eine so barbarische Gegend geraten zu sein. Aber wir hatten Glück. Als wir gerade auf die Suche gingen, und zwar nach einem wohlerwogenen Kriegsplan, der Hüterjunge nach Norden, die Magd nach Süden und ich nach Westen, kam die Kuh von der Ostseite her angetrabt und meldete sich mit einem donnernden Gebrüll zur Stelle.
„Na siehste,“ sagte der Wirt belehrend zu mir, „wenn man nur die Arbeit nich scheut, bringt se immer ihren Segen.“
Zum Abendbrot bekam ich ein neues Glas Buttermilch, einen Berg von Bratkartoffeln, Butter, Brot, Wurst und Käse vorgesetzt.
Das fand ich nun recht anständig, aber ich dachte an die Kostenrechnung und sagte, so viel könne ich nicht essen. Da nahm mich der Wirt unter die Arme, hob mich ein paarmal in die Höhe und sagte verächtlich:
„Neunzig Pfund hechstens wiegt die Borste. Wie alt bist du denn nu schon?“
„Achtzehn Jahre,“ sagte ich. „Ich besuche das Breslauer Seminar und bin schon im zweiten Kursus.“ Ich dachte, das würde dem Mann imponieren, aber es war leider nicht der Fall.
„Miserabel siehste aus,“ sagte er; „wahrscheinlich haste de Schwindsucht.“
Ich sagte dem Gemütsmenschen beklommen, dass ich zwar ein wenig mager, aber ganz gesund sei. Das glaubte er aber nicht, sondern meinte:
„Das is ja eben das Gutte bei sulchen Leuten, dass se selber nich wissen, wie’s um se steht. Meine Schwägern, die hat’s nich geglobt, dass se de Schwindsucht hätte, bis se tot war. Die sah grade su aus.“
Mir wurde plötzlich ganz übel, und ich liess mutlos den Löffel sinken.
„Ich hab’ keinen Appetit mehr,“ sagte ich leise.
„Das is bluss wegen deinem verknuchten Gelabere,“ fuhr nun die rundliche Wirtin ihren Mann an; „su einem jungen Blutte su an elendiglichen Quatsch vorreden, das is ja a reenes Verbrechen! Junger Herr, hör’n Se bloss nich uff den alen Esel, der weess nich, was a labert.“
„Nanu,“ sagte der Wirt betroffen, steckte die Hände in die Hosentaschen und sah immer verwundert zwischen mir und seinem Weibe hin und her. „Was — was hab’ ich denn etwa verbrochen?“
Die Wirtin stand kirschrot vor ihm.
„Wenn eener wirklich — nee, nee, du bist ja zu a tummes Luder!“
Sie fasste ihn am Arme und zog ihn hinaus. Ich blieb trübselig hinter dem reichbeladenen Abendbrottisch sitzen. Nach etwa zehn Minuten kam der Wirt wieder herein. Er kratzte sich hinter den Ohren, machte eine sehr verlegene Miene und sagte kopfschüttelnd:
„Meine Ale is zu komisch. Do denkt se nu, Sie könnten denken, ich hätt’s ernste gemeent. Nu do müsst ich ju — do müsst ich ju wirlich a aler Labersack erster Klasse sein, wenn ich ei’m Menschen wie Sie sulches Zeug vorredte. ’s war doch bluss Sposs. Denn Sie sein ju wie Milch und Blutt — und Gewichte haben Se — schwer leck — ich hab Se kaum erheben können — und Muskeln ha’n Sie und zu a Suldaten werden Se komm’, a starker Kerl sein Se!“
„Du laberst ja schun wieder,“ kam die Wirtin zur Tür hereingefahren; „denn das globt a doch jitzt nich. Do merkt a doch, wie der Hase leeft.“
„Ich sag’ überhaupt nischt meh,“ sagte der Wirt und setzte sich beleidigt in einen Winkel.
„Das is ooch viel besser,“ entgegnete ihm die Gattin. „Und Sie, junger Herr, machen Se sich nischt draus. Essen Se immer recht tüchtig und sein Se viel ei freier Luft, do kriegen Se im Läben keene Schwindsucht.“
„Ganz dasselbe, was ich von Anfang an gesat ha,“ brummte der Mann im Winkel.
Dann wurde es still.
Nach einer Weile fragte mich die Wirtin, ob ich noch ein Glas Buttermilch wünschte. Ich dankte. Der Wirt fuhr höhnisch lachend empor.
„Puttermilch! Nischt wie Puttermilch! Davo kriegt eener freilich keene Schwindsucht. Aber die Cholera kriegt a! — Das is doch kee Junge meh, das is doch a Herr. Eener, der schon im zweeten Seminar is. Fer den passt keene Puttermilch, fer den passt a Seidel Bier!“
Er brachte zwei Gläser Bier und lud mich ein, mit ihm auf der Bank vor der Haustür Platz zu nehmen.
Das war der Anfang meiner Freundschaft mit dem Roten Hahnenwirt Heinrich Hollmann, einer Freundschaft, die noch heut besteht.
Der Abend war still und trüb. Es war, als hätten alle Bäume in schlaffer Trägheit die Köpfe geneigt. Der Nebel stieg langsam und müd’ vom Tale auf, über dem Kammweg lag ein fahler Schein, gelb wie Laternenlicht. Am Waldrand huschte eine Eule, sonst regte sich nichts.
„Das wird eine gute dunkle Nacht,“ sagte der Hahnenwirt. Dann fing er an, mir Schmugglergeschichten zu erzählen, eigentlich die einzige Art von Geschichten, die er in den Grenzhäusern erleben konnte.
„Die die Schmuggler für schlechte Leute halten,“ sagte mein neuer Freund, „sein alles tumme Kerle. Die wissen eben nich, wie’s hier zugeht. Das bissel kleener Grenzverkehr rüber und rüber macht keen Staat arm oder reich. Da lohnt sich der ganze Sums mit den Grenzjägern nich. ’s is olles Quatsch.“
„Aber es wird doch manchmal einer erschossen,“ wandte ich ein.
„Erschussen? Ja, Schmuggler — Grenzjäger nich! Da könn’ Se lange suchen, eh Se een erschuss’nen Grenzjäger finden. Nu ja, ’s is mal a schlechter Kerl drunter, wie ’s halt ieberoll schlechte Kerle gibt; aber sunst sein de Schmuggler ehrenwerte Leute. Orme Teifel sein’s, die sich amal a paar Pfennige schwer genug verdien’. Wovon soll’n se denn leben hier in diesen Bergen?“
„Sie sind wohl auch ein Schmuggler?“ fragte ich harmlos.
Aber da fuhr er auf.
„Jüngla,“ sagte er, „nimm dich in acht, sunst hau ich dir eene runter. Beleidigen loss’ ich mich nich!“
Ich erschrak über diesen Entrüstungsausbruch und stammelte eine Entschuldigung, setzte auch beschwichtigend hinzu, dass ich selbst schon Kleinigkeiten für den eigenen Bedarf geschmuggelt hätte. Da knurrte er:
„Wer hier in der Gegend nich schmuggelt, is blödsinnig!“
Später, viel später war einmal der Deutsche Kaiser im schlesisch-böhmischen Grenzgebirge, Es wurde ihm ein Glas böhmischen Weines vorgesetzt. Er trank ihn und sagte: „Na prosit, — geschmuggelt ist er ja sicher!“ Und lachte.
An jenem Abend aber griff ich in die Tasche, zog einen Papierbeutel heraus und bot meinem Gastfreund eine Zigarre an. Der sah mich betroffen an.
„Der Junge roocht,“ sagte er, „und hat doch de —“
„Ich hab’ nicht die Schwindsucht,“ unterbrach ich ihn. „Nehmen Sie nur.“
„Österreicher,“ sagte er anerkennend, als er die Marke prüfte, „seht amal die Borste an! Na, wenn sich das bluss mit dem Biere und der vielen Puttermilch verträgt.“
Dann rauchten wir und schwiegen. Ein Mann stieg vom Kammweg herunter, den ich nach einiger Zeit als einen Grenzjäger erkannte.
„Da kommt ein Grenzer.“
„Ja,“ meinte Hollmann, „eener, der noch Durst hat. Es is Wenzel Hollmann von der anderen Seite.“
„Ist er verwandt mit Ihnen?“
„Weil er Hollmann heesst? Ach, keene Spur. Hier heessen drei Viertel von allen Leuten Hollmann oder Liebich. Wu sull’n ooch immer die neuen Namen herkummen!“
Wenzel Hollmann, ein geschmeidiger Mann in knapper österreichischer Uniform, setzte sich zu uns und trank drei oder vier Gläschen Wünschelburger Kornbranntwein. Seine Dienstkappe legte er neben sich auf die Bank. Es stak ein winziges Sträusschen daran.
„Immer hat a a Pukettela) an der Mütze,“ sagte der Hahnenwirt; „’s is halt a schneidiger Kerl.“
„Na, du weisst doch, dass mir das immer die Kinder vom „Blauen Hahnen“ dranmachen. Und du putzest mich ja selber oft aus,“ entgegnete der Grenzer.
Der Rote Hahnenwirt lachte aus vollem Halse.
„Ja, denkst du, der Rote steht gegen den Blauen zurücke? Putzt der Blaue seine Kunden, putzt der Rote erst recht seine Kunden.“
Er entfernte das Sträusschen, das aus drei Stengelchen Rosmarin und einem gelben Hahnenfuss bestand, brach vom Gartenzaun zwei Heckenröslein, pflückte vom Beet eine rote Nelke und befestigte sie an der Kappe des Grenzers.
„Der Rote Hahn lässt sich von der Konkurrenz nischt vormachen,“ sagte er.
Der Grenzer lächelte ein wenig geschmeichelt und ging bald darauf davon.
Der Hahnenwirt lachte leise hinter ihm her. Dann sagte er:
„Na, Jüngla — junger Herr — ich sollt’s ja eegentlich nich verraten, aber Se werden ja nischt ausmähren — Se haben selbst schon geschmuggelt — na, und da soll’n Se gleich amal a rechtes Schmugglerstückel zu seh’n kriegen. Wissen Sie, was das bedeutet?“
Er nahm die Rosmarinstengel und den Hahnenfuss auf, die der Grenzer dagelassen hatte.
„Also, passen Se auf. Das, was ich hier in der Hand hab, is ’ne Geschäftsbestellung. Und zwar eene vom Blauen Hahnenwirt drüben. Der Hahnenfuss bedeutet a Fass Butter, und die Rosmarinstengel bedeuten drei Pfund Schokolade. Die soll ich nu nach drüben liefern.“
„Und das bringt der Grenzer?“ rief ich überrascht.
„Jawull, der Grenzer! Der is der zuverlässigste Bote. Der tumme Kerl hat natürlich keene Ahnung, dass a unsern Briefträger macht. Ich hab’, wie Se gesehen haben, gleich meine Gegenbestellung beim Blauen Hahn gemacht: eine rote Nelke, das is a Fässel Roter, und zwee Heckenröslein, die bedeuten zwee Flaschen gezehrten Oberungar. Das trägt a nu wieder rüber, denn a pendelt immer zwischen uns beeden hin und her.“
„Das ist grossartig ausgedacht!“ rief ich begeistert.
„Ja, Kupp muss ma haben,“ sagte der Hahnenwirt stolz. „Wir haben ’ne ganze Liste ausgearbeit’. Klee z. B. bedeutet Slibowitz, Jelängerjelieber bedeutet Virginiazigarren, fette Henne versinnbildlicht ’ne Tonne ungarisches Schweineschmalz, Flachs is natürlich Leinwand, Männertreu sind Hosenträger, Rosen Stoff für seid’ne Blusen und ’ne kleine Distel is ’n Sack Salz. Eine volle Getreideähre heisst: Ich bitte um die Rechnung; eine leere Ähre aber bedeutet: Wart’ noch a bissel, hab’ jetzt gerade keen Geld.“
„Es ist genial,“ flüsterte ich voll Bewunderung.
„Ja, junger Herr,“ sagte der Hahnenwirt, „wenn Se immer hier wären, könnten Se noch a ganz gescheiter Kerle werden.“ —
„Der Wenzel Hollmann scheint mir grade kein sehr tüchtiger Grenzjäger zu sein,“ wandte ich nach einer Weile ein.
„Der — nich tüchtig? Oho! Ein Satan is a. Unsere Preussen sind viel langsamer, se haben zu dicke Bierbäuche, aber der dürre Windhund von Österreicher, der geht Tag und Nacht rum und hat beinah schon die ganze Gegend erwischt.“
„Hat er Sie auch schon einmal erwischt?“ fragte ich.
„Mich? Ich bin keen Schmuggler,“ brauste er wieder auf; doch dann setzte er hinzu: „Unsere Leute, ich meine die, die so die Waren zwischen mir und meinem Blauen Kollegen drüben hin- und herschaffen, die hat er freilich schon ziemlich ofte erwischt — der Lump der!“
Er schnob vor Ingrimm.
„Dreimal mehr Strafe haben wir schon blechen müssen, als der ganze Handel einbringt. Aber Geschäft is Geschäft. Blödsinnig müsst’ ma sein, wenn ma nich schwärzte. Und geleimt wird a doch! Das haben Sie ja gesehen, wie a geleimt wird! So a Spass schwemmt ollen Ärger weg. Der grösste Hauptkerl aber, den a noch nie erwischt hat, das is der Wassermüller Liebich unten in a Talhäusern. Das is so a Mordsteufelskerl, der würd’ nicht erwischt, und wenn der deutsche und der österreichische Kaiser selber uff die Grenzwache zögen.“
Nach diesem starken rednerischen Trumpf rieb sich Heinrich Hollmann vergnügt die Hände.
„Das Dollste is,“ fuhr er fort und er lachte mit so tiefem Vergnügen, dass man merkte, wie die Freude aus dem untersten Herzen kam; „das Dollste is, dass der Liebich dem Wenzel Hollmann die eegne Liebste weggeschmuggelt hat. Das verwindet der Windhund sein Lebtag nich.“
„Möchten Sie mir das erzählen?“
Er schielte mich von der Seite her an.
„Für Liebesgeschichten biste noch a bissel zu grün,“ sagte er. Aber er erzählte, und erzählte zum Teil hochdeutsch.
„Also — da war a Mädel drüben — Franziska — ’s hübscheste Mädel im ganzen Gebirge. Alle war’n in se verschossen — alle — alle ohne Ausnahme, hüben wie drüben. Am dollsten aber waren der Grenzjäger Wenzel und der Wassermüller Liebich in die Franziska verliebt. Also, die beiden waren schon total verrückt um die Köppe. Je mehr se nu aber auf das Mädel spannten, desto mehr hatten se natürlich uff einander ’ne grenzenlose Wut. Wenn se sich bloss sahen, wurden sie grün im Gesichte. Am schlimmsten war’s natürlich uff’m Tanzboden. Da wundert man sich noch heute, dass da nich amal a Unglück geschehen is. Se überboten sich, wo se konnten. Hatte der Wenzel ’ne neue Extrauniform, kaufte sich der Liebich ’n neuen schwarzen Anzug, ’n Patent-Gummikragen und bunte Manschetten; wie sich der Wenzel in eener Auktion ’n Zwicker gekauft hatte, durch den a zwar nich sehen konnte, in dem a aber sehr studiert aussah, schaffte sich der Liebich ’ne Meerschaumspitze an, obwohl ihm jedesmal schlecht wurde, wenn a roochte. Der Wenzel machte Schulden über Schulden und koofte der Franziska in eenem Jahre alleine sieben Granatbroschen; der Liebich schenkte ihr ’n goldnen Fingerring mit ei’m Garantieschein, dass a binnen drei Jahren nich schwarz würde. Und so gings weiter, es waren eben, wie gesagt, ganz verrückte Kavaliere. Da versuchte es der Wenzel mit was anderem. A schmiss sich so heftig uff seine Berufsarbeit, dass a binnen kurzem neun Schmuggler erwischte und ’ne schriftliche Belobigung kriegte. Damit hob a sich nu bei der Franziska ein, denn das is wahr: nischt gefällt ei’m Mädel an ei’m Kerl besser, als wenn a Schneid hat. Das is, weil die Weiber selber su feiges Gelichter sind. Also, der Liebich fängt schon an, mitsamt seiner Meerschaumspitze sachte hinten runterzurutschen — da wird a plötzlich a Schmuggler. A bringt der Franziska allerhand feine Geschenke, mal ’ne kleine Tonne grüne Heringe, mal ’n Biertelzentner Viehsalz, und a sagt immer dazu, dass a am liebsten in Wenzels Amtsstunden schmuggelte, weil das der dämlichste Grenzjäger von ganz Österreich wäre Der Wenzel wurde halb verrückt vor Wut. A schlief nich mehr, a lag Tag und Nacht uff der Lauer, a sass amal von Mitternacht bis Morgens uff eenem Baume in strömendem Regen, und wie’s endlich Tag wurde, hatte ihm der Liebich, ohne dass er was gemerkt hätte, ’n Flasche Pain-Expeller unter den Baum gestellt, weil Pain-Expeller gutt is gegen Rheumatismus. Das ganze Gebirge lachte, und wie der Wenzel mit seinem Belobigungsbriefe und eener seid’nen Schürze das nächste Mal zur Franziska kam, merkte er, dass es Essig war. Sie hatte sich für a preissischen Liebich entschieden. Aber ihre Mutter war für a österreich’schen Wenzel. Und da setzte es der Wenzel durch, dass a, wie ich amal ’ne Entenkirmis mit Ball machte, mit der Franziska über die Grenze rüberkommen konnte. A hatte sich für schweres Geld ’nen geschlossenen Glaswagen gemietet. Weil sich’s nu aber nich schickte, dass a bei dem Mädel im Wagen sass, setzt’ a sich manierlich neben a Kutscher, und im Wagen sass die böhmische Jungfer. Wie se ans deutsche Zollhaus kamen, war’s schon dunkel, denn es war im späten November. Der Wenzel stieg ab und sagte der Jungfer im Wagen, er hätte vier österreichische Zigarren zu verzollen. Damit wollt’ a zeigen, was für a gewissenhafter Mensch er wär’, und sich bei der Franziska einheben. Wie er aus’m Zollhaus wieder rauskommt, setzt’ a sich gleich wieder auf’n Bock, und die Fahrt ging weiter. Herr, du meine Güte, wie se hier im „Roten Hahn“ ankamen, sass in dem Wagen ’ne Strohpuppe, und die Franziska war verschwunden. Die tanzte drüben mit ’m Liebich bei der österreichischen Konkurrenz. Der Kutscher, der mit ’m Liebich im Komplott gewesen war, kriegte zwar vom Wenzel a paar gesalzene Ohrfeigen, aber — mit der Franziska war’s aus. Sechs Wochen drauf heirat’ se a Liebich. Kurz vorher hatte se von den sieben Granatbroschen zweie an a Wenzel zurückgeschickt. Su sein die Weiber.“
Der Rote Hahnenwirt machte eine Pause in seiner Erzählung, zündete sich die Zigarre neu an und lachte leise und philosophisch vor sich hin.
„Su sein die Weiber!“ wiederholte er. „Mir is es ooch erst mit der Fünften geglückt. Und fünf is für mich ’ne Unglückszahl.“
Er liess wehmütig den Kopf hängen; aber bald lachte er wieder und erzählte weiter.
„Der Liebich trieb’s nu ganz toll. Kurz vor seiner Hochzeit erzählte er in Wenzels Gegenwart im Gasthause, seine Schwiegermutter müsse doch jetzt Kuchen backen, und da wolle er ihr ein Fass Butter aus dem Preussischen hinüberschaffen. Das war nu der Gipfel der Frechheit. Wenzel, der Grenzjäger, der sowieso mit verglasten Augen und hohlen Backen rumlief, lauerte von nun an Tag und Nacht. Zwar mit der Franziska war er fertig; aber den Kerl — den Lump — den Teufel — reinzulegen, das wär’ für ihn das allerhöchste gewesen. Und richtig — a erwischt ihn. In der Silvesternacht — ’s war ’n Hundewetter — erwischt der Wenzel a Liebich uff eenem entlegenen Seitenwege mit ei’m Fass Butter. Aus einem Graben, direkt aus der Schneejauche heraus springt er ihn an.
„Wo is der Zollschein?“ schreit er.
Liebich, der sonst ein starker Kerl ist, is so erschrocken, dass a lallt und stammelt wie a Kind. — „Ich hab’ — ich hab’ — die Putter — die Putter — verzollt —“
Er sucht in allen Taschen.
„Wo ist der Zollschein?“
Liebich dreht alle Taschen um, immer wieder, immer wieder — er sucht wie verrückt nach ’m Scheine.
„Ich — ich hab’n verloren —“
Wenzel lachte hämisch.
„Wenzel, mach’ mich nich unglücklich!“
Liebich sinkt geknickt auf seine Karre. „Hab’ Erbarmen, Wenzel, lass mich laufen —“
„Marsch, nach dem Zollamt!“
„Hab’ Erbarmen, Wenzel —“
„Nichts da! Vorwärts marsch, oder —“
Wenzel, denk’ an de Franziska — mach se nich unglücklich wegen den paar Pfund Putter —“
„Vorwärts! Die Karre aufnehmen und — marsch vor mir her. Bei Fluchtversuch kriegst ’ne blaue Bohne zwischen die Rippen!“
„Erbarm dich, Wenzel — erbarm dich über mich und de Franziska —“
Der Grenzer hebt das Gewehr. Da nimmt der Liebich die Karre auf. Aber er lässt sie wieder fallen. Es wird ihm schlecht — er muss sich hinsetzen — alle Glieder zittern ihm — es würgt ihn —
„Ich glaub’ — mich hat — hat der Schlag gerührt — mir is so schlecht!“
Liebich is kaum imstande, sich wieder aufzurichten. Den schweren Schubkarren zu stossen, is ihm ganz unmöglich. Er fasst immer nach ’m Herzen. So muss der Grenzer schliesslich selber zugreifen. Er schiebt den Karren, und Liebich muss drei Schritt vor ihm her gehen. Wollte er ausreissen, wär’s sein Tod. So geht’s den steilen Berg hinauf. Der Weg is glitschig; das Wetter is schauderhaft — Wind und Regen schlagen den beiden ins Gesicht. Der Grenzer schwitzt und kann’s kaum noch ermachen. Aber er muss den Karren schieben, denn der Liebich is ganz hin. Taumelig geht er vor ihm her. Immer wieder mal sagt er:
„Wenzel, ich bitt’ dir alles ab, was ich dir angetan hab’ — aber lass mich laufen — tu’s uns nich an!“
Der andere hört nicht darauf.
Und nu kommt’s.
Wie sie den Berg rauf sind, bis zur Chaussee und nich mehr weit zum Zollhause haben, greift der Liebich uff eenmal in de Westentasche und sagt ganz gemütlich: „Na, da hab’ ich ihn ja!“
Und a bringt einen richtigen Zollschein raus. A hatte die Putter richtig verzollt. Der Grenzer, der kaum noch schnaufen kann, steht wie versteinert vor ihm, und Liebich lacht und sagt:
„Ich dank’ Dir ooch, Wenzel, dass du mir die schwere Karre auf ’n Berg geschoben hast. Bist halt doch ein gutter Kerl, Wenzel! Von der Putter back’ wir nu Hochzeitskuchen. Sollst ’n Stickel davon kriegen.“
Der andere is nu nahe am Ersticken gewest, aber der Liebich hat gemeint:
„Ich hab’ dir’s doch von vornherein gesagt, dass ich die Putter verzollt hatte. Und wenn ich dir was sag’, kannste es doch glauben.“
Hat die Achseln gezuckt, is plötzlich wieder ganz bei Kräften gewest und hat seinen Karren auf der Chaussee gemütlich weitergefahren. Und der Wenzel hat sich an einen Baum anhalten müssen und hat laut geheult vor Wut und Scham, wie ihn der andere geäfft hat. A hat mir amal erzählt, a hätt’ ihn totschiessen wollen, aber der liebe Gott hätte ihn vor der Sünde bewahrt. Aber er hat ’n tödlichen Hass uff a Liebich, und das nehm’ ich ihm ooch nich übel.“
Soweit ging die Erzählung des Roten Hahnenwirtes.
Es war unterdes dunkel geworden, und wir gingen schlafen. Von meiner Giebelstube aus sah ich noch ein wenig hinaus auf die dunklen Waldberge. Wer weiss, wo der Wenzel jetzt lag mit der Flinte im Arm und auf das menschliche Wild lauerte, das sich scheu und verstohlen durch die schwarzen Waldgänge schlich und auf jeden Laut lauschte, auf jedes Zeichen Obacht gab, das ein nahes Verderben anzeigen konnte. Und wie ich noch so hinaussah, passierte ein Schmugglerstück dicht vor meinen Augen.
Ein Mann mit einem Schubkarren tauchte aus dem Dunkel auf. Er klopfte leise an einen Fensterladen. Der Hahnenwirt kam aus dem Hause, spähte erst nach allen Seiten, verhandelte mit dem Mann im Flüsterton und belud dann seinen Karren mit einem Fass und einem kleinen Paket.
Der Hahnenfuss und die drei Stengel Rosmarin!
Das ging nun hinüber über die Grenze nach dem „Blauen Hahn“. Ich war so aufgeregt, dass ich noch nicht schlief, als die Wirtsstubenuhr unten die elfte Stunde klirrte. Nicht lange darauf klopfte es unten an die Tür. Ich fuhr rasch in die Kleider, denn wo hätte ich junger Bursch ein Geschehnis in dem alten Schmugglerhaus verpassen wollen. Ich schlich die Treppe hinab und duckte mich in einen Winkel. Hollmann kam mit einer Laterne angeschlürft und fragte, wer draussen sei.
„Liebich — der Wassermüller Liebich!“ antwortete eine tiefe Stimme.
Mir pochte das Herz. Der Müller Liebich, der war ja der berühmte Schmuggler, der Gegner Wenzels, des Grenzers.
Da öffnete der Wirt die Tür. Ein kräftiger Mann stand draussen.
„Nanu, Liebich, willst du was über die Grenze schaffen?“
„Ja,“ sagte der andere, und seine Stimme war ganz heiser.
„Meine —meine Frau will ich rüberschaffen.“
„Deine — Frau?“
Liebich lehnte sich an den Türpfosten.
„Sie is gestorben,“ sagte er tonlos. „Die Leiche will ich rüberschaffen. Da liegt sie.“
Er wies auf ein Wägelchen, das draussen im Dunkeln stand.
„Liebich,“ rief der Hahnenwirt, „du redst wohl irre? Du wirst doch mit sowas keen Allotria treiben!“
„Komm raus,“ sagte der andere. Der Hahnenwirt ging hinaus, und ich folgte, ohne dass mich jemand bemerkte. Liebich hob eine Decke von dem Wägelchen auf. Darunter stand ein Sarg. Tiefinnerlicher Schmerz schüttelte den Mann so, und er weinte so stossweise, so bitterlich, dass der ganze furchtbare Ernst klar war.
„Wann — wann is se denn —“
„Vorgestern. Wir haben das erste Kind gekriegt. Nach sechs Jahren. Das Kind lebt — die Franziska is tot.“
„Und nu willst du sie rüberschaffen? Nach Hause?“
„Ja, sie wollte drüben begraben werden.“
„Und warum bringst du sie denn in der Nacht?“
„’s macht sonst zu viel Schererei, wenn man eine Leiche über die Grenze haben will. Is se aber erst amal drüben, wird se auch drüben begraben.“
Liebich wollte die Leiche seiner Frau über die Grenze schmuggeln. Er konnte wohl gar nicht anders; sein ganzes Denken war so eingerichtet, dass ihm ein Verhandeln mit Grenzbehörden ganz ausgeschlossen schien. Müde setzte er sich auf die Bank, auf der ich vorhin mit Hollmann gesessen hatte.
„Ich wollt’s alleine schaffen,“ sagte er, „aber ich kann nich. Die Kräfte verlassen mich.“
Was er dem Feinde gegenüber früher einmal geheuchelt hatte, war jetzt bitterster Ernst geworden.
„Du musst mir helfen, Hollmann; ich ermach’s nich alleine.“
Der Gastwirt erholte sich von seiner Bestürzung; dann versprach er, dem Freunde zu helfen. Jetzt erblickte er auch mich und schnob mich wohl erst zornig an; aber nach einigem Hin und Her erlaubte er mir sogar, mich dem kleinen traurigen Zug anzuschliessen.
Die Leiche einer jungen Frau und Mutter auf einem kleinen wackeligen Wägelchen, vorn an der Deichsel der leise schluchzende Mann, hinten, den Karren schiebend, Hollmann und ich, so ging es langsam den Bergweg hinauf. Ein müder Nachtwind surrte durch die Bäume, ein feiner Regen rieselte vom Himmel. Was war das für eine traurige Fahrt! Und doch pochte mir das Herz in ungewohnten Schauern, und die Wangen brannten mir viel mehr von der Aufregung als von der Anstrengung.