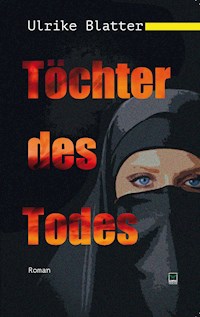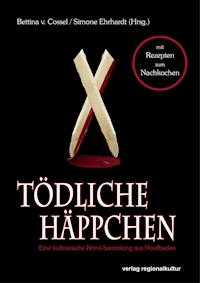Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lindemanns
- Sprache: Deutsch
Ein literarischer Krimi-Leckerbissen. Wahrsagerin Blanche will reich werden - sehr reich. Noch haust sie im Kölner Severinsviertel, wo die Häuser bröckeln. Bald wird sie sich jedoch ein exklusiveres Domizil gönnen, denn sie treibt ihr Spiel mit der ebenso naiven wie wohlhabenden Sybille. Aber die Geister der Vergangenheit hetzen sie Tag und Nacht. Als das Stadtarchiv einstürzt, wendet sich das Blatt. Ob zum Guten oder Schlechten, weiß nur Cleo, die mysteriöse Katze. Aber wer fragt eine Katze? Ulrike Blatter, geboren im Mai. Wann sonst? In Köln. Wo sonst? Danach viel herumgekommen. Als Ärztin in der Rechtsmedizin sammelte sie Themen für ihre Krimis, in der Sozialpsychiatrie lernte sie Menschen mit originellen Biographien nicht nur kennen, sondern auch lieben. Heute lebt sie im südbadischen Exil, wo sie ihre große Liebe fand. Es zieht sie aber immer wieder zurück ins Rheinland. Da geht es ihr nicht anders als Blanche, der Protagonistin dieses Romans. Mehr Informationen unter: www.ulrike-blatter.de oder auf facebook.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike Blatter
Vor dem Erben
kommt das Sterben
Roman
Für Marianne,
die es gern noch erlebt hätte.
Extra Coloniam nulla vita;
si est vita, non est ita.
Ulrike Blatter, geboren im Mai. Wann sonst? In Köln. Wo sonst? Danach viel herumgekommen. Als Ärztin in der Rechtsmedizin sammelte sie Themen für ihre Krimis, in der Sozialpsychiatrie lernte sie Menschen mit originellen Biographien nicht nur kennen, sondern auch lieben. Heute lebt sie im südbadischen Exil, wo sie ihre große Liebe fand. Es zieht sie aber immer wieder zurück ins Rheinland. Da geht es ihr nicht anders als Blanche, der Protagonistin dieses Romans. Mehr Informationen unter: www.ulrike-blatter.de oder auf facebook.
Dies ist ein Roman; Handlungen und Personen sind frei erfunden. Steffi und Karl-Hermann Bluhme sowie Dr. Mark Benecke, die in diesem Buch „auftreten“, sind zwar reale Personen, ihre jeweiligen Handlungen und Zitate in diesem Buch sind aber ebenfalls frei erfunden. Die entsprechenden Textpassagen wurden von ihnen autorisiert. Kevin K. (17) und Khalil G. (23) kamen auf tragische Weise beim Archiveinsturz ums Leben. Sie werden unter ihren echten Namen erwähnt, Lebensumstände sowie die Umstände ihres Todes beruhen auf einer Presserecherche, alle weiteren Details sind frei erfunden. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen bestehen, ist dies unbeabsichtigt und reiner Zufall. Weitere Angaben zur Recherche finden sich im Anhang.
Vorwort
von Franz Meurer*
Im Mittelpunkt dieses Buches steht das Severinsviertel. Und trotzdem spielt auch die Schäl Sick, also die andere Rheinseite, eine wichtige Rolle. Ich darf ja hier im Vorwort nichts verraten, aber das fällt mir schwer. Deshalb erzähle ich Ihnen jetzt lieber etwas über unser recht armes Viertel Köln-Vingst: „Dort beginnt Sibirien“, soll Konrad Adenauer gesagt haben. Und auch heute noch liegt die Überschuldungsquote an der Spitze der Veedel in Köln. Doch wir halten zusammen. Das sind nicht nur leere Worte, sondern ein gelebtes Miteinander.
Die Autorin dieses Buches wurde in der Südstadt geboren und zog mit sieben Jahren nach Vingst. Damals hatten die Arbeiter noch reichlich Geld in der Tasche und der Kaufhof in unserem Bezirk war die umsatzstärkste Filiale in Deutschland. Diese Zeiten sind längst vorbei. Im Jahr 2012 schloss nach 83 Jahren der Kaufhof seine Türen für immer. Und so, wie in diesem Buch der Niedergang des Severinsviertels protokolliert wird, erging es auch uns auf der Schäl Sick: Nach und nach fielen 70 000 Arbeitsplätze weg. Schritt für Schritt wurde aus dem Wohngebiet stolzer Industriearbeiter ein Stadtteil mit „Erneuerungsbedarf“, wie es so schön im Behördendeutsch heißt.
Aber Bangemachen gilt nicht! Denn auf den Niedergang folgt bürgerschaftliches Engagement. Deshalb ist Ulrike Blatters Buch auch keine Lektüre für Depressive. Ich kann nur für Köln-Vingst sprechen, aber wir machen unser Stadtviertel schön. Wir verhindern „broken windows“ und pflanzen Blumen. Ehrenamtliche und Arbeitslose mähen täglich das „Straßenbegleitgrün“ (auch so eine unsägliche Behörden-Wortschöpfung!). Dies alles tun wir und noch viel mehr, aber vor allem eins: Wir machen den Menschen Mut und geben ihnen die Selbstachtung zurück!
Für uns Vingster ist es wunderbar, dass unser Veedel in diesem Buch vorkommt. Auch die Kölner Südstadt war einmal ein Veedel der kleinen Leute. Jetzt wohnen dort vor allem die Intellektuellen und Etablierten. Dort kann man beobachten, was passiert, wenn Wohnraum für die Normalos unbezahlbar wird. Bei uns auf der Schäl Sick gibt es noch Wohneigentum für 1 000 Euro pro Quadratmeter. Wer also reich werden will: Herzliche Einladung zur Investition in Köln-Vingst!
Nach Lektüre des Buches natürlich.
*Pfarrer Franz Meurer, auch genannt Don Camillo von Köln, ist der Pfarrer der Armen und gilt als kölscher Franziskus. Der Stadtteilpfarrer für Köln-Höhenberg und Vingst, „Erzbischof der Herzen“ (Kölner Express), lehnte es 2014 ab, sich für die Nachfolge von Kardinal Meissner nominieren zu lassen.
Das Kölsche Grundgesetz
§ 1
Et es, wie et es: Sieh den Tatsachen ins Auge.
§ 2
Et kütt, wie et kütt: Habe keine Angst vor der Zukunft.
§ 3
Et hätt noch immer jot jejange: Lerne aus der Vergangenheit.
§ 4
Wat fott es, es fott: Jammere den Dingen nicht nach.
§ 5
Nix bliev, wie et wor: Sei offen für Neuerungen.
§ 6
Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet: Sei kritisch, wenn Neuerungen überhand nehmen.
§ 7
Wat wellste maache? Füge dich in dein Schicksal.
§ 8
Mach et jot, ävver nit ze off: Achte auf deine Gesundheit.
§ 9
Wat soll dä Quatsch? Stelle immer erst die Universalfrage.
§ 10
Drinkste ene met? Komme dem Gebot der Gastfreundschaft nach.
§ 11
Do laachste dech kapott:
Bewahre dir eine gesunde Einstellung zum Humor.
Prolog
3. März 2009
In dem Moment, als das Kölner Stadtarchiv einstürzte, stand Blanches Herz bereits seit einigen Sekunden still. Vielleicht hatte sie das Grollen gerade eben noch wahrgenommen. Diesen unterirdischen Pulsschlag, der wie ein Erdbeben durch das ganze Stadtviertel fuhr. Aber als der Putz von der Badezimmerdecke rieselte, war ihr Kopf schon nach vorne gesunken und Blanches Gesicht trug den Ausdruck dümmlicher Überraschung. Wie bei einer, die aus dem Halbschlaf geweckt wurde und nicht recht weiß, wo sie sich befindet, schienen ihre halb offenen Augen den knallorangenen Fön zu betrachten, der sich zwischen ihren bleichen, sommersprossigen Unterschenkeln auf dem Wannenboden drehte. Wie ein übergroßes Insekt mit trägem Flügelschlag setzte er das Wasser in Bewegung. Um und um rührte er das Fichtennadelgrün, das sich immer weiter erhitzen und schließlich auch die Farbe verändern würde. Und auch mit dem Duft nach frischem Wald wäre es dann bald schon vorbei.
Ob Blanche das Augenpaar erkannt hatte? Diesen Blick, der auf ihr ruhte, wenige Sekunden bevor der Fön ins Wasser fiel? Diese weit geöffneten Augen, trügerisch klar; man meint, durch sie hindurchzusehen bis auf den tiefsten Grund einer einsamen Seele. Aber ist nicht alles, was wir zu sehen meinen, eine Täuschung? Jedenfalls wird Blanche viel Zeit haben, über die ganze Angelegenheit gründlich nachzudenken. Solche Seelen wie ihre wandern lange. Ich weiß es genau. Mein Name ist Cleo. Ich bin über zweitausend Jahre alt. Ich lese die geheimsten Gedanken und durchschaue Menschen bis in den letzten Winkel ihrer Seele.
Ich spreche jedoch nicht mit jedem. Und nicht jeder, mit dem ich spreche, versteht mich.
Ein Schlag unten im Keller. Es wird dunkel. Der Fön surrt nicht mehr. Das Wasser kommt zur Ruhe. Draußen zuckt Blaulicht. An- und abschwellendes Sirenengeheul. Aber sie fahren an unserem Haus vorbei.
Mein Name ist Cleo. Ich bin die Beobachterin.
TeilI
Bühnenbild und Maske
Ich hatte bekannte Straßen bei euch
mit Steinen, die Guten Tag sagten
zu meinen Füßen, wenn sie darauf traten.
(Irmgard Keun)
Kapitel 1
Montag, 29. September 2008, gegen Mittag
Kaum hatte der Zug angehalten, riss Blanche die Tür auf und sprang mit beiden Beinen in all das Rot, das ihr entgegenknallte. Aber der rote Teppich auf Bahnsteig 3 war lediglich ein aufgeklebter Kunststoffstreifen, an den Rändern abgetreten und in der Mitte schon ziemlich schmuddelig. Für einen winzigen Moment stand Blanche vollkommen allein dort: eine schmale Gestalt in schwarzer Lederjacke und Lederhose, den breitkrempigen Cowboyhut verwegen auf den dunklen Haaren, die im Nacken nachlässig zusammengebunden waren. Als sich schließlich auch die anderen Türen öffneten und die Masse der Mitreisenden sich auf den Bahnsteig ergoss, schwamm Blanche in der Menge mit. Obwohl ihre Füße in schweren Boots steckten, mutete ihr Gang fast tänzerisch an. Vielleicht lag es daran, dass sie an dem Rucksack auf der rechten Schulter nicht besonders schwer trug. Weiteres Gepäck hatte sie nicht.
Der rote Teppich führte weder zur Treppe noch zum Aufzug, sondern endete an einer beleuchteten Plakatwand. „Kölner Impro-Festival“ stand dort auf knallrotem Grund. Blanches blasse Lippen brachten so etwas wie ein Lächeln zustande, während ihre Augen sich zu Schlitzen verengten. Improvisations-Theater. Damit kannte sie sich aus. Seit über zwanzig Jahren tat sie nichts anderes. Zwar nicht auf den Bühnenbrettern, die angeblich die Welt bedeuten, sondern ganz real in der Welt, die ihr viel zu oft zur Bühne wurde. Und das war Blanches Welt: die engen Seitengassen, die dunklen Hinterhöfe, die lärmigen Kneipen und die nächtlichen Autobahnraststätten. Viel zu oft war ihre Welt auch nur ein Schlafplatz unter der Brücke oder eine öffentliche Toilette gewesen. Aber das war nun vorbei. In letzter Zeit war es deutlich besser gelaufen. Nach der Klinik das Zimmer in der WG und danach Gruppenräume und Seminare. Viele Seminare. Die Dokumente in Blanches Rucksack wogen nicht viel. So wenig, wie ein paar Seiten Papier eben wiegen. Blanche jedoch wusste, was sie wert waren. Sie waren Eintrittskarten in ein neues Leben. Improvisationstheater? Wieder glitt ein schiefes Grinsen über Blanches Gesicht. Mit dem Lächeln gerieten mehrere Piercings in Augenbrauen und Lippen in Bewegung. Sie wandte sich zur Treppe, holperte schnellfüßig durch die Menschenmenge nach unten in die Bahnhofspassage. Ihr Cowboyhut wippte hoch über den Köpfen der anderen wie eine vorwitzige Boje in mattem Wellengang.
Vor dem Glasportal wandte Blanche den Blick nach oben und atmete durch. Die steinerne Masse ragte turmhoch. Ein Wasserfall, der innehielt, sich den Gesetzen der Schwerkraft entzog, um im nächsten Moment nach oben zu fließen, hoch, schwindelnd hoch, bis zu den Turmspitzen. Und dann ... Blanche legte den Kopf in den Nacken, hielt mit einer Hand den Hut, der ins Rutschen gekommen war, und atmete tief durch. Zwanzig Jahre hatte sie den Dom nicht mehr gesehen.
Auf der zugigen Domplatte standen vier als Engel verkleidete Möchtegern-Pantomimen und nötigten Passanten zu gemeinsamen Fotos. Hier war alles ein einziges Theater. Blanche zog eine Sonnenbrille aus der Jackentasche, versteckte den Ausdruck ihrer Augen, wandte der Domplatte den Rücken zu und bog kurz darauf mit entschlossenen Schritten in eine breite, fast schnurgerade Straße mit hohen Häuserfronten. Sie schritt weit aus und fasste ihr Ziel ins Auge.
Schon von Weitem leuchtete ihr die prächtige romanische Fassade von St. Gereon entgegen. Blanche machte sich allerdings weder Gedanken um die fast tausendjährige Geschichte der Kirche noch interessierte sie die architektonische Raffinesse der zehneckigen Kuppel, des berühmten Dekagons. Sie betrat mit klopfendem Herzen das stille Kirchenschiff durch einen Seiteneingang, tupfte aus alter Gewohnheit mit dem Zeigefinger in den Weihwasserbehälter, vergaß jedoch das Kreuzzeichen. Entschlossenen Schrittes ging sie zum Dekagon, die Augen starr auf eine Mauernische gerichtet, in der ein knapp mannshoher Säulenstumpf stand. Die sogenannte Blutsäule. Angeblich sei Jesus Christus an ihr gegeißelt worden. Blanche kannte die Übersetzung der lateinischen Inschrift nur zu gut: „Glaube mir, hier an diesem Stein wurde vor langer Zeit Blut vergossen. Wenn ich mich schlecht verhalte, straft ER.“ Der Legende nach durfte man sich der Blutsäule nur mit reinem Gewissen nähern, da man sonst empfindlich bestraft wurde. Hatte man gar ein Menschenleben auf dem Gewissen, sollte man erst recht in sicherer Entfernung bleiben. Schon mancher, der den Rat nicht beherzigt hatte, musste für diesen Leichtsinn mit dem Leben zahlen. Einige heimliche Mörder, die in frecher Herausforderung vor die Säule getreten waren, brachen kurz darauf tot zusammen.
Bei der späteren Untersuchung der Leiche fand man die Kleidung in der Regel unbeschädigt, dennoch wiesen alle tiefe Stichwunden über dem Herzen auf.
Nichts lag Blanche ferner, als das Schicksal herauszufordern. Aber sie brauchte Klarheit. Wenn schon das eigene Gewissen keine ausreichende Richtschnur bot, dann war ein solches Orakel eine willkommene Hilfe. 1981 hatte sie schon einmal vor den Toren von St. Gereon gestanden, sich jedoch nicht hineingewagt. Jetzt lagen die Dinge anders. Jetzt wollte sie nicht mehr länger weglaufen. Selbst wenn sie damals schuldig geworden war, hatte sie nicht in den letzten Jahren genug gebüßt? Objektiv betrachtet, war es die reinste Idiotie, die Entscheidung zur Rückkehr von einem solch abergläubischen Ritual abhängig zu machen. Blanches Fall würde niemals vor einer irdischen Gerichtsbarkeit verhandelt werden, so viel war sicher. Es blieb ihr also nur dieser spirituelle Weg. Außerdem betrachtete sich Blanche sowieso als Expertin für Spirituelles. Was lag also näher, als sich todesmutig diesem Test zu unterziehen?
Blanche atmete tief durch, nahm die Sonnenbrille ab und stellte sich frontal vor die Säule. „Hier bin ich“, sagte sie mit zittriger Stimme. Nichts geschah. Sollte sie vielleicht niederknien?
Nein, das wäre nun doch zu albern. Sicher stand sie schon fünf Minuten hier. Nichts. Zumindest kein Stechen in der Herzgegend. Nur die Kälte, die allmählich vom Steinboden in Blanches Beine kroch. Blanche seufzte. Tiefe Erleichterung machte sich breit. Es war gut, dass sie sich dazu durchgerungen hatte. Denn es fühlte sich besser an als jede Absolution. Sicherheitshalber wartete sie noch sechzig Atemzüge lang und achtete darauf, langsam zu atmen. Das Schicksal sollte seine Chance haben. Blanche betrachtete sich als komplizierten Fall und wollte die Aktion nicht überhastet abbrechen. Das Schicksal sollte alle Fakten überprüfen und in Ruhe abwägen, um dann zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Blanche würde das Urteil akzeptieren.
Als sie sich schließlich zum Gehen wandte, holte sie das eingangs vergessene Kreuzzeichen nach und hätte dabei gleichzeitig am liebsten der Säule die Zunge rausgestreckt. Schaute nach oben. Erstarrte. Die zehneckige Kuppel über ihr war rot, so rot. Rot wie Blut. Dicke Tropfen quollen aus dem höchsten Punkt der Kuppel, liefen an den Mauerrippen entlang, und wenn sie sich nicht schnell in Sicherheit brachte, würden sie Blanche treffen und sie von oben bis unten besudeln. Sie machte, dass sie fortkam. Im Langschiff wandte sie den Blick zurück und erkannte, dass es goldene Tropfen vor rotem Hintergrund waren. Harmlos. Kein Blut. Vermutlich der Heilige Geist oder etwas in dieser Art.
„Sei nicht albern“, ermahnte sie sich selbst und warf sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen die schwere Kirchentür.
Draußen überflutete sie goldenes Herbstlicht. Sie setzte wieder die Sonnenbrille auf.
„Köln, ich komme“, sagte sie laut.
Kapitel 2
Montag, 29. September 2008, nachmittags
Warum war sie eigentlich nach Köln zurückgekehrt? In Blanche verknoteten sich Gedanken und Gefühle. Wiedersehensfreude war nicht darunter. Eher eine Art unklarer Sehnsucht, überschattet von lähmender Müdigkeit. Et es, wie et es. Das war der Satz, der in diesem Durcheinander immer wieder auftauchte. Erster Artikel des Kölschen Grundgesetzes. Den Tatsachen ins Auge blicken, nicht immer nur weglaufen. Endlich zur Ruhe kommen. Einfach mal sehen, was das Leben so bringt. Et hätt noch immer jot jejange. Dritter Artikel Kölsches Grundgesetz. Aber dennoch, je näher sie dem Severinsviertel kam, desto übermächtiger wurden die Erinnerungen ...
Nach der Schule hatte Blanche immer den Umweg über den Chlodwigplatz genommen und jeden Tag vor der Severinstorburg innegehalten, bevor sie weiterging. Das Fallgitter, ein kopfüber hängender Staketenzaun aus spitz zulaufenden Planken, war stets zu einem Drittel heruntergelassen. Wahrscheinlich sollte das dekorativ wirken. Als Kind hatte Blanche jedoch immer einen leisen Schauder im Nacken, wenn sie sich dem mittelalterlichen Stadttor näherte. Es war ihr unmöglich, einfach nur hindurchzugehen. Sobald sie sich der Fall-Linie des Gatters näherte, begann sie zu rennen. Immer. Denn niemand konnte mit Sicherheit wissen, ob sich die rostige Konstruktion nicht doch einmal aus dem Mauerwerk löste und todbringend herabsauste, ihr das Genick durchschlug, und nur wenn sie unaussprechliches Glück hätte, verlöre sie lediglich ein Stück ihrer Ferse, genauso, wie sie es einmal in einem Märchen gelesen hatte.
So wurde Blanche mitsamt ihrer ledernen Schultasche täglich von den Schatten des Severinstores verschlungen und anschließend ausgespien in eine enge und lärmige Straße, die den Namen desselben Heiligen trug, nach dem eine Brücke benannt war, eine Kirche, eine Kneipe und sogar der erste Sohn des Frontmanns von BAP, ja das ganze Stadtviertel war nach dem berühmten Bischof Severin benannt. Aber kein vernünftiger Mensch hätte jemals das Wort Severinsviertel in den Mund genommen. Man lebte im Veedel, für jeden Kölner reichte das als Ortsangabe. Und für die vollkommen Begriffsstutzigen oder Auswärtigen schob man allenfalls noch ein genuscheltes Vringsveedel als Erläuterung nach. Denn „dat Veedel“ war schon Kult, lange bevor es vom offiziellen Tourismus entdeckt wurde. Und zwar bei den Alteingesessenen. Bot das Veedel doch alles, was man zum Leben brauchte. Und das im Überfluss. Was es dort nicht gab, brauchte keiner. Man munkelte sogar von Ureinwohnern, die noch nie im Leben am Neumarkt gewesen seien. Mit zehn begann Blanche, an diesem heimattrunkenen Gewäsch zu zweifeln. Und spätestens mit zwölf glaubte sie den Erwachsenen kein Wort mehr. Nicht ein einziges. Jeden Mittag umklammerte Blanche die Lederriemen ihres Schulranzens und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen den Schlund der Severinstorburg. Andere Menschen durchquerten den Torbogen, als sei nichts dabei. Als spürten sie keine Bedrohung. Als wüssten sie nicht, wie eng es dahinter wurde. Denn hier drinnen war alles anders. Draußen war es laut und hell und frei. Draußen war es gefährlich, aber nicht dunkel-gefährlich, sondern gefährlich wie auf einer Achterbahn: prickelnd, überraschend und atemraubend. Draußen lockte die Gefahr. Drinnen drohte sie. Drinnen, das hieß Heimat und Familie. Drinnen war alles so scheußlich vertraut. Drinnen, das hieß dauernde Kontrolle und ständig diese lästigen Fragen, auf die es keine Antworten gab. Am liebsten hätte sie das alles hinter sich gelassen, hätte Flügel gehabt und wäre fortgeflogen. Als sie es dann endlich ausprobierte, kam der Absturz. Und sie konnte rennen, so lange sie wollte und so weit sie wollte. Sie wusste: Das Tor stand dort und wartete auf sie. Das Tor war geduldig.
Blanches Hand umklammerte Mutters Brief mit der Adresse in Köln-Höhenberg. Dort war sie noch niemals vorher gewesen. Ziemlich öde Ecke. Galt als Problembezirk.
Hohe Arbeitslosigkeit. „Aber viel Grün“, hatte Mutter geschrieben. „Jetzt kann ich wenigstens aus dem Fenster gucken, ohne auf Häuserwände zu starren. Und dieser ewige Lärm von der Baustelle! Mir wurde das alles zu viel.“ Diese Zeilen hatten Blanche irritiert. Seit Generationen hatte ihre Familie im Veedel gelebt. Irgendetwas musste passiert sein.
*
„Ja klar ist hier einiges passiert. Was denkst du dir eigentlich? Du kommst nach über zwanzig Jahren zurück – und alles ist genauso, wie es einmal war?“ Zumindest Mutters nörgelnder Tonfall war derselbe.
„Du hast dich ganz schön verändert.“ Blanche versuchte, es neutral auszudrücken. War es die Frisur? Mutter trug einen damenhaften Bob mit aufwendig gemachten Strähnchen in Gold- und Kupferblond und nicht mehr diese Vokuhila-Katastrophe. Zugegeben, damals war das der letzte Schrei gewesen, und als Inhaberin zweier Friseursalons war Blanches Mutter gezwungen, fast jede Modetorheit auf dem eigenen Kopf vorzuführen. Aber unzweifelhaft war Mutter inzwischen zur Dame mutiert. Sogar ihre Gesichtshaut war vornehm erblasst. Statt knackiger Solarium-Bräune und kreisrunder Rougebäckchen sah Blanche zarte Knitterfältchen mit einem dezenten Hauch von Puder und Make-up. Nur die Augenbrauen waren immer noch viel zu stark gezupft. Die schwungvoll nachgemalten Bögen waren eine Spur zu hoch nach oben gerutscht und verliehen Mutters Gesicht den steten Ausdruck leichter Verblüffung.
„Ich hab mir die Zähne machen lassen“, bemerkte Mutter und entblößte eine makellos porzellanene Front. „Das ist doch nicht Mutters Gesicht“, dachte Blanche. „Das ist irgendwie ... eine Maske.“
Durch das Wohnzimmerfenster ging der Blick in einen kleinen, akkurat gepflegten Garten. Im Wesentlichen bestand er aus Rasen und Hecke. Auf der Türmatte hatte gestanden: Herzlich willkommen. Mutter hatte auf Blanches Klingeln sofort geöffnet. So, als hätte sie gewartet. Unerklärlicherweise hatte sie Blanche sofort erkannt. Kurz hatte es so ausgesehen, als wolle sie Blanche sogar umarmen. Sie hatte sich jedoch rasch wieder im Griff gehabt und ihrer Tochter lediglich die Fingerspitzen ihrer sorgfältig manikürten Hand gereicht.
„Und das Rauchen habe ich auch aufgegeben.“ Mutter drückte den Rücken durch. „Das ist sehr gut für die Haut.“
„Ich nicht. – Noch nicht.“ Blanche ärgerte sich über den schuldbewussten Klang ihrer Stimme. „Gar nicht so einfach, mit dem Rauchen aufzuhören. Bei all dem Stress.“ Mutter erkundigte sich nicht weiter nach Blanches Stress. Sie saß, ohne sich anzulehnen, auf dem weißen Ledersofa. Blanche hatte das Zigarettenpäckchen erst gar nicht aus der Jackentasche gezogen. Auf dem Glastisch standen zwei Kaffeetassen und zwei Wassergläser. „Früher hatten wir doch dieses Geschirr mit Blümchenmuster?“ Blanche kramte in ihrer Erinnerung. „Das mit dem goldenen Rand und den Vergissmeinnicht.“
„Das hab ich auf dem Flohmarkt verkauft, nachdem die Omma gestorben war.“ Mutter klang mürrisch. Ihr Blick ging ins Leere. Sie hatte „Omma“ gesagt. Mit kurzem O und hastig gedoppelten M. Blanche tastete nach dem Zigarettenpäckchen und atmete tief durch. Kaffeetassen. Sie war ein Vierteljahrhundert weggewesen, und jetzt sprachen sie über Kaffeetassen. Vielleicht war das auch besser so. Sonst müssten sie über das andere sprechen. Über das Unaussprechliche. Blanche stand auf.
„Ich glaube, ich muss jetzt“, sagte sie. Sie sagte es in einem Tonfall, als habe sie ein festes Ziel. Mutter blieb sitzen. „Wo willst du denn hin?“
„Ich komme schon klar.“
„Nun hau doch nicht gleich wieder ab. Du bist doch gerade erst gekommen.“
Lisbeth stand auf und kramte umständlich aus einer Schublade einen Schlüsselbund heraus. „Kennst du den?“
Blanche schluckte. „Die alte Wohnung?“
Lisbeth legte den Schlüsselbund in die Mitte des Tisches. „Genau. Ich schlage vor, wir beide machen einen ...“ Sie zögerte. „ ... wir machen einen Deal – so sagt man das doch? Ich hätte dir immer gern eine Ausbildung oder sogar ein Studium gezahlt. Aber du hattest ja andere Pläne.“ Lisbeths Blick ging ins Ungefähre, und Blanche rutschte unangenehm berührt hin und her. „Stattdessen durfte ich blechen für deine Therapien und für die Entzüge“, fuhr Lisbeth mit harter Stimme fort. „Wie viele waren es eigentlich? Jahrelang habe ich gar nichts von dir gehört, und jetzt stehst du auf einmal vor meiner Tür, als wäre nichts gewesen. Aber jetzt, mein Fräulein, bekommst du deine letzte Chance, um mir zu beweisen, dass du dein Leben endlich mal in den Griff kriegst.“
Und während Blanche die Augen nach oben verdrehte, wurde Mutters Tonfall weinerlich: „Mit Omma ging es ja schon länger bergab“, wechselte sie urplötzlich das Thema. „Trotzdem – als wir die Metzgerei verkaufen mussten ... das war wirklich schlimm für sie. Aber Omma war einfach zu vergesslich geworden. Und stehen konnte sie auch nicht mehr.“
„Die Krampfadern“, warf Blanche ein, froh, auch etwas zum Gespräch beizutragen, aber Mutter hatte schon wieder eine Kehrtwende vollzogen und lamentierte nun über den Verfall der Immobilienpreise. Ihre damenhaft bleiche Gesichtshaut rötete sich, und selbst das Dekolleté wurde fleckig. „Als diese verdammte Baustelle immer näher rückte, bekamen es die Leute allmählich mit der Angst zu tun“, berichtete sie. „Überall Risse in den Wänden. Und dann diese ständigen Vibrationen ... 2004 ist dann der Kirchturm von St. Johann Baptist beinahe umgekippt. Wahrscheinlich hast du davon in der Zeitung gelesen.“
Blanche nickte wortlos. Damals, als die Bilder vom „Schiefen Turm zu Kölle“ über die Fernsehschirme der Nation flimmerten, hatte es Blanche einen Stich gegeben. Zuerst hatte sich Blanche über ihre ungewohnten Gefühle gewundert, dann heftig an ihren Wahrnehmungen gezweifelt. Aber schließlich blieb nur eine einzige Erklärung: Es war banales Heimweh, das sie hinterrücks übertölpelt hatte. Unaufhaltsam waren weitere Erinnerungen hochgekommen – und zwar nicht solche, die sie zu fürchten gelernt hatte, nein, die schrecklichen Bilder blieben sorgsam verstaut in den untersten Schubladen ihres Bewusstseins. Wie aus dem Nichts leuchteten nun wieder die Bilder unbeschwerter Tage. Und dieser ganze elende Gefühlswirrwarr, der sich aus all dem ergab, hatte schließlich dazu geführt, dass Blanche ein Zugticket nach Köln gekauft und keine Rückfahrkarte gelöst hatte. Und nun saß sie auf einem weißledernen Sofa und ließ das Gejammer einer knapp sechzigjährigen Frau über sich ergehen.
„Für Ommas Metzgerei haben wir fast nichts mehr bekommen. Die Immobilienpreise waren endgültig im Keller.“ Mutter seufzte. „Wir hatten den besten Zeitpunkt zum Verkauf um mindestens zwei Jahre verpasst. Omma hat den Verlust der Metzgerei übrigens nie verwunden. Der Laden war tatsächlich ihr Lebenselixier gewesen. Na ja ... um es kurz zu machen: Du kannst dir an zehn Fingern ausrechnen, dass es finanziell grade so gereicht hat für das Häuschen hier und für die Pflege von Omma.“
Mutter zog eine gute Show ab, das musste der Neid ihr lassen. Blanche wusste gar nicht, dass sie die Rolle der treusorgenden Tochter auch drauf hatte. Glitzerten da nicht sogar Tränen in Mutters Augen? Lisbeth räusperte sich jedoch, drückte den Rücken wieder durch und stellte eins unmissverständlich klar: „Das bisschen Geld, das mir jetzt noch geblieben ist, muss reichen. Das ist quasi meine Rente. Mit vierzig bist du jetzt wirklich alt genug, um für dich selber zu sorgen. Und spekulier bloß nicht auf ein fettes Erbe ... Denn eins garantiere ich dir: Ich lasse niemandem etwas übrig. Eher stecke ich den letzten Cent in eine Karibik-Kreuzfahrt und lasse mich auf See bestatten. Ich habe mein Lebtag lang hart gearbeitet, und jetzt will ich mir auch endlich mal was gönnen. Ein halbes Jahr gebe ich dir – und keinen einzigen Tag länger, hast du mich verstanden?“
Mit diesen Worten schob sie den Schlüssel rüber zu Blanche. „Klare Ansage“, antwortete Blanche und zog das Zigarettenpäckchen heraus.
„Darf ich?“ Mutter nickte schweigend und schob eine Untertasse als Aschenbecher in Reichweite.
„Du hast dich wirklich sehr verändert“, wiederholte Blanche und stieß den Rauch genussvoll aus. „Na ja, man tut eben, was man kann.“ Mutter griff sich ins Haar. Sie sah besser aus, als jemals zuvor in ihrem Leben – und sie wusste das.
„Aber ganz ehrlich ...“ Mutters Blick wanderte über Blanches Gestalt. „Du bist auch nicht mehr das, was du mal warst.“
Und das war ganz eindeutig kein Kompliment.
Kapitel 3
Montag, 29. September 2008, früher Abend
Nachdem Blanche gegangen war, saß Elisabeth Schmitz, genannt Lisbeth, noch lange auf dem weißen Ledersofa und starrte auf ihre Hände. Ihre Haut hatte sich längst schon von der jahrzehntelangen Friseurarbeit erholt. Die stets offenen Ekzeme zwischen den Fingern und die schmerzhaften Schrunden am Nagelbett waren verschwunden. Dafür waren Altersflecken hinzugekommen. Und statt Fingernägeln in Neon-Knallfarben, nun French Manicure. Dezent und sauber. Bloß nichts Auffälliges. Ein Spaziergang würde ihr jetzt sicher guttun. Bis zu den weiten Rasenflächen der Merheimer Heide waren es nur wenige Schritte.
Lisbeth könnte die Abkürzung nehmen und am Rand der Merheimer Heide entlang bis zum Kalker Friedhof spazieren. Sie könnte Ommas Grab besuchen. Lisbeth war zwar nicht der Typ, der an Gräbern stumme Zwiesprache hielt. Aber vielleicht würde es ihr in diesem Fall trotzdem guttun.
Lisbeth blieb sitzen.
Durch das angekippte Fenster drang leise zischend der Puls der nahen Autobahn. Lisbeth hörte nichts. Sie saß dort im Tosen ihrer Erinnerungen.
Ihre Tochter Lara nannte sich also neuerdings Blanche. Warum sie ihren alten Namen abgelegt hatte, verriet sie nicht. So, wie sie eigentlich kaum jemals etwas wirklich Wichtiges mit ihrer Mutter besprochen hatte. Wenn man es genau nahm, hatten Lisbeth und Lara sowieso nur wenig miteinander zu tun gehabt. Eigentlich schon seit Laras Geburt.
Nein, genau genommen, sogar schon vorher. Lisbeth war gerade zwanzig geworden und steckte mitten in den Vorbereitungen zum Meister-Kurs, als sich das Kind anmeldete. Was aber nicht wirklich ein Problem sei, wie die Omma meinte. „Ich war auch zwanzig, als ich dich bekommen habe. Und 1948 war ein Kind wirklich das Letzte, was ich brauchen konnte. Nach der Währungsreform ging es endlich wieder mit der Metzgerei aufwärts, und wir hatten alle Hände voll zu tun. Gott sei Dank wird ein Kind ja im Wesentlichen von alleine groß. Und dat Kleine von dir, dat kriegen wir auch groß, Lisbeth, da brauchste dir keine Sorgen zu machen.“
Omma war schon immer eine ungewöhnliche Frau gewesen. Tatkräftig und mit jeder Menge Haare auf den Zähnen. Der ältere Bruder und Erbe der Metzgerei wurde seit Januar 1943 vor Stalingrad vermisst, und von diesem Schlag erholten sich beide Eltern nie mehr. Die Mutter hoffte und grämte sich zu Tode, und der Vater schloss sich freiwillig einem Himmelfahrtskommando des Volkssturms an, nachdem von der Metzgerei nur noch ein rauchender Trümmerhaufen übrig geblieben war. Und während Köln noch aussah wie nach dem realexistierenden Weltuntergang, hatte die Omma nach Kriegsende die Ärmel hochgekrempelt und begonnen, den elterlichen Betrieb wieder aufzubauen. Eigentlich unmöglich, war die Omma doch damals noch nicht mal volljährig gewesen. Und sie hatte auch lediglich eine Ausbildung als Fleischfachverkäuferin gehabt. Und dies auch nur mit einem „So-lala-Abschluss“, der den Kriegswirren geschuldet war. Aber damals herrschten wilde Zeiten, und die Kriegskinder hatten gelernt zu überleben. Irgendwie. Und dass die wiederaufgebaute Metzgerei schließlich zwei Meter weiter in die Straße hineinragte als das alte, zerbombte Haus, war sicher nur ein Zufall. Genauso, wie es auch ein glücklicher Zufall war, dass die alten Grundbücher verbrannt waren. Jedenfalls herrschte die Omma Anfang der fünfziger Jahre über ein großzügig geschnittenes Ladenlokal mit moderner Wurstküche und Fleischmengerei. Ohne die Hilfe starker Männer wäre dies alles natürlich niemals möglich gewesen. Vielleicht fiel Ommas Aufstieg auch unter die Kategorie „Fräuleinwunder“ oder „Onkelehe“. Aber über so etwas sprach man nicht, und der Erfolg gibt schließlich jedem recht. Und ob Lisbeth amerikanische Soldaten-Gene in sich trug oder diejenigen eines kräftigen Metzger-Gesellen, der 1947 für einige Monate im Vringsveedel unterschlüpfte, darüber wusste die Omma immer gut zu schweigen. Obwohl sie sich selbst als stockkatholisch bezeichnete, hielt sie sich mit solchen Belanglosigkeiten, wie es eine uneheliche Geburt war, erst gar nicht auf. Und als eine Kundin zwanzig Jahre später nicht aufhörte, über Lisbeths Fehltritt zu lamentieren, warf sie die Dame kurzerhand aus dem Laden. In dem Maße, wie Lisbeths Bauch sich rundete, verlor die Omma zwar eine Zeitlang Kundschaft, aber als das Kind erst mal da war, kamen sie alle wieder zurück. Lara war als Baby rosig und prall und stets gut gelaunt und nahm sich auf dem Arm der stolzen Großmutter fast so appetitlich aus wie die saftigen Würstchen in der Auslage. So kam die ganze Angelegenheit sachte und ohne großes Aufhebens wieder ins Lot. Und die Schnepfe vom Jugendamt, die ungezählte Mündel zu verwalten hatte, wurde regelmäßig mit einem riesigen Wurstpaket abgespeist und machte ebenfalls keine Probleme.
Die Einzige, die Probleme machte, war Lara. Die Geburtsjahre von Mutter und Tochter – 1948 und 1968 – waren wilde, unordentliche Jahre gewesen, in denen einiges an althergebrachter Ordnung ins Rutschen geraten war. Ob diese Unruhe und Unordnung auch in Laras Genen steckte?
Denn aus dem wonnigen, pflegeleichten Baby wurde ein widerborstiges und störrisches Kind. An das, was noch später kam, dachte Lisbeth nicht gern zurück. Das Leben war sowieso schon schwer genug. Man musste sich nicht auch noch durch trübe Erinnerungen zusätzlich selber fertig machen. Das führte doch zu nichts. Mit dem Verkauf der Metzgerei und der beiden Friseursalons hatte Lisbeth nämlich einen energischen Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen. Umzug auf die andere Rheinseite. Ein neues Leben. Nur, dass es partout nicht beginnen wollte, das neue Leben. Dass sie immer noch festsaß. Vielleicht sollte sie eine Kreuzfahrt buchen? Andere schafften das doch auch. Oder sie sollte sich wenigstens einen Hund zulegen, damit sie einen Vorwand hätte, in der Merheimer Heide spazieren zu gehen.
Aber sie tat nichts von alledem. Sie kam noch nicht mal runter vom Sofa. Lara jedoch hatte den Absprung geschafft.
Schon damals, an dem Tag, als die Dreizehnjährige abends nicht nach Hause kam. Natürlich gingen sie nicht zur Polizei. „Du weißt schon, warum“, sagte die Omma. „Damit trittst du nur eine Lawine los.“ Noch am gleichen Abend kam dann auch der ersehnte Anruf. Er brachte Klarheit und warf trotzdem nichts als neue Fragen auf.
„Mama, mach dir keine Sorgen. Mir geht es gut.“ Laras Stimme klang, als habe sie etwas genommen.
„Endlich fühle ich mich frei“, sagte sie. „Als ob ich Flügel hätte. Als ob ich fliege.“
„Jetzt ist sie total abgestürzt“, schluchzte Lisbeth.
„Ach was, die fängt sich wieder“, sagte die Omma. Und setzte nach reiflicher Überlegung hinzu: „Ich kenne sie.“
Lisbeth lauschte auf den Puls der Autobahn. Sie saß dort im Tosen ihrer Erinnerungen. Saß dort wie unter einer kalten Dusche.
Kapitel 4
3. März 2009, 15.30 Uhr
Ich bin Cleo. Ich kann zwar mit äußerster Präzision in die Vergangenheit sehen. Die Zukunft jedoch bleibt mir verborgen. Deswegen wusste ich nie, welches Schicksal mich erwartete. Ob dies Ärgernis oder Gnade ist, wage ich nicht zu entscheiden. Nur so viel ist sicher: Mir ist es noch nie vergönnt gewesen, in einem Bett zu sterben. – Ob diese leidige Tradition nun in einer Kölner Dachgeschosswohnung ihre Fortsetzung finden wird? Keine Ahnung, aber ich bin dieser sinnlosen Grausamkeiten so unsagbar überdrüssig! Trotzdem lassen sich die Tatsachen nicht wegdiskutieren. Ich stecke fest in dieser Wohnung, und meine üblichen Schlupflöcher sind alle verschlossen. Auch wenn ich noch so laut schreie, wird mich niemand hören. Die Nachbarin unter mir ist halb taub. Frau Yilmaz mit ihrer kleinen Tochter ist im Dezember ausgezogen, und der Laden im Erdgeschoss steht auch schon seit Monaten leer. Um genau zu sein: Nachdem Blanche ihn leergekauft hatte, schloss Frau Jansen die Ladentür, drehte den Schlüssel zweimal im Schloss herum und wurde nie wieder gesehen. Ich schweife schon wieder ab. Übrigens eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das passiert, wenn man so viel Zeit hat wie ich. Irgendwann, nach den ersten tausend Jahren, realisiert man, dass in diesem Ozean von Zeit genügend Raum ist, um die Gedanken wandern zu lassen. Aber um zum Kern zurückzukommen: Die Chancen stehen gut, dass ich hier langsam und qualvoll zugrunde gehen werde. Die Götter, oder wer auch immer, haben mir zwar Begleitung zugedacht. Wenn ich jedoch selbst hätte wählen dürfen, nie hätte ich Blanche, diese bleiche, kunstblonde Frau, auf meine Gästeliste gesetzt. Außerdem liegt sie nun schon seit mehr als einer Stunde mausetot im giftgrünen Badewasser. Kein schöner Anblick. Und auch Sie, dieses andere Wesen, dessen Blick ich lieber ausweiche, ist nicht die Gesellschaft meiner Wahl. Zugegeben, Sie steht mir nahe, dennoch bereitete Sie mir nichts als Ärger. Anfangs brachte ich Ihr sogar einiges an Sympathie entgegen – aber kaum, dass wir uns kennengelernt hatten, wurde Sie zu meiner gefährlichsten Gegenspielerin. Denn zweifellos wäre ohne Ihr Handeln Blanche noch am Leben. Und wäre es nicht meine Aufgabe gewesen, Blanche zu retten? Habe ich nun versagt und werde bestraft werden? Ich kenne die gnadenlosen Rituale nur zu gut. Es gibt kein Entrinnen.
Sie, mein rätselhaftes Gegenüber, scheint jedoch vollkommen unbeeindruckt. Ohne die Leiche weiter zu beachten, lässt Sie sich auf dem Klodeckel nieder. Sie schaut mich an. „Wie konnte es nur so weit kommen“, fragt Ihr Blick. Und meine Gedanken wandern zurück ...
*
Ich wusste, dass Lara alias Blanche kommen würde. Es war im letzten Herbst, an einem sonnigen Septembermorgen, als ich meinen Posten neben dem Laden bezog, der den schönen Namen „Wünsch dir was“ trug. Aber es wurde fast Abend, bis Blanches unverkennbare Silhouette an der Straßenecke auftauchte. Die schmale, dunkle Gestalt schlenderte die Severinstraße entlang, als käme sie nur zufällig vorbei. „Sicher hat sie als Erstes ihre Mutter besucht“, dachte ich. Deswegen war sie auch so spät dran. Den Rucksack trug sie lässig über eine Schulter geworfen. Er schien leer zu sein. Also hatte sie sich von der Mutter kein Fresspaket aufschwatzen lassen. „Ganz die Alte“, dachte ich und konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Die Haustür befand sich direkt neben dem Schaufenster, unter dem ich mich zu Boden duckte, aber Blanche beachtete mich nicht, kramte einen Schlüsselbund hervor und probierte mehrere Schlüssel aus. Ich kannte jeden einzelnen. Der Kellerschlüssel geriet ihr als Erstes zwischen die Finger. Er passte zu einem rostigen Vorhängeschloss am Kellerabteil, in dem ein rot-grün lackiertes Damenfahrrad der einzige Wertgegenstand war. Noch nicht einmal die Einbrecher, die dort regelmäßig vorbeischauten, interessierten sich dafür. Schon längst zwängten sie sich nicht mehr nachts durch Kellerfenster, sondern spazierten frech am helllichten Tag in die Häuser. Seit in der Severinstraße anstelle des Trottoirs eine metertiefe Baugrube klaffte, gerieten die Dinge generell ein wenig ins Rutschen. Manch einer im Veedel hatte schon länger das ungute Gefühl, nicht mehr auf festem Grund und Boden zu stehen. Obwohl die Bauherren von der KVB nicht müde wurden, den Anwohnern zu versichern, dass alles mit rechten Dingen zugehe. Nichts habe man zu befürchten, rein gar nichts, hieß es in stereotypen offiziellen Verlautbarungen; so, als sei es die normalste Sache der Welt, knapp unterhalb der jahrhundertealten Kellergewölbe einen Tunnel voranzutreiben. Selbstverständlich hatte ich mich schon vor Ort umgesehen. In einer Samstagnacht, als die Maschinen verstummt waren, hatte ich mich durch eine Lücke im Bauzaun gezwängt und neugierig die unterirdische Baustelle inspiziert. Ich hatte im Laufe der Jahrhunderte schon viele kühne Bauwerke gesehen. Dieses jedoch war mir unheimlich. Eiskaltes Sickerwasser hatte meinen Rücken durchnässt, und der Schreck fuhr mir bis ins Mark, als ich die metallenen Stützstreben im Tunnel ächzen hörte. Aber was mich schließlich endgültig zum Rückzug bewegte, war das befremdliche Verhalten der Ratten, die, gleich mir, in dieser Nacht die Baustelle erkundeten. Kölner U-Bahn-Ratten sind ein hartgesottenes Gesindel. Sie leben zwischen den Gleisen und lassen sich weder von der Dunkelheit noch von den vorbeirasenden Waggons erschrecken. Aber diesen Tunnel flohen selbst diese kühnen Hasardeure der Unterwelt. Zitternd und mit gesträubten Barthaaren wichen die Ratten zurück, die nachdrängenden zögerten ebenfalls, witterten Gefahr, pfiffen Warnsignale wie in höchster Not und preschten dann alle gleichzeitig davon, ein einziges haariges Knäuel, das sich durch Ritzen und Röhren zwängte und in der Nacht verschwand. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich mit ihnen floh. Die Tunnelbaustelle habe ich danach nie wieder betreten. Seit dieser Nacht verstand ich die Sorgen der Anwohner.
Vielleicht fühlten sie sich ähnlich wie Blanche damals, als sie sich auf dem Garagenvorplatz das Fahrradfahren beibrachte. Die Arme steif ausgestreckt, umklammerten ihre Hände die viel zu weit entfernte Lenkstange des rot-grünen Damenfahrrades. In waghalsigen Schlenkern jagte Blanche dem Schwerpunkt nach, der ihr immer wieder heimtückisch entwischte, aber nur fast; mit jeder Pedal-Umdrehung weit nach rechts und links ausholend, erhaschte sie ihn immer noch gerade so. Und dann schwebte sie mehr, als sie fuhr, wie auf einem schmalen Grat in schwindelnder Höhe, immer knapp davor zu stürzen. Unverdrossen radelte sie weiter und gab nicht auf.
Ich beobachtete Blanche schon damals. Zu dieser Zeit, es muss Mitte der siebziger Jahre gewesen sein, hatte ich noch die Gestalt der weißhaarigen Frau Müller von gegenüber. Schon am frühen Vormittag klopfte ich mir ein dickes Kissen zurecht und machte es mir damit am Küchenfenster gemütlich. Zugegeben – ich war zu dieser Zeit bereits ziemlich dement. Aber das störte niemanden. Mich übrigens am allerwenigsten. So hatte ich wenigstens meine Ruhe, und wenn ich mich ungewöhnlich benahm, schöpfte niemand Verdacht. Es hat ziemlich viele Vorteile, wenn man unterschätzt wird.
Blanche war damals höchstens sieben Jahre alt, aber man konnte schon gut erkennen, dass da ein außergewöhnliches Talent heranwuchs. Vor allem ihr Freiheitsdrang war überdurchschnittlich. Und ihr Stolz. Niemand durfte das Damenfahrrad am Gepäckträger festhalten. Ein Kinderfahrrad mit Stützrädern? Lieber wäre sie gestürzt. Aber immer fing sie sich im allerletzten Augenblick. In meinem Leben war ich schon vielen Menschen begegnet, die ihre Ziele hartnäckig und mit Ehrgeiz verfolgt hatten. Die meisten waren gescheitert. Ihnen hatte das Entscheidende gefehlt – etwas, das man nicht herbeizwingen kann – das gewisse Quäntchen Glück. War Blanche ein Liebling der Götter? Ich beschloss, ihre Entwicklung zu verfolgen. Trotzdem verlor ich sie aus den Augen. Um ehrlich zu sein: Ich hatte anderes zu tun. In den darauffolgenden Jahren änderte sich mein Leben nämlich tiefgreifend. Eine Zeitlang kannte ich mich selbst fast nicht mehr. Bis ich mich wieder einigermaßen in meiner eigenen Existenz zurechtfand, waren fast zwanzig Jahre vergangen. Blanche würde mich nicht wiedererkennen, so viel stand fest. Denn auch meine äußere Erscheinung hatte sich komplett gewandelt.
Aber dann – es muss etwa Mitte September 2008 gewesen sein – spürte ich auf einmal wieder eine innere Verbindung zu Blanches Seele. Meine mühsam erarbeitete Gelassenheit wich einer fiebrigen Unruhe. Ich begann, mich herumzutreiben, strich rastlos um die Severinstorburg herum, hetzte dann wieder die Seitenstraßen hinauf, stets den Baulärm im Nacken und immer mit dem unklaren Gefühl, eine wichtige Verabredung zu verpassen. Es bestand kein Zweifel: Sie kam zurück. Warum? Welch eine müßige Frage! Kein Mensch, der je in Köln lebte, geschweige denn jemand, der hier geboren wurde, schafft es jemals, sich vollständig von dieser Stadt zu lösen.
Auch mir erging es so. Nachdem ich als Cleopatra den Tod fand, wurde ich – wenig originell! – als Tochter einer ägyptischen Sklavin wiedergeboren und kam schließlich im Gefolge der Agrippina hierher in diese Stadt. Das war im Jahr 50, als dem ehemaligen römischen Grenzposten die Stadtrechte verliehen wurden.COLONIA CLAUDIA ARA AGRIPPINENSIUMhieß die neue Stadt, kurz Colonia. Daraus wurde Köln. Und ich mit Leib und Seele Kölnerin.
Warum sollte es Blanche anders ergehen? Siebenundzwanzig Jahre sind nur ein Wimpernschlag im Strom der Ewigkeit. Berechnet auf die Existenz eines kleinen, individuellen Lebens, können mehr als zwanzig Jahre jedoch sehr lang sein. Es war also hohe Zeit, dass Blanche an den Ort ihrer Geburt zurückkehrte. Aber nun war sie nicht länger das strahlende Glückskind im zerzausten Blondhaar. In den letzten Jahren hatte sie einige Scheußlichkeiten überlebt. Bewundernswert, wie sie sich immer wieder aufgerappelt hatte. Ja, sie hatte noch nicht einmal ihr rotzfreches Grinsen verloren! Aber es war nicht nur dieses Durchhaltevermögen, das mich faszinierte. Blanche hatte schon in jungen Jahren ein weiteres außergewöhnliches Talent besessen; eine gefährliche Begabung, die sie schon früh unter Beweis stellte. Leider mitschauderhaftem Ergebnis. Aber mehr als ein Vierteljahrhundert im Exil, das war Strafe genug. Länger als lebenslänglich. Es war Gras über die Sache gewachsen und endlich Zeit für einen Neuanfang. Aber dennoch: Blanche war einer dieser Menschen, die mit untrüglichem Instinkt gegen Wände und durch Glastüren rennen. Irgendjemand würde auf sie aufpassen müssen. So viel war sicher. Und dieser Jemand würde ich sein.
Wie würde Blanche jetzt, nach so vielen Jahren, aussehen? Ob sie sich stark verändert hätte? Während ich ihrer Ankunft entgegenfieberte, sah ich immer nur das blonde Kind vor mir. Als sie damals das Radfahren übte, gab es nichts anderes in ihrem Leben. Sie übte eine ganze Woche, jeden Tag. Sie übte schon am Vormittag. Sie übte von Montag bis Donnerstag. Am Freitag kam der Anruf aus der Schule, ob das Kind krank sei. Aufgescheucht rannte die Mutter nach Hause. Die Wohnung war leer. Im Keller fehlte das Fahrrad. Blanche hatte das viel zu schwere Gerät die Hintertreppe hinaufgeschleppt und übte unverdrossen hinter dem Haus auf dem Garagenvorplatz. Die Mutter hatte in der Aufregung vergessen, den rosa-weiß gestreiften Kittel auszuziehen. Nun stemmte sie die Hände in die Seiten, während sie ihre Tochter beobachtete. Der Kittel spannte sich über ihrem Busen. „Salon für die Dame“ stand darauf, und Blanche fuhr bereits Achter und Schlangenlinien. Die Mutter schwieg und kehrte zurück in den Friseurladen.
Ob die erwachsene Blanche sich überhaupt noch an das rot-grüne Fahrrad im Kellerabteil erinnerte? Blanche ließ den Kellerschlüssel achtlos durch die Finger gleiten, suchte den Haustürschlüssel aus dem Bund heraus, öffnete die Tür und trat mit bebenden Nüstern ins Treppenhaus. Dort roch es so wie immer. Ein Gemisch aus Küchendunst, Weichspüler und Putzmitteln. Bevor die Tür wieder ins Schloss fiel, schlüpfte auch ich ins Treppenhaus. „Kschksch“, machte Blanche, und ich zog mich höflich auf die Kellertreppe zurück. Selbstverständlich erkannte sie mich nicht wieder. Aber Warten war noch nie ein Problem für mich. Das habe ich über viele Jahrhunderte bis zur Perfektion entwickelt. Ich schloss die Augen zu schmalen Schlitzen und begann, die rechte Pfote zu lecken. Blanche musste hoch in den dritten Stock. Ich folgte ihr auf leisen Pfoten und wartete auf dem Treppenabsatz.
Der Schlüssel für die Wohnungstür war uralt. Blanche hatte ihn schon zu Schulzeiten an einem Band um den Hals getragen. Wie mit leichtem Widerstreben öffnete sich die Wohnungstür einen Spaltbreit. Blanche stand einen Atemzug lang auf der Schwelle. Drinnen war es dunkel. Zögernd schob sie die Tür auf und betrat die Wohnung. Es roch nach Staub und verwelkten Blumen, und wie ein trübes Rinnsal ergoss sich das Gefühl fröstelnder Einsamkeit ins Treppenhaus. So ähnlich roch es auch in Friedhofskapellen. Ich schlich wie in Zeitlupe, setzte meine Pfoten mit Bedacht und erklomm Stufe um Stufe. Als ich oben ankam, schlug Blanche mir die Tür vor der Nase zu.
Sie beachtete mich nicht. Noch nicht.
Ich spitzte die Ohren. Drinnen riss Blanche alle Fenster auf. Sie stellte das Radio an. Suchte einen Sender. Dumpfe Bässe wummerten, und das grelle Kreischen einer E-Gitarre beleidigte mein empfindliches Gehör. Ich legte die Ohren flach an den Kopf und zog mich in mich selbst zurück. Aus der Wohnung tönte ein Krachen und Splittern. Ob Blanche Gläser an der Wand zerschmetterte? Oder Stühle und Schränke mit wuchtigen Axtschlägen zerkleinerte? Ich schloss die Augen und begann, mich in einen schützenden Kokon einzuweben. Ein reißendes Geräusch, gefolgt von metallischem Rattern. Offenbar zerfetzte Blanche die Vorhänge und riss dabei die Gardinenrollen gleich mit herunter. Eine nervtötende Stimme erhob sich nun über dieser Kakophonie der Zerstörung. „Hells Bells!“, kreischte, grölte, jaulte es aus der Wohnung. Ich krümmte mich zwar vor Widerwillen, allerdings verfehlte das stetige Stampfen und Heulen seine Wirkung nicht. Offenbar fand Blanche erst dadurch ihren Rhythmus. Nun hackte, schlug und riss sie im Takt der Musik. Ob sie in eine Art Trance fiel? In meiner Kehle stieg ein Schnurren empor und wuchs zu einem wärmenden Wohlgefühl, das sich allmählich über den ganzen Körper ausbreitete. Behaglich rollte ich mich auf der Fußmatte zusammen. Die hässlichen Geräusche blinder Zerstörungswut versanken wie in Watte. „Nur noch ein wenig Geduld“, ermahnte ich mich. „Alles geht vorbei. Und diese fürchterliche Musik werde ich ihr schon noch austreiben.“
Kapitel 5
Dienstag, 30. September 2008
Die schneeweiße Katze ließ sich auch am nächsten Tag nicht vertreiben. Jedes Mal, wenn Blanche die Tür öffnete, saß das Tier wieder auf der Fußmatte. Als sich wenig später das Gerümpel im Treppenhaus stapelte, schnupperte es prüfend an Regalbrettern, Teppichen und Kartons mit alten Bilderrahmen. Es wirkte fast so, als mache die Katze eine Bestandsaufnahme. Vernehmlich schnüffelnd versenkte sie zuletzt Kopf und Schultern in einer Teppichrolle. Nur noch das Hinterteil und ein fahrig balancierender Schwanz waren zu sehen. „Kschksch“, machte Blanche und wedelte mit der Hand, als wolle sie das Tier hinunterwischen. Mit weit aufgerissenen Augen tauchte die Katze aus der Teppichröhre auf. Laut fauchend und mit Tatzenschlägen verteidigte sie ihren muffigen Spielplatz und ließ keinen Zweifel daran, dass sie es ernst meinte. „Dann bleib doch, wo du bist, du Mistviech“, schnaubte Blanche.
Von unten schallte eine zittrige Stimme durchs Treppenhaus: „Was ist denn da oben schon wieder los?“
In ausgetretenen Pantoffeln schlurfte eine uralte Frau die Treppen hoch. Mit ihrem ständig hin- und herwackelnden Schädel sah sie so aus, als missbillige sie zutiefst die Szene, die sich ihren Augen bot. Dabei war es lediglich Altersschwäche, die den Kopf der Frau auf und ab tanzen ließ wie eine halbwelke Tulpenblüte auf einem viel zu dünnen Stängel.
„Nein so etwas! Das ist ja die liebe Frau Voss!“, rief Blanche in überraschtem Tonfall und trat der Alten mit weit ausgebreiteten Armen entgegen. „Wie schön, Sie wiederzusehen!“
Die Freude war gespielt, aber das machte nichts. Der Effekt war entscheidend. „Sie haben sich ja fast nicht verändert“, flunkerte Blanche munter weiter. „Ich habe Sie sofort erkannt.“ Das war nicht gelogen, zumindest nicht direkt, hatte Blanche doch im Vorübergehen auf dem Türschild gelesen, dass dort immer noch der gleiche Name stand wie vor zwanzig Jahren.
Frau Voss teilte diese spontane Wiedersehensfreude offenbar nicht. Sie zitterte heftig und klammerte sich mit beiden Händen am Treppengeländer fest. Ihre arthritisch verformten Finger glichen Vogelklauen. Ihr Blick war der eines fremdelnden Kindes. Sie beäugte eingehend die magere Gestalt, die mit flatternden Ärmeln auf dem Treppenabsatz stand wie ein notgelandeter Erzengel. Blanche übte sich in Geduld. Für das, was sie vorhatte, war sie auf gute Nachbarschaft angewiesen, und eine misstrauisch spionierende Alte war so ziemlich das Letzte, was sie brauchen konnte. Also lächelte sie weiter zuvorkommend und hielt der eingehenden Prüfung stand. Endlich glomm so etwas wie Wiedererkennen in Frau Voss’ alterstrüben Augen auf.
Blanche trug als Arbeitskleidung einen abgelegten rosa-weiß gestreiften Friseurkittel. Und während Frau Voss die schwungvolle Schrift über Blanches linkem Busen entzifferte – Salon für die Dame –, gelang es ihr endlich, ihre Erinnerungen mit dem Bild, das sich ihren Augen bot, in Übereinstimmung zu bringen. Sie schlotterte noch stärker, sodass sogar das Treppengeländer in leichte Schwingungen geriet. Schließlich fasste sie ihr Erstaunen in Worte: „Jott sei Dank – isch hab nämlich jedacht, dat mein Jedächtnis mir wieder mal einen Streich spielt. Aber jetzt erkenne ich dich. Du bist dat Kleine von dem Lisbeth – dat Lara? Stimmt’s?“
Blanche nickte. Klein war sie zwar nicht mehr und den Namen Lara hatte sie auch schon vor vielen Jahren gegen den Künstlernamen Blanche eingetauscht, aber im Grunde genommen hatte die Voss’sche recht. Sie war die Tochter von Elisabeth Schmitz, genannt „et Lisbeth“, ehemals Inhaberin zweier Friseursalons – die verlorene Tochter, die jetzt wieder in die alte Heimat zurückgekommen war, um ihr Leben neu zu ordnen. Frei von Altlasten und randvoll mit frischer Energie. Und zwar Energie, die nicht aus Amphetaminen oder anderen dubiosen Chemieverbindungen stammte. Sie war neugeboren, sie stieg wie Phönix aus der Asche. Deshalb war alles neu an ihr. Sogar der Name. Frau Voss jedoch tadelte sie: „Du hast dich aber stark verändert! Du bist so dünn jeworden, Kind! Und hattest du nicht früher immer so schöne, blonde Haare jehabt? Wo sind die denn jeblieben?“
„Ach, wissen Sie“, Blanche griff sich in die dunklen Haarsträhnen. „Öfters mal was Neues. Als Tochter einer Friseurmeisterin liegt mir das Haarefärben doch sozusagen im Blut.“
Die Antwort schien glaubwürdig, das Zittern ließ nach, Frau Voss lockerte den Klammergriff ihrer Finger und streckte Blanche ihre Arthritis-Klaue zum Gruß entgegen. „Dat is aber wirklich schön, dat du dich wieder mal hier blicken lässt. War ja auch jammerschade um die jroßzügige Wohnung, dat da keiner mehr drin jewohnt hat, seit deine Mutter umjezogen ist. Na ja, ich versteh es auch. Die musste sich um die Omma kümmern und seit die U-Bahn jebaut wird, ist dat ja hier auch kein Leben mehr, oder?“ Sie klapste Blanche vertraulich auf den Unterarm. „Und jetzt willste hier renovieren? Aber da musste doch nicht jleich die janzen alten Sachen rausschmeißen. Dat sind doch teilweise richtig schöne Ante-que-täten.“
Das Zittern verstärkte sich wieder. Es wurde Zeit, das Gespräch zu beenden.
„Liebe Frau Voss“, Blanches Stimme war von erfrischender Munterkeit. „Ich muss jetzt aber wirklich weitermachen, sonst läuft mir die Zeit davon. Wenn ich alles neu eingerichtet habe, lade ich Sie mal auf ein Tässchen Kaffee ein – dann nehmen wir uns Zeit und reden mal so richtig ausführlich über die guten alten Zeiten. Versprochen! Aber Sie verstehen mich doch sicher? Ich muss jetzt ...“
„Ja, Liebchen“, nuschelte Frau Voss und umfasste wieder energisch das Treppengeländer. „Da freu ich mich drauf, wenn wir beide mal zusammen Kaffee trinken. Jetzt will ich dich aber nicht länger aufhalten.“ Sie schob vorsichtig den linken Pantoffel über die Kante der Treppenstufe und begann schlurfend, schlotternd und schnaufend den Abstieg.
Die Katze thronte immer noch auf einer Teppichrolle. Blanche bedachte sie mit einem mörderischen Blick und verschwand in der Wohnung. Aufatmend lehnte sie sich mit dem Rücken an die Korridortür. Kaffeeklatsch mit alten Damen war so ziemlich das Letzte, was sie normalerweise auf ihrer Agenda hatte. Sie würde es nur tun, um sich das Stillschweigen der alten Voss zu erkaufen. Denn sie wollte auf gar keinen Fall ihr Gewerbe offiziell anmelden. So etwas kostete nur unnötig Geld und führte zu lästigen Fragen diverser Ämter. Blanche wusste noch nicht einmal, ob es gestattet war, in einer normalen Zwei-Zimmer-Wohnung Geschäftsräume einzurichten. Sie lächelte. Die Voss’sche Neugier würde sicher genauso schnell nachlassen wie ihre Energie fürs Treppensteigen. Ganz unten war ein Laden. Bastelbedarf und Geschenkartikel. Aber offenbar nur unregelmäßig geöffnet. In der Wohnung darüber wohnte anscheinend eine junge Familie. Jedenfalls versperrte ein Kinderwagen den Treppenaufgang. Solche Leute hatten genug mit sich selbst zu tun und würden sich kaum für das interessieren, was im Dachgeschoss vor sich ging. Blanche krempelte die Ärmel hoch. Es lag noch viel Arbeit vor ihr. Mutter hatte zur Bedingung gemacht, dass sie die Wohnung auf Vordermann brachte. Die Wohnung entrümpeln und dafür ein halbes Jahr mietfrei wohnen. Das war der Deal. Mutter war schon immer geschäftstüchtig gewesen. Genauso wie die Omma. Nur bei Blanche hatte es nicht gereicht. Noch nicht mal für einen ordentlichen Schulabschluss. Nach den zwei erfolgreichen Geschäftsfrauen war aus Blanche anscheinend der typische Vollversager der dritten Generation geworden. Aber Mutter sollte sich wundern, was Blanche in einem halben Jahr auf die Beine stellen würde! Auch wenn es ihr niemand zutraute: Blanche war ein Naturtalent in Menschenführung. Und sie hatte in den letzten Jahren einiges dazugelernt. Sie hatte es sogar schriftlich. Auf ihren Abschlusszeugnissen prangten zwar nicht die Siegel von höheren Schulen oder Universitäten. Unter Eingeweihten nannte man die Lehrgänge, die Blanche erfolgreich absolviert hatte, mit vertraulichem Augenzwinkern auch „die Schule des Lebens“. Trotzdem war Blanche stolz auf das Erreichte.
Schnaufend zerrte sie einen Karton mit alten Büchern und Zeitungen über den Gang. Ob sie den Kram noch einmal sichten sollte? Obendrauf lag ein altes Fotoalbum in dick wattiertem Plastik-Einband. Das nahm sie heraus und legte es zur Seite. Darunter kam ein schmales Heft mit zerfleddertem Einband zum Vorschein. „Kölner Geschichte in Straßennamen“, lautete der Titel der Broschüre. Die vergilbten Seiten verströmten einen zarten Geruch. Als Blanche sie über den Daumen schnalzte und auffächerte, zerfiel das Heft in einzelne Blätter, die matt zu Boden taumelten.
Lediglich die Seite mit der Richmodis-Sage blieb ihr in der Hand. Blanche betrachtete angewidert die wenig ansprechende Zeichnung der armen Frau, die mit flatternden Leichengewändern durchs nächtliche Köln irrte, die Dienstboten halb zu Tode erschreckte und die Pferde so scheu machte, dass sie in ihrer Angst die Treppen hinaufpolterten, bis hoch zum Dachboden. Dort glotzten sie noch heute stier und stumm auf den Neumarkt hinunter. Als Kind hatte Blanche mit heimlichem Schaudern zu den weißen Pferdehäuptern hinaufgeschaut.
„Die sind doch nicht echt“, hatten Mutter und Omma im Wechselgesang behauptet und das störrische kleine Mädchen über den Zebrastreifen Richtung Neumarkt gezerrt.
Die kleine Blanche, die damals noch Lara hieß, hatte dennoch wie unter Zwang immer wieder den Kopf nach hinten gedreht. „Sie haben sich bewegt!“, kreischte sie und hätte sich fast losgerissen.
„Es ist ROT“, hatte Mutter geblafft und Blanche unsanft weitergezogen. „Wenn du nicht von der Straße runtergehst, dann wirst du noch überfahren. Ich weiß gar nicht, wat du mit den blöden Pferdeköpfen hast. Die sind doch bloß aus Holz.“
„Ich weiß, dass die tot sind. Aber trotzdem bewegen die sich“, hatte Lara versucht, ihr begreiflich zu machen. Die Omma hatte nur einen kurzen Blick nach schräg oben geworfen und dann missbilligend den Kopf geschüttelt. Offenbar erstarrten die Pferdeköpfe zu leblosen Figuren, sobald ein Erwachsener sie betrachtete. Konnte vielleicht nur ein Kind erkennen, was Lara so überdeutlich sah? Damals geriet die Realität das erste Mal ins Rutschen, aber bei aller Angst: Die Faszination für das Grauenhafte blieb. Wieder und wieder musste die Omma der schaudernden Lara die Richmodis-Sage erzählen, und eine Zeitlang hatte die Kleine die befremdliche Leidenschaft, ihre Sonntagnachmittage auf Friedhöfen zu verbringen. Auf Melaten verharrte sie staunend vor pompösen Denkmälern, aber lieber noch kümmerte sie sich um verwahrloste Kindergräber, die sie mit Blumen dekorierte oder mit Tannenzapfen und Schneckenhäusern. Auf Melaten lagen viele Berühmtheiten, und die Omma kannte alle Geschichten. Zu Laras großer Enttäuschung blieb das Grab der Richmodis jedoch unauffindbar.
„Als die Richmodis gestorben ist, da gab es Melaten noch gar nicht“, erklärte die Omma. „Zu der Zeit hammse dort höchstens mal jelegentlich eine Hexe verbrannt.“
Und dann erzählte sie mit der selbstvergessenen Routine eines Kriegskindes, wie man die Knochen zerstampft und die Asche in den Rhein geschüttet habe. Ommas Geschichten waren beileibe kein Kinderkram, denn manchmal verlor sie sich in Erinnerungen, wenn sie mit ihrer Enkelin zwischen bemoosten Grabsteinen spazieren ging. Manchmal kamen die Bilder aus den Bombennächten wieder hoch, und dann schilderte Omma die Hexenverbrennungen besonders drastisch.
„Weißt du, Lara, diejenigen, die fett waren, die haben besonders gut gebrannt.“ Und sah dabei die Nachbarin vor sich, die zu dick war, um durch das Fenster zu flüchten, während das ganze Haus hinter ihr schon in hellen Flammen stand. „Phosphorbomben“, murmelte sie abwesend. „Die konnte man gar nicht löschen.“
„Hat man mit dem Phosphor auch die Hexen verbrannt?“, erkundigte sich das Kind und klammerte sich mit schweißnassen Fingern an die Hand der Großmutter.
„Nein“, hatte die Großmutter dann geantwortet und sich die Augen gerieben, als sei sie gerade aus einem bösen Traum erwacht.
„Nein, Liebchen. Das ist alles schon lange her. Heutzutage tun die Menschen sich sowas nicht mehr an.“ Und verschwieg dabei so einiges, was Lara dennoch spürte. Warum zog es dieses seltsame Kind auch immer nur auf Friedhöfe? Warum gingen sie nicht mal in den Rheinpark, wo es neuerdings so einen schönen, modernen Kinderspielplatz gab? Aber nein, das Kind wollte immer nur auf Friedhöfe. Und dann wunderte man sich, wenn das Kind schlecht schlief. „Das bleibt aber unter uns“, hatte die Omma gewarnt und mit dem knochigen Zeigefinger gewackelt, wenn sie sonntags wieder einmal fremde Gräber besuchten. Und dann fuhren sie mit der Straßenbahn raus zum Südfriedhof und am übernächsten Wochenende zum Westfriedhof, wo es auch jüdische Gräber gab. Die waren mit Steinen geschmückt statt mit Blumen und sahen noch trauriger aus als die vergessenen Kindergräber.
„Warum muss man immer so weit rausfahren mit der Straßenbahn, wenn man auf einen Friedhof will?“, erkundigte sich Lara, und die Omma hatte geantwortet: „Weil niemand was mit den Toten zu schaffen haben will.“
Das verstand Lara. Und sie erkannte mittlerweile auch die Aussichtslosigkeit ihrer Suche nach dem Grab der Richmodis. Denn die mittelalterlichen Friedhöfe gab es nicht mehr. Die Toten mussten inzwischen draußen vor den Stadtgrenzen bleiben. Und mit den Toten das unaussprechlich Böse.
Eines Tages erkannte sie jedoch, dass sie etwas übersehen hatte. Es war nur ein Zufall, dass sie die Gräber in der direkten Nachbarschaft fand. Direkt am Waidmarkt. Neben dem Polizeipräsidium. Tausendmal war sie an der unscheinbaren Kirche vorbeigegangen. An einem trüben Novembernachmittag schaute sie zum ersten Mal durch das Tor und erschrak. Im Innenhof der Georgskirche lagen schlichte Steinplatten im Kies. Und alle trugen dasselbe Sterbedatum: 2.3.1945. „Der Krieg“, seufzte Omma und wollte nicht darüber sprechen. Aber Lara hatte erkannt, dass das Böse direkt aus der Nachbarschaft kam. Und sie beschloss, wachsam zu bleiben. Denn die Toten kamen zurück. Manchmal stieg ein Leichnam nachts herab vom Pestkreuz der Severinskirche und schlurfte halb nackt, mit zerfetzter Haut und Armen, die seltsam verdreht in den Schultergelenken baumelten, durch die Gassen. Manchmal irrte die totenbleiche Kaufmannsfrau Richmodis durchs nächtliche Köln. Manchmal kollerten Schädel, an denen noch Reste der behaarten Kopfhaut klebten, aus ihren goldumrandeten Altarbildern und wisperten in der Gosse, wenn die Betrunkenen sich auf den Heimweg machten. Manchmal thronte das Tote auch in Gestalt zweier abgeschlagener Pferdeköpfe hoch oben über dem alltäglichen Gewimmel und wieherte hämisch. Damals entdeckte Blanche, dass es eine Welt hinter den Dingen gibt. Abends, wenn sie im Bett lag und nicht einschlafen konnte, spürte sie die Kraft, die diesen Geschichten innewohnte. Die Monster unter ihrem Bett, im Keller und auf dem Speicher warteten nur darauf, dass sie die Kontrolle verlor. Damals, als sie aussah wie ein blondes, unschuldiges Kind, balancierte sie jeden Tag auf Messers Schneide. Täte sie auch nur einen falschen Schritt, fiele sie auf die Feuerseite, dorthin, wo die Mäuler der gefräßigen Monster gähnten. Oder sie fiele auf die andere Seite und fiel und fiel und fiel ... Es war nicht auszudenken. Damals wurde Lara zu einem unzufriedenen, launischen Kind, und niemand verstand, warum. Aber wer Nacht für Nacht ins Bodenlose stürzt und dabei lediglich die Alternative hat, zerschmettert oder im Rachen eines Höllenmonsters zermalmt zu werden, dem war es doch nicht zu verdenken, dass er am Tage unausgeschlafen und grantig über die Messerschneide balancierte, die das Leben nun einmal war. Es wurde erst besser, als Lara in die Schule kam. Zunächst war sie auch dort eine Außenseiterin. Als sie jedoch erkannte, dass sie sich mit ihren Geschichten Menschen gefügig machen konnte, wendete sich das Blatt. Und all dies begann, als sie die Pferde der Richmodis entdeckte.
Blanche ließ das vergilbte Blatt mit der Richmodis-Sage zu Boden segeln, fegte alles zusammen und stopfte es unbesehen wieder in die Umzugskiste. Ein ganzer Pappkarton, vollgestopft mit alten Geschichten. Nutzloser Kram. Ballast. Wozu, um Himmels willen, sollte man dieses vergilbte, stockfleckige Zeug aufbewahren? Die Kiste kam in den Keller. Später würde sie handliche Bündel zum Altpapiercontainer tragen. Und während sie den Deckel des Kartons zuklebte, sang Blanche laut und trotzig und völlig schief: „Ich mach mir die Welt – widewide – wie sie mir gefällt ...“
Die Kehle wurde ihr eng und der Gesang brach ab. Hier stand sie, Blanche alias Lara, vierzig Jahre alt, bis jetzt noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben sozialversicherungspflichtig beschäftigt und schaufelte tonnenweise alte Geschichten aus ihrem Leben heraus. Sie holte tief Luft. Es gab keinen Grund für Selbstmitleid. Blanche räusperte sich, grinste schief und blinzelte ein paar Tränen weg. „Heissa – widewitt“, murmelte sie. „Und jetzt komme ich!“ Sie öffnete die Tür und hievte den schweren Karton über die Schwelle.
Auf einer Teppichrolle saß die weiße Katze und blinzelte zurück.
Kapitel 6
3. März 2009, 17 Uhr