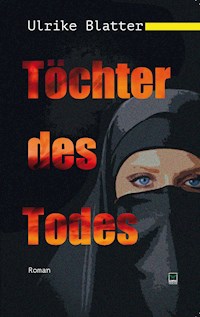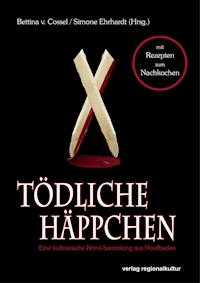Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch die Nachkommen der nächsten und übernächsten Generation sind durch Kriegserfahrungen zutiefst geprägt worden. Gerade, wenn nie darüber gesprochen wurde. Wer aber eine Sprache gefunden hat, wird nicht ausgrenzen und hassen, sondern mithelfen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Ein kleines Eifeldorf. Der Mittelpunkt der Welt. Hier wird 1934 ein Junge geboren, der keinen Namen hat. Das macht aber nichts: Er muss nur schnell erwachsen werden, bevor der Krieg vorbei ist. Denn Helden brauchen keine Namen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ULRIKE BLATTER
DerHütejunge
EINE KINDHEITIM KRIEG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 by CMZ-VerlagAn der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-9126-26, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Schlussredaktion:Beate Kohmann, Bonn
Satz(Adobe Caslon Pro 11 auf 14,5 Punkt)mit Adobe InDesign CS 5.5:Winrich C.-W. Clasen, Rheinbach
Papier (Alster 90 g mit 1,5 f. Vol.):Salzer Paper GmbH, St. Pölten / Österreich
Umschlagfoto:Junge auf Kuh – Eifel, ca. 1930(aus unbekanntem Fotonachlass)
Umschlaggestaltung:Lina C. Schwerin, Hamburg
Gesamtherstellung:Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
eISBN 978-3-87062-325-8
1–1000 • 20180915
www.cmz.de
www.ulrike-blatter.de
Meinen Elternund allen Kriegskindern von damals und heute
Inhalt
Die Familie des Jungen
Teil IHüter der Farben
Die blaue Murmel
Täntchen
Im Zug der Nonne
Das Kloster
Heil!
Wassermann
Geisterwelt
Einberufung
Regenstimmen
Die Soldaten kommen
Das neue Haus
Kirche
Schule
Große Zeiten
Die Warze
Heimatfront
Fuss
Beichte
Teil IIDie leere Zeit
Der ewige Sommer
Antreten
Pater noster
Mit einem Lächeln sterben
Was unter uns bleibt
Der schwarze Schmetterling
Fräulein Becker
Mutterkreuz
Der Hütejunge
Der Luftkampf
Der leere Sarg
Die Flakbatterie
Wachet auf, ruft uns die Stimme
Bomber über Berlin
Ein Ami im Apfelbaum
Der Froschtöter
Gertrud geht
Abbildungsteil
Johannes muss an die Front
Weihnachten ist was für kleine Kinder
Ohne Deckung
Bedrückende Stille
Eifelschreck
Die Russen
Schang, der Franzose
Die Offensive
Die Front
Schwester Philippine
Die Kirche, ein Totenhaus
Das letzte Mal – Schang, der Franzose
Unter zerrissenen Himmeln
Sie bombardieren unser Dorf
Davongekommen
Das Marienkind
Volltreffer
Teil IIIHüter der Freude
Schlafen
Ein Dach über dem Kopf
Schwarzer Mann
Amtsstuben
Der Stumpf
Der Totengräber
Die neue Ordnung
Nachkrieg
Das war’s
Butterziegel
Der Jude ist so
Matschpapier
Gelegenheiten
Glasklar
Frau, komm!
Dazugekommen
Kirmes
Neue Träume
Das Leben geht weiter
Nicht länger unsichtbar
Zeittafel
Glossar
Nachwort und Dank
Die im Text zu findenden Zahlen zwischen und beziehen sich auf die Abbildungen.
Die Familie des Jungen
Die Großeltern mütterlicherseits: Hilarius und Wilhelmine. Der Großvater stammte aus der Eifel und die Großmutter aus Westfalen. Der Großvater erarbeitete sich als Fabrikarbeiter in Köln-Mülheim genügend Geld, um im Heimatdorf ein Haus für die rasch wachsende Familie zu bauen. In der Eifel betrieb die Familie eine Landwirtschaft und besaß ein Fuhrunternehmen.
Die Mutter: Katharina, genannt »Tring«, wurde als drittes Kind in Köln-Mülheim geboren. Nach der Schulentlassung arbeitete sie etwa zehn Jahre »in Anstellung«, bis sie – vierundzwanzigjährig und hochschwanger – heiratete. Nach dem frühen Tod ihres Ehemannes wurde dessen Beamtenpension gestrichen, und sie brachte die sechs Kinder mit der kärglichen Rente durch. Neben Haushalt, Landwirtschaft, Garten und Kinderbetreuung arbeitete sie auch immer wieder bei der Weinlese oder verdiente Geld hinzu, indem sie bei der Ernte aushalf. Manchmal war sie bei solchen Einsätzen tagelang unterwegs und wurde teilweise auch in Naturalien bezahlt.
Der Vater: Nikolaus, stammte aus dem Heimatdorf des Jungen und arbeitete bei der Reichsbahn. In den Inflationsjahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde er – wie Zehntausende anderer Beamter – in den »provisorischen Ruhestand« versetzt, was einer Entlassung gleichkam. Danach arbeitete er im eigenen Steinbruch. Obwohl er »steinreich« war, kam er dennoch auf keinen grünen Zweig, da der Inhalt der Geldkoffer, mit denen er bezahlt wurde, schon Stunden später nichts mehr wert war. Zunehmend stellte er sich gegen die Nazis und ihren »Hüddeler« – den richtigen Namen des »Führers« hätte er nie in den Mund genommen. Es ging um Landbesitz, aber auch um politische Äußerungen, als er 1934 angezeigt wurde. Der ebenfalls regimekritische Pfarrer war schon inhaftiert, als Vater die gerichtliche Vorladung erhielt. Er starb im Krankenhaus des Heimatdorfes, bevor es zur Gerichtsverhandlung kam. Posthum wurde seiner Witwe die Beamtenpension aberkannt (s.o.). Der Steinbruch verfiel. Die wenigen kargen Ländereien mussten verkauft werden, um das Überleben der Familie zu sichern.
Johannes: ältester Sohn, »der große Bruder«. Er wurde wenige Wochen vor Lehrabschluss eingezogen und geriet bei Kriegsende in Gefangenschaft. Nach dem Krieg als Hilfs- und Fabrikarbeiter beschäftigt; er lebte schließlich in Köln und fand Arbeit bei der Post, zuerst in der Packkammer, später auf dem Stellwerk.
Hilarius, genannt »Hilar«: zweitältester Sohn, »der Abwesende«. Er arbeitete schon früh bei Bauern in den Nachbardörfern, begann eine Lehre bei der Reichsbahn. Als er gegen Kriegsende den Stellungsbefehl zum »Volkssturm« erhielt, tauchte er einige Monate mit zwei Freunden in den Wäldern unter und versteckte sich zeitweise auch bei den Großeltern. Nach dem Krieg arbeitete er als Bäcker, als Melker, im Bergbau und in einer Gießerei.
Gertrud: »die große Schwester«, bildhübsch und als einziges Mädchen mit fünf Brüdern immer etwas Besonderes – was ihr das Leben aber nicht leichter machte. Sie arbeitete nach der Schule in »Anstellung«. Eine Berufsausbildung war damals für Frauen nicht üblich, da sie »sowieso heirateten« – was sie auch tat und Mutter von drei Töchtern wurde, die später alle berufstätig waren.
Ernst: »der Revoluzzer«, rothaarig, aufsässig, sensibel. Er streifte ständig in der Natur umher und wäre am liebsten Förster geworden. Eine Schuhmacherlehre konnte er nicht beenden, da der Meister seinen fleißigen und billigen Lehrling nicht zur Prüfung freigab. Frustriert arbeitete er zuerst auf dem Bau, später in der Fabrik. Er lebte bis zu seinem frühen Tod bei der Mutter und hat nie geheiratet.
Christian: »der Streithahn«, zweitjüngster Sohn, dem man lieber aus dem Weg ging, da er aufbrausend und rechthaberisch war. Als einzigem der Brüder gelang es ihm, die Gesellenprüfung abzulegen. Er arbeitete zuerst als Hufschmied, später als Kunstschmied und dann bis zur Rente in der Metallverarbeitung.
Der Junge: »der Träumer«, als jüngstes Kind vaterlos aufgewachsen mit dem Gefühl, »eigentlich gar nicht da zu sein«. Er malte und zeichnete fürs Leben gern. Den Berufswunsch »Künstler« konnte er nie verwirklichen: Nach der Schule fand er zuerst keine Lehrstelle; als ihm ein Glasmaler eine anbot, wurde dies als brotlos vom Familienrat abgelehnt. Er arbeitete sieben Jahre für einen Fuhrunternehmer und sammelte täglich die Milch bei den Bauern ein, um sie zur Molkerei zu fahren. In Köln fand er Anstellung bei der Post, zuerst als Rangierer, später als Paketzusteller. Die Arbeit als Zusteller bezeichnete er als seinen Traumberuf. Er zeichnet und malt noch heute.
Teil I
Hüter der Farben
Die blaue Murmel
Mai 1934–1937. Jeder Mensch ist im Augenblick seiner Geburt nackt, unschuldig und unwissend. Als der Junge in die Welt stürzte, wusste er bereits einiges. Aber er verstand nichts. Er wusste von einem Schmerz; der war mitten durch ihn hindurchgegangen und hatte etwas zerrissen. Mutter hätte ihm erzählen können, dass vier Wochen vorher der Vater gestorben war. Aber wie hätte er ihre Worte verstehen können? Vielleicht hatte er gespürt, dass seine Mutter alles dafür gegeben hatte, ihn nicht auch noch zu verlieren. Aber nach einem Monat hatte sie die Kraft verlassen, und so war er in die Welt gestürzt. Das Gefühl, in bodenlose Tiefe zu fallen, blieb ihm noch lange.
»Er sieht aus wie ein Engel«, sagte die große Schwester.
Darüber konnten die älteren Brüder lachen; Mutter jedoch nicht. Zerrissen von Geburtsschmerz, Alltagssorgen und Trauer wollte sie nur eins: einen gesunden Sohn, der seinen Lebenswillen mit kräftigem Geschrei zeigte, keinen Engel. Eine Tante wurde beauftragt, das Kind auf dem Rathaus anzumelden. Ob sie zögerte, als sie den Namen auf dem Formular bestätigte? Es war nicht der Name, den die Mutter ausgewählt hatte. Zwei Tage später wurde das Neugeborene getauft. Also war es amtlich.
Mutter brachte den Namen einfach nicht über die Lippen. Der Junge gewöhnte sich daran. Und blieb namenlos.
Als sechstes Kind wuchs er hinein in eine Familie voller Erdenschwere und hatte dennoch ständig das Gefühl, fortfliegen zu können – oder abzustürzen. Anfangs sprach man nur selten mit ihm. Und so hielt er sich fest an Dingen. Und an Farben. Vor allem an denen, die von innen kamen: Diese wahren Farben sprühten in unvergleichlicher Intensität, waren dabei aber kaum fassbar, so dass sich alle Kanäle der Wahrnehmung auf das Feuerwerk konzentrieren mussten, das seine auf die Augenlider gepressten Finger erzeugten. Zuerst war da lediglich ein grüner Punkt, der sich atmend zu einem Ring erweiterte und ganz am Rande des gerade eben noch Wahrnehmbaren in einem samtenen Blau erstrahlte, um sich dann in nie gesehenen Farben zu verlieren.
Auch im Inneren gewisser Murmeln waren manchmal magische Farben verborgen. Obwohl ihm die ewigen Tauschgeschäfte seiner Freunde ziemlich zuwider waren, hatte er doch Ernst eine blaue Murmel abgehandelt, die – gegen das Licht gehalten – in einem ähnlich intensiven Blau leuchtete, wie er es sonst nur in den tiefen Seen seiner Sinne wahrnahm.
Beim Kirchenbesuch vertrieb er sich die Zeit damit, Geschichten zu den Fensterbildern zu erfinden, auf denen Heilige mit starren Gesichtern in die Ferne blickten. Fand das Hochamt bei schönem Wetter statt, tanzten farbige Reflexe über die kühlweiße Kirchenwand. Zog eine Wolke vorüber, schwächte sich das Farbenspiel ab oder verschwand sogar vollständig. Dann vergingen bange Minuten, in denen das Geplätscher der Predigt und der Zwang zum Stillsitzen fast unerträglich wurden.
Als er in die Verwahrschule kam, freute er sich über den Überfluss an Buntpapier, Stiften und Farben. Mit ungebärdigen, sich in die Quere kommenden Händen faltete und schnitt er Papiere in eine vorbestimmte Form und liebte es, alles bunt anzumalen. Was er zustande brachte, war zwar von schmerzhafter Vergänglichkeit, aber er badete im Glück, sich selbst etwas Farbiges zu erschaffen.
Die blaue Murmel verbarg er noch lange wie einen Schatz.
Täntchen
Herbst 1937. Der Junge saß unter der Nähmaschine, halb verborgen unter herabhängendem Kleiderstoff. Gleichmäßig nickte das breite schmiedeeiserne Fußpedal, surrend drehte sich das Schwungrad. Er war es leid, die verschiedenen Stofffetzen nach Farben zu sortieren, und lehnte den blonden Kopf an das Bein der Mutter. Ihre warme Hand streichelte ihn kurz, schob dann aber seinen Kopf sanft zur Seite, da er sie beim Treten der Nähmaschine störte.
Dünnes Glockengeläut drang durch das angelehnte Fenster. Mutter hielt mit ihrer Arbeit inne, hob das geflickte Hemd und biss einen heraushängenden Faden ab. Aufmerksam lauschte sie nach draußen. Zwei dünne Glockenschläge, dann Ruhe. Wieder zwei Glockenschläge und eine erneute Pause. Das ging eine Weile so, bis Mutters Hand wieder den Weg nach unten fand und er sich in ihre Wärme schmiegte, diesmal, ohne fortgeschoben zu werden. Als die Glocke verstummte, bückte Mutter sich zu ihm hinunter. »Dat wird wegen Schoos-Täntchen sein«, sagte sie.
Der Junge schaute ratlos, und Mutter erklärte es ihm: Zweimal geläutet, bedeute, dass eine Frau gestorben sei. Täntchen war schon so lange Zeit krank gewesen; ja, es war sehr wahrscheinlich, dass die Glocke dem Dorf nun ihren Tod bekannt gegeben hatte. Bei dieser Gelegenheit erfuhr der Junge auch, dass beim Tod eines Mannes die Glocke dreimal angeschlagen wurde und bei einem Kind einzelne Glockenschläge hintereinanderkamen, ohne Pause.
»Also sterben auch Kinder?«
»Sicher, auch Kinder können sterben; alles, was lebt, stirbt irgendwann einmal.« Und nach einem kritischen Blick auf den Jungen: »Los jetzt, wasch dir das Gesicht und komm mit!«
Sie gingen also die tote Frau besuchen.
Als sie Schoos’ Haus betraten, nahm Mutter seine Hand und führte ihn in das Schlafzimmer. Der Spiegel an der Wand war unter einem Tuch verborgen und die Vorhänge zugezogen. Am Kopfende des Bettes standen einige Kerzen, deren Flammen unruhig flackerten. Langsam gewöhnten sich die Augen des Jungen an das dämmrige Licht. Der kleine Raum war voller Leute. Alle waren gekommen, um Täntchen anzuschauen, und er konnte anfangs nur viele Rücken und Beine erkennen. Er löste sich von der Hand der Mutter, zwängte sich an den Erwachsenen vorbei und traf unerwartet schnell auf das Bett. Das stand mitten im Zimmer und war mit einem Leintuch bedeckt, das so steif gestärkt war, dass sich der schmale Körper der darunterliegenden alten Frau kaum abzeichnete.
Täntchen lag fest schlafend in all diesem Weiß und zwischen den gehäkelten Spitzen.
Die Erwachsenen traten einzeln vor, sprenkelten ein wenig Wasser auf Täntchens Bett und schlugen ein Kreuz. Eine Frauenstimme betete leise: »Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.«
»Amen«, murmelten die Anwesenden, schlurften schwerfällig mit den Füßen und gingen dann wieder nach draußen in die Küche, ins Helle. Wenn die alten Frauen Täntchen so in ihrem Bett liegen sahen, mussten sie weinen. Die Männer weinten nicht, aber einige zogen den Rotz in der Nase hoch oder schnäuzten sich umständlich.
Insgesamt war dieser Besuch sehr feierlich und schön. Der Junge fand keinen Grund zum Weinen.
Als Mutter gehen wollte, bat der Junge flüsternd darum, noch ein wenig bleiben zu dürfen, was ihm erlaubt wurde, denn der Heimweg war kurz, und er würde sich alleine zurechtfinden.
Das Zimmer leerte sich, und er trat neugierig an das Kopfende. Niemals hätte er gewagt, den tiefen Schlaf der alten, freundlichen Frau mit einer Berührung zu stören. So blieb ihm nur, das liebe Gesicht zu betrachten.
Früher hatte Täntchen viel mehr Falten gehabt, stellte er fest. In der jetzt eingetretenen Ruhe war eine Ahnung von Jugendlichkeit spürbar, und fast erwartete der Junge, dass sie nun die Augen aufschlagen und ihm schelmisch zublinzeln würde. Aber dann blakte und rußte eine der Kerzen, und die Augen der Frau schienen tiefer einzusinken, der Mund verschloss sich unnachgiebig, und die Linie zwischen den Lippen wurde zu einem bläulich-schwarzen Strich. Täntchen wollte nun in Ruhe gelassen werden. Und so ging er.
In den folgenden vier Tagen besuchte er Täntchen regelmäßig mittags und abends. Nach Ablauf dieser Trauerzeit legten Männer sie in eine große hölzerne Kiste und brachten sie in die Kirche, um feierlich Abschied zu nehmen, wie Mutter sich ausdrückte. Sie erklärte ihm auch, dass bei normalen Menschen der Sarg so hingestellt würde, dass der Tote mit den Füßen zum Altar lag. Das klang einleuchtend, saßen doch auch die Lebenden in dieser Richtung. Ein Priester dagegen wende auch im Sarg noch die Füße zur Gemeinde.
Der Junge musste kichern und stellte sich vor, wie die vielen Blicke der Leute den Pastor unter den Fußsohlen kitzeln würden. »Tote spüren nichts mehr«, meinte Mutter kurz angebunden, und er überlegte, ob Schoos-Täntchen auch im Sarg noch ihre Schuhe anhatte. Es erschien ihm unvorstellbar, dass die alte Frau jetzt für immer in dieser Kiste schlafen sollte. Der Sarg war mit großen Nägeln verschlossen, so dass man nicht mehr hineinschauen konnte. Dann trugen sie Täntchen auf den Friedhof. Im nächsten Frühjahr würden Blumen aus ihr herauswachsen.
Im Zug der Nonne
Frühling 1938. In diesen Wochen fehlten viele Kinder in der Verwahrschule. Die Diphterie griff sich vor allem die Jüngsten und Rotbackigsten. Die Erwachsenen sprachen von einem Würgeengel.
Der Junge stellte sich eine dunkle Gestalt vor, einen Todesboten, der in wallende Gewänder gekleidet, von Haus zu Haus schritt und mit seinem in das Blut der Kinder eingetauchten Zeigefinger ein rotes, ekliges Kreuz an die Haustüren zeichnete. Hier eines und dort auch eines, willkürlich und scheinbar mutwillig ein Haus überspringend oder auch zwei, dann wieder mit Riesenschritten zurückkehrend, um das Versäumte nachzuholen. Es starben trotz aller Vorsicht viele. Es half nicht, wenn man sich die Decke über den Kopf zog, denn die tödliche Gefahr war in der Luft, die sie atmeten. Und atmen musste der Mensch.
Der Junge zog jeden Morgen einen magischen Kreis um sich herum. Einen Kreis aus Worten, die außer ihm niemand kannte. Sie laut auszusprechen, hätte sie ihrer Kraft beraubt.
Und obwohl es angeblich nichts brachte, die Decke über den Kopf zu ziehen, tat er es dennoch. Dann lag er unter der Glocke des eigenen verbrauchten Atems, betäubt und geschützt vor den giftigen Schwaden der kalten Nachtluft. Er war fest davon überzeugt, dass es einzig in seiner Macht stand, dass der blutige Engel ihr Haus verschonte.
Und tatsächlich fehlte keiner seiner Spielkameraden, als sie Wochen später ihr Revier am Kirchenweg wieder in Besitz nahmen. Mit aneinanderschlagenden Zähnen ratterten sie mit dem Bollerwagen wieder und wieder über das Kopfsteinpflaster. Einmal ging es nicht mehr rechtzeitig mit dem Bremsen, da rasten sie gegen den Zaun vor Hoffmanns Haus, und fürs Erste war Schluss mit Autorennen. Später zeigte der Junge voller Stolz eine lange Narbe an der Wade.
Der Kirchenweg führte linkerhand ins Laacher Reich. Der Junge malte sich aus, dass dort ein märchenhafter König über ein Volk herrsche, das so ganz anders wäre als die gewöhnlichen Dorfbewohner. Zum Beispiel konnten die Untertanen des Laacher Reiches nach Belieben ihr Geschlecht wechseln. Das Gebiet lag nämlich hinter dem Regenbogen, der immer mit einem Bein im Flüsschen Kyll und mit dem anderen in der reißenden Wirft stand. Wie jedes Kind wusste auch der Junge, dass er nur das Tor des Regenbogens finden und durchschreiten musste, um endlich, endlich ein Mädchen zu werden. Mädchen hatten lange Zöpfe mit schönen Schleifen und saubere Kleider. Betrübt blickte er an seinem ererbten, gewendeten und geflickten Zeug hinunter. Die Hosen waren von undefinierbarer Farbe, und nicht der kleinste Schmuck oder Zierrat war an seiner Kleidung zu finden. Aber alles Suchen half nicht – der Regenbogen, so oft er sich auch zum Greifen nahe zeigte, war launisch, entzog sich ihm, entschlüpfte und verblasste, um dann urplötzlich wieder wie neu dazustehen: eine flimmernde Luftspiegelung – immer vor ihm, nie hinter seinem Rücken. Und so blieb er, widerstrebend und hoffend, ein Junge.
Während links das geheimnisvolle Laacher Reich lag, ging es rechts zur großen Kreuzung, wo sich alle Straßen trafen; Straßen, die von weither kamen, aus der Welt. Dort ging es zur Kirche, zum Markt und zu den Geschäften – und zum Kloster mit dem Kindergarten , den sie meist Verwahrschule nannten.
Abb. 1Kindergartengruppe aus dem »Klösterchen« in Stadtkyll (1925).
Bei schönem Wetter wurden die Kinder in Zweierreihen aufgestellt und unter Aufsicht einer Nonne aus dem Dorf hinausgeführt. Die großen Jungen gingen hinten. Hinter den Kleinkindern konnten sie sich gut verstecken und echte Männergespräche führen. Tauschgeschäfte wurden getätigt, man rempelte sich ein wenig, aber hauptsächlich warteten sie auf Pater Porten. Denn Pater Porten kam immer. Wenn die hochgewachsene Gestalt in der viel zu weiten Soutane auftauchte, knufften sich die Jungen voller Vorfreude in die Seiten. Pater Porten ging immer mit leicht hängenden Schultern, als beuge er sich zu den Kindern hinab. Komplizenhaft erwiderte er ihr erwartungsvolles Grinsen und reihte sich verstohlen bei den größeren Jungen ein.
Aus den unergründlichen Tiefen seiner Taschen holte er Hände voller Haselnüsse, knackte sie und verteilte sie reihum. Die Nonne, die ihn zuerst misstrauisch beäugt hatte, wandte sich beruhigt wieder den Kleinen zu und ließ sie ein Lied anstimmen.
Nun zog Pater Porten ein großes schmutzig-weißes Taschentuch hervor und wischte sich den Schweiß von Stirn und Nacken. Ein verschmitztes Lächeln glitt über sein gerötetes Gesicht, als er das Tuch wieder in der Soutane verstaute. »Wollen mal sehen«, murmelte er. »Wollen mal sehen …« Nüsse gab es keine mehr, so sehr er auch das Futter seiner Taschen um- und umwendete. Die Jungen trabten geduldig neben ihm her und knufften sich voller Vorfreude in die Seiten. Sie kannten das Spiel. Und in genau kalkuliertem Erstaunen hielt der Pater auf einmal seinen Fund in die Höhe: einen Stumpen! Und der fand bald schon seinen Weg zu den großen Jungen. Fachmännisch prüften diese ihre Beute. Sie gingen nun etwas breitbeiniger, blinzelten sich gegenseitig zu und hatten auf einmal feuerrote Ohren. Gab Pater Porten ihnen dann Feuer, klemmten sie den Stumpen weltmännisch zwischen Zeige- und Mittelfinger oder verbargen die Glut in der hohlen Hand. So spazierten sie gemächlich, gaben den Stumpen weiter, und das war so schön, dass sie fast zu rauchen vergaßen und die Glut zu verlöschen drohte.
Jupp war der erste, der einen tiefen Zug nahm. Die anderen wollten ihm nicht nachstehen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Hustend und keuchend warfen sie schon bald das stinkende Kraut auf den Boden. Einige verdrückten sich seitwärts in die Büsche, ernst und mit blassen Gesichtern.
Auch der Pater musste sich beeilen, wollte er ungeschoren davonkommen, denn mit wehenden Röcken kam die Nonne angerannt, um ihre Schützlinge wieder einzusammeln.
Rasch hob er dann den Saum seiner Soutane, um größere Schritte machen zu können, und empfahl sich ebenso unauffällig, wie er gekommen war.
Ganz ohne Zweifel hatte sich auch dieser Ausflug wieder einmal gelohnt: Noch während sie mit einem merkwürdigen Kollern im Bauch zurücktrotteten, erzählten die Jungen sich, wie tief und wie oft sie den Rauch inhaliert hätten – ganz auf Lunge – und dass es ihnen demnächst sicher gelingen werde, die schönsten Ringe in die Luft zu blasen. Ganz sicher.
Das Kloster
Frühsommer 1938. Das Kloster war wie ein großer alter Schrank mit vielen Türen und Schubfächern. Einige ließen sich ohne große Mühe öffnen, andere waren streng verboten – und natürlich gab es auch Geheimfächer, deren Inhalt nur Eingeweihten zugänglich war. Große zweiflügelige Türen führten ins Krankenhaus , eine andere etwas weniger breite Tür in den Kindergarten. Ein kleines Schmuckfach war die Kapelle, die man schon nicht mehr einfach so betreten konnte. Man musste den Finger mit Weihwasser nassmachen, die Tropfen über Stirn, Schultern und Brust sprenkeln und »Vater-Sohn-und-Eiliggeist« sagen. Wer war dieser eilige Geist? Erst später erfuhr der Junge, dass Heiligergeist das richtige Wort sei, was ihn aber noch mehr verwirrte. Er dachte bei Geistern an alte Burgruinen, in denen nachts Gespenster heulten und ihre schweren Ketten rasselnd hinter sich herschleiften. Diese Geister waren aber niemals Heilige, wie sie rot-blau-golden auf die Kirchenfenster gemalt waren.
Abb. 2Marienhaus des Klosters in Stadtkyll; genutzt als Exerzitienhaus, Müttererholungsheim, Büro der Westwallbehörden, Lazarett; 1945 komplett zerstört, wieder aufgebaut und ca. 2010 abgerissen.
In der Klosterkapelle gab es keine bunten Bilder. Nur einen gekreuzigten Jesus über dem Altar, der den Jungen jedoch nicht weiter interessierte. Die Muttergottes gefiel ihm viel besser. Sie öffnete den hellblauen Mantel über ihrem weißen Gewand, indem sie ihn mit leicht gewölbten Händen auseinanderhielt. Ihren Körper konnte er unter den reichen Falten noch nicht einmal erahnen. Das Gesicht mit den halbgeschlossenen Augen zeigte ein leises, fast verstohlenes Lächeln.
Durfte sie denn überhaupt lächeln, die Madonna mit dem blutenden Herzen? Aber hier blutete nichts; sie hatte die Hände frei, trug auch kein Kind und schien ganz für den Jungen da zu sein. Der wäre gern einmal unter ihren blauen Mantel geschlüpft, um dort warm und sicher zu sitzen, einen weißleinenen Rockzipfel in der Hand, damit sie nicht unversehens verschwände.
Mutter sang: »Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus; laß uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorübergehn.«
Er liebte dieses Lied sehr.
Auch die Angelegenheit mit den Geistern fand schließlich ihre Aufklärung. Eines Tages stellten die Nonnen eine Anzahl Kinder in Zweierreihen auf und führte sie die Treppen hinab in den Keller, wo eine schmale, aber schwere Tür sich nur langsam aufschieben ließ. Eine längliche Kammer, steinerne Wände, kühl und eng. Darin eine Bahre mit einem Mann, der letzte Nacht im Spital verstorben war. Die Hände der Nonne schimmerten sehr hell gegen den dunklen Stoff der weiten Ärmel, als sie mit einer ruhigen Bewegung das Leichentuch zurückzog. Der Junge kannte den Toten nicht. Gleichmütig betrachtete er die Gestalt ein Ave Maria und ein Vaterunser lang, was die Nonne mit geübter Stimme vorbetete. Erst als sie den Raum verließen, erfasste den Jungen ein heißes Gefühl von Mitleid, so dass ihm die Tränen in die Augen schossen. Alle anderen Toten, die er in seinem bisherigen Leben gesehen hatte, waren zu Hause aufgebahrt gewesen. Dieser hier lag ganz allein, unbeweint und in der Kälte vergessen. Einzige Wegzehrung für den langen Weg in den Himmel oder ins Fegefeuer waren die kargen Nonnengebete. Wenig war das, so wenig wie ein trockenes Stück Brot oder der angebrannte Rest im Suppentopf. Sicher musste der da im Keller sich bald schon auf die lange Heimreise machen, um weit weg sein Dorf und seine Familie zu suchen, gehetzt und voller Sehnsucht – ein unruhiger Geist. Ja, dieser da wurde ganz sicher nun zum Geist oder war schon einer.
Seit diesem Erlebnis verstand der Junge den Begriff der armen Seelen auf seine Weise.
Den Stall besorgte Schwester Philippine. Die Leute sagten, dass sie Tiere mehr liebe als die Menschen. Dem Jungen erschien ihr Gesicht wie aus Holz geschnitzt. Nein, die ganze Frau kam ihm wie direkt aus der Erde gewachsen vor, duftend nach Heu und Stall und gewaltig wie eine in Bewegung geratene Linde. So schwankte er jedes Mal, wenn er sie sah, zwischen Furcht und unwillkürlichem Lachen. Sie jedoch beachtete ihn kaum.
Völlig verborgen blieb ihm das private Leben der Nonnen. Es gab ein sogenanntes Wohngebäude, das sich der Junge wie eine Art Puppenhaus vorstellte. In winzigen, dicht an dicht aneinandergereihten Zimmerchen vermutete er jeweils ein Bett, darin eine Nonne liegend, steif auf dem Rücken, in ihrem dunklen Habit, die Hände gefaltet auf der Brust. So verbrachten sie wohl die Nacht, bis mit dem Sonnenaufgang wieder der Kreislauf der Pflichten und der guten Werke begann.
Heil!
Donnerstag, 25. August 1938. Das Fahrrad wackelte bedenklich, als sie in voller Fahrt die Hüll hinunterschossen. Der Junge spreizte die Beine, um nicht die Füße zwischen die Speichen zu bekommen. Mit beiden Händen klammerte er sich an die Kleider der Mutter und barg den Kopf an ihrem Rücken. Er schnüffelte zufrieden. Mutter roch so gut: nach Küche, nach frischem Schweiß, nach dunkler Erde und Frühlingsluft. Jetzt fuhren sie mindestens so schnell wie ein Auto, aber allmählich tat ihm der Hintern weh vom langen Sitzen auf dem harten Gepäckträger. Mit ein wenig Glück kamen sie, ohne anzuhalten, über die Kreuzung rüber und drüben ein Stück weit den Berg hoch. Dann musste Mutter nicht absteigen und das Fahrrad schieben. Deshalb verstand der Junge nicht, warum sie jetzt bremste und schließlich sogar anhielt.
Der Junge lockerte seinen Griff, und Mutter rutschte vom Fahrradsattel. Die große Kreuzung war voller Menschen. Soldaten hielten die Menge mühsam hinter einer Absperrung zurück. Auf Treppchen, Simsen und Geländern balancierten die kleinen und großen Jungen. Bis weit die Prümer Straße hinauf drängte sich die Menge.
Ein Summen war zu hören, wie von einem eingesperrten Bienenschwarm. Ein Fahnentuch flappte zuerst müde, dann, erfasst von einer leichten Brise, leckte es mit einem Mal rotzungig nach oben in den wolkenlosen Himmel.
Auch die Fähnchen in den Händen der Kinder begannen sich zu regen. Ein Gewoge rot-weißer Fähnchen, die im Wind knatterten, und lustig tanzte das schwarze Kreuz mit; das musste sich festhalten mit allen vier Haken, sonst fiel es noch runter und rollte weg.
Abb. 3Maikundgebung (um 1935) auf dem Kirchplatz in Stadtkyll.
So furchtbar gerne wäre der Junge nun abgestiegen und hätte sich zu den anderen gesellt. Klein und wendig wie er war, wäre es ihm ein Leichtes gewesen, sich zwischen den Beinen der Leute hindurchzuzwängen, und er hätte ganz vorne am Straßenrand stehen können. Er wusste jedoch die Antwort der Mutter, auch ohne zu fragen, und so blieb er auf seinem Drahtsitz, den Hals gestreckt und den Kopf so weit nach oben gereckt wie eben möglich, um nur ja nichts zu verpassen.
Mutter stützte den linken Arm in die Hüfte. Mit der Rechten hielt sie das Fahrrad und blieb in dieser Haltung stehen.
Das Summen dort drüben wurde lauter, steigerte sich zu einem Brausen, einem Wellenschlag, so wie er es einmal im Inneren einer Muschel gehört hatte – nur lauter; sehr viel lauter. Vereinzelte Rufe waren zu hören, und alle Gesichter wandten sich erwartungsvoll in eine Richtung.
Jetzt hatte Mutter einen Entschluss gefasst und machte sich auf den Weg. Tauchte ein in die zerfaserten Ränder des Menschenteppichs, wurde von der dicht gepackten Masse verschluckt, gepresst und weitergeschoben, ohne dass sie noch entscheiden konnte, in welche Richtung es ging. Der Junge sah nur noch graue Rücken, braune Rücken, Wollstoff-Rücken, geblümte Rücken oder karierte mit Spitzenkragen, sah Strickjacken und Mäntel. Hüte obendrauf, viele Hüte.
»Heil!«, schrien die Leute. »Heil und Sieg!«
Sie erreichten den Straßenrand. Mit wenigen, den Atem anhaltenden, raschen Schritten gelang es der Mutter, die Straße zu überqueren, kurz bevor eine Krad-Staffel über das Pflaster knatterte. Ein braun uniformierter Mann zog sie mitsamt dem Fahrrad unsanft zur Seite, da explodierte auch schon die Luft zwischen den Häusern. »Heil!«, knallte es auf das Pflaster. »Heil!«, prallte es an Mauern und Häuserwände und taumelte als Echo zurück in die Menge. »Sieg Heil!«, brüllte ein feuchter rosiger Mund direkt neben ihnen, und da war auch schon so ein Fähnchen, das er gar zu gerne genommen hätte. Mutters Blick aber ließ ihn zögern, obwohl der fremde Mann ihm das Ding fast gewaltsam in die geschlossene Faust stecken wollte. »So nimm doch, Junge!«, sagte der Mund – und schließlich: »Na, dann eben nicht!« Wandte sich wieder nach vorne, mit sich überschlagender Stimme weiter rufend: »Heil! Sieg Heil!«
»Heil und Sieg – der Deubel und der Krieg!«, sagte Mutter mit rauer Stimme, aber niemand außer dem Jungen hatte es gehört.
Sie machte sich wieder auf den Weg; ruckartig stieß sie das Rad vorwärts, um sich Platz zu verschaffen in der saugenden Menge. Der Junge drehte und wendete sich auf seinem Sitz wie ein Aal, behielt die Straße im Blick und erwischte gerade noch rechtzeitig den entscheidenden Moment: Schwarz glänzend schob sich die prachtvolle Limousine über die Kreuzung. So etwas hatte der Junge noch nie gesehen: ein Auto gleich einem geduckten Raubtier, geschmeidig und mit elegant geschwungener Karosserie. Das Verdeck war zurückgeschlagen. Wie lästige Stechfliegen die Kradräder drumherum. Der Besitzer dieses Autos musste wohl ein sehr wichtiger Mann sein.
Es waren zwei, die auf der Rückbank saßen. Den Kleinen mit dem Schnauzbart kannte er; das war der Hitler, der jetzt wie eine mechanische Puppe immer wieder den rechten Unterarm nach oben riss, die Hand lässig über die Schulter klappend. Der andere war der Dicke – wie hieß er noch? Von dem sah er aber nur die riesigen Ohren und den rosafarbenen Nacken, der sich über den Kragenrand zwängte. Schon war der kostbare Augenblick vorbei, denn Mutter war inzwischen an Baumgartens Schuhgeschäft angekommen; die Mauer der Menschenleiber schloss sich, und der Blick auf das Auto war ihm verwehrt.
Da klatschte es, Papier riss und ein dünnes Stäbchen knackte und splitterte. Im tosenden Lärm wurden diese Geräusche fast verschluckt, aber der Junge schaute genauer hin und erkannte seinen Bruder Ernst. Mit dem Rücken an die Schaufensterscheibe gelehnt, stand er vor dem Schuhgeschäft und hielt sich die rechte Backe. Seine roten Locken standen wirr und verschwitzt vom Kopf ab und traurig blickte er auf die Reste seines Fähnchens. »Wag es nicht!«, fauchte Mutter, als er sich bücken wollte, um die Fetzen aufzuheben. Mit der Fußspitze schob sie die Papierschnipsel zur Seite wie ein Häufchen Dreck. »Ich weiß überhaupt nicht, was du hier eigentlich verloren hast. Kein Wort mehr!« Das war ungerecht, denn Ernst hatte überhaupt nichts gesagt! »Ab nach Hause!«
Ernst schüttelte sich wie ein nasser Hund und setzte sich widerwillig in Bewegung. Der Junge verstand seinen großen Bruder nur zu gut. Nicht der kleinste Spaß wurde einem gegönnt. Solch ein großes Auto sah man nicht alle Tage. Ein wenig Fähnchen-Schwenken und Sieg-Heil-Rufen, was war denn dabei? Das war doch nichts Schlimmes.
Wassermann
Februar 1939. Es war immer noch Winter. Allerdings konnte man an manchen Tagen schon den Frühling spüren. Dort, wo die Sonne über Mittag den Boden wärmte, taute der Schnee. Aus der fettig glänzenden Gartenerde schoben sich die ersten Stängel der Schneeglöckchen. Am Fuß der Bruchsteinmauern buckelten sich die schuppig-pelzigen Knospen des Huflattichs. Aber noch war es zu früh. Noch fror es jede Nacht.
Und er war immer noch vier Jahre alt.
Im Frühjahr würde er fünf. Dann wäre er schon ziemlich groß. Christian war sogar schon sieben Jahre alt. Also war überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass die Jungen an diesem Morgen loszogen, um ins Laacher Reich zu gehen. Der eine war ja schon groß, und der andere würde es bald sein.
Als sie den Kirchenweg hinauf marschierten, biss ihnen der Wind in Ohren und Nasenspitzen. Später kroch die Kälte auch in Hände und Füße. Beide trugen lediglich Pantoffeln. Die zwei ließen sich jedoch nicht entmutigen, schlugen die Arme gegen den Körper und stampften fest auf. Sie waren jetzt schon so weit gelaufen, dass es nicht mehr lohne umzukehren, nur um andere Schuhe anzuziehen, befanden sie einmütig.
Dann standen sie am Ufer des Mühlenteichs und hauchten Wärme in ihre Fäuste, so dass der Atem wie eine fedrige Wolke über ihren Köpfen stand. »Du gehst zuerst«, meinte der Große. »Nein, du – du bist größer und musst mir zeigen, wie es geht.«
Über den Teich führte nur ein schmaler Steg, nicht viel mehr als ein Brett. Aber das Geländer aus einer Bohnenstange versprach Sicherheit, und außerdem war der Teich zugefroren. Es konnte also nichts passieren.
Christian warf prüfend ein paar Kieselsteine aufs Eis. Sie rutschten über die glatte Fläche und machten dabei weite schwingende Töne.
»Das trägt«, stellte Christian fest. »Komm jetzt, bleib dicht hinter mir.« Auf Chris war Verlass. Sicher und breitbeinig stapfte er über den Steg. Die Schritte des Bruders fraßen kleine ovale Löcher in die knusprige Raureifkruste, die das Holz überzog. Der kleinere Junge nahm sich vor, genau in diese Fußstapfen hineinzutreten.
Zögernd setzte er einen Fuß auf das Brett. In diesem Augenblick begann das Zittern. Unsicher zog er den anderen Fuß nach, wollte aber nicht mit den ohnehin schon klammen Fingern nach dem kalten Geländer greifen. Um das Gleichgewicht besser halten zu können, hielt er den Atem an.
Dann ging alles sehr schnell.
Die alles durchdringende Empfindung war Kälte, die sich wie ein Reifen um seine Brust legte, so dass er nicht mehr normal einatmen konnte, sondern mühsam nach Luft schnappte, wie ein Fisch auf dem Trockenen. War es ihm bisher gelungen, einen kleinen Rest Körperwärme unter der Jacke und in seinen Hosentaschen zu speichern, so floss diese jetzt davon wie das Wasser aus einem löchrigen Eimer. Erst dann bemerkte er die Nässe, die in seine Pantoffel drang und ihm die Kleider an den Körper presste. Er wandte den Blick nach oben und erkannte die Scherben eines Sterns im Eis, das sein Körper durchbrochen hatte. Er ahnte den Steg als dunklen Schatten und bemerkte erstaunt, dass sein Kopf auf der Wasseroberfläche lag wie ein vergessener Ball. Nachts war Wasser abgelassen worden. Gerade so viel, dass der Junge im Teich stehen und atmen konnte. Er sah in das milchige Licht, stellte fest, dass er nicht ertrank, und machte sich auf den Weg zum Ufer.
Seine Füße waren wie betäubt, aber die Hausschuhe fanden den Weg zwischen den Steinen, und er ließ den Körper einfach mittreiben bis hoch zu dem Ball, der sein Kopf war und Ausschau hielt. Mehr und mehr wurde er in der umklammernden Kälte zu einem treibenden Wassergewächs, zu einem Stück Schwemmholz, zu einem Klumpen Eis. Es waren nur wenige Schritte bis zum Ufer, und er wusste, dort stand ein Zaun. Er hoffte, dass Christian dort auf ihn warten würde.
Nahe beim Ufer war eine Luftblase im Eis eingeschlossen. Es kostete ihn Mühe, den rechten Arm hochzuheben. Die Finger hatten sich durch die Kälte ohne sein Zutun zur Faust gekrümmt, die er nun durch die geschwächte Eisdecke stieß. Jede Bewegung war mühsam, zäh und schwer vom saugenden Wasser.
Der Zaun stand da, wo er ihn erwartet hatte. Der Bruder nicht.
So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit eigener Kraft aus dem Wasser zu ziehen. Er streckte den Arm noch weiter vor, die linke Hand kam der rechten zur Hilfe, und beide ergriffen den Zaun. Ein vierjähriger Junge ist nicht besonders schwer – aber dieser Zaun war alt und morsch, viel zu schwach, um sein Gewicht zu tragen. Die Bretter kamen ins Rutschen, und der Junge hielt zwei Holzstücke in der Hand, unter den Fingernägeln schwärzliche Splitter.
Jetzt erst kroch Entsetzen in seine Glieder. Er schien alleine zu sein und war stumm. Solange er unter dem Eis feststeckte, würde niemand seine Rufe hören. Seine Finger lösten sich vom Holz. Da spürte er einen leichten Stoß gegen die Waden. Vor Schreck wäre er fast in den Knien eingeknickt, aber die Knie waren steif gefroren. Wieder ein Stupsen und ein sanftes Drücken. Gleichzeitig zog es an seinen Händen und streifte sacht am Körper vorbei.
Es waren wohl Fische, die er aus ihrer Winterruhe aufgeschreckt hatte und die ihn nun neugierig untersuchten. Er konnte sie nicht sehen, nur spüren. Er überließ sich dem Strom der silbrigen Leiber, wurde mitgenommen in wellenförmigen Bewegungen und konnte auf einmal wieder laufen, stromab, dorthin, wo der Teich seinen Abfluss hatte und den Mühlenbach speiste. Dorthin wollte er jetzt gehen, aber er ging nicht, nein, er schwebte, wurde getragen von den Fischen. Alles war gut, und er hatte keine Angst.
Nur kurz sah er den Herrn der Fische – den Wassermann. Sein Gesicht tauchte vor ihm auf, und er schien zu lächeln. Dann drehte er sich um und spurte einen schmalen Pfad ins Wasser, so dass der Junge die restlichen zehn Meter bis zum Wehr mühelos zurücklegen konnte. Er betrachtete die algenbewachsenen, breiten schuppigen Schultern mit der großen Rückenflosse. Dann schaute er nach oben und sah Christian als silbrig-grauen Schatten am Ufer seinen Weg begleiten. Als er den Blick wieder nach vorn richtete, war der Wassermann verschwunden. In Gedanken versprach ihm der Junge, ihn später einmal zu besuchen.
Nun waren es nur noch wenige Schritte bis zum Wehr, wo das Eis aufgebrochen war und selbst im kältesten Winter nicht gefror. Auch der Bruder war da, und mit seiner Hilfe fand der Junge schnell wieder ans Ufer.
Erst jetzt kam die Angst, nicht vor dem kalten, dunklen Wasser – es war die Angst vor Strafe. Auf einmal fühlte er sich wieder sehr klein, und auch Christian schaute hilflos und wusste keinen Rat.
Hand in Hand gingen die beiden Brüder zurück. Ihre Finger waren klamm und rot vom Frost, ihre Zähne klapperten in der beißenden Kälte – aber dennoch gingen sie langsamer, als sie gekommen waren. Christian war der Ältere; er hatte die Verantwortung gehabt und würde nun den ganzen Ärger abbekommen, soviel stand fest.
Nur – wie viel Ärger bekam man, wenn man den kleinen Bruder um ein Haar ertrinken ließ?
Als sie vor der Haustür ankamen, lösten sie ohne ein Wort ihre Hände, und ihre Wege trennten sich. Christian stahl sich die Treppe hoch. Dem jüngeren Bruder, dem völlig durchnässten und durchgefrorenem, blieb jedoch nur der Gang in die gut geheizte Küche. Wie zufällig stellte er sich neben den Ofen. Es schien jedoch, als ob selbst dieses Feuer die Eiseskälte in ihm nicht zum Schmelzen bringen könnte. So stand er da und biss die Zähne zusammen, damit sie nicht klapperten. Um seine Füße bildete sich eine Pfütze. Mit unbeteiligten Blicken verfolgte der Junge das kleine Rinnsal, das sich, von dieser Pfütze gespeist, einen Weg in die Küche suchte. Es sickerte bis zum Herd, wo Mutter stand und kochte. Die sah das Wasser, folgte ihm bis zu seinem Ursprung und entdeckte so ihren jüngsten Sohn. Der stand da wie eine Salzsäule, nein, wie eine Eissäule, aus der große erschrockene Augen starrten.
Und nie, niemals im Leben würde er seiner Mutter vergessen, dass sie kein böses Wort sagte. Keine Vorwürfe, keine Strafe, nur ein warmes Bett auf der Küchenbank, eine Wärmeflasche und heißen Tee in Unmengen. Und Liebe, die ihn derart aufwärmte, dass er von dem ganzen Abenteuer noch nicht einmal einen Schnupfen davontrug.
Und obwohl er natürlich den Bruder nicht verpetzt hatte – selbst wenn sie ihn geschlagen hätte, wäre kein Sterbenswörtchen über seine Lippen gekommen –, obwohl also diese Art von Tapferkeit gar nicht von ihm gefordert wurde, hatte die Mutter dann doch noch alles herausbekommen. Es war auch zu dumm, dass Christian seine verdreckten und steif gefrorenen Pantoffeln unten an der Treppe stehengelassen hatte. Noch nicht einmal versteckt hatte er sie! Die Pantoffeln hatte die Mutter dann natürlich gefunden – und so, wie sie ihn, den Kleinen verwöhnt hatte, so wurde er, der Große, dann abgestraft. Ganz begreifen konnten sie es nicht. So groß war der Unterschied doch gar nicht – zumindest, wenn man die Pantoffelchen betrachtete: seine und die von Christian sahen ziemlich gleich aus –, und er war verwöhnt worden und der Bruder geschlagen. Es wollte ihm einfach nicht in den Kopf.
Gott sei Dank war der Bruder nicht nachtragend.
Geisterwelt
Frühjahr 1939. Die Tage wurden heller, aber immer noch ging ein rauer Wind. Abends zitterten die Kinder in ihren Betten, und es dauerte lange, bis die Decken wärmten. In dieser Zeit traf der Junge mit seiner zehnjährigen Schwester Gertrud ein Abkommen: Jeden Abend wärmte er ihr tapfer das klamme Bett – als Gegenleistung las sie ihm vor. Nicht solche Kleinkindergeschichten, wie er sie vom Kindergarten zur Genüge kannte. Nichts von Hänsel und Gretel, dem Froschkönig und von Schneewittchen. Von Riesen und Drachen wollte er hören, von versunkenen Inseln, und er wollte alles wissen über die Fahrten von Abenteurern und Schelmen.
Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohlbekannt,
die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand;
sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer,
du fragst nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.
Da war es ihm wie ein leises angenehmes Grauen. Wie schön war es, dicht an die Schwester gekuschelt, den Rest der Geschichte zu hören: Wie die Riesentochter hinausging aufs Land und dort einen Bauern samt Fuhrwerk vom Feld pflückte, in ihr Taschentuch knotete und das Ganze als zappelndes Spielzeug mit nach Hause nahm. Da musste er lachen und erinnerte sich daran, wie er die kleinen glitschigen schwarz lackierten Kutteköpp auf ebensolche Weise hochgenommen hatte. In der hohlen, rosigen Handfläche geborgen, hatte er sie sorgfältig aus den Pfützen am Wegrand hinübergetragen in den Wassergraben. Dort konnten sie dann zu großen fetten Fröschen heranwachsen, ohne Angst zu haben, dass ihre Pfütze austrocknen würde. Im Spiel mit den Kaulquappen hatte auch er sich gefühlt wie ein Riese. Nur kurz kam ihn die Lust an, die quaddeligen dicken Bäuche mit der Kuppe seines Daumens zu drücken – so lange, bis etwas passierte; irgendetwas würde geschehen, etwas, was fremd war und in der Magengrube zog und flirrte, und er spürte wieder dieses unbenennbare Grauen, das ihm die Schultern hochzog und ihn die Hände rasch abschütteln ließ, bevor auch nur eines der kleinen Tierchen Schaden genommen hatte. Er war zutiefst davon überzeugt, dass die Kutteköpp die Kinder des Wassermanns waren.
Als die Tage länger wurden, fiel ihm ein, dass er den alten Herrn Bach schon lange nicht mehr gesehen hatte. Er sei krank, hieß es. An einem ruhigen Nachmittag sah er, dass die Tür zum Bach-Haus offenstand, und beschloss, den alten Mann wieder einmal zu besuchen. So überquerte er die Straße, sprang durch die offene Tür und polterte die hölzernen Treppenstufen hoch; die waren rotbraun angestrichen und an den Kanten blättrig abgestoßen, dort, wo auch seine Fußspitze hängen blieb, so dass er Halt suchend nach den gedrechselten Stangen des Geländers griff.
Oben angekommen, schien ihm das Haus auf einmal unnatürlich still. Die Tür zum Schlafzimmer war verschlossen. Von plötzlicher Scheu erfasst, lauschte er mit angehaltenem Atem, legte die Hand auf die Türklinke, wagte es aber nicht, zu klopfen oder gar einzutreten. Auf Zehenspitzen schlich er weiter über den Kokosläufer, der seine Schritte dämpfte, und schaute sich um. Am Ende des Flures sah er eine angelehnte Tür. Neugierig stupste er dagegen, die Tür öffnete sich ohne Widerstand und gab den Blick frei auf eine hagere, weiße Gestalt.
Dass der da schlafend lag, konnte der Junge nicht glauben; dass der da der alte Bach sein sollte, noch viel weniger. Zwischen schwarz verhängten Wänden, beleuchtet von zwei dünnen, im Luftzug halb verlöschenden Kerzen, lag ein böser, magerer Greis mit unbarmherzigem Mund und Händen, die sich gleich Krallen in das Betttuch krampften. Ein langer, glänzend weißer Bart reichte ihm bis weit über den Bauch. Solch einen Bart hatte der alte Bach niemals gehabt. Jetzt schien sich das silberne Haar unter seinem Atemhauch zu ringeln und zu strecken, bewegte sich gleich der Zunge einer spöttischen Schlange auf den Jungen zu. Gleich würde der da die Augen aufschlagen und sie im Kopf herumrollen lassen wie feurige Räder. Gleich würden diese langen dünnen Hände nach ihm greifen und ihn festhalten. Dann würde ihm Schreckliches widerfahren, ebenso wie seinem Freund, dem armen alten Bach, der jetzt verschwunden war – Gott weiß wohin! In dieser engen Kammer lag nur noch dieser fremde, grauenerregende Mann.
Da half nur noch die Flucht. Kopfschüttelnd sah Frau Bach ein Kind aus dem Haus herausstürzen, wie von Furien gehetzt, ohne einen Blick nach links oder rechts zu werfen. Und seufzend ging sie mit schweren Schritten die Treppe hinauf und lehnte die Tür zur Totenkammer vorsichtig wieder an, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass oben alles seine Ordnung hatte.
Der Junge hatte noch lange Zeit Angst vor toten Leuten. Seit diesem Tag wusste er, dass er nie mehr unbefangen und gleichmütig auf Leichenschau gehen konnte.
Einberufung
Freitag, 25. August 1939. Eines Tages würde es keine Väter mehr geben. Nach dem heutigen Tag gab es nur noch Frauen und Kinder, alte Leute und – Soldaten.
Noch waren die Väter zwar daheim und gingen ihrer Arbeit nach wie immer; aber etwas hatte sich verändert, etwas war anders. »Sie müssen jetzt bald fort«, hieß es im Dorf, und der Junge konnte nicht begreifen, warum und wohin, aber niemand erklärte es ihm.
»Et jitt Kreech«, meinte Mutter mürrisch und schob krachend Töpfe und Pfannen auf der gusseisernen Herdplatte umher, ließ die Hände dann sinken und schaute zum Fenster raus, mit einem merkwürdig fernen Blick.
»Warum Krieg?«
»Warum, warum? Wat weiß ich; et hätt wohl einfach zu vill Minsche …«, und sie klapperte wütend auf dem Herd herum, ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern. Der verstand die Erwachsenen nicht. Anstatt sich zu freuen, dass es nun losging, endlich richtig losging mit dem Soldatenleben, machten sie bedrückte Gesichter, und viele Frauen hatten verweinte Augen. Frauen hatten ja sowieso keine Ahnung; sie mussten zuhause bleiben und sich um den täglichen Kram kümmern, sie wussten nichts vom wilden, herrlichen Soldatenleben. Bei Büb rannten drei Frauen unruhig durchs Haus. Frau Schmitz, das war die Mama von Büb, die Oma und sogar Tante Lisbeth – alle waren da, seit der Einberufungsbefehl gekommen war. Nur Bübs Papa war nirgendwo zu sehen. Wahrscheinlich stand er im Metzgerladen, so wie immer.
Abb. 4Männer aus dem Nachbarort Schönfeld nach der Musterung (1938; fotografiert in Stadtkyll).
Die beiden Jungen verständigten sich mit Blicken, dann traten sie hinaus auf die Straße. »Ich weiß wirklich nicht, warum die sich so anstellen«, meinte Büb und nickte verächtlich mit dem Kopf in Richtung Haustür. »Das bisschen Krieg ist doch schnell vorbei, meint mein Papa. Der Hitler wird es denen schon zeigen.«
»Wem denn?«, fragte der Junge, beschämt über sein Unwissen.
Büb beantwortete die Frage mit einer weit ausholenden Geste. »Allen, dem Feind eben. Das ist schrecklich kompliziert, und mein Vater meint immer, das hängt zusammen mit dem Schmand-Vertrag.«*
Schmand war saure Sahne – und dass man sich um Essen streiten konnte, wusste der Junge nur zu gut. Mutter stöhnte doch immer darüber, dass alles so knapp und teuer sei. So begann der Junge langsam zu begreifen, dass es in diesem Krieg um Nahrungsmittel gehen musste; jawohl, böse Feinde ließen das deutsche Volk hungern – und das deutsche Volk waren er, und Mama und seine Geschwister und seine Freunde und alle anderen Leute im Dorf. Hungerte von denen jemand? Egal, der Führer wollte sich nun jedenfalls zur Wehr setzen und es denen ein für alle Mal zeigen. Zack! Und Büb deutete einen gekonnten rechten Schwinger gegen einen imaginären Gegner an.
Der Junge trat einen Schritt zurück. Klar, dass die Feinde freiwillig nichts hergaben und der Führer deswegen Soldaten brauchte, die ihm bei dieser großen Aufgabe halfen. Ein solcher Soldat war jetzt der Vater von Büb. Auch Dahms Vater und Herr Görres, Lindens Heinrich und Baumgartens Niklas. Die und noch viele andere. Alle jungen und starken Männer im Dorf. Alle hatten heute einen Brief vom Führer bekommen – die Einberufung. Der Vater von Mies allerdings nicht; der war nicht wehrtauglich. Der konnte nicht mit in das große Abenteuer.
Bedrückt gestand Büb, dass er von den kommenden Wochen nichts Gutes erwarte. »Alleine mit den drei Weibern im Haus … dat wird ärch«, prophezeite er düster. »Richtig schlimm wird dat.« Er sah den Tatsachen ins Gesicht: Bübs Mama, seine Oma und Tante Lisbeth würden wie aufgescheuchte Hühner durch das Haus und den Garten flattern, ach was, durchs ganze Dorf, um auf ihn achtzugeben. Ununterbrochen würden sie ihn behüten, und da würde nicht das kleinste Schlupfloch sein, nicht das kleinste Fitzelchen Freiheit. Jedenfalls nicht, solange der Vater weg war.
Büb seufzte schwer.
Tröstend klopfte ihm der Junge auf die Schultern. Noch war der Vater ja da, außerdem sei der Krieg bekanntermaßen schnell vorbei und alles wieder beim Alten.
Aber jetzt galt es erst einmal, das Neue zu packen und zu schmecken, es festzuhalten und zu genießen, so lange es ging. Ein wildes, fremdes Glück erfüllte den Jungen, als er wieder nach Hause trabte und im Takt der Schritte vor sich hin sang: »Tirantantei, der Kreech, der kütt! Tirantantei, der Kreech, der kütt!«
*Gemeint ist hier der Versailler Friedensvertrag von 1919, im Volksmund häufig »Schand-Vertrag« genannt.
Regenstimmen
September 1939. Im Winter war er im Eis eingebrochen. Der Sommer war schon fast vorüber, als er sich an das Versprechen erinnerte, das er dem Wassermann gegeben hatte.
Kaum fand er die Stelle am Ufer wieder, von der er doch meinte, sie sich ganz fest eingeprägt zu haben. An der steilen Böschung standen jetzt die Halme dicht an dicht, und als er sich durch die knisternde Barriere hindurchschlängelte, schloss sich hinter ihm eine grüne raschelnde Wand.
Abb. 7Das »Reich des Wassermanns« mit Blick auf den Burgberg (1933; Stadtkyll).
Der Wassermann erwartete ihn. Das grüne Haupt auf die schuppigen Unterarme gelegt, wirkte er wie ein bemooster Stein oder wie ein verwittertes Stück Schwemmholz. Man musste genau hinsehen, um den König des Mühlenteiches zu erkennen. Er zeigte kein Zeichen von Ungeduld. Auch keines der Freude. Mit einem Nicken des schweren Schädels forderte er den Jungen auf, sich hinzusetzen. Dann geschah eine Weile nichts – oder es schien zumindest so.
Ihre Augen ruhten ineinander – die goldenen, tiefen des Wassermanns und die grauen des Jungen. Hell und hart wie Kieselsteine, blank geschliffen, poliert, glatt.
»Was willst du von mir?«, brach schließlich der Junge das Schweigen. Betont gleichgültig manövrierte er einen Binsenhalm zwischen den ersten und den zweiten Zeh und zog bedächtig daran. Der elastische Halm rutschte aber immer wieder zwischen den Zehen hervor und ließ sich weder knicken noch abreißen.
Geduldig schaute ihm der Wassermann zu. Sein goldenes Augenlicht schien wie das klingende Tönen von Metall – wie das dumpfe Schlagen der Glocken einer Kirche, tief versunken im See.
»Sprich mit mir«, sagte der Junge. Trotzig musterte er das grüngraue Gesicht vor sich und war versucht, einen Stein in den Mühlteich zu werfen. Jetzt schien der Blick des Wassermanns wie ein Seufzen, wie ein kaum hörbarer Ton des Leidens.
Den Jungen durchzuckte der Gedanke, dass Wassermänner nicht in den Himmel kämen, dass sie auf immer verdammt seien und noch nicht einmal der Hölle wert. »Nicht Fisch, noch Fleisch«, dachte er und wusste nicht, woher dieser Gedanke kam.
Mit einem schmatzenden Geräusch zog jetzt endlich der Wassermann seinen Arm aus dem Uferschlamm und schrieb eine große Geste in die Luft, so als ob er das Gras und Schilf zu sich einladen wollte und dann noch die Welt darüber hinaus und was dahinterlag, wo auch immer – alles.
»Alles schweigt mit mir«, hieß die Bewegung. »Und du, mein Junge, solltest es auch besser tun!« Noch immer sagte er kein einziges Wort.
Aber der Junge verstand auch so, was der Alte ihm sagen wollte: »Warum reden? Ist durch Reden schon irgendetwas besser geworden? Worte sind wie Wind. Der macht auch nur kleine Wellen auf der Wasseroberfläche, und sonst bewegt er gar nichts. Der Wind weiß nichts von den Palästen und Welten auf dem Grund des Sees. Auch du wirst nichts wissen von den Dingen unter der Oberfläche der Dinge, wenn du immer nur nach Worten suchst.«
»Aber wie soll ich dann die anderen verstehen, wenn sie mir alles verschweigen? Ich weiß nichts und verstehe nichts. Die anderen denken, ich bin dumm. Die lachen zwar nur heimlich über mich. Aber ich spüre es doch. Und wenn Büb mir etwas erklärt, verstehe ich es erst recht nicht. Ich habe so viele Fragen, aber niemand hört mir zu!«, schrie der Junge aufgebracht. Vielleicht schrie er es auch gar nicht. Vielleicht dachte er es auch gar nicht in diesen Worten, denn wie gesagt, Worte konnten es nicht fassen.
Der Himmel bezog sich mit dunklen Wolken, und es grollte. Als die ersten dicken Tropfen fielen, sprang der Junge verwirrt auf. Es war ihm, als erwache er aus einem tiefen Traum.
Ein Frosch sprang davon.
Der Regen strömte hernieder und schien mit ihm zu plaudern, als er nach Hause stürmte. Es war ein warmer, freundlicher Sommerregen, der viele Geschichten gleichzeitig erzählte. Der Junge verlangsamte seinen Lauf. Nass war er sowieso. Es machte keinen Unterschied, ob er schnell oder langsam ging. Lieber hörte er dem Regen zu, der Morsezeichen auf ein Blechdach klopfte, im Rinnstein gluckerte und mit sich selbst Verstecken spielte oder als majestätischer Theatervorhang herabrauschte. Dicke Blasen platzten in Pfützen und machten lustige Kussgeräusche.
Der Junge wurde müde, diesen vielen Geschichten zu lauschen; kaum hatte er eine ein Stück angehört, begann eine neue.
Schließlich verlor sich alles im eintönigen Fluss des Wassers, und der Junge erkannte das Schweigen, das hinter den vielen Geschichten stand. Aber was kam hinter dem Schweigen?
Vielleicht musste er zum Wassermann werden, um das herauszufinden.
Die Soldaten kommen
Oktober 1939. Es war ein heller Nachmittag, aber die Sonne wollte nicht mehr recht wärmen. Nur gedämpft drang das Gezeter der Spatzen von draußen herein. Eine Fliege stieß lärmend gegen die Fensterscheibe. Der Junge saß allein am großen Küchentisch. Vor ihm befand sich ein postkartengroßer Spiegel, wie man ihn beispielsweise zum Rasieren benutzte. Den metallenen Bügel auf der Rückseite hatte er aufgeklappt, damit das Ding stehenblieb. Forschend schaute er auf das Bild, das sich im schmutzig-rosa Rahmen zeigte. Danach wandte er den Blick hinauf zum Bild des Vaters, der einzigen Fotografie, die sie von ihm besaßen. Der Vater war ganz Uniform, ganz Soldat, ganz ferner Blick.
Abb. 5Bild des Vaters (ca. 1915).
Die Haare des Jungen stimmten nicht, sie hingen ihm in lächerlichen Fransen in die Stirn; außerdem waren sie von einem empörend kindlichen Blond.
Auch im Ausdruck der Augen unter der glatten Stirn konnte er keine Ähnlichkeit entdecken. Seine Augen waren zu rund, viel zu wenig umschattet. Der Blick nicht finster – auch nicht, als er prüfend und versuchsweise die Augenbrauen zusammenzog. Die feinen blonden Linien bewegten sich aufeinander zu, ohne dass sein Blick auch nur eine Spur bedrohlicher geworden wäre. Der Junge seufzte und setzte sich auf seine Hände.
Es knisterte leise, wenn die Fliege mit den Flügeln gegen das Fensterglas stieß. Im oberen Stock konnte man Schritte und leises Gelächter hören.
Wie musste ein Soldat aussehen?
Forschend schaute der Junge erneut zum Bild des Vaters an der Küchenwand. Dieser Seitenblick gab dem Sohn eine Ahnung von Schwere und Dunkelheit. Um Vaters Mundwinkel lag ein weicher Zug. Er schien nicht so auszusehen, wie ein Held aussehen musste, ein Sieger.
Herrisch sollte er aussehen, das wusste der Junge – und kühn. »Herrösch«, sagte der Junge halblaut und sprach das i wie ein ö, langgezogen, weich und halb gesungen. »Und kü-en.« Er wiederholte die beiden Worte etwas lauter, ohne sich ihrem Sinn zu nähern.
Verächtlich zog er die Mundwinkel nach unten. Überrascht entdeckte er dabei die Veränderung des Mienenspiels: Das Kinn trat schärfer hervor und die runden Kinderwangen strafften sich, zeigten eine Andeutung von Schatten der Entbehrung und Entschlossenheit.
Zur ersten hatte sich nun eine zweite dicke Fliege gesellt, und gemeinsam rannten sie in dickköpfiger Entschlossenheit gegen die gläserne Barriere. Dem Jungen erschien ihr Gebrumm wie das Dröhnen von Motoren, und im Hintergrund des Spiegelbildes meinte er graue Schatten zu sehen, die sich bewegten, stampften, marschierten.
Das Fensterglas klirrte leise unter dem Ansturm der großen Insekten. Hatte manje schon erlebt, dass eine Schmeißfliege ein Fenster zerbrach? Im oberen Stock fiel ein Stuhl um, und eilige Schritte liefen zum Fenster.
Zu hören war ein Stampfen. Dazu gesellte sich ein Ächzen und Stöhnen, ein Rollen, das kam und ging.
Noch immer hatte das Spiegelbild den Jungen in seinen Bann geschlagen. Klebrig, zusammengefaltet erschienen ihm nun seine hohlen Wangen, und er hätte ihnen gerne ihre übliche Form wiedergegeben. Endlich riss sich der Junge von seinem Zerrbild los und wandte den Kopf zum Küchenfenster.
Von dort kam das Rollen und Stampfen.
Mit lahmen Knien rutschte er vom Küchenstuhl, ging zum Fenster und öffnete es weit. Surrend fanden die Fliegen ihre Freiheit.
Und dort kamen die Soldaten! Helle Gesichter, wie Flecken aufgesetzt auf die grauen Uniformen. Es waren viele. Man konnte sie nicht zählen, so viele waren es. Gleichmäßig kamen sie daher, zu Fuß, auf Wagen sitzend, die Plane der Ladefläche zurückgeschlagen, und so etwas wie ein versprengtes Lächeln blitzte auf. Krad-Geknatter, das Ächzen der Gefährte, unterdrücktes Gemurmel, das Klirren von Metall auf Metall.
»Vater«, murmelte das Kind und vergaß sofort, was es gesagt hatte. »Die Soldaten kommen!«, rief es mit heller, klarer Stimme und konnte nicht schnell genug hinausspringen in Sonnenlicht, Glast und Blenden.
Das neue Haus
Freitag, 5. April 1940. Kurz vor seiner Einschulung zog die Familie um. Das neue Haus stand in einem dichtgedrängten Halbrund anderer Gebäude auf einer Anhöhe, die Burgberg genannt wurde. Dies bedeutet eine spürbare Verbesserung der Wohnsituation, da sie nun ein ganzes Haus zu ihrer Verfügung hatten.
Abb. 6Blick auf Stadtkyll (1930er Jahre; hinter der Kirche beginnt der Aufstieg zum »Burgberg«).
Treppauf tobten sie zum Bubenzimmer, das riesig war wie ein Rittersaal. Hinten am Flur nahmen sie die kleine Kammer in Augenschein, die für die Schwester reserviert war, polterten wieder treppab hinein in die Küche und sprangen nebenan durch die große Stuff. So erkundeten sie zwei Stockwerke, vergaßen auch nicht den Stall – das musste man sich mal vorstellen: ein eigener Stall für ihre einzige magere Kuh!
Bedenklich weit weg erschien jedoch die Toilette. Im alten Haus am Kirchenweg waren sie stolze Besitzer eines Wasserklosetts gewesen. Hier führten zwölf steile Treppenstufen zu einem schamhaft an den Hang geklebten Häuschen. Stets wehte ein kalter Luftzug um die wehrlos in die Tiefe hängenden Körperteile, was ein kaum zu unterdrückendes Gefühl von fremder Beobachtung und Verkrampfung mit sich brachte. Dies jedoch war der einzige Nachteil des Hauses am Burgberg.
So gingen sie frohgemut daran, den Handkarren zu beladen. Obwohl sie wirklich nicht viel besaßen, schien die Menge der zu transportierenden Gegenstände lange Zeit nicht abzunehmen. Die Ehebetten und der mächtige Schlafzimmerschrank klappten unter fachkundigen Händen unerwartet flach zusammen, ragten aber weit über das hintere Ende des Karrens hinaus, so dass sie abgestützt und angehoben werden mussten, als es über das holprige Pflaster ging. Gebückt schoben und zogen sie ihr Bajaasch