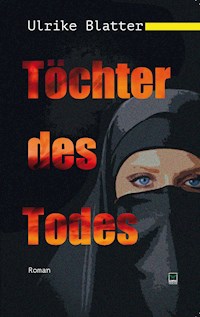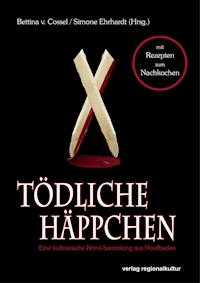Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Bloch
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Kommissar Bloch, der spröde Eigenbrötler von der Kripo Konstanz, kann sein Glück kaum fassen, als ihn eines Tages die attraktive Alenka anspricht. Dass die slowenische Journalistin eine ungeklärte Todesserie unter Drogenabhängigen in ihrem Heimatland recherchiert, interessiert ihn nur am Rande. Bloch will nur eins: dieses unvermutete späte Glück mit aller Kraft festhalten. Als Alenka jedoch kurz darauf einem mysteriösen Unfall zum Opfer fällt, taumelt er in einen Strudel sich überschlagender Ereignisse. Als Jäger folgt er der den Spuren der geliebten Frau bis in ihre Heimat und versucht zu verstehen, warum sich Alenka bedroht fühlte. Berührte ihre Story rund um Biowissenschaften und Sucht so viele gesellschaftliche Tabus, dass sie dafür sterben musste? Seine Nachforschungen führen ihn immer tiefer in die Verstrickungen einer postsozialistischen Gesellschaft, die die ersten Schritte in den noch fremden Kapitalismus wagt. Gier und Menschenverachtung, aber auch historische Altlasten prallen aufeinander. Bloch stößt zunehmend auf Widerstand, ja blanken Hass, wird vom Jäger zum Gejagten und kehrt nach Deutschland zurück. Aber nichts hilft: Die beiden säuberlich getrennten Welten - hier das professionelle, glatte Deutschland, die beschauliche Bodenseeregion - dort das Nebelland Slowenien - rücken einander auf beängstigende Weise immer näher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike BlatterNur noch das nackte Leben
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Der Mann, der niemals töten wollte
Nur noch das nackte Leben
Ulrike Blatter lebt in der Nähe von Konstanz. Nach ihrem Medizinstudium bildete sie sich in der Psychotherapie mit den Arbeitsschwerpunkten »Sucht und Trauma« weiter. Mehrere Jahre arbeitete sie in Rechtsmedizin und Suchtberatung sowie als Ärztin in der Sozialpsychiatrie. Ihr ehrenamtliches Engagement führt sie seit vielen Jahren in die Länder Ex-Jugoslawiens, wo sie mehrere Projekte initiiert hat und weiterhin begleitet. Seit ihrer Jugend schreibt und veröffentlicht sie Lyrik. Neben einigen Reportagen über die Situation Heranwachsender in den Nachkriegsgebieten Bosniens und Kosovos veröffentlichte sie zwei Kinderbücher, zwei Kriminalromane und zahlreiche Kriminalkurzgeschichten. Für ihre Texte erhielt sie Schreibstipendien und wurde mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Ulrike Blatter ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller, bei den Mörderischen Schwestern und im Syndikat. Nur noch das nackte Leben ist der dritte Band der Reihe um den Konstanzer Kommissar Bloch.
Ulrike Blatter
Nur nochdas nackte Leben
Originalausgabe
© 2011 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 99 86 68
Fax: 0 65 93 - 99 87 01
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von:
© Lev Dolgatsjov – www.fotolia.de
Redaktion: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-942446-12-9
E-Book-ISBN 978-3-95441-012-5
Für Lissy Schmidt† 3. April 1994
»And I see your true colours shining throughI see your true colours and that’s why I love you«
Cindy Lauper
Prolog
Selbst im allerletzten Augenblick, wenn sie vor der kaum schulterbreiten Gasse standen und man sie aufforderte, aus eigener Kraft nur noch einen einzigen Schritt zu tun, begehrten die Wenigsten auf. Vielleicht war es die Hoffnung, die sie schweigen ließ. Vielleicht waren sie auch nur zu abgestumpft.
Die Begrenzung des Durchgangs wurde linkerhand von der fensterlosen Rückseite des Zellenbaus gebildet. Rechts ragte die mit bröckeligem Putz überzogene Seitenwand des Krematoriums empor. Der Ausgang der Gasse lag in nördlicher Richtung, sodass kaum Licht hineinfiel. Manche der Delinquenten wurden nach der langen Haft im abgedunkelten Zellenblock sogar von diesem spärlichen Licht geblendet. Dann hoben sie eine Hand schützend über die Augen, blinzelnd und verunsichert, während der Henker hinter sie trat und mit leichter Hand den Genickschuss setzte.
Keinesfalls durfte man die Todeskandidaten zu weit in die Gasse hineingehen lassen. Dann nahm das Herausziehen der Leiche zu viel Zeit in Anspruch. Diese Arbeit sowie die Verbringung der Körper in das Krematorium wurden von Häftlingen erledigt. Währenddessen standen die Männer des Exekutionskommandos in der Nähe, sprachen oder lachten, beides jedoch nicht übertrieben laut. War die Gasse freigeräumt, schnippten sie ihre Zigarettenkippen auf den Kies und gingen erneut an die Arbeit.
Der Tonfall zwischen den Häftlingen und den Wachhabenden war in der Regel neutral. Lediglich wenn die Entsorgung eines Körpers zu lange dauerte, fielen einige wenige Worte in scharfem Befehlston. Auch das Häftlingskommando ging in der Regel schon wenige Wochen später in die Exekutionsgasse.
So waren die Hinrichtungen normalerweise eine relativ ruhige Angelegenheit.
Nur bei Irina war es anders gewesen. Irina hatte sich gewehrt. Vor der Gasse stehend hatte sie sich umgedreht und laut den Namen Hermann gerufen.
»Fragt Hermann«, hatte sie gerufen. »Das ist ein Irrtum. Mich dürft ihr nicht nehmen. Fragt Hermann. Er weiß Bescheid!«
Natürlich hatte sie es nicht genau mit diesen Worten gerufen. Irina sprach nur gebrochen deutsch. Aber dies in etwa war der Sinn ihrer unter Schluchzen stockend hervorgestoßenen Satzfetzen. Marija, die mit einem Eimer voller Kartoffelschalen in der Nähe vorbeiging, erkannte Irinas Stimme. Sie sah jedoch keine Notwendigkeit, den Eimer abzusetzen, da sie sich selbst damit unnötig in Gefahr gebracht hätte. Es war streng verboten, Essensreste aus den so genannten Führerhäusern in die Häftlingsbaracken zu bringen. Also ging Marija mit ruhigen Schritten weiter.
Es fuhr eine Männerstimme wie ein Messer in Irinas Gestammel. Es war ohne Zweifel Hermanns Stimme. »Erledigt die kleine Nutte«, sagte er, und Irinas Schreie zerschellten an den Wänden der Gasse.
Marija stolperte, fing sich aber wieder. Sie warf einen kontrollierenden Blick auf den Boden. Keine einzige Kartoffelschale war aus dem Eimer gerutscht. Am Abend würden die Frauen daraus eine Suppe kochen.
Am nächsten Morgen wurde Irinas zu Asche verbrannter Körper in den See geschüttet, zusammen mit der Asche aller Mitglieder des Häftlingskommandos.
In den folgenden Wochen sorgte Hermann dafür, dass sämtliche Soldaten, die Irinas Exekution beigewohnt hatten, zum Fronteinsatz abkommandiert wurden.
Nur Marija entging dieser systematischen Säuberung.
Und Marija wusste genau, warum.
1. Kapitel
Erich Bloch krümmte sich auf dem Beifahrersitz über den aufgeklappten Stadtplan. Seine Gedanken waren bei Alenka. Ein stechender Chemiegeruch stieg ihm in die Nase und ließ seine Augen tränen.
Wieso saß er schon wieder in einem Einsatzfahrzeug, und warum begannen seine Tage nicht mehr in einem dieser kleinen Straßencafés, durchdrungen von den Geräuschen eines südlicheren Lebens? Noch vor Kurzem hatte sich doch alles richtig und gut angefühlt: Vor ihm eine Tasse Cappuccino, ein Blinzeln hinaus auf die Adria, deren Wasser jeden Tag eine andere Färbung zeigte, und ihm gegenüber hatte diese schöne Frau gesessen. Alenka.
Was war nur schiefgegangen?
»Mach mal das Fenster auf, Cenk. Das stinkt fürchterlich«, sagte Bloch.
Cenk warf einen schrägen Blick auf den Stadtplan. »Kommen wir überhaupt zu Fuß zum Tatort, Erich?«
»Fundort.« Bloch starrte durch die Windschutzscheibe. »Vorerst ist es nur der Fundort einer Leiche und kein Tatort. Wir müssen abwarten, ob überhaupt ein Fall daraus wird. Schau mal, ob wir da vorne links abbiegen können. Dann ist es die zweite rechts, und wir kommen mit dem Auto bis vor die Haustür.« Er klappte den Stadtplan zusammen und verstaute ihn im Handschuhfach.
Die mittelalterliche Altstadt von Konstanz war bei allen Einsatzkräften gleichermaßen gefürchtet. Hinter den reichbemalten Fassaden der prächtigen Patrizierhäuser versteckte sich ein Gewirr von Innenhöfen, Durchgängen und Hinterhäusern. Besonders schlimm war es zwischen Pulverturm und Konzilstraße, wo in die schmalen Brandgassen kaum jemals ein Sonnenstrahl drang. Dorthin waren sie unterwegs. »Dann hoffen wir mal, dass das nicht-satellitengestützte Ortungssystem vom Ersten Hauptkommissar zielführend ist.« Cenk bremste und bog in eine kopfsteingepflasterte Gasse.
Erster Hauptkommissar – klang da etwa Ironie in Cenks Stimme? Jeder seiner Kollegen wusste, dass Bloch schon seit Jahren über eine Frühberentung nachdachte und jegliche Karriereambitionen ausdrücklich verneinte. Wenn ihm die Arbeit über den Kopf wuchs, pflegte er diese Tatsache mit Nachdruck immer wieder zu erwähnen. »Ich habe ja schließlich immer noch meinen Hund«, sagte er dann und tätschelte die Nackenwülste von Mops Churchill. Die Kollegen grinsten darüber mehr oder weniger offen. Churchill galt schon lange als Maskottchen der gesamten Konstanzer Kriminalpolizei und nicht etwa als Blochs Privatbesitz. Mittlerweile war der Hund deutlich gealtert, bekam durch seine abgeflachte Nase kaum noch Luft, hechelte kurzatmig mit weit geöffnetem Maul und war immer öfter inkontinent. Jahrelang war er bei Einsätzen mitgefahren und hatte stundenlang geduldig auf der Rückbank ausgeharrt. Das war nun nicht mehr möglich, da ansonsten das gesamte Fahrzeug erbärmlich nach Hundepisse gestunken hätte. Churchills letzter Ausrutscher war auch der Grund für den Chemiegeruch, der immer noch hartnäckig in den Polstern des Einsatzfahrzeuges hing.
Hätte er vor einigen Monaten auf Graf gehört, dann würde Bloch jetzt im Büro sitzen und nicht im Auto. Er wäre eine Besoldungsstufe nach oben gerutscht und Dezernatsleiter der Kripo geworden. Als Graf, der bisherige Amtsinhaber, Bloch zuvorkam und sich vorzeitig pensionieren ließ, war die Überraschung groß gewesen. Der Grund war allerdings kein erfreulicher. Was anfangs nur ein Gerücht war, bestätigte sich rasch: Kehlkopfkrebs. Viel Zeit würde Graf nicht mehr bleiben, seinen Ruhestand zu genießen. »Den wohlverdienten Ruhestand«, wie es in der Abschiedsrede hieß, nach der alle Kollegen mit billigem Sekt anstießen und es vermieden, Graf in die Augen zu sehen.
Eine seiner letzten Amtshandlungen war es gewesen, Bloch die Nachfolge anzubieten. »Das Alter hätten Sie ja, Herr Kollege«, hatte er gesagt. »Und die Erfahrung sowieso.« Dann räusperte er sich und musste einige Minuten mit einem Hustenreiz kämpfen, der seine Sätze zerstückelte. »Seit zig Jahren Hauptkommissar, seit drei Jahren EHK, Erster Hauptkommissar«, hatte Graf die Personalakte zusammengefasst. »Zeit für den nächsten Schritt. Das zahlt sich ja auch später bei der Altersversorgung aus.« Er versuchte zu lachen. Wieder wurde ein Husten daraus. Dieses Räuspern und das hustende Knarren in der Stimme – das gehörte zu Graf, seit Bloch ihn kannte. Oder hatte es sich irgendwann einmal eingeschlichen, und keiner hatte es beachtet?
Niemand würde Grafs ständigen Geräuschteppich vermissen.
Bloch bat sich Bedenkzeit aus. Zwei Tage später lehnte er ab. Er wusste das Datum noch genau. Es war der 10. April gewesen. Wenig später stand in seiner Personalakte der Vermerk Altersteilzeit. Die Kollegen grinsten zwar und ergingen sich in schlüpfrigen Andeutungen, aber Bloch antwortete nur stereotyp, die Änderung seiner Lebensumstände habe ganz und gar nichts damit zu tun, dass er zufälligerweise Anfang April eine gewisse Alenka kennen gelernt habe; zugegebenermaßen eine attraktive Erscheinung, aber in seinem Alter stünde man doch über gewissen Dingen – und hier setzte Bloch jeweils einen Gesichtsausdruck voller Weisheit und Entsagung auf – sie seien doch beide erwachsene Menschen, sowohl Alenka als auch er; alt genug jedenfalls, um über die Illusionen einer flüchtigen Verliebtheit zu lächeln.
»Mensch Erich, nun tu doch nicht so abgehoben«, hatte Cenk zurückgegeben, und Blochs Gesichtsausdruck war kurzfristig entgleist.
Aber er hatte sich sofort wieder im Griff. Die Sache mit Alenka und ihm, das ging wirklich niemanden etwas an. »Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps«, blaffte er Cenk ungewohnt heftig an, und ob der Kollege vollkommen vergessen habe, dass es in seinem Leben auch noch eine Familie gebe. Dagegen konnte selbst Cenk nichts einwenden. Seine Frau erwartete ihr erstes Kind, und das Stichwort Familie versetzte selbst ihn, den obercoolen Assistenten, in eine ungewohnt milde Stimmungslage.
An Blochs Argumentation gab es tatsächlich nichts zur rütteln: Vor wenigen Wochen war sein einziger Enkel Max sechs Jahre alt geworden. Im September stand die Einschulung an. Eva war durch ihren häuslichen Pflegedienst, den sie mit einigem Erfolg betrieb, regelmäßig auch nachmittags eingespannt. Schon seit einiger Zeit konnte sie Max zu ihren alten und kranken Kunden nicht mehr mitnehmen, und die Grundschule bot keine geregelte Betreuung an.
Es war keine direkte Bitte gewesen, aber sie hatte Bloch das Problem ungewöhnlich ausführlich geschildert. Normalerweise erwähnte sie ihrem Vater gegenüber keine persönlichen Schwierigkeiten. Ihr Kontakt war oberflächlich und wahrscheinlich genau deswegen vollkommen konfliktfrei. Diesmal jedoch hatte Bloch eine Art Hilferuf vernommen. Es hatte Zeiten gegeben, da wäre es ihm nicht weiter schwergefallen, einen solchen Appell großzügig zu überhören. Aber manchmal war es so im Leben, dass die Dinge ganz einfach zusammenpassten. Also hatte Bloch die entsprechenden dienstlichen Schritte eingeleitet und sich kurz darauf ein Fahrrad gekauft. Einige Tage wunderte er sich, dass er auf diese Weise quer durch die Altstadt schneller an seine Arbeitsstelle gelangte als mit dem Auto im obligatorischen Dauerstau. Mittwochs und donnerstags hatte er nun einen freien Nachmittag. An den Wochenenden arbeitete er weiterhin nach Dienstplan. Dann übernahm Eva den Hund. Die freie Zeit verbrachte er meist mit Max. Sie gingen in den Park oder auch mal ins Kino. Max wünschte sich sehnlichst eine Angel – jetzt, im Frühsommer. Ab dem Herbst wären dann auch die Hausaufgaben dran. Bloch hatte keine Ahnung, nach welchen Methoden heutzutage in der Grundschule gelernt wurde, aber er traute sich das grundsätzlich zu.
Die Entscheidung war ihm dann trotz der Arbeitswut, die ihn seit Jahren kennzeichnete, überraschend leichtgefallen. Bloch nannte es »mein Leben endlich mal in Ordnung bringen«. Es war ihm jedoch nicht entgangen, dass die Kollegen hinter vorgehaltener Hand »Dummheit« dazu sagten.
Am 15. Mai hatte er noch gemeinsam mit Alenka abends auf die Wellen der Adria geschaut. Das Abendrot hatte man kitschig nennen oder es meteorologisch interpretieren können. Aber im Süden entwickelte sich das Wetter sowieso meist anders als man erwartete. Darüber hatten sie an ihrem letzten gemeinsamen Abend gesprochen: über das Wetter. Etwas Banaleres war kaum vorstellbar.
Bloch konnte sich an kein Vorzeichen erinnern. Nichts. Und dennoch hatte sie ihn am nächsten Morgen zurückgeschickt.
»Mein Urlaub ist noch nicht zu Ende«, hatte er protestiert. »Wir haben das Zimmer doch noch für eine Woche bezahlt!«
Aber Alenka hatte den Kopf geschüttelt und an ihm vorbeigeschaut. »Zu gefährlich«, hatte sie gesagt.
Am Wetter konnte es nicht gelegen haben. Das Wetter war fantastisch gewesen. Warm, strahlender Sonnenschein bei tiefblauem Himmel, und es ging eine sanfte Brise, die das Meer ein wenig kräuselte. Alle Farben von ungewöhnlicher Klarheit; die Landschaft wie frisch gestrichen.
»Zu gefährlich«, hatte sie gesagt, und Bloch hatte verstanden: »zu lästig, zu alt, zu unattraktiv.«
Er hatte nicht viel zu packen. Bloch war mit einer kleinen Reisetasche gekommen, in die er wahllos alles hineinstopfte.
Wahrscheinlich hatte es wieder einmal an seiner verdammten Beziehungsunfähigkeit gelegen.
Wenn er mehr Zeit haben würde, wollte er anfangen, darüber nachzugrübeln. Zum Beispiel Mittwochabend.
Cenk fuhr auf den Randstein. »Wir sind da, Chef.«
Ein Krankenwagen blockierte die gesamte Breite der Gasse. Ein Radfahrer bremste, stieg ab und versuchte vergeblich, sein Gefährt am Rettungswagen vorbeizuschieben. Er warf einen misstrauischen Blick auf Cenk und Bloch, die zwar in Zivil gekleidet, aber durch ihr Auto eindeutig als Polizisten zu identifizieren waren. Nach zwei vergeblichen Anläufen spuckte er auf den Boden, zerknirschte einen derben Ausdruck zwischen den Zähnen, einen Ausdruck, der sich wahrscheinlich gegen alle gottverdammten Ordnungshüter auf dieser Welt richtete, und fuhr dorthin zurück, woher er gekommen war.
Beim Aussteigen bemerkte Bloch, dass Cenk in den letzten Wochen ein paar Kilos zugenommen hatte. Er hatte irgendwo gelesen, dass häufig auch werdende Väter rundlicher wurden.
Cenk sprach übrigens nie über Beziehungsprobleme. Cenk sprach lieber über so erfrischend normale Dinge wie Lebensversicherungen, Steuerprogression und private Altersvorsorge.
2. Kapitel
Das Treppenhaus war eng und roch muffig. Kurz bevor sie den ersten Stock erreichten, wurde dort oben eine Tür hastig geschlossen. Von draußen drang das nimmermüde Schrillen der Schwalben herein, die auf der Jagd nach Ungeziefer halsbrecherische Flugkunststücke boten.
Ein Sanitäter polterte mit schweren Schuhen über die abgestoßenen Holzstufen und bugsierte seinen silbrigen Rettungskoffer gekonnt an ihnen vorbei. »Kollege ist noch oben«, rief er über die Schulter und hastete weiter nach unten, ohne die Schritte zu verlangsamen. »Es ist im dritten Stock«, tönte es mit frischer Stimme von weiter unten.
»Danke«, sagte Bloch viel zu leise und bemühte sich, nicht kurzatmig zu klingen.
Vor der Korridortür stand der zweite Sanitäter und verbreitete den frischgewaschenen Geruch zupackender Kumpelhaftigkeit. »Is’ wohl so ’ne Art Privatpuff«, sagte er. »Rufen Sie mich, falls Sie noch Fragen haben.« Er wies mit der Kinnspitze auf die halb offene Wohnungstür.
Cenk und Bloch betraten den ungelüfteten Korridor, in dem es penetrant nach billigem Parfüm, ranzigem Fett und kaltem Zigarettenrauch roch.
Die Kneipe war überfüllt gewesen und hatte nach ranzigem Fett und kaltem Zigarettenrauch gerochen. Da hatte Bloch sein Bierglas genommen und draußen einen Platz gesucht. Eigentlich war es dafür Anfang April noch zu kalt, aber es war in Mode gekommen, zu jeder Jahreszeit draußen zu sitzen. Die Konstanzer betrachteten sich als mediterranes Völkchen, ganz so, als ob die tief verschneiten Alpengipfel nicht in Sichtweite wären. Und so schossen gasbetriebene, pilzförmige Heizstrahler auf den Trottoirs förmlich aus dem Boden, und auf Klappstühlen und Bänken waren flauschige Decken ausgelegt, in die sich die fröstelnden Gäste hüllten.
Bloch nippte lustlos an seinem viel zu kalten Bier. Heißer Kaffee wäre die klügere Wahl gewesen. Aber dafür war es schon zu spät. Nach einem Kaffee würde er die halbe Nacht nicht zur Ruhe kommen.
»Kalt, nicht wahr?« Normalerweise sprachen Frauen in ihrem Alter keine fremden Männer an. Schon gar nicht Männer, die so aussahen wie Bloch. Es sei denn, sie gingen einem gewissen Gewerbe nach. »Alleine hier?«
»Ich erwarte niemanden. Und Sie?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Darf ich?«, fragte sie und saß schon an Blochs Tisch, bevor er antworten konnte. Sie war sicher um die Fünfzig, dabei aber von einer irritierenden Jugendlichkeit, die es schwer machte, ihr Alter zu schätzen. Nicht gerade schlank, eher sportlich, aber auch das konnte täuschen, denn sie trug eine Jacke aus gewalktem Wollstoff, die ihre Figur verbarg. Darüber ein Tuch mit wild ineinander geschlungenen Mustern. Alles in Rostrot und Orange, was fantastisch zu ihrem rotbraunen Haar aussah. »Ich bin auf Recherche«, sagte sie. »Zuerst dachte ich, Sie sind derjenige, mit dem ich verabredet bin – aber offensichtlich habe ich Pech.« Sie lachte. »Wie sagt ihr ›Kunstpech‹?«
»Künstlerpech«, korrigierte Bloch und hob sein Bierglas.
»Das Problem kenne ich auch. Aber Gott sei Dank bin ich jetzt nicht im Dienst.«
Das Bier schmeckte auf einmal viel besser.
»Auch Journalist?«
»Nein, von der Polizei. Sie sind nicht von hier, oder täusche ich mich?«
Sie war nicht von hier. Sie hieß Alenka und kam aus Slowenien. In Deutschland recherchierte sie für ein Buch, das im folgenden Jahr erscheinen sollte. Irgendetwas über Drogen. Eigentlich war sie mit einem Dozenten der Universität verabredet gewesen, einem Toxikologen, aber offensichtlich hatte es nicht funktioniert. Bloch empfand es als schmeichelhaft, für einen Universitätsdozenten gehalten zu werden – und nicht für einen potentiellen Freier.
Sie hatte schöne Augen. Grün, mit Einsprengseln, die im Seitenlicht aufleuchteten wie kleine Glassplitter. Durch ihr rotbraunes Haar fingerten sich einige schmale, graue Strähnen.
Später tauschten sie ihre Handynummern aus. Und obwohl Bloch keinen Kaffee getrunken hatte, kam er trotzdem die ganze Nacht nicht zur Ruhe.
Alle Wände waren in dunklen Farben gestrichen, violett und schwarz, die Türen silbern. Die einzige Beleuchtung waren Lichterketten, die in üblen Verrenkungen von der Decke hingen.
»Zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad«, sagte Cenk, der lange auf Wohnungssuche gewesen war. In der regionalen Presse wurde in letzter Zeit oft darauf hingewiesen, dass Familien mit kleinen Kindern Schwierigkeiten hätten, eine angemessene Bleibe zu finden.
Eine Tür war nur angelehnt. Trübes Tageslicht sickerte in einem schmalen Streifen auf die fleckige Auslegeware.
»Hier sind wir wohl richtig«, sagte Bloch und trat ein.
Das Zimmer wurde von einem überbreiten Bett dominiert. Ein Fernseher mit DVD-Player, Stereoanlage sowie diverse Spiegel und Lampen vervollständigten die nicht eben üppige Einrichtung. In einer Zimmerecke stand frech erigiert eine fast zwei Meter lange, matt glänzende Granate.
»Die ist angeblich nicht mehr scharf«, sagte der Sanitäter, der ihnen ins Zimmer gefolgt war.
»Muss man aber noch checken. Ist nur Deko. Sagt zumindest die andere. Die wartet übrigens in der Küche. War nicht zu bewegen, noch mal hier reinzukommen.« Er pulte sich etwas aus den Zähnen und wies mit einem Kopfnicken nach unten. »Da ist sie. Die ist jetzt wohl auch nicht mehr scharf, wenn ich das mal so sagen darf.«
Die Tote lehnte mit dem Rücken halb sitzend am Bett. Bekleidet war sie lediglich mit einem Catsuit aus grobmaschigem Netzstoff, im Schritt offen. Ihr Kopf war nach hinten gesunken und der Mund weit geöffnet. Sie hatte sehr kurze, blondierte Haare, die wirr vom Kopf abstanden. Eine Perücke mit hüftlangem, lialfarbenem Haar lag wie ein ungepflegtes, bösartiges Haustier auf dem fleckigen Teppich.
Sie hätten ihr lediglich die Perücke abgezogen und den Kopf nach hinten gelegt, erklärte der Sanitäter. Wegen der bereits beginnenden Totenstarre hätten sie jedoch nichts weiter unternommen. Abgesehen vom erwähnten minimalen Positionswechsel sei die Fundsituation unverändert.
»Wo bleibt der Gerichtsmediziner?«, fragte Bloch.
»Schon da«, antwortete ein junger Mann im weißen Kunststoffoverall, der überhitzt und mit verschwitzten Haaren in der Tür stand und sich die Latexhandschuhe überzog.
Niemand hatte ihn kommen gehört. Bloch sah ihn zum ersten Mal. Dauernd schickten sie neue Assistenzärzte. Offensichtlich war die Fluktuation in der Rechtsmedizin extrem hoch.
»Ich habe keinen Parkplatz gefunden«, erklärte der junge Arzt und ließ sich neben der Leiche auf die Knie nieder. »Da musste ich den ganzen Weg vom Stadttheater bis hierher zu Fuß laufen. Eine Zumutung bei der Hitze und mit dem schweren Koffer.« Er klappte den Aluminiumkoffer auf, der randvoll war mit Scheren, Häkchen, Pinzetten, Sonden sowie verschiedenen Kunststoffbehältern. Alles blitzsauber, genau wie in einer Arztpraxis.
Ob die jungen Ärzte ihre Koffer nach jedem Einsatz selber reinigen und neu bestücken mussten? Bloch nahm sich vor, bei Gelegenheit nachzufragen.
»Dann wollen wir mal«, sagte der Mediziner und prüfte die Totenflecken, spreizte die Schenkel einer langbeinigen Pinzette und klappte das Augenlid der Verstorbenen hoch. »Schauen Sie mal«, sagte er. »Ulkige Augenfarbe, nicht wahr?«
Die Iris war von einem irritierenden Smaragdgrün, viel zu intensiv für eine Tote.
»Sind nur Kontaktlinsen«, sagte der Gerichtsmediziner und schob die Plastiklinse ein Stück zur Seite. Die wahre Augenfarbe der jungen Frau war ein vollkommen erloschenes Aschgrau.
Danach untersuchte er sorgfältig die Mundschleimhaut auf Stauungsblutungen, die Zeichen einer Strangulation. Auch Bloch beugte sich nach vorne. Aber da war nichts. Nur der fade, kalte Geruch, den alle Toten schon wenige Minuten nach dem Stillstand der Atmung verströmen.
»Was ’n Mann an so einer nur findet«, kommentierte der Sanitäter abfällig. »Da vergeht einem ja alles. Also mir täte die bestenfalls leid ...«
Niemand antwortete ihm.
Als Nächstes durchtrennte der Arzt vorsichtig das netzartige, schwarze Gewebe mit einer Schere.
»Cenk«, sagte Bloch. »Da ist anscheinend noch eine zweite Frau in der Küche. Mit der könntest du doch in der Zwischenzeit reden. Ich komme dann rüber, wenn wir hier fertig sind.«
»Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg«, beeilte sich der Sanitäter mit der Antwort. Offensichtlich war er froh, endlich gebraucht zu werden.
Schon nach wenigen Minuten richtete sich der Arzt auf. »Da ist nicht viel zu holen«, meinte er. »Jedenfalls nichts für eine Mordkommission. Da sind keine frischen Zeichen für Gewaltanwendung, nur das Übliche: Hier an den Handgelenken diese quer verlaufenden, weißen Linien, die kennen Sie ja zur Genüge.«
Bloch nickte. Er hatte solche Narben schon oft gesehen. Fast ausschließlich bei Frauen. Die Zeichen fehlgeschlagener Selbstmordversuche.
Der Arzt zeigte auf die Beine der Toten: »Und diese ausgedehnten Kratzspuren an den Beinen passen auch zum Gesamtbild.«
»Kokain?«, fragte Bloch.
Der Arzt nickte. »Es sieht nicht nach intravenösem Drogenkonsum aus. Ich finde jedenfalls keine Einstiche an den typischen Stellen – obwohl ich das noch bei besseren Lichtverhältnissen kontrollieren muss.« Er schaltete eine schmale Taschenlampe ein und leuchtete in die Nasenlöcher der Frau. »Aber hier bin ich fündig geworden: die Nasenschleimhaut ist völlig zerstört. Ein einziges, blutiges Geschwür. Die Kleine muss in ihren letzten Lebenswochen wirklich ausgiebig gekokst haben, so viel steht jetzt schon fest. Dafür brauche ich kein Labor.«
Ein dünnes, rotbraunes Rinnsal trat aus beiden Nasenlöchern aus. Die Ablaufrichtung änderte sich je nachdem, wie die Leiche hin und her gedreht wurde, sodass schließlich ihre untere Gesichtshälfte rot verschmiert war, was erstmals der Szene einen gewissen dramatischen Anstrich gab.
»Todeseintritt frühestens vor drei Stunden«, fasste der Arzt seine Ergebnisse zusammen. Er wischte die Pinzette am Teppichboden ab und steckte sie in den Koffer zurück. »Vorher wahrscheinlich stundenlanges Koma. Keine Zeichen äußerer Gewalt. Eine Obduktion muss trotzdem durchgeführt werden.« Er zog einen Totenschein aus dem Koffer und kreuzte die Rubrik unklare Todesursache an. »Ist bei uns zurzeit sowieso ziemlich ruhig«, sagte er und schloss den Koffer. »Da können wir uns auch mit so einer ein bisschen mehr Mühe geben. Außerdem ist sie als didaktisches Material sehr geeignet.«
»Als was?« Bloch verstand nicht, was er meinte.
Der Arzt grinste: »Um sie den Studenten zu zeigen.« Auf einmal hatte er es eilig. Er zog die Handschuhe aus und ließ sie achtlos neben der Leiche auf den Boden fallen. Dann ging er zur Tür, ohne sich noch einmal umzudrehen. Offensichtlich war dieser Fall für ihn schon so gut wie erledigt.
Bevor er in die Küche ging, zog Bloch das schmuddelige Laken vom Bett und deckte die Tote flüchtig zu. In Gedanken begann er bereits, den Abschlussbericht zu diktieren.
In der verqualmten Küche erwartete ihn mit verheulten Augen und verquollenem Gesicht die Kollegin der Verstorbenen. Sie war lediglich mit Unterwäsche und einem knallroten Kimono bekleidet. Cenk saß mit anklagendem Gesichtsausdruck neben ihr am Küchentisch. Für ihn, der vor zwei Jahren, seiner Frau zuliebe, unter großen inneren Kämpfen das Rauchen aufgegeben hatte, musste es eine Qual sein, neben einem überquellenden Aschenbecher zu sitzen. Aber er war nicht untätig gewesen und hatte bereits einige Seiten in seinem Notizblock vollgeschrieben. Der Sanitäter stand abwartend im Türrahmen.
Die Frau hatte zu Protokoll gegeben, dass sie beide, nachdem die Männer sich verabschiedet hatten, ins Bett gegangen seien. Das sei am frühen Morgen gewesen, etwa gegen halb vier.
»Ich hab total fest geschlafen«, schluchzte sie und zog den kunstseidenen Stoff über ihrer fülligen Brust zusammen. »Wenn ich mir vorstelle, dass Angelique neben mir lag und ich nicht gemerkt hab, wie sie – also ich kann es einfach nicht glauben – dass sie gestorben ist. Das ist voll der Schock für mich – können Sie mich nicht verstehen?«
Sie war deutlich älter als die Kleine im Nebenzimmer, die Bloch auf höchstens 19 Jahre schätzte. Ihr verlebtes Gesicht war von schweren Tränensäcken und tiefen, bitteren Falten um die Mundwinkel gezeichnet. Über die Wangen liefen spinnenartige Ausläufer geplatzter Äderchen. Allenfalls bei sehr indirekter Beleuchtung und stark geschminkt mochte sie noch einigermaßen passabel aussehen.
»Sie hatten also gestern Abend Gäste«, setzte er die Befragung fort.
»Privatparty«, bestätigte die Frau unterwürfig. »Wir hatten ein paar nette Gäste und haben uns so richtig schön amüsiert.« Sie schenkte ihm ein verrutschtes Lächeln.
»Privatparty«, schnaubte der Sanitäter im Hintergrund. »Da inserierste wohl Mittwoch und Samstag für und bietest frisches, junges Fleisch an – naturgeile Polin, frisch eingetroffen – so in der Art, oder? Ist doch unappetitlich so was, echt wahr.«
»Der da hat mir überhaupt nichts zu sagen«, greinte die Rotseidene. »Herr Chefkommissar, sagen Sie ihm, dass er das mit mir nicht machen kann. Dass er anständig mit mir reden soll.«
»Hauptkommissar«, berichtigte Bloch sanft.
»Sag ich doch, Herr Hauptkommissar. Die Angelique, die war nämlich echt meine Freundin, auch wenn mir das hier niemand glaubt. Das war ja alles total anders – überhaupt nicht so, wie der da denkt. Der hat ja keine Ahnung, wie hart das Leben sein kann.« Mitleid heischend machte die Frau Bloch schöne Augen und zog eine Schnute wie ein kleines Mädchen. Der Kimono klaffte.
Bloch betrachtete seine Hände, die auf der nikotinfleckigen Resopalplatte lagen. Er wirkte vollkommen unbeteiligt; jemand wie Cenk, der ihn genau kannte, wusste jedoch, dass Bloch hochkonzentriert zuhörte, dabei auf Details wie Tonfall und Wortwahl achtete, Einzelheiten, die vielleicht später einmal wichtig werden konnten. Aber selbst Bloch musste erkennen, dass es allmählich Zeit wurde, die Rolle des passiven Zuhörers abzulegen. Es gelang ihm nur unvollkommen. Mit einem Seitenblick auf die kunstvoll Schluchzende ermahnte er den Sanitäter: »Mit Vorurteilen kommen wir hier doch keinen Schritt weiter.«
Der junge Kerl zeigte sich jedoch wenig beeindruckt, kehrte den harten Hund heraus: »Hartes Leben«, brummte er. »Privatparty – dass ich nicht lache. Familienväter mit AIDS infizieren, das isses doch, was ihr macht!«
»Na, jetzt hören Sie aber mal«, begehrte die Frau auf. »Wir arbeiten nur mit Kondom!«
Jetzt konnte selbst Cenk ein Grinsen nicht unterdrücken.
»Sag ich doch«, feixte der Sanitäter an Bloch gewandt. »Nix Privatparty. Die ist ´ne ganz ordinäre Puffmutter, die ein Junkie-Baby für sich arbeiten lässt. Geld nimmt so eine schon lange nicht mehr. Für Stoff darf da jeder drübersteigen. Mann ey, die sind total fertig!«
»Jetzt reicht es aber!« Bloch erhob sich und schickte einen kühl kalkulierten Sheriff-Blick in Richtung des Sanitäters.
Diesmal verstand er, knickte ein, versuchte aber noch im Abgang Haltung zu bewahren und grantelte: »Dann gehe ich eben. Nichts für ungut, aber hier brauchen Sie mich sowieso nicht mehr.«
Niemand widersprach.
Die weitere Befragung der Frau förderte dann doch noch ein interessantes Detail zutage: Bereits in der Nacht hatte Angelique Kreislaufprobleme gehabt und der Notarzt wurde gerufen. Dieser habe ihr eine Stärkungsspritze verpasst, worauf sich die Kleine auch völlig erholt habe.
»Völlig?«, setzte Bloch nach, während Cenk mitschrieb.
»Na ja, sie war schon ziemlich breit«, gab die andere zu und nestelte an ihrem Ausschnitt, ohne Bloch dabei anzuschauen.
»Sie haben wahrscheinlich schon gesehen, dass sie gesnifft hat. Ihre Nase war total hin. Ich hab immer gesagt, Angelique, sag’ ich, lass die Finger vom Puder.«
»Puder?«, unterbrach Cenk.
»Puder, Schnee, Koks, Kokain – ist doch total egal, wie Sie das Zeug nennen«, antwortete sie. »Halte ich sowieso nicht so viel von, ganz ehrlich. Wenn du nicht aufpasst, biste hinterher einfach nur voll schlecht drauf. Totaler Absturz, aber massiv, echt. Also, ehrlich gesagt, ich selber brauch das nicht. Na ja, ab und zu ´ne Linie, ein Näschen – ist schon okay, zum Aufwärmen sozusagen. Aber die jungen Dinger heute, die knallen sich das Zeug rein, wie wenn da nichts dabei wäre.« Die Frau nahm einen Zug an der Zigarette und inhalierte sehr tief. Ihre Hände mit den unnatürlich langen Fingernägeln zitterten leicht.
»Dabei hat sie sonst immer sehr auf sich geachtet, die Angelique. War tipptopp gepflegt. Hatte echt ‘nen Tick mit ihrer Haut. Gespritzt hat sie auch nie. Da achten die Kerle drauf, Narben an den Armen und so, das können die nicht ab. Trotzdem – also wirklich, Sie können mir glauben, die Kleine konnte froh sein, dass ich ein wenig auf sie aufgepasst hab – und jetzt das – nee wirklich ...« Sie begann erneut zu schluchzen, aber ihre Augen blieben trocken und belauerten Bloch argwöhnisch.
Bloch hatte diese Flut von Schuldzuweisungen, Rechtfertigungsversuchen und Selbstmitleid passiv über sich ergehen lassen. Was er wissen wollte, hatte er erfahren. Der Rest war Sache der Toxikologie. Lediglich der Information mit dem angeblichen Notarzteinsatz musste er noch nachgehen.
Er wollte das sofort erledigen. Auf dem Weg ins Krankenhaus würde er Cenk im Präsidium absetzen. Dort konnte der schon mal das Protokoll bearbeiten.
»Wir können den Sarg bestellen, Cenk«, sagte er und stand auf. Die Frau würdigte sie keines Blickes mehr und zündete sich die nächste Zigarette an, während eine Kippe halb geraucht im Aschenbecher verglimmte.
Die Gänge des Krankenhauses waren in freundlichem Gelb gestrichen. Alles war neu und sauber. Ein wohltuender Kontrast zu der verkommenen, düsteren Wohnung. Bloch ging als Erstes auf die Toilette, wusch sich gründlich die Hände und sprühte eine Desinfektionslösung über die Haut.
Der zuständige Notarzt hatte zwar inzwischen seinen Dienst beendet, saß aber noch immer in einem kahlen, fensterlosen Büro und diktierte Berichte. Auf dem Schreibtisch stapelten sich die Akten, zwischen deren Seiten vergilbte Notizzettel heraushingen. Auf einer Untersuchungsliege, die wahrscheinlich noch nie ein Patient berührt hatte, lagen aufgeblätterte und mit unleserlichen Notizen versehene Nachschlagewerke. Auf dem Boden warteten gebündelte Fachzeitschriften auf ein gnädiges Ende in der Altpapiersammlung. Offenbar wurden in diesem Zimmer nicht allzu häufig Besucher empfangen.
Der Notarzt befreite einen dreibeinigen Hocker von den daraufliegenden Akten, schickte einen langen, suchenden Blick durch den Raum und legte die Papiere schließlich seufzend auf den Boden. »Setzen Sie sich. – Kaffee?«
»Ja, sehr gerne«, sagte Bloch.
Der Arzt ging hinaus und ließ die Tür offen. Bloch hörte unterdrücktes Lachen und leise Gespräche. Das Quietschen von Gummisohlen auf Kunststoffboden, das Geklapper eines Putzeimers, dazu ein Schwall Essensdünste. Gemüsesuppe oder etwas in der Art.
Der Arzt kam mit zwei großen Tassen zurück und schloss die Tür schwungvoll mit dem Fuß. Die Geräusche verstummten. Der Essensgeruch blieb. Der Kaffee war lauwarmes Spülwasser.
Nach Meinung des Arztes sei auf jeden Fall auch Heroin im Spiel gewesen, da Angelique auf die Naloxon-Injektion prompt reagiert habe. Naloxon sei ein hochwirksamer Opiat-Antagonist, der in Sekundenschnelle die Heroinaufnahme im Körper blockiere. Fatalerweise wirke das Medikament nur kurz – dafür aber sehr intensiv. Angelique – ihr richtiger Name sei übrigens Anna Nowak – sei auch sofort aus der Bewusstlosigkeit aufgetaucht, habe dann aber über starke Entzugssymptome geklagt und sich kategorisch geweigert, zur Überwachung ins Krankenhaus zu gehen.
»Das ist normal«, fügte der Notarzt hinzu. »Kaum sind sie wieder einigermaßen auf den Beinen, laufen sie auch schon davon. Die Gefahr ist natürlich groß, dass sie sich sofort den nächsten Druck setzen und dann in die nächste Überdosierung reinschliddern. – Schade. Aber da kann man leider gar nichts machen. Für eine Zwangseinweisung fehlte mir eine Handhabe; außerdem war sie ja nicht allein.«
Auch Bloch kannte solche Fälle. »Wer war denn sonst noch da?«
»Zwei, drei Freier. Vielleicht war auch noch ein weiterer Kerl im Bad.« Der Arzt schüttelte sich. »Eigentlich unvorstellbar, was die mir gesagt haben. ›Kommen Sie Doktor, geben Sie ihr doch ‘ne Spritze, damit sie wieder wach wird. Es ist noch viel zu früh. Wir wollen sie noch ein bisschen ficken.‹ – Widerlich, nicht wahr?«
Bloch schwieg und erduldete die nun einsetzenden Bemerkungen über den Drogenstrich. Es war die immer gleiche Leier der Sanitäter und Notfallärzte: Dass sie sich mies fühlten bei diesen Einsätzen, da es sowieso völlig sinnlos sei – bei genauer Betrachtung wäre es sogar ein Missbrauch des beitragsfinanzierten Gesundheitswesens.
»So eine Sache geht einem doch an die Nieren«, schloss der Arzt. »Das zieht man auch nicht mit den Kleidern aus. Meiner Meinung nach sollte man die alle wegsperren.«
Bloch fragte im unschuldigsten Tonfall: »Wegsperren? Wen meinen Sie denn konkret? Etwa die Freier?«
»Nein, die Nutten natürlich.« Nach kurzem Zögern setzte er hinzu: »Oder etwa nicht?«
»Nichts für ungut«, Bloch stand auf. »Aber die Frauen können doch am wenigsten dafür.«
»Ach, wissen Sie, wenn man mit dem Elend jeden Tag konfrontiert wird, rutscht einem vielleicht auch mal so eine Bemerkung raus. Es ist zum Kotzen: Wir rennen nur den Symptomen hinterher, und da draußen wird es täglich immer schlimmer. Und ganz oben sitzt dann einer, der die verdammt große Kohle mit diesem ganzen Elend macht. Es ist zum Dreinschlagen.«
»Klar, sehe ich genauso.« Bloch war das personifizierte Verständnis. »Übrigens, danke für den Kaffee.«
Der Arzt hatte schon wieder das Diktiergerät in der Hand.
Bloch schloss die Tür.
Wenig später setzte er sich ins Auto und kurbelte das Fenster runter. Wenn er im Durchzug saß, bekam er einen steifen Nacken. Ließ er das Fenster geschlossen, umwaberten ihn die Dünste der chemischen Polsterreinigung.
Seit zwei Tagen war Bloch nun ohne Nachricht von Alenka. Kein Anruf, keine SMS. Er wusste nicht, ob er sich Sorgen machen sollte. Bevor sie ihn fortschickte, hatte Alenka in vagen Worten von einer Gefahr gesprochen, aber Bloch hatte das für eine Ausrede gehalten, um ihn loszuwerden. Welche Gefahr sollte von Alenkas Recherche ausgehen? Das war doch unrealistisch. Alenka hatte sich mehrfach mit irgendwelchen Menschen in verschiedenen Cafés getroffen, und dann hatten sie miteinander gesprochen. Nichts weiter. Alenka hatte sich erst später im Hotelzimmer Notizen gemacht. Von den Gesprächen hatte Bloch nichts verstanden, es lief alles auf Slowenisch oder Kroatisch oder Albanisch ab. Wer kannte sich schon in diesem Durcheinander der Balkansprachen aus? Er hatte sich vollkommen deplatziert gefühlt.
Obwohl der Deal gewesen war, dass sie beide erwachsene Menschen waren und es keine wie auch immer gearteten Ansprüche gab, die sie aneinander banden, hatte er sich dennoch an jedem Abend seit seiner Rückkehr vor dem Einschlafen fast zwanghaft vorstellen müssen, wie sie mit einem anderen Mann im Hotelbett lag. Mit einem deutlich jüngeren Mann, der einige Kilo weniger auf den Rippen hatte als er.
Bloch ließ den Motor seines Dienstfahrzeuges an. Als er rückwärts aus der Parklücke manövrierte, fiel ihm ein, dass er dem Arzt noch nicht mal die Hand zum Abschied gegeben hatte.
3. Kapitel
Nachdem er den Wagen vor dem Präsidium abgestellt hatte, sah Bloch auf die Uhr. Zeit für eine Pause. Bloch betrachtete die mittelgraue Hose aus pflegeleichtem Material, die er üblicherweise auch in der Freizeit trug. Er seufzte und beschloss, heute auf das Kantinenessen zu verzichten. Das Kaufhaus lag in der Altstadt, zu Fuß nur wenige Gehminuten entfernt.
In der fast menschenleeren Herrenabteilung drehte er ratlos an mehreren der karussellartigen Kleiderständer. Nach längerem Suchen fand er endlich die Jeans-Hosen. Sie lagen, nach Größen geordnet, in einem in viele Quadrate unterteilten Echtholzregal. Das Regal sah teuer aus, und auch die Preise der Hosen ließen Bloch an einen taktischen Rückzug denken. Dann atmete er durch und bemühte sich um eine erste Orientierung.
Jeansgrößen entsprechen nicht den üblichen Konfektionsgrößen. Da standen neben dem Strichcode lediglich ein W und ein L mit einer zweistelligen Ziffer daneben. Bloch griff hastig und auf gut Glück zu. Ein erster zögerlicher Versuch in der engen Umkleidekabine endete im Desaster. Es gelang ihm noch nicht einmal die Hose über die Mitte seiner Oberschenkel zu zerren.
Kurz darauf stand er wieder vor dem feindseligen Regal, fand das entsprechende Quadrat jedoch nicht wieder, und schob die unordentlich zusammengefaltete Hose hastig unter irgendeinen Stapel. Geschlagen wandte er sich zum Gehen.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?« Die Verkäuferin war übertrieben schlank. Ihre offensiv zur Schau getragene Jugendlichkeit passte nicht zu ihrer gewählten Ausdrucksweise. Sie trug ein Bauchnabelpiercing, das weit oberhalb des Hosenbundes glitzerte.
Bloch war irritiert. Dass man dermaßen junge Mädchen in der Herrenabteilung arbeiten ließ, war befremdlich. Der eher matronenhafte Typ wirkte erfahrungsgemäß auf Männer seines Alters wesentlich vertrauenerweckender. »Gerne«, presste Bloch hervor. Er wedelte mit der rechten Hand vor den Holzquadraten. »Was meinen Sie? Welche Größe …?«
Kurz darauf schaute er wieder in den Spiegel, und was er dort sah, gefiel ihm sogar einigermaßen. Er musste lediglich den Bauch ein klein wenig einziehen. Vielleicht sollte er auch noch einen neuen Gürtel kaufen.
»Sehr schön.« Die Verkäuferin hielt ein Polo-Shirt mit breiten blauen und schmalen gelben Streifen in die Höhe. »Vielleicht nehmen Sie noch etwas in einer frischeren Farbe?«
Bloch nickte. »Was meinen Sie – würde mir auch Rot stehen?«, fragte er waghalsig, gepackt von einem plötzlichen Mutanfall, während er schon wieder zur Hälfte in der engen Umkleidekabine steckte.
»Ich hole Ihnen etwas in Ihrer Größe.«
Bloch sah sein Spiegelbild an und lächelte.
Alenka würde mit dem Zug kommen. Vielleicht sollte er zur Begrüßung eine Kleinigkeit mitbringen. Eine Rose vielleicht? Seine Gedanken gerieten ins Rutschen.
Wege zueinander. Kommunikationswege zum Beispiel. Elektronische Kommunikationswege. Digitale Aneinanderreihungen. Reihen. Schlangen. Schlangestehen, zum Beispiel vor einer Kasse. Auch die Erfassung der Warenbestände erfolgt elektronisch. Entweder eine Null oder eine Eins. Entweder oder. Ja oder nein. So läuft Kommunikation. Kommunikation ist Verschlüsselung. Auf diese Weise machen sie auch das Leben der Bürger immer sicherer. Überwachungskameras überall.
Alenka hatte »Naschen« dazu gesagt, und dann hatte sie noch gesagt: »Lass doch das Licht an.«
Bloch hatte auf ihrer Bettkante gesessen. Ihm gegenüber der Kleiderschrank mit einer Spiegeltür. Bloch hielt den Blick gesenkt und wandte eine möglichst große Fläche seines Rückens Alenka zu.
»Mach doch das Licht aus«, bat er.
»Nein«, sagte Alenka und schob ihre glatte, kühle Hand in seine Leistenbeuge. »Da bist du schön weich«, sagte sie und setzte hinzu, bevor er beleidigt sein konnte: »Deine Haut meine ich.« Und dann kicherte sie.
»Mach das Licht aus«, beharrte er störrisch.
»Mein Cherz«, sagte sie. »Mein Cherz, nun komm doch.«
Es sollte »Herz« heißen, aber sie sprach es mit ihrem ulkigen kleinen Balkanakzent wie »Cherz« aus – und das Licht blieb eingeschaltet. Und wahrscheinlich war es dann zuletzt doch noch schön gewesen. Die ganze Sache kam ihm so anders vor. Es lag weniger an seiner Ungeschicklichkeit; es war eher sein Erstaunen, dass eine zumindest in Grundzügen vertraute Handlung sich so vollkommen neu anfühlen konnte. Aus Verblüffung darüber hatte er vergessen, das Ganze zu genießen. Vielleicht hatte es auch etwas damit zu tun, dass er sich führen ließ. Er war sich nicht sicher, ob »führen« der richtige Ausdruck war, irgendetwas in ihm sträubte sich dagegen, aber dann vergaß er es fast unmittelbar.
Mit Brigitte war es anders gewesen. Damals war es eher eine Art Körperübung, bei der die Abfolge der Bewegungen schon im Vorhinein festgelegt war. Ob Brigitte jemals Spaß dabei gehabt hatte?
Bloch wusste nicht, wie er hätte feststellen können, dass es Brigitte Spaß machte. Außerdem war sie ziemlich rasch mit Eva schwanger geworden. Danach war Sex zwischen ihnen kein Thema mehr gewesen.
Hinterher stand Alenka nicht auf, um sich zu duschen oder etwas in dieser Art. Sie schien sich nichts daraus zu machen, vollkommen nackt neben ihm auf dem Laken zu liegen. Bloch hatte sich zugedeckt. Alenka war etwa genauso alt wie er. Aber sie lag dort wie … wie ein junges Mädchen? Wie eine Frau im besten Alter? Wie nannte man das? Bloch wagte nur scheue Blicke zur Seite. Was er sah, gefiel ihm.
Alenka schob ihre Beine ein wenig auseinander. Diesmal legte sie seine Fingerspitzen auf ihre Leistenbeuge. Sachte schob sie die Finger tiefer. Alenka hatte einen feuchten Mund zwischen ihren Schenkeln.
»Schön«, sagte Alenka. »Schön, nicht wahr?«
Naschen nannte sie es.
Schattenmorellen – was für ein unheimliches Wort. Violette Schattenmorellen aus dem Keller, aus dem Reich der Schatten. So, wie sich das anhörte, mussten sie giftig sein. »Alles Quatsch«, sagte Mutter und gab einen kräftigen Klecks Sahne auf die Waffeln mit Schattenmorellen. Mutter sagte Sauerkirschen. Das hörte sich zwar nicht so geisterhaft an, appetitanregend klang es aber auch nicht. Erich betrachtete trübsinnig die aufgeweichte Waffel, auf der sich Sahne und saurer Kirschsaft zu einer missfarbenen Pampe gemischt hatten. »Du stehst erst auf, wenn du den Teller leer gegessen hast«, sagte Mutter.
»Ich helf’ dir«, sagte Karin, als Mutter in die Küche ging, und stopfte sich den Waffelmatsch in den Mund.
»Na also, geht doch«, sagte Mutter. »Ihr räumt den Tisch ab. Ich geh kurz rüber zu Tante Martha.«
Wo war eigentlich Vater gewesen an diesem Sonntag?
»Du träumst schon wieder«, sagte Karin und stupste ihn in die Seite. »Komm, wir gehen naschen. Ich hab den Schlüssel. Wir nehmen ein Glas von hinten. Das fällt gar nicht auf.«
Karin, die Blondzopfige, die Brave im karierten Hängerkleidchen, dessen Saum von einer Biese eingefasst wurde, auf der sich giftgrüner Glücksklee und knallrote Marienkäferchen abwechselten. Karin, die Strahlende, die Große. Karin, die immer wusste, wie man etwas macht, die an alles drankam.
Im Winkel unter der Kellertreppe befand sich ein Verschlag, dessen Tür stets abgeschlossen war. Dort bewahrte Mutter Marmelade und eingemachte Früchte auf. Auch die Schattenmorellen.
Es half nichts. Er musste mit und am Fuß der Treppe Schmiere stehen. Das Vorhängeschloss quietschte fürchterlich. Im Keller roch es nach muffigen Kartoffeln und nach bösen Geistern. Karin steckte ihm das Marmeladenglas unter die Strickjacke. »Gut festhalten, hörst du?« Er nickte und hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Oben hängte Karin den Schlüssel zurück an den Haken. Sie musste dazu auf einen Stuhl steigen. »Los, mach schon«, flüsterte Erich, und die Stuhlbeine veranstalteten einen unglaublichen Lärm auf den schwarz-weißen Fliesen des Küchenbodens.
Die Kinder huschten zu ihrem Geheimplatz. Es war eine Weide unten am Bach, die ihre Zweige ins Wasser hängen ließ. Im Frühjahr wollte Karin ausprobieren, ob man sich an den Zweigen ein Stück bachabwärts treiben lassen könne. Die Mutter würde das nicht erlauben, obwohl Karin schon sechs Jahre alt war. »Mit sechs Jahren ist man groß«, sagte Karin und schaufelte sich die Marmelade mit drei Fingern der rechten Hand in den Mund. »Pass bloß auf, dass du dir die Jacke nicht vollkleckerst.«
Sie war zwar groß und würde nach Ostern sogar ein Schulkind sein, aber trotz all ihrer Klugheit hatte sie vergessen, einen Löffel mitzunehmen. Erich trank die Marmelade aus dem Glas. Er traute sich nicht, mit den Fingern hineinzufahren. Das hätte sicher Flecken gegeben. Karin war viel geschickter als er.
»Das kannst du auch bald«, tröstete sie ihn. »Du musst halt noch ein bisschen warten, dann bist du auch genauso groß wie ich.«
Zwei Jahre. Eine Ewigkeit. Dann wäre Karin fast schon erwachsen, und mit wem sollte er dann spielen?
»Pass doch auf«, schimpfte Karin und wischte einen Klecks von seiner Hose.
»Ich seh dir doch an, wenn du lügst«, sagte Mutter wenig später.
»Wo siehst du das?«, hatte er gewagt zu fragen. Jacke und Hemd waren sauber geblieben. Woran konnte sie es nur sehen?
»Ich seh es in deinen Augen. Wenn du so weitermachst, dann nimmt das noch ein schlimmes Ende mit dir. Und jetzt geh dein Gesicht waschen.«
Am nächsten Tag hatte er lange in den Handspiegel seiner Mutter geschaut. In seinen Augen konnte er nichts Auffälliges entdecken. Sah so ein Lügner aus? Was war das, ein »schlimmes Ende«?
Wofür brauchte Mutter einen Spiegel? Tante Martha von gegenüber, die eigentlich keine richtige Tante war, die schminkte sich, und dafür brauchte sie einen Spiegel. Mutter schminkte sich nie.
»Was machst du da?«, fragte Mutter und nahm ihm den Spiegel weg. Er hatte nicht gehört, wie sie hereingekommen war. »Kannst du nicht etwas Sinnvolles tun? Nimm dir doch nur einmal ein Beispiel an deiner Schwester.«
Bis Dienstschluss keine besonderen Vorkommnisse. Zeit für Routinearbeiten. Pünktlich um fünf fuhr Bloch im frühsommerhellen Nachmittagslicht mit dem Fahrrad nach Hause.
Daheim blinkte das rote Auge des Anrufbeantworters. Das Band jedoch blieb stumm. Unbekannte Nummer stand auf dem Display.
Alenka hätte gewiss eine Nachricht hinterlassen.
Bloch stellte die Einkaufstüte auf den Küchentisch, ging zum Fenster und öffnete es weit. Sein Blick ging in den Hinterhof. Dort stand irgendein Baum in voller Blüte. Bloch roch einen nicht unangenehmen, fast weiblichen Duft und lauschte einem Geräusch, das dem ähnelte, was von der Kreuzlinger Straße hereindrang. Dort staute sich wie gewöhnlich der Grenzverkehr. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass dieses Geräusch von den Bienen kam, welche die Baumkrone besetzt hielten. Er hätte in der Schule besser aufpassen sollen, dann wüsste er jetzt, welcher Baum in seinem Hinterhof stand.
Bloch ließ das Fenster offen und schaute in den Kühlschrank. Abendessen beim Türken an der Ecke, entschied er. Danach ein schönes, kaltes Bier. Morgen würde Max kommen. Da musste er noch etwas einkaufen. Vielleicht kehrte morgen auch Alenka zurück. Dann würde er den Jungen zum Bahnhof mitnehmen. Das würde ihm Spaß machen. Ob es peinlich war, wenn er Alenka küsste? Ob er eine Rose mitnehmen sollte oder etwas in dieser Art?
Wenn sie wieder zurückkam, dann würde sie bleiben.
Das war Wunschdenken, er wusste es.
Es war sicherer, das Fenster zu schließen, bevor er runterging zum Türken an der Ecke. Man konnte nie wissen.
Das Telefon klingelte.