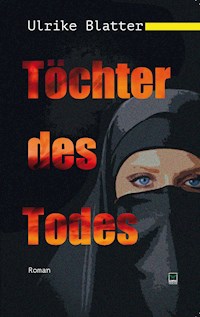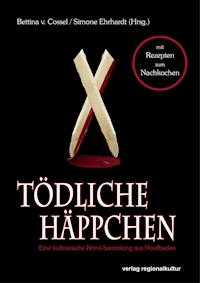Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: KBVHörbuch-Herausgeber: Action Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Bloch
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Bei der Kripo Konstanz wird die sechsjährige, schwerkranke Yasmin als vermisst gemeldet. Auch der Leiter des Jugendamts, Dr. Joachim Leimer, verschwindet plötzlich spurlos. Während es sich bei Dr. Leimer um eine alltägliche Ehe-Eskapade zu handeln scheint, nehmen die Ermittler das Verschwinden des Mädchens sehr ernst. Auch Hanna Kronawitter, die den Fall Leimer "abarbeiten" soll. Zunächst gibt es keine sichtbare Verbindung zwischen den beiden Vorgängen, aber dann wird die Verknüpfung auf erschreckend brutale Weise deutlich: Bei Yasmins alleinerziehender Mutter wird eine Leiche in der Badewanne gefunden. Kampfspuren und Schnittverletzungen zeichnen ein grausames Bild. Die Spur führt über die Schweizer Grenze zu einem Mann, der nichts mehr zu verlieren hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Ulrike Blatter
Der Mann, der niemals töten wollte
Ulrike Blatter lebt in der Nähe von Konstanz. Nach ihrem Medizinstudium bildete sie sich in der Psychotherapie mit dem Arbeitsschwerpunkt »Sucht und Trauma« weiter. Mehrere Jahre arbeitete sie in Rechtsmedizin und Suchtberatung sowie als Ärztin in der Sozialpsychiatrie. Ihr ehrenamtliches Engagement führt sie seit vielen Jahren in die Länder Ex-Jugoslawiens, wo sie mehrere Projekte initiiert hat und weiterhin begleitet. Sie veröffentlichte einen Kriminalroman und zahlreiche Kriminalkurzgeschichten und wurde für ihre Texte bereits mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet. Ulrike Blatter ist Mitglied im »Verband deutscher Schriftsteller«, bei den »Mörderischen Schwestern« und im »Syndikat«.
Der Mann, der niemals töten wollte ist ihr erster Titel im Programm des KBV.
Ulrike Blatter
Der Mann, derniemals töten wollte
1. Auflage September 20102. Auflage April 2011
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 99 86 68Fax: 0 65 93 - 99 87 01Umschlaggestaltung: Ralf Krampunter Verwendung von:© Mollypix - www.fotolia.deRedaktion: Volker Maria Neumann, KölnPrint-ISBN 978-3-940077-96-7E-Book-ISBN 978-3-95441-011-8
Für Sr. Madeleine Schildknecht,die in Bosnien ihren Nachnamen neu entdeckte:Schildträgerin für Hoffnung und Versöhnung
Was ist Wirklichkeit?Verkürzt gesagt: wir selbst.Was sind Tatsachen?Verkürzt gesagt: Absurditäten.Imre Kertész
PROLOG
Die beiden Soldaten saßen sich an einem Tisch gegenüber. Zwischen ihnen lag ein Zigarettenpäckchen der Marke DRINA. Die Fenster waren mit Pappe zugeklebt. Licht fiel lediglich durch ein Loch in der Zimmerdecke. Das obere Stockwerk und das Dach waren zerstört. Das Zimmer, in dem sie saßen, war das einzige im Haus, vielleicht sogar das einzige im ganzen Dorf, das noch einigermaßen intakt war. Sie nutzten es zum Rückzug während der Kampfpausen. In den anderen Zimmern wuchsen zwischen Schrott und zerschlagenen Möbeln junge Bäume empor. Die Soldaten waren weder durch Kampfanzüge oder eine Uniform eindeutig einer der Kampfparteien zuzuordnen. Der Jüngere trug eine Weste mit Camouflage-Muster über einem grauen Sweatshirt sowie Turnschuhe, die ehemals weiß gewesen waren. Außerdem hatte er sich eine verspiegelte Sonnenbrille ins Haar geschoben. Der Ältere hatte seine Waffen griffbereit neben sich liegen. Ein breites Messer steckte in seinem rechten Stiefelschaft. Außer diesen Waffen war nichts an ihm, was ihn als Kämpfer kennzeichnete. Er hätte ein Bauer sein können oder ein Lehrer, der in seiner Freizeit gerne an Autos herumbastelt.
Es war ein einfacher Holztisch, an dem sie saßen, und es waren einfache, billige Holzstühle, die in dieser Umgebung befremdlich unversehrt wirkten. In der Zimmerecke, die am dunkelsten war, schräg gegenüber dem Loch in der Decke, lag ein Bündel, eingewickelt in eine grauwollene, schwere Militärdecke. Unten schauten zwei Füße heraus. Sie steckten in billigen Plastikschuhen, die hinten heruntergetreten waren. Die Decke hatte schon in dem Zimmer gelegen, als sie es gestern bezogen hatten. Sie stank entsetzlich nach Mäusepisse, aber das konnte dem Toten egal sein. Während sie dort saßen und schwiegen, breitete sich allmählich eine große Blutlache an dem einen Ende der Decke aus.
Der ältere Soldat nestelte eine Zigarette und ein Feuerzeug aus dem Päckchen und zündete die Zigarette an.
Der Jüngere schaute ihm kommentarlos zu, als das Feuerzeug mehrmals klickte, ohne dass eine Flamme kam.
Als der ältere Soldat schließlich doch den Rauch ausstieß und sich zurücklehnte, ergriff der Jüngere das Wort. »Du sprichst nicht.«
»Nein.«
»Willst du nicht?«
Schulterzucken des Älteren. Das leise, fressende Geräusch, wenn die Glut dünnes Zigarettenpapier ergreift.
»Du gehst wieder raus? Gleich?«
»Ja.«
»Triffst du ihn?«
»Weiß nicht.«
»Muss schlimm sein für dich.«
Der Ältere zuckte wieder mit den Schultern. Er schaute auf die Tischplatte. Er schaute durch die zerfetzte Zimmerdecke hinaus. Draußen war ein lichter, blauer Frühlingstag.
Auch der jüngere Soldat nestelte jetzt eine Zigarette aus dem Päckchen und zündete sie an. Bei ihm funktionierte das Feuerzeug problemlos. Sie rauchten eine Weile schweigend und lauschten nach draußen. Der Kampflärm von der anderen Talseite war verstummt. Es war sehr still. Man hörte noch nicht einmal das Geräusch eines Vogels.
»Habt ihr euch lange gekannt?«
Der Ältere sagte: »Was heißt schon ›lange‹. Ich habe ihn gekannt.«
»Muss schlimm sein.«
»Schlimm! Schlimm! Was weißt du? Weißt du, was wirklich schlimm ist?« Die Stimme des älteren Soldaten war laut geworden.
Der junge Soldat schwieg und schaute ihn an.
Der Ältere fuhr fort: »Wirklich schlimm ist dieses beschissene Gefühl, dass ich nicht meine Pflicht getan habe.«
»Ja, da hast du wohl recht.« Manche Sätze wurden nur gesagt, damit das Schweigen nicht zurückkam.
Das Gesicht des älteren Soldaten hatte sich verändert. Seine Augen waren kleiner geworden. Schwarze Funken, die rückwärts in einen Tunnel gesogen wurden. Jetzt sah er gefährlich aus. Unberechenbar.
»Siehst du – selbst du sagst es! Ich hätte ihn töten können. Da drüben. Ich hatte ihn genau im Visier. Er hat mich nicht gesehen. Aber ich ihn. Den bleichen Fleck, wo sein Gesicht war, das Gewehr, die Uniform, alles. Ich hatte ihn genau im Visier. Mein Fehler. Ich habe nicht abgedrückt, ich habe ihn durch das Zielfernrohr angeschaut. Viel zu lange habe ich ihn angesehen.
»Und dann? Was war dann?«
»Er hatte ein Gesicht, verstehst du? Ein Gesicht wie einer von uns. Ich bin erschrocken. Wie soll ich das erklären. Dachte, ich kenn ihn. War unsicher. Schaute noch mal hin.«
Sie rauchten.
»In Wirklichkeit kannte ich ihn gar nicht. Aber auf einmal schien mir, er hätte aus meinem Dorf sein können oder aus einem Nachbardorf, verstehst du? Er schien mir auf einmal ... Er war irgendwie ... vertraut. Kannst du das verstehen? Er saß unter einem Tarnnetz und zielte mit dem Gewehr auf mich. Ich saß da unter meinem Tarnnetz und zielte mit dem Gewehr auf ihn. Netter Kerl, habe ich gedacht. Er schien mir ein netter Kerl zu sein.«
»Ja, das kommt vor. Man darf eben nicht so genau hinschauen. Es ist besser, du siehst sie als Tiere.«
»Ja, kann sein, du hast bestimmt recht.«
»Sonst wird das zu schwierig mit dem Hass. Ich habe das Hassen auch erst lernen müssen. Bin ja direkt von der Schule zu euch gekommen. Mann, was war ich da noch jung. Ich wusste überhaupt nicht Bescheid. Aber sie haben es mir beigebracht. Weiß Gott, das haben sie.«
Der Ältere schaute den Jüngeren an. Er mochte siebzehn sein oder siebenunddreißig. Es war schwierig, sein Alter zu schätzen. Diesmal nahm der ältere Soldat den Gesprächsfaden wieder auf: »Weißt du, was das Schlimmste ist?«
»Was denn?«
»Ich kann ihn immer noch nicht hassen.«
»Trotzdem?«
»Trotzdem.«
»Das musst du aber.«
»Mein Freund ist tot, weil ich meine Pflicht nicht getan habe. Es ist einfach so in diesem verdammten Krieg, dass du dauernd Entscheidungen triffst, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Verstehst du? Im Frieden ist es vollkommen egal, ob ich am Fenster stehe oder auf einem Stuhl am Tisch sitze.«
»Ich verstehe.«
»Wirklich? Verstehst du wirklich? Stehe ich am Fenster, trifft mich ein Scharfschütze. Sitze ich am Tisch – überlebe ich. Oder werde ich unter dem Dach begraben werden, wenn eine Granate das Haus trifft? Solche Entscheidungen meine ich. Im Krieg scheint es nur falsche Entscheidungen zu geben.«
»Deswegen gibt es Befehle.«
»Ja. Und ich habe meine Pflicht nicht getan. Der da drüben lebt noch. Ein Scharfschütze wie ich. Ein Snajper. Netter Kerl, dachte ich. Es war wie ein Spiel, als ich sein Leben schonte. Ein netter Kerl. Konnte ihn einfach nicht hassen. Es war ein Fehler.«
»Hast du jetzt genug Hass in dir?« Die Stimme des Jüngeren klang gelangweilt. Er schien der Diskussion überdrüssig.
Die Zigarette des Älteren war mittlerweile sehr kurz geworden, sodass die Glut seinen Fingern schmerzhaft nahe kam. Er betrachtete die Glut, drückte die Zigarette aber nicht aus.
»Ich weiß es nicht. Nein. Ja. Ich glaube, eher nicht. Weißt du, was das Schlimmste ist? – Wie soll ich es dir nur erklären? Du wirst es nicht verstehen. Nicht wirklich, meine ich. Wie er war. Mein Freund. Wir haben nie viel gesprochen. Er hatte es nicht so mit dem Sprechen. Er hinterlässt keine Spur im Leben. Nichts.«
»Wie meinst du das? – Hat er keine Familie?«
»Keine Familie.«
»Keine Freunde?«
»Nur mich.«
»Keine Frau?«
»Da war mal eine Freundin. Keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Vielleicht hat sie es noch rechtzeitig geschafft rauszukommen. Sie war eine von den anderen. Damals war das ja noch eine Zeitlang möglich. Nettes Mädchen. Hübsch. Aber er sprach nie viel über sie. Ich glaube nicht, dass sie ... Sie war nicht so.«
Der Ältere drückte die Zigarette auf der Tischplatte aus. Ein kreisrunder Brandfleck entstand.
»Da ist keine Spur im Leben. Nichts.«
»Nichts. Nur bei dir.«
»Ja, nur bei mir. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann wird der da mich töten – so wie er ihn getötet hat. Und weißt du, was das Schlimmste ist?«
Auch der Jüngere drückte nun seine Zigarette aus. Er tat es unter der Tischplatte. Es war so, als wolle er den Älteren zurechtweisen. Der beachtete es nicht und fuhr fort: »Wenn er mich auslöscht, dann tötet er auch ihn noch einmal. Dann aber endgültig. Um mich wird vielleicht jemand weinen. Doch, ganz sicher. Man wird weinen und sich erinnern. Aber er stirbt dann endgültig. Ich meine: Keine Spur bleibt von ihm im Leben.«
Der Ältere stand auf und griff nach seinem Gewehr, tastete nach dem Messer im Stiefelschaft.
»Du musst wieder raus? Jetzt?«
»Ja.«
»Triffst du ihn?«
»Weiß nicht.«
1. Kapitel
Magst du?«, fragte der Mann. »Hier siehst du – ich chabe Apfel.«
»Du sprichst wirklich ein komisches Deutsch«, sagte das Mädchen.
Der Mann schwieg. Mit seinem Messer schnitt er den Apfel in Teile. Dann putzte er das Messer an der Hose ab.
Das Kind fand das ein bisschen eklig, aber es war vorsichtig und sagte nichts. Sie kannte den Mann noch nicht so genau, und Mutti hatte immer gesagt, dass man bei Fremden nicht vorsichtig genug sein könne. Er war freundlich. Aber auch komisch.
Das Messer lag zwischen ihnen auf der Bank. Es war ein sehr altes Messer.
Das Kind tippte mit dem Zeigefinger vorsichtig gegen die Klinge.
»Lass das«, sagte der Mann und machte böse Augen.
Erschrocken zog das Kind die Hand zurück. »Wann kommt denn endlich meine Mutti?«
Er antwortete nicht.
Die Erde hatte sich vor einer Woche auf die Winterseite gedreht. Obwohl die Sonne aufdringlich hell schien, zeigte das Außenthermometer an Blochs Schlafzimmerfenster Minusgrade.
Montag.
Unmöglich, sich innerhalb weniger Tage an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Ständig hatte Bloch das Gefühl von Verspätung. Der Blick auf die Uhr belehrte ihn jedoch, dass bis zur Morgenbesprechung noch reichlich Zeit war. Bloch drückte den Schalter der Kaffeemaschine.
Genau in diesem Moment ließ sich Churchill mit einem seltsam ziehenden Keuchen in der Kehle auf die Seite fallen und zuckte krampfhaft mit den Pfoten.
Natürlich kam er dann doch zu spät zur Besprechung.
»Ist eben ein alter Hund«, kommentierte die neue Kollegin.
Bloch, verschwitzt und abgehetzt, sah nur ihren spöttischen Seitenblick. Er murmelte einen dialektgeprägten Ausdruck, von dem er hoffte, dass er der Kollegin aus Frankfurt unverständlich blieb, während er gleichzeitig versuchte, den widerstrebenden Churchill am Halsband unter den Tisch zu zerren.
Suchend schaute er sich nach dem Dezernatsleiter um: »Ist Graf auch zu spät dran?«
Kriminalassistent Cenk wies augenzwinkernd zur Tür: »Der ist am Telefon. Niemand hat bemerkt, dass du unpünktlich warst.«
Die neue Kollegin schnippte anbiedernd mit den Fingern, um Churchills Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Vielleicht war es ja ein Asthmaanfall?«
Churchill hob sein stumpfnasiges Mopsgesicht und bedachte sie mit einem völlig ausdruckslosen Blick aus blutgeäderten, feuchten Halbkugeln. Bloch grinste, denn er wusste, dass dieses höfliche Desinteresse des Hundes ein gutes Zeichen war: Der Mops war wieder völlig hergestellt.
»Asthma«, wiederholte er und achtete darauf, dass er ins Ungefähre sprach und knapp an der neuen Kollegin vorbeischaute. »Ich wusste gar nicht, dass Hunde das auch bekommen können.«
Dafür, dass sie erst zwei Wochen im Team war, benahm sich die Neue ganz schön forsch. Bloch beugte sich hinunter und tätschelte Churchills Nackenwülste. Zumindest sollte sie doch in der Zwischenzeit kapiert haben, dass Churchill das Maskottchen der ganzen Abteilung war.
Besser als ein Mann, hatte Dezernatsleiter Graf vor zwei Wochen gesagt; besser als ein Mann müsse so eine sowieso sein in diesem Job, und hübscher sei sie allemal. Eine undeutliche Aussprache war sonst nicht sein Ding, aber diesmal hatte Graf genuschelt. Bloch hatte sich einen Kommentar verkniffen.
Er wandte den Blick zu ihr. Den Ermittlerblick. Nicht etwa, dass jemand auf die Idee kam, er würde eine Frau einfach so anschauen. Zum Vergnügen gar. Das würde eher zu seinem Assistenten Cenk passen. Zum athletisch schlanken Cenk, der dank seiner türkischen Abstammung immer eine attraktive Sommerbräune spazieren führte – auch mitten im Winter. Cenk, bei dem die Frauen schwach wurden, wenn er sich mit schiefem Lächeln über die stoppelkurzen Maulwurfshaare strich. Cenk, dessen Freundin erst vor Kurzem Schluss gemacht hatte.
Was machte Graf eigentlich so lange am Telefon?
Zierlich war sie die Neue, zierlich, aber nicht zerbrechlich. Eher sportlich. Bloch zog unwillkürlich den Bauch ein, bemerkte es und ärgerte sich darüber.
Sie sah ziemlich stur aus. Haarfarbe schwarz. Echt oder gefärbt, das konnte er nicht sagen. Nicht bei diesem Gegenlicht. Die Sonne schien hell wie im Hochsommer. Aber sie hatte kaum Kraft. Auffahrunfälle auf eisglatter Fahrbahn, hatte es im Radio geheißen. Frisur, da gab es nichts zu meckern, kurz, praktisch, fast ein Herrenschnitt. Es gab auch Polizistinnen mit langem Haar. So, als ob sie der strengen Uniform etwas entgegensetzen wollten. Die da wollte nicht. Kriminalhauptkommissarin Kronawitter. Kronawitter, das klang wie Gewitter. Ob sie einen Vater hatte, der stolz auf sie war?
Bloch wandte seinen Blick ab. Sie warteten nun schon fast eine Viertelstunde. Und noch immer telefonierte Graf im Nebenraum. Ohne ihn konnte die Besprechung nicht beginnen.
Cenk sortierte gelbe Zettel.
In den Papieren der Neuen hatte er den Vornamen Hanna gelesen. Aber bisher hatte sie noch niemand beim Vornamen angesprochen. Cenk hatte einmal, wie zur Probe, Krönchen gesagt, als er und Bloch unter sich waren. Aber die Neue war kein Typ für Spitznamen.
Sicher war ihr Vater stolz auf sie.
Cenk hatte mittlerweile einen kleinen Stapel aus gelben Zetteln vor sich liegen und klopfte mit dem Kugelschreiber auf die Tischplatte. Die Neonröhren summten ununterbrochen. Wenn Bloch übermüdet und gereizt war, störte es ihn. Heute jedoch war er ausgeschlafen, und die Arbeit hielt sich seit Tagen in überschaubaren Grenzen. Wieso störten ihn die Neonröhren gerade heute?
Eva, dachte Bloch. Wieso kommt mir Eva gerade jetzt in den Sinn?
Und wo war Graf? Wann begann endlich die Besprechung? Seit seine Tochter aus der Psychiatrie entlassen worden war, hatte sie sich nicht mehr bei ihm gemeldet. Vier Jahre mochte das jetzt her sein. Er hatte noch nicht einmal ihre Adresse.
Diese elende Warterei brachte einen nur auf dumme Gedanken.
Dezernatsleiter Graf betrat den Raum. Die Falten zwischen Nasenflügel und Mundwinkel wie mit dem Messer geschnitten. Magenfalten. Die entstehen, wenn man sich zu viele Sorgen macht.
Ob Eva wohl im Telefonbuch stand?
»Guten Morgen, meine Herren«, begann Graf und räusperte sich. Seit ein paar Wochen hatte er Probleme mit der Stimme. »Guten Morgen, Frau Kollegin Kronawitter.«
Was wäre, wenn Churchill jetzt wieder einen Asthmaanfall bekäme?
Es war eine Vermisstenmeldung. Der Leiter des hiesigen Jugendamts war nicht nach Hause gekommen. Die Ehefrau sei auf einer Weiterbildung gewesen und habe sich zuerst keine Gedanken gemacht, als sie ihn telefonisch nicht erreicht habe. Auf der Arbeit sei er aber schon vergangenen Freitag, nach der Mittagspause, nicht mehr gesehen worden.
»Wieso macht sich die Frau so wenige Gedanken um ihren Mann?«, fragte Cenk.
»Direkt hat sie dazu nichts gesagt«, meinte Graf. »Aber sie ließ durchblicken, es sei nichts Ungewöhnliches, dass er in der dienstfreien Zeit auch mal das Handy ausschaltete. – Natürlich kann das auch ein ...«, Graf hüstelte wieder. »Ein Arrangement zwischen den beiden gewesen sein.«
Seltsam, dass dieser Fall bei ihnen landete, so weit oben – normalerweise bearbeitete das zuerst ein Polizeiposten draußen. Lag es an der Prominenz des Verschwundenen? Oder an der Durchsetzungsfähigkeit seiner Ehefrau?
»An seiner Arbeitsstelle ist auch niemandem aufgefallen, dass er fehlte. Aber die sind auch viel im Außendienst unterwegs und sitzen nicht ständig hinter ihren Schreibtischen.«
»Aber der Chef?« Cenk kniff die Augen zusammen. »Der ist doch nicht ständig draußen, oder? Also wir würden Sie spätestens montags um viertel nach acht vermissen, Herr Graf, da können Sie aber sicher sein!«
Graf lenkte einen betont neutralen Blick in Cenks Richtung. Wenn der Dezernatsleiter lächelte, blieb das so gut wie unsichtbar. Das Einzige, was passierte, war, dass seine Falten tiefer wurden.
Cenk senkte den Kopf und kritzelte hastig und mit hohem Druck etwas auf seinen Notizblock. Der Stapel gelber Zettel zitterte.
»Also die Ehefrau vermisst ihn«, lenkte Bloch das Gespräch wieder in übliche Gefilde zurück. Die nach Hause kommende Ehefrau, der abgängige Mann, Churchills schnarchende Atemzüge, ein stinkender, übervoller Aschenbecher auf dem Fensterbrett des Besprechungszimmer, den seit Wochen niemand wegräumen wollte, Grafs Magenfalten, der aufdringliche Geschmack nach Routine und Langeweile, und über allem das Summen der Neonröhren.
Cenk kritzelte weiter wie in Trance. Was er zeichnete, sah aus wie ein Kopf. Wie ein Phantombild.
Bloch schrieb den Namen des Vermissten auf. Sebastian Leimer. Doktor Sebastian Leimer. »Wo kam der eigentlich her«, fragte Bloch. »Ist der Leimer ein Hiesiger?«
»Nein, ich glaube nicht«, sagte Graf. »Seine Frau zumindest klang irgendwie norddeutsch. Ist das wichtig?«
»Weiß nicht«, sagte Bloch. »Ist nur so ein Detail.« Er unterstrich den Doktortitel und malte ein Fragezeichen an den Rand.
»Die Frau klang ziemlich aufgeregt. Es war gar nicht einfach, einigermaßen geordnet mit ihr zu sprechen.« Graf war ein durch und durch geordneter Typ. Kein Wunder, dass das Telefongespräch so lange gedauert hatte. »Kommt von einem Workshop und findet das Haus verlassen. Keine Nachricht. Nichts. Pass und Handy waren noch da.«
Cenk schaute nur kurz von seinem Notizblock hoch: »Wahrscheinlich löst sich das Ganze sowieso in zwei Tagen in Wohlgefallen auf. Das ist sowieso meist die gleiche, langweilige Geschichte. Ich würde das nicht dramatisieren.«
»Gab es private Probleme? Ist die Frau vielleicht früher zurückgekommen als erwartet?« Kollegin Kronawitter brachte es auf den Punkt.
»Offensichtlich genau Ihre Kragenweite, Frau Kollegin«, knarrte Graf und schob ihr den Zettel mit der Gesprächsnotiz zu. »Klären Sie das mal ab, sozusagen von Frau zu Frau.« Die Magenfalten vertieften sich. Es sollte wohl ein Lächeln sein. »Umfeld, üblicher Tagesablauf, auch am Wochenende, Gewohnheiten, Sportverein, Eheprobleme, das Übliche eben.«
»Und die Nachbarn«, sagte Frau Kronawitter mit professioneller Freundlichkeit.
»Sagte ich ja, das Übliche. Wenn Sie Unterstützung brauchen, dann melden Sie sich.«
Grafs Handy surrte. Er hustete hinein, wischte die Tastatur ab, sagte »´tschuldigung« und »ich höre«. Nestelte in seinen Taschen herum.
Cenk schob ihm wortlos einen Kugelschreiber zu.
Jetzt konnte Bloch sehen, was Cenk auf seinen Notizblock skizziert hatte: es war ein Frauengesicht. Es war ganz eindeutig nicht das Gesicht der Kollegin Kronawitter. Es war voller, mit sanften Lippen und langen, dunklen Haaren. Schwere Augenlider. Irgendwie orientalisch. Back to the roots. Aber Cenk war in Karlsruhe geboren und nicht in der Türkei. Er sprach ein lupenreines Hochdeutsch, nicht dieses verwaschene, nuschelige Bodensee-Alemannisch, wie sie es hier taten, wenn sie es nicht von vornherein für eleganter hielten, die harten Rachenlaute der Schweizer Seite einfließen zu lassen.
»Können Sie nicht etwas deutlicher werden?«, raunzte Graf ins Telefon. »Nein, das ist absolut nicht genug. Ich brauche auch die Nummer der Arbeitsstelle und vom Kindergarten ... Was sagen Sie da? ... Ja, dann kümmern Sie sich doch mal ein bisschen!«
Graf unterbrach die Verbindung und ließ wohl am anderen Ende der Leitung einen völlig überforderten, jungen Kollegen zurück. Überfordert musste er sein, sonst hätte er sich nicht direkt zu Graf durchstellen lassen und dabei so eine stümperhafte Vorstellung geboten. Jung war er sicher. Die sich so verhielten, waren immer jung. Bloch konnte sich kaum noch daran erinnern, wie das damals bei ihm gewesen war. Es war zu lange her.
»Chaoten. Völlig überforderte Chaoten.« Graf schickte einen zerzauselten Blick über seine Brillenränder. »Können heutzutage noch nicht einmal einen Notruf entgegennehmen. Stellen nicht mal die simpelsten Fragen. Alles muss man selber ... Bloch, das ist für Sie. Notieren Sie!«
Blochs Kugelschreiberspitze schwebte über dem Papier. Da standen ein Datum im November, die Uhrzeit und ein Name. Dr. Leimer. Die Uhrzeit stimmte. Winterzeit, obwohl die Sonne schien. In den letzten Tagen schweiften Blochs Gedanken ständig ab. Im Drogeriemarkt, der seiner Wohnung gegenüber lag, gab es so ein alkoholhaltiges Zeug mit Lecithin. Vielleicht half das gegen Konzentrationsmängel. Genauso gut könnte er abends auch einen Schnaps trinken. Bloch zog einen Strich.
Es handelte sich um die zweite Vermisstenmeldung innerhalb von zwanzig Minuten. Yasmin Nürtinger. Sechs Jahre alt, wohnhaft in einer kleinen Randgemeinde von Konstanz. Dörfliches Umfeld. Direkt am See.
»Das Kind geht noch in den Kindergarten. Wurde Freitagmittag das letzte Mal gesehen, als die Mutter die Kleine abgeholt hat.«
Bloch schrieb mit. Ein Mensch war verschwunden. Was hieß das schon? Solange niemand nach dir fragte, war es so, als gäbe es dich gar nicht.
»Wer hat denn angerufen?« Auch Cenk hatte mitgeschrieben. Der Frauenkopf verkam zur Randnotiz.
»Die Kinderklinik hat angerufen. Die Ambulanz.«
»Das ist doch ungewöhnlich, oder?«
»Ja, aber sie haben es ziemlich dringend gemacht. Die Kleine hätte bereits am Freitag einen Termin gehabt. Irgendetwas, was der Kollege da draußen nicht so richtig verstanden hat. Das müssen Sie noch recherchieren, Herr Bloch. Irgendwas Chronisches, Diabetes oder eine Herzkrankheit, es klang sehr verworren. – Jedenfalls ist es so, dass sie sich regelmäßig in ärztliche Kontrolle begeben muss, sonst kann es für die Kleine schnell gefährlich werden.«
»Wie gefährlich?«
Graf hob die Schultern. »Ziemlich, nehme ich an. Gefährlich ist ein dehnbarer Begriff.«
»Und die Eltern?«
»Da ist nur eine Mutter, und die konnten sie wohl nicht erreichen, was wohl auch untypisch ist. Die Mutter ist zwar alleinerziehend, aber sie scheint sich zu kümmern.«
Als ob alle alleinerziehenden Mütter zwangsläufig Kandidatinnen für die Vernachlässigung ihrer Kinder wären. Bloch ersparte sich eine Bemerkung. Brigitte hatte die gemeinsame Tochter Eva auch alleine großgezogen – und zwar zu einer Zeit, als der Begriff alleinerziehend noch nicht in aller Munde war. Eva war wohl nicht direkt vernachlässigt worden. Zumindest nicht von ihrer Mutter. Aber jetzt war sie erwachsen, und Bloch hatte keinen Kontakt mehr. Auch vorher war es eher schwierig gewesen.
»Wieso Jugendamt?«, fragte Cenk. »Sie erwähnten das Jugendamt, Herr Graf.«
»Ja richtig, da muss irgendwas vorgefallen sein, dass die Frau noch betreut wurde. Oder soll ich sagen, kontrolliert? Normalerweise gibt es das ja nicht mehr, dass ein Kind ohne Vater automatisch einen Amtsvormund bekommt.«
Eva hatte keinen Amtsvormund, erinnerte sich Bloch. Damals waren sie noch verheiratet gewesen. Da gab es diese Regel noch, aber irgendwann Mitte der Neunzigerjahre wurde die Amtsvormundschaft nach Schema F abgeschafft. Unnötig. Zu teuer. Zu personalintensiv. Je nachdem. Es gab mittlerweile zu viele Kinder, bei deren Geburt kein Vater eingetragen wurde. Parthogenese. Jungfernzeugung ohne Zutun eines Vaters. Wie bei den Blattläusen. Die Kollegin Kronawitter hätte solche Gedanken sicher als eine Unverschämtheit empfunden. Vielleicht war die Kollegin Krona-witter ja lesbisch? Irgendwie sah sie so aus. Bloch hatte noch nie einer leibhaftigen Lesbe gegenüber gesessen.
Er fühlte sich eingeengt. Vielleicht war das bei solchen Frauen immer so. Auch Brigitte hatte ihn eingeengt. Aber anders. Außerdem hatten sie sich da schon länger gekannt als bloß zwei Wochen.
Diese abschweifenden Gedankengänge machten ihm allmählich wirklich zu schaffen. Bloch nahm sich ernsthaft vor, seinen Hausarzt nach einem seriösen Mittel gegen Konzentrationsprobleme zu fragen. »Also, Cenk. Du den Kindergarten und ich die Kinderklinik? Ist das okay?«
»Alles klar, Chef.« Cenk grinste.
Wenn er Chef sagte, hatte das immer etwas Ironisches. Vielleicht war Bloch aber auch einfach nur zu empfindlich. Früher hatte er ein dickeres Fell gehabt.
2. Kapitel
Wir werden jetzt ein Stück weit laufen«, sagte der Mann. »Fahren wir denn nicht mehr mit dem Auto?«
»Vielleicht später. Jetzt müssen wir laufen.«
»Ich finde, es hat Spaß gemacht mit dem Auto. Am schönsten habe ich gefunden, dass wir im Auto geschlafen haben.«
»Ja«, sagte der Mann. »Vielleicht machen wir das später noch mal. Hat mir auch Spaß gemacht.«
Dabei hatte es keinen Spaß gemacht. Überhaupt nicht. Sie sagte das nur, damit er nicht mehr böse wurde. In der ersten Nacht hatten sie auch noch nicht im Auto geschlafen. Da waren sie in einem Gartenhaus. Zuerst war es fast so gewesen wie Ferien. Aber das Kind musste die ganze Zeit leise sein und im Haus bleiben. Dabei hätte es sehr gerne auf der Wiese gespielt. Abends gab es Brot und Äpfel. »Kannst du nicht Würstchen grillen?«, hatte das Kind gefragt und auf den Grill gedeutet, der auf der Veranda stand. Er sagte, es ginge nicht. Vielleicht hatte er keine Lust gehabt. Vielleicht war es auch etwas anderes.
Bis zu diesem Moment war der Nachmittag richtig spannend gewesen. Wie ein Ausflug oder der Anfang von den Ferien. Das Kind hatte seine Mutter gar nicht vermisst. Den ganzen Tag nicht. Dann aber kam der Abend. Und der Mann machte keine Grillwürstchen.
»Die Mutti würde mir jetzt aber was anderes zum Essen geben, nicht nur so blödes Brot«, sagte das Kind. Da hatte er zum ersten Mal so geguckt. So seltsam. Irgendwie gruselig.
Aber schnell lächelte er wieder und schnitt einen Apfel in kleine Stücke. »Da nimm«, sagte er. »Ist auch gut.« Aber das Kind wollte nicht. »Dann gehst du eben schlafen«, sagte er.
Aber es war noch ganz hell draußen. Und die Mutti war immer noch nicht gekommen. Auch wenn das Kind sauer auf die Mutti gewesen war, war das noch lange kein Grund, es alleine ins Bett zu schicken. Nur im Krankenhaus war das Kind manchmal ohne seine Mutter eingeschlafen, aber das zählte nicht. Es wollte nicht an das Krankenhaus denken. Nicht in diesem Moment, wo die Angst so nah war. Und dann kamen die Tränen wie von selber. »Heul nicht«, sagte der Mann und seine Augen wurden klein und hart. »Du bist zu laut.«
Vielleicht war er kein echter Freund, vielleicht hatte er den ganzen Tag über nur so getan. Jetzt guckte er nämlich wieder so – so gruselig. Gruselig war eigentlich nicht das richtige Wort, aber dem Kind fiel kein anderes ein. Und dann schrie es: »Du sollst nicht so gucken, hör auf damit! Und jetzt will ich nach Hause. Ich habe keine Lust mehr, hörst du?«
Da wischte er mit seiner Hand durch die Luft. Sehr schnell und sehr hart wischte er durch die Luft, ganz knapp am Gesicht des Kindes vorbei. Fast sah es so aus, als ob er es schlagen wollte.
»Du darfst nicht schreien«, sagte er.
»Ich schreie gar nicht«, sagte das Kind.
»Doch, das tust du. Was ist los?«
»Ich will zu meiner Mutti«, wimmerte das Kind und wagte es nicht mehr, laut zu sein.
»Ich gehe jetzt raus«, sagte er. »Ich rufe deine Mutter an.«
»Darf ich auch mit ihr sprechen?« Sie fragte mit ihrer allerliebsten Stimme. Mit einer ganz leisen Stimme.
»Mal sehen«, antwortete er und steckte das Messer in seinen Stiefelschaft. So etwas hatte das Kind noch nie gesehen. Bei ihnen zu Hause lagen die kleinen Messer ordentlich nebeneinander in der Küchenschublade. Das große Brotmesser lag immer woanders. Aber das große Messer durfte das Kind sowieso nicht berühren. Nicht, dass du dir wehtust, hatte die Mutti immer gesagt. Und den Spruch: Feuer, Schere, Messer, Licht sind für kleine Kinder nicht. So ein Blödsinn. Das Kind war kein kleines Mädchen mehr, sondern schon sechs Jahre alt. Und wenn die Mutti es erlaubte, dann könnte sie im nächsten Jahr endlich zur Schule gehen.
Er telefonierte gar nicht lange. Als er wieder reinkam, machte er ein ernstes Gesicht.
»Kann ich jetzt mit meiner Mutti sprechen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ist deine Mutter bisschen böse auf dich«, sagte er und das Kind senkte den Kopf.
»Ist bisschen böse, dass du mir machst solche Schwierigkeiten und will sie erst mit dir sprechen, wenn du wieder bist lieb.«
»Das ist voll gemein«, flüsterte das Kind und biss sich auf die Lippen. Aber es war nicht gemein, das wusste sie genau. Die Mutti war so. Das Kind hob den Kopf. »Wenn du glaubst, ich weine jetzt, dann hast du dich geschnitten«, sagte sie. ›Dann hast du dich geschnitten‹ – das hatte die Mutti manchmal gesagt und es klang sehr erwachsen und sehr vernünftig.
Sie hatte es sowieso satt, immer und überall die Kleinste und Dümmste zu sein. Endgültig satt, ein für allemal. Und wenn man mit knurrendem Magen in einer Gartenhütte schlafen musste, um groß zu werden, dann würde sie es eben tun. Ihre beste Freundin, die hieß Sarah. Sie hatte rote Locken und eine riesige Zahnlücke. Die durfte schon in die Schule, obwohl sie drei Wochen jünger war. Das war so ungerecht. Aber bevor sie in die Schule gehen durfte, musste die Mutti noch mit dem Doktor reden. ›Du musst das verstehen‹, hatte die Mutti gesagt. Aber so richtig verstanden hatte sie es nicht.
Und, ganz ehrlich gesagt, sie war sich gar nicht sicher, ob dieser Doktor überhaupt ein richtiger Arzt war. Vielleicht tat er nur so. Er trug nämlich noch nicht mal einen weißen Kittel. Ein richtiger Arzt, der musste einen Kittel haben. Aber der da grinste immer nur so blöd rum und hatte nur jede Menge Sticker und Aufkleber – und die Spritze. Die blödeblöde Spritze. Die hatte er immer dabei. Der schleimte sich nur deswegen an die Kinder ran, um ihnen das Blut auszusaugen. Mutti sagte doch sonst immer: Man kann nie vorsichtig genug sein. Und dann ließ sie es zu, dass einer, der nur behauptete ein Arzt zu sein, ihr jede Woche das Blut aussaugte. Na gut, nicht jede Woche, aber sicher viel zu oft.
»Bist du jetzt wieder brav?«, fragte der Mann. Der Messerknauf schaute oben aus seinem Stiefel heraus. Das sah ein kleines bisschen gefährlich aus. Natürlich nur, wenn man wusste, was da im Stiefel steckte.
Sie musste irgendetwas Nettes sagen, damit er wieder ein Freund wurde. »Bist du ein Pirat?«, fragte das Kind.
Da musste der Mann lachen. Er verzog die Mundwinkel weit nach hinten, fast bis an die Ohren, und sein Gesicht wurde total faltig. »Sieht so Pirat aus?«, fragte er und breitete die Arme weit aus, als ob es Flügel wären. Weit hinten im Mund hatte er eine Zahnlücke.
Das Kind musterte ihn eindringlich. Der Mann war schmal, sehr mager, fast wie einer der großen Jungen, die nachmittags immer an der Bushaltestelle im Dorf herumlungerten. Aber er war kein Junge; er war ein Mann. Ein älterer Mann. Nicht so alt wie Opa Ebner, aber älter als Mutti. Mutti hatte keine Zahnlücke.
»Na?«, sagte der Mann. »Bin ich Pirat?«
»Weiß nicht«, sagte das Kind. »Ich muss dich mal genau ansehen.«
Da musste er wieder lachen, senkte die Arme und ließ es geduldig zu, dass das Kind ihn musterte. Er trug eine komische, flache Mütze aus dunklem Stoff. Solche Mützen trugen Piraten nicht. Die hatten Kopftücher oder Korsarenhüte. Auch die Augenklappe fehlte. Der grob gestrickte Pullover und die Jeans, die würden zu einem Piraten passen. Er hatte so einen Schattenbart, der sah aus wie schwarze Vogelflügel. Das passte auch, genauso wie die Zahnlücke – nicht zu vergessen: Er trug ein Messer im Stiefel. Aber trotzdem: Etwas fehlte.
»Du bist kein Pirat«, sagte das Kind. »Du hast nämlich kein Schiff, und hier gibt es auch kein Meer.«
»Nein«, sagte der Mann. »Hier gibt es nur Bodensee und da gehen wir auch weg von. Und weißt du was? Ich bin froh, dass du das herausgefunden hast. Ich glaube nicht, ich wäre guter Pirat. Aber vielleicht zeige ich dir mal das richtige Meer. Magst du?«
»Vielleicht«, sagte das Kind. »Ich war ja noch nie am Meer.«
»Nimmst du deine Rucksack als Kissen für Kopf«, sagte der Mann und wies auf die Bank. »Ist auch Decke da.«
Das Kind kletterte gehorsam auf die Bank und drückte das Gesicht in den roten Lieblingsrucksack. Er war mit einem Plüschhasengesicht verziert. Rechts und links baumelten lange Ohren schlapp herunter. Der Rucksack war ein Ostergeschenk von Mutti gewesen.
Die Hasenohren waren eigentlich immer schmutzig, egal wie oft Mutti den Rucksack wusch. Das macht nichts, sagte das Kind. Das ist un-hü-genisch, sagte Mutti. Da kannst du von krank werden.
»Wie heißt du eigentlich?«, fragte das Kind.
3. Kapitel
Der Name ist ein bisschen kompliziert«, sagte der Arzt. Es klang so, als ob er sich dafür entschuldigte, dass er es nicht einfacher machen konnte. »Idiopathische systemische Immunopathie mit zyklisch intermittierendem Verlauf und begleitender Kardiomyopathie«, las der Arzt von der Akte ab. »Das ist die Hauptdiagnose. Dann kommen noch einige kleinere Zusatzdiagnosen und ein paar Verdachtsdiagnosen, die wir zurzeit abklären. Das ist alles reichlich komplex.« Er seufzte und schob Kommissar Bloch die Krankenakte rüber. »Vielleicht möchten Sie es lieber direkt abschreiben?«
»Gerne.« Bloch kritzelte die Diagnosen in sein Notizbuch. »Aber ehrlich gesagt – jetzt bin ich genauso schlau wie vorher.«
Der Arzt zuckte mit den Schultern und lächelte. Wenn er lächelte, sah er viel jünger aus, fast wie ein Praktikant, aber das Namensschild an seinem Pulli besagte, dass er Oberarzt war. OA Dr. med. Philipp Schäfer stand dort. Daneben ein runder Sticker mit einem lachenden, wolligen Schäfchen.
»Wir tragen keine weißen Kittel mehr«, hatte Dr. Schäfer ihm erklärt, als er ihn vor der Kinderambulanz in Empfang genommen hatte. »Die Kinder sollen uns als Freunde sehen, meinetwegen auch als Partner oder Verbündete im Kampf gegen die Krankheit. Für ein Kind ist es ja schon schlimm genug krank zu sein – nicht mehr zur Schule zu gehen, nicht mehr mit den Freunden draußen herumtoben zu können. Da müssen wir Mediziner die Kinder nicht noch zusätzlich ängstigen und eine völlig unnötige Distanz schaffen. In unserem Beruf ist das kontraproduktiv.«
»Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht«, musste Bloch zugeben. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie das mit Eva gewesen war. War Eva als Kind einmal im Krankenhaus gewesen? Damals hatten die Ärzte sicher alle noch weiße Kittel getragen. Der einzige Krankenhausaufenthalt seiner Tochter, von dem Bloch wusste, lag etwa vier Jahre zurück. Und das war nicht die Kinderklinik gewesen, sondern die Psychiatrie.
Im Korridor der Kinderklinik kam es Bloch geradezu unnatürlich dunkel vor. Obwohl draußen die Vormittagssonne schien, flackerten hier drinnen die Neonröhren. Von der Decke baumelten Papierfiguren: Sonne-Mond-und-Sterne, Schneewittchen-und-die-sieben-Zwerge. Die böse Königin fehlte. »Zurzeit basteln die Kindern Martinslaternen«, erklärte Dr. Schäfer und deutete in einen Aufenthaltsraum, in dem mehrere Kinder und eine Betreuerin an niedrigen Tischen saßen und mit Schere und Papier hantierten. Einige Kinder hatten keine Haare, andere schoben einen Infusionsständer umher. Wieder andere sahen vollkommen gesund aus.
Sie waren weitergegangen. Aus einem Zimmer klangen schrille Geräusche. Es war kein Lachen. Eher ein Schrei. Zutiefst erschrocken, hatte Bloch genau hingehört, konnte aber dennoch die Geräusche nicht einordnen. Er wagte es nicht den Arzt zu fragen. Dr. Schäfer hatte sich für die Enge seines Büros entschuldigt und auf seinem überladenen Schreibtisch eine Ecke freigeräumt, damit der Kommissar sein Notizbuch ablegen konnte. Bloch saß ungünstig über Eck. Die Tischkante bohrte sich unangenehm in seinen Bauch, wenn er sich vornüberbeugte.
Er sollte unbedingt abnehmen. Übergewicht galt als Risikofaktor.
Dr. Schäfer hingegen war von geradezu penetranter Schlankheit. Fröhlich, frisch gewaschen, kinderlieb. Sicher lachte er auch beim Blutabnehmen.
»Also«, sagte er strahlend. »Dann wollen wir diese komplizierte Diagnose einmal auseinanderdröseln. Idiopathisch – das ist so ein dehnbarer Begriff. Übersetzt bedeutet es so viel wie ›aus sich selbst heraus entstanden‹. Meistens wollen wir Mediziner damit zum Ausdruck bringen, dass wir nicht genau wissen, wo der Grund für diese Erkrankung zu suchen ist.«
»Oder, dass Sie aufgegeben haben, danach zu suchen?«, wagte Bloch einen Einwurf.
»Typischer Laienwitz«, grinste Dr. Schäfer. »Aber irgendwie nachvollziehbar. Niemand ist so richtig zufrieden, wenn man die Ursache einer Krankheit nicht kennt. Aber wir können auch nur in dem Rahmen wissenschaftlich sauber diagnostizieren, den uns der Stand der aktuellen Forschung bietet. Bevor das Mikroskop erfunden war, waren bakterielle Infektionen auch idiopathische Erkrankungen. Kein Mensch konnte sich vorstellen, dass es krankmachende Mikroorganismen gibt. Genau dasselbe gilt für genetisch determinierte Erkrankungen. Vieles wissen wir einfach noch nicht und müssen dann zu einer Verlegenheitsdiagnose greifen.«
»Also wissen Sie gar nicht so richtig, was der kleinen Yasmin fehlt?«, fasste Bloch zusammen.
»Nein, so kann man das nicht sagen«, widersprach Dr. Schäfer. »Die Diagnose geht noch weiter, und wenn sie auch im Wesentlichen rein deskriptiven Charakter hat, so sagt sie dennoch einiges über das Wesen dieser Erkrankung aus. Lassen Sie es mich einfach mal ins Deutsche übersetzen, dann können Sie vielleicht erkennen, was ich meine.« Dr. Schäfers Ton war wohlwollend und belehrend, aber auf keinen Fall besserwisserisch. Sein Beruf brachte es wohl mit sich, dass er häufig einfache Worte für komplizierte Sachverhalte finden musste. »Man kann es auch so sagen: Eine Schwäche des gesamten Immunsystems mit unklarer Ursache, die in regelmäßigen Zeitabständen auftritt und den gesamten Organismus erfasst. Begleitend haben wir eine Miterkrankung des Herzmuskels beobachtet. Außerdem noch, wie ich bereits erwähnte, in Abklärung: unerklärliche Blutzuckerschwankungen, eine Blutarmut und Reaktionen, die auf eine Allergie hindeuten.«
»Was sind das für Allergien, und wie äußern die sich?«, fragte Bloch, der mit Schreiben kaum nachkam.
»Asthmaanfälle und ein generalisierter Hautausschlag, so eine Art Ekzem, das urplötzlich auftritt und ebenso schnell wieder verschwindet, teilweise innerhalb weniger Stunden. Eine sehr instabile, rätselhafte Symptomatik. In der Literatur haben wir etwas Ähnliches in dieser komplexen Kombination noch nicht gefunden. Wir kennen Yasmin jetzt seit drei Jahren.« Dr. Schäfer klappte die Akte zu. Sie war bemerkenswert dick. Dicker jedenfalls als Blochs eigene Akte, die der Hausarzt bei seinen sporadischen Besuchen auf dem Schreibtisch liegen hatte. Der Hausarzt hatte ihm dringend zur Grippeimpfung geraten, aber Bloch war immer noch unentschlossen, da die Impfung weder gegen die Vogel- noch gegen die Schweinegrippe half. Zu Menschen hielt er sowieso Abstand. Seit einigen Tagen rasteten wieder riesige Zugvogelschwärme am Bodensee, und die umliegenden Bauern fürchteten um ihre fett gefütterten Martinsgänse, die draußen auf den Wiesen schnatterten. Gänse konnte man nicht im Stall halten. Die brachten sich gegenseitig um.
»Das klingt alles ziemlich«, Bloch zögerte. »Gefährlich?« Er formulierte es als Frage. Bloch war medizinischer Laie, aber die schiere Anzahl der Diagnosen klang überwältigend. So viele Krankheiten bei einem einzigen Kind.
»Ja, genau.« Dr. Schäfer klopfte auf die Akte der kleinen Yasmin. »Wir machen uns große Sorgen um die Kleine. Die Mutter ist normalerweise äußerst zuverlässig. Noch nie hat sie einen Termin ausfallen lassen, zumindest nicht, ohne sich vorher telefonisch bei uns zu melden. Und jetzt ist sie nicht erreichbar. Das Kind war nicht im Kindergarten – irgendwas stimmt da nicht.«
»Absolut nachvollziehbar, dass Sie sich Sorgen machen«, meinte Bloch. »Wie viel Zeit haben wir denn, das Kind zu finden? Ich meine, muss sie regelmäßig irgendwelche Medikamente einnehmen oder etwas in der Art? Kann man sagen, nach soundsoviel Tagen gerät sie in akute Gefahr? Das würde uns weiterhelfen, um die Situation besser einzuschätzen – auch wegen der Intensität der Fahndungsmaßnahmen, Information der Öffentlichkeit, Anzahl der Kollegen, die benötigt werden, eventuell Bildung einer Sonderkommission. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber letzten Endes ist das alles auch eine Kostenfrage. Meist steckt etwas vollkommen Harmloses dahinter; zum Beispiel könnte die Mutter den Termin lediglich vergessen haben und ist zur Oma gefahren.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Dr. Schäfer. »Soweit ich weiß, hatte Frau Nürtinger überhaupt keine weitergehenden familiären Kontakte. Von einer Oma habe ich noch nie etwas gehört, in all den Jahren nicht. Da war wohl eine Freundin, von der sie mal erzählt hat, aber den Namen weiß ich nicht. Ja, das ist eine schwierige Frage – wie viel Zeit bleibt uns, das Kind zu finden? Sie hat, wie gesagt, eine Herzschwäche. Die macht ihr normalerweise nicht zu schaffen; aber wenn sie Fieber hat zum Beispiel, dann kann es innerhalb von Stunden kritisch werden. Oder bei ungewohnter, körperlicher Anstrengung. Es kann Yasmin sehr lange, Tage, ja Wochen, absolut gut gehen und sie ist von einem gesunden Kind kaum zu unterscheiden – aber wenn etwas passiert ...« Dr. Schäfer schwieg.
»Ich verstehe«, sagte Bloch. »Wenn etwas passiert, dann kann es extrem schnell gehen.«
Dr. Schäfer nickte. »Bitte«, sagte er. »Bitte tun sie alles, was in Ihrer Macht steht. Sie ist so ein liebenswertes, kleines Mädchen. Wir haben sie alle sehr gern.«
Erst als Bloch den Schlüssel ins Zündschloss steckte, ärgerte er sich über diese abschließende Bemerkung des Arztes.
»Das klingt ja, als würden wir uns nur für liebenswerte Kinder einsetzen«, knurrte er vor sich hin.
4. Kapitel
Der Name ist ein bisschen kompliziert«, sagte die Leiterin des Kindergartens Sonnenrain.
Cenk saß ihr gegenüber, zwischen sich hatten sie einen Schreibtisch, der von Papieren, Broschüren und Katalogen für Bastelmaterial überquoll. Durch ein großes Fenster ging der Blick in eine riesige, menschenleere Gartenanlage mit Schaukel, Rutschbahn und Klettergerüst. Im Sandkasten stand eine Blechwanne, in der sorgsam große Holzscheite aufgeschichtet waren.
»Für unser Martinsfeuer heute Abend«, erläuterte die Leiterin des Kindergartens. »Im Moment ist es noch zu kalt, um die Kinder draußen spielen zu lassen. Aber gegen Mittag hat die Sonne mehr Kraft, dann können sie raus, bis sie abgeholt werden.«
Die Kindergartenleiterin hatte einen Doppelnamen: Frau Assmann-Burger. Cenk hatte den Namen sofort aufgeschrieben, sonst hätte er ihn mit Sicherheit wieder vergessen. Frau Assmann-Burger war eine füllige Mittfünfzigerin, die Cenk an irgendjemanden erinnerte. Eine feuerrote Haarmähne umgab ihren Kopf im leuchtenden Gegenlicht der Vormittagssonne wie eine Strahlenkorona. Ebenso farbenfroh war ihre Kleidung: Sie bestand aus wallenden, wahrscheinlich ökologisch korrekt pflanzengefärbten Stoffen in den Farben Rot, Blau und Gelb. Frau Assmann-Burger sah aus wie lebendig gewordenes Anschauungsmaterial für das Erlernen der Primärfarben.
»Also, dann wollen wir mal«, die Erzieherin schaute über den Rand ihrer Lesebrille, ob Cenk auch schreibbereit war, und las vor: »Yasmin-Tamara-Sabrina-Sophia Nürtinger. Wie gesagt, der Name ist ein bisschen kompliziert. Was wollen Sie denn genau wissen?«
»Kommt es öfters vor, dass Kinder so viele Vornamen haben?« Cenk schaute nachdenklich auf die lange Buchstabenreihe, die ausgereicht hätte, um eine ganze Gruppe von Kindern mit Namen zu versorgen.
»Doppelnamen sind ja schon einige Jahre wieder in Mode – vor allem bei den Mädchen. In manchen Gruppen haben wir drei Marie-Sophies oder Annalenas. Vielleicht ist das ja auch ein Ausdruck neuer, nun ja ...«, die Kindergartenleiterin räusperte sich. »Nennen wir es Trend zur neuen Bürgerlichkeit. Aber Sie sind doch nicht hierher gekommen, um mit mir über die Marotten der Eltern bei der Namensgebung ihrer Kinder zu diskutieren?«
»Nicht direkt«, sagte Cenk. »Aber wir müssen das Mädchen und ihr Umfeld besser kennen lernen. Bisher wissen wir kaum etwas. – Und der Name ...«, er stockte, »in diesem Fall die Namen helfen uns da vielleicht ein Stück weiter. Sophia zum Beispiel. Sophia klingt, glaube ich, irgendwie durchaus nach neuer Bürgerlichkeit. Aber die anderen Namen? Yasmin – das kenne ich aus meiner Familie. So heißen türkische Mädchen. Und Tamara-Sabrina? Sind solche Namen nicht heutzutage eher stigmatisierend?«
»Vielleicht kann so ein Name später tatsächlich zum Stolperstein werden – wenn die Kinder irgendwann aus den pädagogischen Schonräumen ins wahre Leben entlassen werden. Aber Yasmin ist doch ein schöner Name, und die Kleine wird sich ja später auch nicht ständig mit allen vier Vornamen vorstellen.«
»Ganz Ihrer Meinung«, beeilte sich Cenk, die Schönheit des Namens Yasmin zu bestätigen.
»Hat die Kleine vielleicht einen türkischen Vater?«
Die Frau machte eine fahrige Handbewegung. Ihr kanariengelber Schal verrutschte. Mit einer ungeduldigen Geste brachte sie ihre Garderobe wieder in Ordnung. »Keine Ahnung. Frau Nürtinger hat uns nie etwas von einem Vater erzählt. Der war schlicht und ergreifend nicht existent.« Frau Assmann-Burgers Tonfall machte deutlich, dass es unmodern und völlig realitätsfremd sei, sich über die Tatsache zu wundern, dass ein Kind vaterlos aufwuchs. Falls seine Exfreundin Sonja in der letzten gemeinsamen Nacht schwanger geworden wäre, könnte sie jetzt bereits im vierten Monat sein. Cenks Kind würde im Frühjahr zur Welt kommen und je nachdem, wie Sonja es handhabte, würde er nie davon erfahren.
»Also ist Frau Nürtinger auch nicht geschieden?«
»Nein, soweit ich informiert bin, ist sie nicht geschieden. Es gibt einfach keinen Vater.«
»Also auch keine Unterhaltszahlungen?«
»Da müssen Sie das Jugendamt fragen. Das Amt hat wohl die Kindergartengebühren bezahlt. Frau Nürtinger konnte nicht arbeiten. Zumindest nicht regelmäßig. Die Kleine hatte immer wieder ziemlich heftige Krankheitsschübe, und man wusste nie, wann es wieder losging. Die arme Frau hatte es in den letzten Jahren wirklich nicht leicht. Wissen Sie, vielleicht hat sie bei der Geburt des Kindes schon gespürt, wie schwierig das alles werden wird. Und dann hat sie dem Kind eben ein paar Namen mehr gegeben als üblich – sozusagen als protektive Faktoren.«
Cenk schrieb Schutzfaktoren. In türkischen Familien hängten sie den Kindern blaue Perlen gegen den bösen Blick um den Hals. Es war auch verpönt, ein Kind lautstark ob seiner Schönheit zu bewundern. Das könne Unglück herbeiziehen, hieß es, und davon waren viele ältere Frauen immer noch überzeugt.
»Frau Nürtinger hat auch immer wieder betont, wie besonders und ganz und gar einzigartig ihr Kind sei.« Frau Assmann-Burger hustete trocken. Vermutlich rauchte sie in ihrer Freizeit. »Wissen Sie eigentlich, was heutzutage der Begriff ›besonderes Kind‹ bedeutet?«
»Keine Ahnung.«
Frau Assmann-Burger hustete wieder. Vielleicht rauchte sie auch nicht und hustete lediglich aus Verlegenheit. »Besonderes Kind, das bedeutet – sozusagen in der mildesten Ausprägung – ›irgendwie auffällig‹, aber meistens meint man damit schlicht und ergreifend, dass das Kind nicht passt, dass es sozial oder geistig leicht behindert ist – und dass es über kurz oder lang aussortiert wird.«
»Das hört sich aber hart an. Ich meine – die sind doch noch so jung; da kann man doch noch nicht von Aussortieren sprechen.«
Die beiden sahen sich kurz in die Augen. Natürlich wusste auch Cenk nur zu gut, dass der Prozess des Aussortierens harte Realität war. Aber normalerweise sagte man es nicht so unanständig direkt. Frau Assmann-Brunner rauchte sicher. Cenk konnte förmlich sehen, wie sie dicke Schwaden aus Rauchwolken zwischen sich und ihren Gesprächspartner legte. Unangenehmes Thema, dachte Cenk. Vor allem, wenn man den Job schon so viele Jahre macht wie sie. Vielleicht hat sie sogar vor Jahren Kinder einmal gern gehabt. Sie sah nicht so aus wie jemand, der Kinder mag. Frau Assmann-Burger sah aus wie jemand, der einen verdammt schweren Job verdammt gut hinkriegt.
»Na ja, vielleicht verstehen Sie jetzt, warum wir immer versucht haben, Frau Nürtinger auszureden, dass ihr Kind ein ›besonderes‹ Kind sei. Außerdem wollte die Yasmin das gar nicht. Wenn Sie die Kinder fragen, dann wollen alle nur normal sein. Da herrscht schon bei den Kleinen ein enormer Gruppendruck.«
»Haben Sie vielleicht ein Foto von Yasmin?«, fragte Cenk.
Die Erzieherin erhob sich. Eingeklemmt zwischen Schreibtisch und Regalwand gelang es ihr nur mühsam, ihre Leibesfülle zu drehen und einen Ordner aus einem Fach herauszuangeln. Der Ordner hatte das gleiche Rot wie Frau Assmann-Burgers Leinen-Tunika.
»Da ist sie.« Ein kurzer Finger mit sorgfältig kirschrot lackiertem Fingernagel deutete auf ein Gruppenbild. Diese Nagellackfarbe entsprach auf gar keinen Fall einem pädagogisch korrekten Rot. Dafür war sie viel zu dunkel. Eher eignete sie sich zur Übertünchung nikotinverfärbter Fingernägel.
»Das war auf unserem Sommerfest. Da haben wir ein Gruppenbild gemacht. Weil Yasmin so zierlich ist, steht sie bei den Kleinsten in der vordersten Reihe.«
Ein blondes Geschöpf. Fast ein Lächeln im Gesicht – aber genau betrachtet nur beinahe. Hängerkleidchen mit wildem Blumenmuster. Pink. Türkis. Grelle Mischfarben. Sicher Kunstfaser, nicht so ökologisch korrektes Zeug, wie es die Kindergartenleiterin trug. Das Lächeln des Mädchens passte zu Sophia. Sophia heißt Weisheit.
Das Kunstfaser-Kleidchen war von Tamara-Sabrina.
Wo war Yasmin?
Yasmin war barfuß.
»Das Foto muss ich mitnehmen, sagte Cenk.
»Selbstverständlich«, sagte Frau Assmann-Burger und löste es aus dem Ordner heraus. »Wir können weitere Abzüge machen. Die Negative sind noch da. Übrigens konnten wir bei Yasmin gewisse Retardierungen beobachten, wahrscheinlich bedingt durch die vielen Krankheiten. Wir haben diverse Tests gemacht. Auf nonverbaler Ebene, Sie verstehen. Auf diese Weise gelingt es am besten, den Entwicklungsstand eines Kindes abzuschätzen, auch wenn es in der sprachlichen Entwicklung verzögert ist.« Frau Assmann-Burger blätterte in Yasmins Akte. »Hier: Kaufmann-Assessment Battery for Children, Continuous Performance Test nach Conners und so weiter und so weiter, ich glaube, ich brauche die jetzt nicht alle aufzuzählen.«