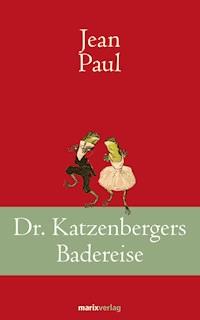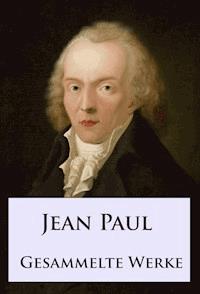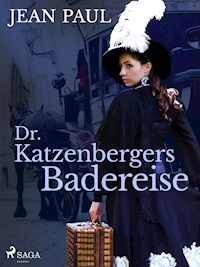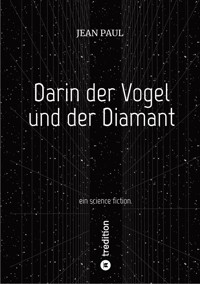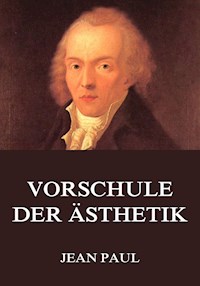
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die "Vorschule der Ästhetik", in Wirklichkeit nur eine Vorschule der Poetik, nicht kunstreich gegliedert, aber von ungeheurer Belesenheit in der schönen und philosophischen Lteratur und von scharfem, selbständigem Urteil zeugend, voll der geistreichsten und bedeutendsten Bemerkungen im einzelnen, knüpfte in vielen Dingen an Herder an, dessen Tod während der Ausarbeitung dieses Werkes Jean Paul tief erschütterte und zu dem begeisterten Nachruf am Schlusse desselben veranlaßte; sie setzte desgleichen die ästhetischen Untersuchungen Goeth's und Schillers unmittelbar voraus, hatte aber noch mehr die Anschauungen und Arbeiten der Romantiker über das Wesen der Poesie und Kunst zur philosophischen Grundlage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorschule der Ästhetik
Jean Paul
Inhalt:
Jean Paul – Biografie und Bibliografie
Vorschule der Ästhetik
Erste Abteilung
I. Programm
II. Programm
III. Programm
IV. Programm
V. Programm
VI. Programm
VII. Programm
VIII. Programm
Zweite Abteilung
IX. Programm
X. Programm
XI. Programm
XII. Programm
XIII. Programm
XIV. Programm
XV. Programm
Dritte Abteilung
I. oder Miserikordias-Vorlesung
II. oder Jubilate-Vorlesung
III. Kantate-Vorlesung
Kleine Nachschule zurästhetischen Vorschule
I. Programm
II. Programm
III. Programm
IV. Programm
V. Programm
VI. Programm
VII. Programm
VIII. Programm
IX. Programm
X. Programm
XI. Programm
XII. Programm
XIII. Programm
XIIII. Programm
XV. Programm
I. Miserikordas-Vorlesung in der Böttigerwoche
II. Jubilate-Vorlesung
III. Kantate- oder Zahl- und Buchhändlerwoche
IV. Himmelfahrt-Woche
Vorschule der Ästhetik, Jean Paul
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849633158
www.jazzybee-verlag.de
Jean Paul – Biografie und Bibliografie
EigentlichJean Paul Friedrich Richter, unter dem Namen Jean Paul berühmt gewordener Schriftsteller, geb. 21. März 1763 in Wunsiedel als Sohn eines Rektors und Organisten, gest. 14. Nov. 1825 in Bayreuth, verbrachte seine Kindheitsjahre, seit 1765, in dem Dorfe Joditz bei Hof, besuchte erst seit 1776 in dem nahen Schwarzenbach, wohin sein Vater versetzt worden war, regelmäßig die Schule, gewann aber die wesentlichsten Anregungen aus einer von früh an lebhaft, freilich auch wahllos betriebenen Lektüre, über die er in dicken Folianten ausführliche Auszüge eintrug. Um Ostern 1779 bezog er das Gymnasium in Hof. Durch den bald darauf erfolgten Tod des Vaters und der Großeltern geriet er mehr und mehr in materielle Bedrängnis, die ihn aber nicht hinderte, Ostern 1781 die Universität Leipzig zu besuchen, um Theologie zu studieren. Doch nahm er es mit den Studien (nur der Philosoph Platner fesselte ihn eine Weile) nicht sehr ernst und wandte sich bald ausschließlich der literarischen Tätigkeit zu, durch die er sich auch leichter über die äußere Not hinweghelfen zu können hoffte. Von bekannten Schriftstellern wirkten jetzt außer Hippel, der schon auf der Schule sein Lieblingsautor gewesen war, Rousseau und die englischen Humoristen und Satiriker stark auf ihn ein. Für sein erstes Buch, das nach des Erasmus' »Encomium moriae« verfaßte »Lob der Dummheit«, in dem er die Dummheit redend einführt, fand er keinen Verleger (es wurde erst lange nach Jean Pauls Tode bekannt). Besser ging es den des Dichters Eigenart schon deutlich verratenden »Grönländischen Prozessen«, die wenigstens einen Verleger fanden (Berl. 1783), wenn sie auch von dem Publikum und der Kritik sehr kühl aufgenommen wurden. Um den drängenden Gläubigern zu entrinnen, begab sich R. Ende 1784 heimlich von Leipzig hinweg und traf vom Frost erstarrt in Hof bei der Mutter ein, von wo es ihm auch in den nächsten Jahren nicht gelingen wollte, literarische Beziehungen anzuknüpfen, die seiner Not hätten ein Ende machen können. Erst zu Anfang 1787 bot sich dem Dichter wenigstens ein Unterkommen als Hauslehrer dar, er übernahm den Unterricht eines jüngeren Bruders seines Freundes Örthel in Töpen. Seine dortige Stellung war jedoch unbehaglich, und schon im Sommer 1789 kehrte er nach Hof zurück. Inzwischen schrieb er neue Satiren u. d. T.: »Auswahl aus des Teufels Papieren« (Gera 1789), die ebenso wenig Aufsehen erregten wie Jean Pauls Erstlingswerk. Im März 1790 übernahm er aufs neue ein Lehramt. Einige Familien in Schwarzenbach beriefen ihn zum Unterricht ihrer Kinder, und jetzt betrieb der Dichter sein Amt in angenehmen persönlichen Verhältnissen mit wahrhaft begeisterter Freudigkeit. Die Sonntagsbesuche in Hof gewährten erquickliche Erholung, und in dem damals mit seinem dortigen Freund Otto immer inniger geschlossenen Herzensbund erwuchs ihm ein köstlicher Besitz für sein ganzes späteres Leben. Um jene Zeit entstanden einige kleinere Humoresken: »Die Reise des Rektors Fälbel und seiner Primaner«, »Des Amtsvogts Freudels Klaglibell über seinen verfluchten Dämon« und das »Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wuz in Auenthal«. Sogleich nach Vollendung des »Wuz« begann R. einen großen Roman, dessen Plan ihn schon länger beschäftigte. Während der Arbeit zwar verflüchtigte sich der ursprüngliche Plan, die »Unsichtbare Loge« (Berl. 1793, 2 Bde.) blieb unvollendet; »eine geborne Ruine« nannte der Dichter selbst sein Werk, in dem neben einzelnen unvergleichlich schönen Stellen bereits die ganze Unfähigkeit Jean Pauls zu plastischer Gestaltung, die maßlose Überwucherung der phantastischen Elemente und alles, was sonst den reinen Genuß an seinen Dichtungen stört, zutage trat. Gleichwohl bildet das Erscheinen des Buches in Jean Pauls Leben einen Wendepunkt günstigster Art. Im Herbst 1792 legte er seine Hand an ein neues Werk, den »Hesperus« (Berl. 1795), der sich gleich der »Unsichtbaren Loge« eines großen Erfolgs beim Publikum erfreute. Seit dem Frühling 1794 wieder in Hof bei der Mutter weilend, schrieb er in den nächstfolgenden Jahren: »Das Leben des Quintus Fixlein« (Bayr. 1796), ein humoristisches Idyll wie das »Leben Wuz'«, nur in breiterer Anlage; die »Biographischen Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin« (Berl. 1796), ein Romantorso mit satirischem Anhang; die »Blumen-, Frucht- und Dornenstücke, oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten Siebenkäs« (das. 1796–97, 4 Bde.), in gewissem Sinne die beste Schöpfung des Dichters, der in den Persönlichkeiten des sentimentalen Siebenkäs und des satirischen Leibgeber die entsprechenden Elemente seiner eignen Natur zu verkörpern versuchte. Noch während der Arbeit an dem letztgenannten Roman empfing Jean Paul eine briefliche Einladung nach Weimar, von weiblicher Hand geschrieben. In der Ilmstadt, meldete die Briefstellerin, die sich Natalie nannte (welchen Namen der Dichter alsbald einer Gestalt im »Siebenkäs« anheftete), seien die besten Menschen von Jean Pauls Werken entzückt. Ohne Verzug folgte dieser dem Ruf. Seine Aufnahme übertraf alle seine Erwartungen; vor allen andern begegnete ihm Charlotte v. Kalb (die pseudonyme Briefschreiberin) mit glühender Verehrung. Jean Paul hat von ihr manche Züge für die Schilderung der hypergenialen Linda im »Titan« entlehnt. Zurückhaltender empfingen Goethe und Schiller den Hesperusverfasser, der sich in Weimar meist im Kreis des ihm wahlverwandten Herder bewegte. In jene Zeit fallen die Anfänge des »Titan«, die Abfassung des »Jubelsenior« (Leipz. 1797) und die Schrift »Das Kampanertal, oder: Die Unsterblichkeit der Seele« (Erfurt 1798). Im Sommer 1797 trat eine neue weibliche Gestalt auf die Lebensbühne des Dichters, Emilie v. Berlepsch, eine junge und schöne Witwe, mit der Jean Paul eine Reihe wunderlich exaltierter Szenen durchmachte. Fast hätte eine (vermutlich unglückliche) Heirat den dramatischen Abschluß gebildet. Im Oktober 1797 führte eine Reise nach Leipzig den nun berühmt Gewordenen auf den Schauplatz seiner einstigen Kümmernis, und jetzt drängten sich die Bewunderer um ihn. 1798 folgte auf Einladung der Herzogin Amalie ein abermaliger Besuch in Weimar. Nach einem kurzen Aufenthalt in Hildburghausen (Frühjahr 1799), wo er vom Herzog den Titel eines Legationsrats erhielt, ging Jean Paul nach Berlin, in der Absicht, sich dort dauernd niederzulassen. Im Mai 1801 verheiratete er sich daselbst mit der Tochter des Tribunalrats Meyer, aber eine vom König erbetene Versorgung blieb versagt. Von den damals entstandenen Werken sind hervorzuheben: »Palingenesien« (Gera 1798, 2 Bde.); »Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf« (das. 1799; unter den hier vereinigten kleinern Aufsätzen seien erwähnt: »Der doppelte Schwur der Besserung« und die »Neujahrsnacht eines Unglücklichen«) und die »Clavis Fichtiana« (Erfurt 1800), eine Satire auf den Fichteschen Idealismus; er widmete sie F. H. Jacobi, den er als den größten Philosophen der Zeit bewunderte. In Berlin behagte es dem Dichter nicht auf die Dauer; bald nach seiner Hochzeit nahm er seinen Wohnsitz in Meiningen, wo er zum Herzog Georg in vertraute Beziehungen trat und den »Titan« (Berl. 1800–03, 4 Bde.) vollendete. Doch schon im Mai 1803 verließ er Meiningen wieder und siedelte sich nach kurzem Aufenthalt zu Koburg in Bayreuth an, wo er bis zu seinem Tode wohnen blieb. Das nächste größere Werk des fortan in nur selten unterbrochener idyllischer Zurückgezogenheit lebenden Dichters war ein philosophisches, die »Vorschule der Ästhetik« (Hamb. 1805, 3 Bde.; Tübing. 1813), ein Buch voll geistreichster Einfälle, wertvoll in den über die Theorie des Komischen handelnden Abschnitten. Danach folgte die Abfassung der »Flegeljahre« (Tübing. 1804–05, 4 Bde.). Auch in diesem Roman, der zu den genialsten Schöpfungen Jean Pauls gehört und ihm selbst die liebste blieb, hat er die eigne Doppelnatur, die Gemütsinnigkeit und die humoristische Neigung seines Wesens, jene in dem weich gestimmten Walt, diese in dessen Zwillingsbruder Vult, zur Darstellung bringen wollen. In der »Levana, oder Erziehungslehre« (Braunschw. 1807, 3 Bde.; Stuttg. 1815, 4. Aufl. 1861; neue Ausg. von R. Lange, Langensalza 1893) sollten die in der »Unsichtbaren Loge«, im »Titan« und in den »Flegeljahren« in Romanform dargelegten Grundsätze theoretisch ausgeführt wiederkehren. Während der Zeit der französischen Fremdherrschaft schrieb Jean Paul zu eigner und seines Volkes Erheiterung die Humoresken: »Des Feldpredigers Schmälzle Reise nach Flätz« (Tübing. 1809) und »Doktor Katzenbergers Badereise« (Heidelb. 1809, Bresl. 1823), zwei Erzählungen von derbster Komik. Aber auch in ernsthafteren, wenngleich an satirischen Schlaglichtern reichen Schriften suchte er den gesunkenen Mut der Nation auszurichten, so in der »Friedenspredigt in Deutschland« (Heidelb. 1808) und den »Dämmerungen für Deutschland« (Tübing. 1809). Das letztere Buch, gedruckt in der Zeit, als Davout das Bayreuther Land besetzt hielt, legt auch deshalb ein schönes Zeugnis für Jean Pauls männlichen Mut und edlen Sinn ab, weil er es veröffentlichte, nachdem ihm soeben durch den ganz von dem französischen Imperator abhängigen Fürst-Primas v. Dalberg eine Jahrespension von 1000 Gulden ausgesetzt worden war. Nachdem diese Pension mit dem Großherzogtum Frankfurt 1813 zu Ende gegangen, bezog der Dichter seit 1815 einen gleichen Jahresgehalt von dem König von Bayern. Aus den spätern Lebensjahren Jean Pauls sind zu verzeichnen als bedeutendere Schriften: »Das Leben Fibels« (Nürnb. 1811), »Der Komet, oder Nikolaus Marggraf« (Berl. 1820–22, 3 Bde.), die beiden letzten größeren Arbeiten des Dichters in der komischen Gattung; ferner das Buch »Selina, oder: Über die Unsterblichkeit der Seele« (Stuttg. 1827, 2 Bde.) und endlich das Fragment einer Selbstbiographie, das unter dem im Gegensatz zu Goethe gewählten Titel: »Wahrheit aus Jean Pauls Leben« (Bresl. 1826) erschien und die Jugenderinnerungen des Dichters enthält. Einen tiefen Schatten warf auf Jean Pauls Lebensabend der Tod seines einzigen Sohnes, der 1821 als Student in Heidelberg starb. Seitdem kränkelte er und war zuletzt über Jahresfrist des Augenlichts fast gänzlich beraubt. König Ludwig I. von Bayern ließ ihm 1841 in Bayreuth ein Erzstandbild (von Schwanthaler) errichten.
Jean Paul nimmt eine eigentümliche und schwer zu bezeichnende Stellung innerhalb unsrer klassischen Literaturperiode und zwischen den sich drängenden Richtungen seit dem Beginn des 19. Jahrh. ein. Unzweifelhaft vom besten Geiste des 18. Jahrh., von dem »Ideal der Humanität«, beseelt, schloss er sich doch in seiner Darstellungsweise weit mehr an die frühern Schriftsteller als an Lessing, Goethe oder Schiller an. Die Engländer, vor allen Swift und Sterne, die Franzosen Voltaire und Rousseau, die ostpreußische Schriftstellergruppe Hamann, Hippel und Herder beeinflussten die Entwickelung seines Talents und führten ihn im Verein mit seinem eignen Naturell und seinem persönlichen Schicksal auf wunderliche Abwege. Gemeinsam mit unsern großen Dichtern blieben R. die Überzeugung von der Entwickelungsfähigkeit des Menschengeschlechts und ein freiheitlicher Zug; aber er gelangte niemals zu einer Entwickelung im höheren Sinne des Wortes. Der Abstand zwischen seinen frühesten und spätesten Werken ist ziemlich unwesentlich; die Widersprüche des unendlichen Gefühls und des beschränkten realen Lebens bildeten den Ausgangspunkt aller seiner Romane; aus ihnen gingen die weichen, wehmut- und tränenvollen Stimmungen hervor, über die er sich dann durch seinen unter Tränen hell lachenden Humor erhob. In der empfindsamen Zeit, in der Jean Paul auftrat, musste er den größten Erfolg haben; die schreienden Mängel seiner Darstellung wurden geleugnet; ja, sie scheinen in den meisten Kreisen gar nicht empfunden worden zu sein. R. gelangte nur in dem Idyll und in den besten Episoden seiner größeren Romane zu wirklich künstlerischer Gestaltung; meist wurden bei ihm Handlung und Charakteristik unter einer wuchernden Fülle von Einfällen, reflektierenden Abschweifungen, Episoden und fragmentarischen Einschiebseln verdeckt und erstickt. Verhängnisvoller noch ward für ihn die oben schon erwähnte Vielleserei, in der er ein Gegengewicht gegen die Enge seiner Verhältnisse gesucht hatte, und in ihrer Folge die leidenschaftliche Bilderjagd und Zitatensucht. Alle diese Mängel vereint drückten seinem Stil mit endlosen Perioden und unzähligen Einschachtelungen den Charakter des Manierierten auf, den der Dichter nur da abstreift, wo er von seinem Gegenstand aufs tiefste ergriffen und in innerster Bewegung ist. Gegenüber dem Enthusiasmus, der R. eine Zeitlang zum gefeiertsten Schriftsteller der Nation erhob, heftete sich die spätere Kritik wesentlich an die bezeichneten Unvollkommenheiten seiner Erscheinung. Während in seinen ausgedehnteren Werken, der »Unsichtbaren Loge«, dem »Hesperus«, dem »Titan« und »Komet«, nur einzelne glänzende Beschreibungen, humoristische Episoden oder jene zahlreichen »schönen Stellen« noch zu fesseln vermögen, von denen mehrmals besondere Sammlungen veranstaltet wurden, gewähren alle in ihren Hauptteilen idyllischen oder entschieden humoristischen Dichtungen einen weit reinern Genuss und lassen das Talent und die tieferen Eigentümlichkeiten besser hervortreten. Immer steht die liebevolle, reine Teilnahme bei ihm an allen Mühseligen und Beladenen, an den Armen, Bedrückten und Bedrängten im Vordergrund. Sein Blick für das Köstliche im Unscheinbaren, das Große und Ewige im Beschränkten ist tief und beinahe untrüglich; auch seine Naturliebe verleiht allen seinen Werken Partien von bestrickendem Zauber. Seine scharfe Beobachtung des Komischen wirkt unwiderstehlich, und alle diese Vorzüge erwecken lebhaftes Bedauern, daß dem Dichter das Erreichen klassischer, künstlerisch vollendeter Form versagt blieb. Richters Werke erschienen gesammelt in erster, aber ungenügender Ausgabe in 60 Bänden (Berl. 1826–38), besser in 33 Bänden (das. 1840–42; 3. Ausg. 1860–62, 34 Bde.) sowie in Auswahl in 16 Bänden (2. Ausg., das. 1865); ferner in der Hempelschen Ausgabe, mit Biographie von Gottschall (das. 1879, 60 Tle.; Auswahl 31 Tle.) und eine Auswahl in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur« (hrsg. von Nerrlich, Stuttg. 1882 ff., 6 Bde.). Nach des Dichters Tod erschien noch »Der Papierdrache« (hrsg. von seinem Schwiegersohn Ernst Förster, Frankf. 1845, 2 Bde.). Von verkürzenden Bearbeitungen, die den Dichter der Gegenwart näher bringen wollen, sei erwähnt die des »Titan« von O. Sievers (Wolfenbüttel 1878). Von seinen Briefen sind zu nennen: »Jean Pauls Briefe an Friedrich Heinrich Jacobi« (Berl. 1828); »Briefwechsel Jean Pauls mit seinem Freund Chr. Otto« (das. 1829–33, 4 Bde.); »Briefwechsel zwischen Heinrich Voß und Jean Paul« (hrsg. von Abr. Voß, Heidelb. 1833); »Briefe an eine Jugendfreundin« (hrsg. von Täglichsbeck, Brandenb. 1858). Die »Briefe von Charlotte v. Kalb an Jean Paul und dessen Gattin« (Berl. 1882) und »Jean Pauls Briefwechsel mit seiner Frau und Christian Otto« (das. 1902) gab Nerrlich heraus. Aus der zahlreichen Literatur über R. heben wir hervor: Spazier, Jean Paul Friedrich R., ein biographischer Kommentar zu dessen Werken (Leipz. 1833, 5 Bde.); die Fortsetzung von »Wahrheit aus Jean Pauls Leben« von Otto und Förster (Bresl. 1826–33, 8 Hefte); E. Förster, Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Jean Paul (Münch. 1863, 4 Bde.); Henneberger, Jean Pauls Aufenthalt in Meiningen (Meiningen 1863); Planck, Jean Pauls Dichtung im Licht unsrer nationalen Entwickelung (Berl. 1868); Vischer, Kritische Gänge, neue Folge, Bd. 6 (Stuttg. 1875); Nerrlich, Jean Paul und seine Zeitgenossen (Berl. 1876) und Jean Paul, sein Leben und seine Werke (das. 1889); Jos. Müller, Jean Paul und seine Bedeutung für die Gegenwart (Münch. 1894), Die Seelenlehre Jean Pauls (das. 1894) und Jean Paul-Studien (das. 1899); Hoppe, Das Verhältnis Jean Pauls zur Philosophie seiner Zeit (Leipz. 1901); Reuter, Die psychologische Grundlage von Jean Pauls Pädagogik (das. 1902): Allievo, Gian Paolo R. e la sua Levana (Tur. 1900); Czerny, Sterne, Hippel und Jean Paul (Berl. 1904); F. J. Schneider, Jean Pauls Altersdichtung Fibel und Komet (das. 1901) und Jean Pauls Jugend und erstes Auftreten in der Literatur (das. 1905). Eine begeisterte, formvollendete »Denkrede auf Jean Paul« verfaßte Börne (1825).
Vorschule der Ästhetik
Erste Abteilung
Inhalt der ersten Abteilung
Vorrede zur zweiten Auflage
Vorrede zur ersten Ausgabe
I. Programm. Über die Poesie überhaupt
§ 1 Ihre Definitionen – § 2 Poetische Nihilisten – Versäumung der Naturschule – § 3 Poetische Materialisten, Beispiele unpoetischer Nachäffung der Natur – Nachahmung derselben ist etwas Höheres als deren Wiederholung – § 4 Nähere Bestimmungen der schönen Nachahmung der Natur – Definitionen der Schönheit, von Kant, Delbrück, Hemsterhuis – § 5 Anwendung der beiden Irr-Enden und der Wahrheit am dreifachen Gebrauche des Wunderbaren gezeigt.
II. Programm. Stufenfolge poetischer Kräfte
§ 6 Einbildungkraft – § 7 Bildungkraft oder Phantasie – § 8 Grade der Phantasie; erster: allgemeine Empfänglichkeit – § 9 zweiter: das Talent; dessen Unterschied vom Genie – § 10 dritter: das passive oder weibliche Genie – Grenzgenies.
III. Programm. Über das Genie
§ 11 Vielkräftigkeit desselben – § 12 Besonnenheit, Unterschied der genialen von der unsittlichen – § 13 Instinkt des Menschen bezieht sich auf eine Welt über den Welten – § 14 Instinkt des Genies – gibt den innern Stoff, der ohne Form poetisch ist – neue Weltanschauung Merkzeichen des Genies – § 15 Das geniale Ideal – inwiefern die Anschauung des Ganzen allzeit poetisch und ideal werde.
IV. Programm. Über die griechische oder plastische Dichtkunst
§ 16 Gemälde des ästhetischen Griechenlands – § 17 daraus Ableitung der vier Hauptfarben seiner Poesie; erste oder Objektivität – § 18 zweite oder Schönheit oder Ideal, Einerleiheit des Allgemeinen, Reinmenschlichen und Edeln – § 19 dritte oder heitere Ruhe – § 20 vierte oder sittliche Grazie.
V. Programm. Über die romantische Dichtkunst
§ 21 Das Verhältnis der Griechen und der Neuern; Ursachen der griechischen Überschätzung – § 22 Wesen der romantischen Dichtkunst-Verschiedenheiten der südlichen und der nordischen – § 23 Quelle der romantischen Poesie – § 24 Dichtkunst des Aberglaubens – § 25 Beispiele der Romantik.
VI. Programm. Über das Lächerliche
§ 26 Definitionen des Lächerlichen – Widerlegung der kantischen und einiger neuern – § 27 Theorie des Erhabenen als dessen Widerspiels – das Erhabene ist das angewandte Unendliche – fünffache Einteilung desselben – § 28 Untersuchung des Lächerlichen; es ist der sinnlich angeschauete Unverstand; drei Bestandteile desselben: der objektive, subjektive und der sinnliche Kontrast – § 29 Unterschied der Satire und des Komus – § 30 Quelle des Vergnügens am Lächerlichen.
VII. Programm. Über die humoristische Dichtkunst
§ 31 Begriff des Humors, als eines auf das Unendliche angewandten Endlichen – dessen vier Bestandteile – § 32 erster: Totalität – § 33 zweiter: die vernichtende oder unendliche Idee des Humors – § 34 dritter: Subjektivität – der komische Gebrauch des Ich – wie die Deutschen ihr Ich behandeln und setzen – § 3 5 vierter: Sinnlichkeit – im komischen Individualisieren durch Teile der Teile – durch Eigennamen – durch Umschreibung des Subjekts und Prädikats.
VIII. Programm. Über den epischen, dramatischen und lyrischen Humor
§ 36 Verwechslung aller Gattungen – Beispiele falschen Tadels und falschen Lobes – § 37 Ironie, als der epische Humor oder das Übergewicht des objektiven Kontrastes – § 38 Der ironische Stoff – Persiflage als Mittelding – § 39 Das Komische des Dramas – Unterschied des episch-komischen und episch-dramatischen Talentes – Übergewicht des objektiven und des subjektiven Kontrastes zugleich – § 40 Der Hanswurst als komischer Chor – § 41 Das lyrische Komische oder die Laune und die Burleske, Übergewicht des subjektiven Kontrastes – Notwendigkeit des Metrums bei der Burleske, sowie der Marionetten – komische Wichtigkeit ausländischer Wörter und der gemein-allgemeinen.
Vorrede zur zweiten Auflage
Um die strenge Form und die Gleichförmigkeit des Ganzen auch in der Vorrede zu behaupten, will ich sie in Paragraphen schreiben.
§ 1
Wer keine Achtung für das Publikum zu haben vorgibt oder wagt, muß unter demselben das ganze lesende verstehen; aber wer für seines, von welchem er ja selber bald einen lesenden, bald einen schreibenden Teil ausmacht, nicht die größte durch die jedesmalige höchste Anstrengung, deren er fähig ist, beweiset, begeht Sünde gegen den heiligen Geist der Kunst und Wissenschaft, vielleicht aus Trägheit oder Selbstgefälligkeit oder aus sündiger fruchtloser Rache an siegreichen Tadlern. Dem eignen Publikum trotzen, heißt dann einem schlechtern schmeicheln; und der Autor tritt von seiner Geistes-Brüdergemeine über zu einer Stiefbrüdergemeine. Und hat er nicht auch in der Nachwelt ein Publikum zu achten, dessen Beleidigung durch keinen Groll über ein gegenwärtiges zu rechtfertigen ist?
§ 2
Dieses soll mich entschuldigen, daß ich in dieser neuen Ausgabe nach vier bis fünf Kunstrichtern sehr viel gefragt (§ 1) und auf ihre Einwürfe entweder durch Zusetzen oder Weglassen zu antworten gesucht; und der Jenaer, der Leipziger Rezensent, Bouterwek und Köppen werden die Antwortstellen schon finden.
§ 3
Besonders waren in diesem ersten Teil dem Artikel vom Romantischen berichtigende Zusätze unentbehrlich (§ 2), so wie dem vom Lächerlichen erläuternde. Auch gepriesene Programme erhielten eben darum (§ 1) überall Zusätze.
§ 4
Im Programme über das Romantische (§ 2. 3) nahm ich besondere Rücksicht, widerlegende und aufnehmende, auf Bouterweks treffliche Geschichte der Künste und Wissenschaften etc. etc., ein Werk, das durch eine so vielseitige Gelehrsamkeit und durch einen so vielseitigen Geschmack – so wie desselben Apodiktik durch philosophischen Geist und schöne Darstellgabe – – noch immer auf ein größeres Lob Anspruch machen darf, als es schon erhalten. Wenn man einer Vielseitigkeit des Geschmacks in diesen absprechenden insularischen Zeiten, worin jeder als ein vulkanisches Eiland leuchten will, gedenkt: so werden Erinnerungen an jene schönere erfreulich und labend, wo man noch wie festes grünes Land zusammenhing, wo ein Lessing Augen, wie später Herder, Goethe, Wieland1 Augen und Ohren für Schönheiten jeder Art offen hatten. Ästhetische Eklektiker sind in dem Grade gut, in welchem philosophische schlecht.
§ 5
Gleichwohl will niemand weniger als ich das neue ästhetische Simplifikations-System verkennen (§ 4) oder kalt ansehen, welches, so wie das Voglersche in der gemeinen Orgel, noch mehr in der poetischen die Pfeifen (nämlich die Dichter) verringert und ausmerzt; und Gleichgültigkeit dagegen wäre um so ungerechter, je höher das Simplifizieren getrieben wird, wie z.B. von Adam Müller, welcher seine Bewunderung großer Dichter (von Novalis und Shakespeare an) schwerlich über einen Postzug von vier Evangelisten hinaus dehnt, wobei ich noch dazu voraussetzen will, daß er sich selber mitzählt. Es ist kaum zu berechnen, wie viel durch Einschränkung auf wenige Heroen der Bewunderung an Leichtigkeit des Urteils über alle Welt und besonders an einer gewissen ästhetischen Unveränderlichkeit oder Verknöcherung gewonnen wird. Letzte geht daher selber – aus Mangel des ästhetischen Minus-Machens – sogar guten Köpfen wie Wieland und Goethe ab, welche mehrmals ihr Bewundern ändern und anders verteilen mußten.
In diesen Fehler fallen neuere ostrazisierende (mit Scherben richtende) Ästhetiker schwerlich; sie sind, da sie im Urteilen wie im Schreiben sogleich kulminierend anfangen, keiner Veränderlichkeit des Steigens unterworfen. Man möchte sie mit den Kapaunen vergleichen, welche sich dadurch über alle Haushähne erheben, daß sie sich niemals mausern, sondern immer die alten Federn führen. Anständiger möchte eine Vergleichung derselben mit dem päpstlichen Stuhle sein, welcher nie einen Ausspruch zurückgenommen und daher noch im römischen Staatskalender von 1782 Friedrich den Einzigen als einen bloßen Marquis aufstellte.2
§ 6
Sehr mit Unrecht beschuldigten Kunstrichter (§ 2 vergl. § II. 12) die Vorschule: »sie sei keine Ästhetik, sondern nur eine Poetik«; denn ich zeige leicht, daß sie nicht einmal diese ist – sonst müßte viel von Balladen, Idyllen, beschreibenden Gedichten und Versbauten darin stehen –, sondern, wie schon das erste Wort des Buchs auf dem Titelblättchen sagt, eine Vorschule (Proscholium). Es wäre nur zu wünschen gewesen, jeder hätte aus seiner eigenen geringen Belesenheit besser gewußt, was eine Vorschule im Mittelalter eigentlich geheißen; daher will ich, was darüber die folgende erste Vorrede zu kurz andeutet, hier in der zweiten weitläuftiger fassen. Nämlich nach Du Fresne III. 495. und ferner nach Jos. Scal. lect. Auson. l. I. c. 15. war – wenn ich auf den Pancirollus de artib. perd. bauen darf, aus welchem ich beide Citata citiere (Anführungen anführe) – – das Proscholium ein Platz, welchen ein Vorhang von dem eigentlichen Hörsaale abschied, und wo der Vorschulmeister (Proscholus) die Zöglinge in Anstand, Anzug und Antritt für den verhangnen Lehrer zuschnitt und vorbereitete. – Aber wollte ich denn in der Vorschule etwas anders sein als ein ästhetischer Vorschulmeister, welcher die Kunstjünger leidlich einübt und schulet für die eigentlichen Geschmacklehrer selber? – Daher glaubt' ich aber auch meiner Konduitenmeister-Pflicht genug getan zu haben, wenn ich als Proscholus die Kunst-Zöglinge durch Anregen, Schönziehen, Geradehalten und andere Kallipädie so weit brächte, daß sie alle mit Augen und Ohren fertig daständen, wenn der Vorhang in die Höhe ginge und sich ihnen nun die vielen eigentlichen verhangnen Lehrer auf einem einzigen Lehrstuhle, nämlich dem ästhetischen, beisammen lehrend zeigten, ein Ast, ein Wagner, ein (A.) Müller, ein Krug, dazu Pölitz, Eberhard, hallische Revisoren und noch dreißig andere dazu. Denn bekanntlich ist der ästhetische Lehrstuhl ein Triklinium dreier Parteien (trium operationum mentis), nämlich der kritischen, der naturphilosophischen und der eklektischen.
§ 7
Aber leider gerade dieser ästhetische Dreimaster (§ 6) lud mehr als eine Rüge und Stinkblume für den armen Vorschulmeister aus. System vermißten fast alle – besonders die kantischen Formschneider – und Vollständigkeit viele. Krug fragte, wo denn die von ihm erfundenen Kalleologien, Hypseologien, Syngeneiologien, Krimatologien, Kalleotechniken und andere griechische Wörter wären, ordentlicher Ordnung nicht einmal zu gedenken. Andere vermißten noch tiefsinnigere Wörter, poetische Indifferenzen des Absoluten und Menschlichen – objektive Erscheinungen des Göttlichen im Irdischen – Durchdringungen des Raums und der Zeit in den unendlichen Ideen des Unendlichen als Religion – schwächerer Wörter wie negative und positive Polaritäten gar nicht zu erwähnen. – Die Eklektischen hingegen führten als Widerspiele der Absoluten und der Kritischen nicht über Mangel, sondern über Überfluß der besten tiefsinnigen Wörter Klagen. – So dreimal von Cerberus gebissen, half diesmal mir also mein alter Grundsatz sehr schlecht, lieber drei Parteien auf einmal zu schmeicheln, als gegen eine das Schwert des Tadels zu ziehen, durch welches man regelmäßig umkommt; so wie – ist den Parteien das Gleichnis nicht zu hergeholt – gerade die drei größten Tragiker, welche so vielen tragischen Tod antaten, sämtlich einen seltsamen erfuhren, Sophokles durch einen Weinbeerkern, Äschylos durch eine herunterfallende Schildkrötenschale, Euripides durch Hunde.
§ 8
In der Tat durfte ein Mann wie der Proscholus wohl eines bessern Empfangs (§ 7) von dem Dreifuße der ästhetischen Dreiuneinigkeit gewärtig sein, wenn er sich lebhaft dachte, mit welchem Fleiße er seine Vorschule gerade nach den verschiedenen Anleitungen, welche ihm teils die Kritischen und die Absoluten, teils die Eklektischen zureichten, auszuarbeiten und auszubauen getrachtet, insofern er nämlich anders – was er freilich nicht selber entscheiden kann – seine Lehrer darin genugsam verstanden, daß er teilweise ihre Anleitungen als die bekannten Vexier-Muster benutzte und befolgte, welche schon längst gute Schulmänner ihren Schülern als absichtliche Verrenkungen zum übenden Graderichten vorlegten. Wie z.B. neulich Pölitz nur »Materialien zum Diktieren, nach einer dreifachen Abstufung vom Leichten zum Schweren geordnet, zur Übung in der deutschen Orthographie, Grammatik und Interpunktion; mit fehlerhaften Schemen für den Gebrauch des Zöglings, zweite verbesserte Ausgabe« herausgab: so sucht' ich in den Geschmacklehren der ästhetischen Dreiuneinigkeit mit reinem Fleiße und ohne Vorliebe alle die Behauptungen auf, welche ich etwa für solche Exerzier- und Vexier-Schemen nehmen durfte, die nur dazu geschrieben wären, damit ein angehender Ästhetiker wie ich an ihnen sich so lange versuchte und übte, bis er durch deren Umsetzen, Zurück-anagrammatisieren und Transsubstantiieren die rechte Ästhetik herausbrächte und gäbe. – Wenigstens werde man in diesen Arbeiten nach einer regula falsi, hofft der Vorschulmeister, die gute Absicht nicht verkennen, seie auch der Erfolg zuweilen so, daß der Unterschied zwischen der Vexier- und der Ernst-Ästhetik hätte größer sein können. Nur ist dergleichen nicht leicht. Erstlich die Geschmacklehren der Eklektischen sagen alles, nämlich alles, was schon dagewesen; nun gibt zwar dieses Wiederholen überhaupt den Gelehrten so viel Wert und Übergewicht von Überredung, daß sie mit diesem Wiederholen von eignen und fremden Wiederholungen dem Echo gleichen, welches man desto höher achtet, je öfter es nachgesprochen; aber wie sind diese Pölitzisch-fehlerhafte Schemen anders zu benutzen, als daß man geradezu statt des Alten etwas Neues sagt? Nur schwer ists. –
Was zweitens die Kritischen und drittens die Absoluten anlangt: so hat man anfangs ebensoviel Not, sie zu verstehen, als nachher sie vorteilhaft für den Künstler umzusetzen und zu verdichten; nämlich so sehr und so weit und breit lösen sie alles feste Bestimmte in ein unabsehliches Unbestimmte und in Luft- und Ätherkreis auf. Z.B. Obstacles schreiben sie in ihrer langen abstrakten Sprache immer so: haut beu seu tua queles. Wer würde dies erraten, wenn er nicht vorher im Korrespondenten für Deutschland3 gelesen hätte, daß wirklich ein Graf von L. R. auf seiner hohen Kriegsstufe zwar sehr grausende Arbeiten und Hindernisse glücklich besiegte, aber doch keine größern kannte, als einen Brief, ja ein Wort orthographisch zu schreiben, und daß er in der Tat unfigürlich das obige Wort obstacles
o-b s-ta-cles
so geschrieben: haut beu seu tua queles.
§ 9
Kurz die gegenwärtige Vorschule oder Vor-Geschmacklehre sollte nicht sowohl den Philosophen, denen ohnehin wenig zu sagen ist (ausgenommen entweder Gesagtes oder Ihriges), als den Künstlern selber, aus welchen sie mit reinen, aber nicht Danaiden-Gefäßen geschöpft worden, schwache Dienste leisten. Unter die letzten, woraus Proscholus geschöpft, gehört er selber. – Man wendet zwar gut ein, daß die Praxis der Künstler unvermerkt die Theorie derselben leite und verleite; aber man füge auch bei, daß auch rückwärts die Lehre die Tat beherrsche; so daß daher z. B. Lessings Fabeln und Lessings Fabellehre einander wechselseitig zeugten und formten. Ja zuletzt muß sich der bloße Philosoph, der nicht Täter, nur Prediger des Worts ist und also keine ästhetische Taten durch ästhetische Prachtgesetze heimlich zu beschirmen hat, eine ähnliche Lage gestehen; denn sein Geschmack für Schönheiten reifte doch seiner Geschmacklehre voraus, und seine ästhetischen Theodoren griffen in den ästhetischen Justinian ein. Und sogar dies ist noch besser, als wenn taube Taktschläger, welche die ganze poetische Sphären-Musik nur aus den stummen Noten der Partitur mehrer Ästhetiker kennen, daraus ihren Generalbaß abziehen. Daher war von jeher die ausübende Gewalt die beste zur gesetzgebenden4; Klopstock, Herder, Goethe, Wieland, Schiller, Lessing waren früher Dichter denn Selbstgeschmacklehrer; ja man könnte, wenn man ästhetische Aussprüche teils von beiden Schlegeln, Bouterwek, Franz Horn, Klingemann etc. etc., obwohl einander unähnlicher Schriftsteller, teils von Sulzer, Eberhard, Krug etc. etc. läse und wägte, leicht erraten, welche Partei nie gedichtet. Die Ästhetik des Täters ist ein Oberons-Horn, das zum Tanzen, die des bloßen Wissenschaftlers oft ein Astolfos-Horn, das zum Entlaufen bläset, wenigstens manchen Jünglingen, welche so gern für Schönheiten lebten und stürben.
§ 10
Nach dem vorigen Paragraphen (§ 9) ists fast hart, wenn sanfte Rezensionen einem Manne nicht zutrauen, daß ihm weniger daran gelegen sei, wer als was recht hat, sondern glauben, der Mann heize (als Kalefaktor) seine Vorschulstuben bloß, um sich und einige Leser seiner Scherze warm zu halten. Wär' es nicht ebenso ungerecht, bloß daraus, daß z.B. Pölitz in seiner Ästhetik den Witz gar nicht berührte, auf einen Haß desselben gegen wahren zu raten, als es wirklich ungerecht ist, aus einem langen Programme über Witz auf Vorliebe für falschen zu schließen?
§ 11
Auf der einen Seite bleibt Rezensenten, welche für das Publikum Goldfische sauber abzuschuppen oder Juwelenkolibri nett abzurupfen haben, um zu zeigen, was überhaupt an ihnen ist, wohl das alte gute Recht unbestritten, daß sie, so genau sie es im Widerlegen mit Kleinigkeiten zu nehmen haben, dafür das Wichtige oder Schwere bloß im allgemeinen anzuführen und statt einer Prüfung nur beizusetzen brauchen, daß manches, z.B. das Kapitel über den Humor, eine genaue wirklich verdiene.
§ 12
Auf der andern Seite (§ 11) bestehen die Lehrbuchschreiber mit Recht auf einem ebensogut hergebrachten Privilegium fest; welches am deutlichsten so lautet: »Sobald ein Lehrbuchmacher irgend etwas Neues zu sagen weiß, so steht ihm eo ipso uneingeschränkt das Recht zu, so viel Altes dazu abzuschreiben, bis er aus beiden ein ordentliches vollständiges Lehrbuch fertig hat.« Die Benutzung dieses so wichtigen Freiheitbriefs behält sich der Verfasser für die dritte Auflage vor, wo er zu seinen eignen Gedanken so viele fremde über Ton- und Malkunst, Vers- und Hausbau, Bildhauen und Reiten und Tanzen abschreiben will, daß der akademische Lehrer ein Lehrbuch in die Hand bekommt, zumal da ihm ein Lehrbuch lieber ist als zehn Lesebücher, weil er lieber über etwas als etwas lieset.
§ 13
Diese zweite Vorrede will nur die heitere Paraphrase der ersten sein (§ 14), welche ihr nachfolgt und sogleich so viel Ernstes mitbringt, daß nachher der Übergang leicht ist in den wissenschaftlichen Ernst des ganzen Werks.
§ 14
Indessen Scherz billigen in unsern Zeiten viele; denn er hält eben den wenigen noch von Jahrhundert und Unglück nicht aufgeriebenen Ernst fest aufbewahrt; der biegsame geschmeidige Scherz ist der Ring von Gold, den man an den Finger ansteckt, damit der Ring mit Diamanten nicht abgleite.
§ 15
Geschrieben in Baireuth am Petri-Pauli-Tag, als, wie bekannt, gerade der Hesperus am hellsten schimmerte. 1812.
Jean Paul Fr. Richter
Vorrede zur ersten Ausgabe
Wenn die Menge der Schöpfungstage zwar nicht immer den Werken der Darstellung, aber allezeit den Werken der Untersuchung vorteilhaft ist: so darf der Verfasser nachstehendes Buch mit einiger Hoffnung übergeben, da er auf dasselbe so viel solcher Tage verwandte als auf alle seine Werke zusammengenommen, nämlich über zehntausend; indem es ebensowohl das Resultat als die Quelle der vorigen und mit ihnen in aufsteigender und in absteigender Linie zugleich verwandt ist.
Von nichts wimmelt unsere Zeit so sehr als von Ästhetikern. Selten wird ein junger Mensch sein Honorar für ästhetische Vorlesungen richtig erlegen, ohne dasselbe nach wenigen Monaten vom Publikum wieder einzufordern für etwas ähnliches Gedrucktes; ja manche tragen schon mit diesem jenes ab.
Es ist sehr leicht, mit einigen abgerissenen Kunsturteilen ein Kunstwerk zu begleiten, d.h. aus dessen reichem gestirnten Himmel sich Sterne zu beliebigen Bildern der Einteilung zusammenzulesen. Etwas anderes aber als eine Rezension ist eine Ästhetik, obgleich jedes Urteil den Schein einer eignen hinterhaltigen geben will.
Indes versuchen es einige und liefern das, was sie wissenschaftliche Konstruktion nennen. Allein wenn bei den englischen und französischen Ästhetikern, z.B. Home, Beattie, Fontenelle, Voltaire, wenigstens der Künstler etwas, ogleich auf Kosten des Philosophen, gewinnt, nämlich einige technische Kallipädie: so erbeutet bei den neuern transzendenten Ästhetikern der Philosoph nicht mehr als der Künstler, d.h. ein halbes Nichts. Ich berufe mich auf ihre zwei verschiedene Wege, nichts zu sagen. Der erste ist der des Parallelismus, auf welchem Reinhold, Schiller und andere ebensooft auch Systeme darstellen; man hält nämlich den Gegenstand, anstatt ihn absolut zu konstruieren, an irgendeinen zweiten (in unserm Falle Dichtkunst etwa an Philosophie, oder an bildende und zeichnende Künste) und vergleicht willkürliche Merkmale so unnütz hin und her, als es z.B. sein würde, wenn man von der Tanzkunst durch die Vergleichung mit der Fechtkunst einige Begriffe beibringen wollte und deswegen bemerkte, die eine rege mehr die Füße, die andere mehr die Arme, jene sich nur mehr in krummen, diese mehr in geraden Linien, jene für, diese gegen einen Menschen etc. Ins Unendliche reichen diese Vergleichungen, und am Ende ist man nicht einmal beim Anfange. Möge der reiche warme Görres diese vergleichende Anatomie oder vielmehr anatomische Vergleichung gegen eine würdigere Bahn seiner Kraft vertauschen!5
Der zweite Weg zum ästhetischen Nichts ist die neueste Leichtigkeit, in die weitesten Kunstwörter – jetzo von solcher Weite, daß darin selber das Sein nur schwimmt – das Gediegenste konstruierend zu zerlassen; z.B. die Poesie als die Indifferenz des objektiven und subjektiven Pols zu setzen. Dies ist nicht nur so falsch, sondern auch so wahr, daß ich frage: was ist nicht zu polarisieren und zu indifferenzieren? –
Aber der alte unheilbare Krebs der Philosophie kriecht hier rückwärts, daß sie nämlich auf dem entgegengesetzten Irrwege der gemeinen Leute, welche etwas zu begreifen glauben, bloß weil sie es anschauen, umgekehrt das anzuschauen meint, was sie nur lenkt. Beide Verwechslungen des Überschlagens mit dem Innestehen gehören bloß der Schnellwaage einer entgegengesetzten Übung an.
Hat nun hier schon der Philosoph nichts – was für ihn doch immer etwas ist –, so lässet sich denken, was der Künstler haben möge, nämlich unendlich weniger. Er ist ein Koch, der die Säuren und Schärfen nach dem Demokritus zubereiten soll, welcher den Geschmack derselben aus den winklichten Anschießungen aller Salze (wiewohl die Zitronensäure so gut wie Öl aus Kugelteilen besteht) zu konstruieren suchte.
Ältere deutsche Ästhetiker, welche Künstlern nützen wollten, ließen sich statt des transzendenten Fehlers, den Demant der Kunst zu verflüchtigen und darauf uns seinen Kohlenstoff vorzuzeigen, den viel leichtern zu Schulden kommen, den Demant zu erklären als ein Aggregat von – Demantpulver. Man lese in Riedels unbedeutender Theorie der schönen Künste z.B. den Artikel des Lächerlichen nach, das immer aus einer »drollichten, unerwarteten, scherzhaften, lustigen Zusammensetzung« zusammengesetzt wird – oder in Platners alter Anthropologie die Definition des Humors, welche bloß in den Wiederholungen des Worts: Sonderbar besteht – oder gar in Adelung. Die heuristischen Formeln, welche der Künstler von undichterischen Geschmacklehrern empfängt, lauten alle wie eine ähnliche in Adelungs Buch über den Stil6: »Briefe, welche Empfindungen und Leidenschaften erregen sollen, finden in der rührenden und pathetischen Schreibart Hülfsmittel genug, ihre Absicht zu erreichen«, sagt er und meint seine zwei Kapitel über die Sache. In diesen logischen Zirkel ist jede undichterische Schönheit-Lehre eingekerkert.
Noch willkürlicher als die Erklärungen sind die Einteilungen, welche das künftig erscheinende Geisterreich, wovon jeder einzelne vom Himmel steigende Genius ein neues Blatt für die Ästhetik mitbringt, abschneiden und hinaussperren müssen, da sie es nicht antizipieren können. Darum sind die säkularischen Einteilungen der Musenwerke so wahr und scharf als in Leipzig die vierfache Einteilung der Musensöhne in die der fränkischen, polnischen, meißnischen und sächsischen Nation; – welche Vierherrschaft (Tetrarchie) in Paris im Gebäude der vier Nationen wiederkommt. Jede Klassifikation ist so lange wahr, als die neue Klasse fehlt.
Die rechte Ästhetik wird daher nur einst von einem, der Dichter und Philosoph zugleich zu sein vermag, geschrieben werden; er wird eine angewandte für den Philosophen geben, und eine angewandtere für den Künstler. Wenn die transzendente bloß eine mathematische Klanglehre ist, welche die Töne der poetischen Leier in Zahlen-Verhältnisse auflöset: so ist die gemeinere nach Aristoteles eine Harmonistik (Generalbaß), welche wenigstens negativ tonsetzen lehrt. Eine Melodistik gibt der Ton- und der Dichtkunst nur der Genius des Augenblicks; was der Ästhetiker dazu liefern kann, ist selber Melodie, nämlich dichterische Darstellung, welcher alsdann die verwandte zutönt. Alles Schöne kann nur wieder durch etwas Schönes sowohl bezeichnet werden als erweckt.
Über die gegenwärtige Ästhetik hab' ich nichts zu sagen, als daß sie wenigstens mehr von mir als von andern gemacht und die meinige ist, insofern ein Mensch im druckpapiernen Weltalter, wo der Schreibtisch so nah' am Bücherschranke steht, das Wort mein von einem Gedanken aussprechen darf. Indes sprech' ich es aus von den Programmen über das Lächerliche, den Humor, die Ironie und den Witz; ihnen wünscht' ich wohl bei forschenden Richtern ein aufmerksames, ruhiges Durchblättern, und folglich der Verknüpfung wegen auch denen, die teils vor, teils hinter ihnen stehen, und andere sind ohnehin nicht da. Übrigens könnte jeder Leser bedenken, daß, wie ein gegebener Autor einen gegebenen Leser voraussetzt, so ein gebender einen gebenden, z.B. der Fernschreiber (Telegraph) stets ein Fernrohr. Kein Autor erdreistet sich, allen Lesern zu schreiben; gleichwohl erkeckt sich jeder Leser, alle Autoren zu lesen.
In unsern kritischen Tagen einer kranken Zeit muß Fieber, in der gegenwärtigen Reformation-Geschichte muß Bauernkrieg, kurz, jetzo in unserer Arche, woraus der Rabe wie über die alte Sündflut früher ausgeschickt wurde als die Taube, welche wieder kam mit einem grünen Zweig, muß der Zorn regieren; und vor ihm bedarf jeder einiger Entschuldigung, der in Milde hineingerät und wie Pythagoras und Numa statt lebendiges Fleisch und Blut nur Mehl und Wein zum Opfer bringt. Ich will nicht leugnen, daß ich im letzten Falle bin; ich weiß, wie wenig ich über berühmte Schriftsteller tadelnde Urteile mit jener schneidenden Schärfe gefällt, welche literarische Kopfabschneider und Vertilgung-Krieger fodern können. Spricht man von der Schärfe des Lachens, so gibt es allerdings keine zu große. Hingegen in Rücksicht des Ernstes, behaupte ich, ist an und für sich Melanchthons Milde so sittlich-gleichgültig als Luthers Strenge, sobald nur der eine wie der andere den Tadel ohne persönliche Freude – ungleich jetzigen Reich-Sturm-Fahnen-Junkern –, das Lob hingegen ohne persönliche Freude – ungleich schlaffem langen Gewürm, das Füße und den davon abgeschüttelten Staub leckt – austeilt. Nicht Unparteilichkeit ist dem Erden-Menschen anzusinnen, sondern nur Bewußtsein derselben, und zwar eines, das sich nicht nur eines guten Zieles, auch guter Mittel bewußt ist.
Da der Verfasser dieses lieber für jedes Du parteiisch sein will als für ein Ich: so befiehlt er seinen Lesern, nicht etwa in dieser philosophischen Baute ein heimliches ästhetisches Ehr- und Lehrgebäude, an meine biographischen Bauten angestoßen, eine Zimmermannbaurede oben auf dem Giebel des Gebäudes zu erwarten, sondern lieber das Gegenteil. Schneidet denn der Professor der Moral eine Sittenlehre etwa nach seinen Sünden zu? Und kann er denn nicht Gesetze zugleich anerkennen und übertreten, folglich aus Schwäche, nicht aus Unwissenheit? Das ist aber auch der Fall der ästhetischen Professuren.
Als rechte Unparteilichkeit rechnet er es sich an, daß er fast wenige Autoren mit Tadel belegte als solche, die großes Lob verdienen; nur diese sind es wert, daß man sie so wie Menschen, die selig werden, in das Fegfeuer wirft; in die Hölle gehören die Verdammten. Man sollte auf Mode-Köpfe so wenig als auf Modekleider Satiren machen, da an beiden die Individualität so schnell verfliegt und nichts besteht als die allgemeine Narrheit; sonst schreibt man Ephemeriden der Ephemeren (Tagblätter der Eintagfliegen).
Sollt es' dem Werke zu sehr an erläuternden Beispielen mangeln7: so entschuldigt man es mit der Eigenheit des Verfassers, daß er selten Bücher besitzt, die er bewundert und auswendig kann. Wie Themistokles eine Vergessenheit-Kunst gegen Beleidigungen, so wünscht er eine gegen deren Gegenteil, die Schönheiten; und wenn Platner wahr bemerkt, daß der Mensch mehr seiner Freuden als seiner Leiden sich erinnere: so ist dies bloß schlimm bei ästhetischen. Oft hat er deswegen – um nur etwas zu haben ein ausländisches Werk, das er unendlich liebte, in einer schlechtern Übersetzung oder im Original oder im Nach- oder im Prachtdruck wiedergelesen. Nie wird er daher – insofern es vom Willen abhängt – etwa wie Skaliger den Homer in 21 Tagen und die übrigen griechischen Dichter in vier Monaten auswendig gelernt hersagen, oder mit Barthius den Terenz im 9ten Jahre vor seinem Vater abbeten – eben aus Furcht, die Grazien zu oft nackt zu sehen, welche die Vergessenheit, wie ein Sokrates, reizend bekleidet.
Noch ist einiges zu sagen, was weniger den Leser des Werks als den Literator interessiert. Der Titel Vorschule, Proscholium, wo sonst den Schülern äußerlicher oder eleganter Unterricht im Schulhofe zukam, hatte anfangs Programmen oder Einladungschriften zu dem Proscholium oder der Vorschule einer Ästhetik (noch ist davon im Werk die Einteilung in Programmen) heißen sollen; indes da er – wie die gewöhnlichen Titel: Leitfaden zur, erste Linien einer, Versuch einer Einleitung in – mehr aus Bescheidenheit gewählt worden als aus Überzeugung: so hoff' ich wird auch der bloße abgekürzte einfache Titel »Vorschule der Ästhetik« nicht ganz unbescheiden das ausdrücken, was er sagen will, nämlich: eine Ästhetik.
Angefügt sind noch die drei Leipziger Vorlesungen für sogenannte Stilistiker und für Poetiker, d.h. von mir so genannt. Ich wünsche nämlich, daß die prosaische Partei im neuesten Kriege zwischen Prose und Poesie – der kein neuer, nur ein erneuerter, aber vor-und rückwärts ewiger ist – mir es verstatte, sie Stilistiker zu nennen, unter welchen ich nichts meine als Menschen ohne allen poetischen Sinn. Dichten sie (will ich damit sagen), so wirds symmetrisch ausgeteilte Dinte, nachher in Druckerschwärze abgeschattet; – leben sie, so ists spieß- und pfahlbürgerlich in der fernsten Vorstadt der sogenannten Gottes-Stadt; – machen sie Urteile und Ästhetiken, so scheren sie die Lorbeerbäume, die Erkenntnis- und die Lebensbäume in die beliebigen Kugelformen der gallischen Vexier-Gärtnerei, z.B. in runde, spitze Affenköpfe (»o Gott,« sagen sie, »es ahme doch stets die Kunst dem Menschen nach, freilich unter Einschränkung!«).
Diesen ästhetischen Piccinisten stehen nun gegenüber die ästhetischen Gluckisten, wovon ich diejenigen die Poetiker nenne, die nicht eben Poeten sind. Meine innigste Überzeugung ist, daß die neuere Schule im Ganzen und Großen recht hat und folglich endlich behält – daß die Zeit die Gegner selber so lange verändern wird, bis sie die fremde Veränderung für Bekehrung halten – und daß die neue polarische Morgenröte nach der längsten Nacht, obwohl einen Frühling lang ohne Phöbus oder mit einem halben8 täglich erscheinend, doch nur einer steigenden Sonne vortrete. Ebenso ist seit der Thomas-Sonnen-Wende von und in Kant endlich die Philosophie so viele winterliche Zeichen vom dialektischen Steinbock an bis durch die kritischen Wassermänner und kalten Fische durchlaufen, daß sie jetzo wirklich unter den Frühlingszeichen den Widder und Stier hinter sich hat, wenn man zwei bekannte Häupter hinter dem Oberhaupt Kant so nennen will, welche sich gegenseitig Lehrer, Nachahmer, Freunde und Widerleger geworden – und in das Zeichen der Zwillinge, der Vermählung der Religion und Philosophie, aufsteigt. Früher stand Jacobi einsam da und voraus; jetzo schlingt der Deutsche immer vielfacher um Philosophie und Religion ein Band, und Clodius, der Verfasser der allgemeinen Religionslehre, ist nicht der letzte; die Poesie feiert diese Vermählung mit ihrem großen Hochzeitgedicht auf das All.
Was übrigens gleichwohl wider die Poetiker zu sagen ist nun, die zweite Vorlesung hats ihnen schon in der Ostermesse gesagt. Denn es ist wohl klar, daß sie jetzo – weil jede Verdauung (sogar die der Zeit) ein Fieber ist – umgekehrt jedes Fieber für eine Verdauung (nämlich keiner bloßen Krankheitmaterie, sondern eines Eßmittels) ansehen. –
Wenn Bayle strenge, aber mit Recht das historische Ideal mit den Worten: »la perfection d'une histoire est d'être desagréable à toutes les sectes« aufstellt: so glaubt' ich, daß dieses Ideal auch der literarischen Geschichte vorzuschweben habe; wenigstens hab' ich darnach gerungen, keiner Partei weniger zu mißfallen als der andern. Möchten doch die Parteien, die ich eben darum angefallen, unparteiisch entscheiden (es ist mein Lohn), ob ich das Ziel der Vollkommenheit errungen, das Bayle begehrt.
Möge diese Vorschule nicht in eine Kampf- oder Trivialschule führen, sondern etwa in eine Spinn-, ja in eine Samenschule, weil in beiden etwas wächst.
Baireuth, den 12. August 1804.
Jean Paul Fr. Richter
I. Programm
Über die Poesie überhaupt
§ 1
Ihre Definitionen
Man kann eigentlich nichts real definieren als eine Definition selber; und eine falsche würde in diesem Falle so viel vom Gegenstande als eine wahre lehren. Das Wesen der dichterischen Darstellung ist wie alles Leben nur durch eine zweite darzustellen; mit Farben kann man nicht das Licht abmalen, das sie selber erst entstehen lässet. Sogar bloße Gleichnisse können oft mehr als Worterklärungen aussagen, z.B.: »die Poesie ist die einzige zweite Welt in der hiesigen; – oder: wie Singen zum Reden, so verhält sich Poesie zur Prose; die Singstimme steht (nach Haller) in ihrer größten Tiefe doch höher als der höchste Sprechton; und wie der Sington schon für sich allein Musik ist, noch ohne Takt, ohne melodische Folge und ohne harmonische Verstärkung, so gibt es Poesie schon ohne Metrum, ohne dramatische oder epische Reihe, ohne lyrische Gewalt.« Wenigstens würde in Bildern sich das verwandte Leben besser spiegeln als in toten Begriffen – – nur aber für jeden anders; denn nichts bringt die Eigentümlichkeit der Menschen mehr zur Sprache als die Wirkung, welche die Dichtkunst auf sie macht; und daher werden ihrer Definitionen ebenso viele sein als ihrer Leser und Zuhörer.
Nur der Geist eines ganzen Buchs – der Himmel schenk' ihn diesem – kann die rechte enthalten. Will man aber eine wörtliche kurze: so ist die alte aristotelische, welche das Wesen der Poesie in einer schönen (geistigen) Nachahmung der Natur bestehen lässet, darum verneinend die beste, weil sie zwei Extreme ausschließet, nämlich den poetischen Nihilismus und den Materialismus. Bejahend aber wird sie erst durch nähere Bestimmung, was eine schöne oder geistige Nachahmung eigentlich sei.
§ 2
Poetische Nihilisten
Es folgt aus der gesetzlosen Willkür des jetzigen Zeitgeistes – der lieber ichsüchtig die Welt und das All vernichtet, um sich nur freien Spiel-Raum im Nichts auszuleeren, und welcher den Verband seiner Wunden als eine Fessel abreißet –, daß er von der Nachahmung und dem Studium der Natur verächtlich sprechen muß. Denn wenn allmählich die Zeitgeschichte einem Geschichtschreiber gleich wird und ohne Religion und Vaterland ist: so muß die Willkür der Ichsucht sich zuletzt auch an die harten, scharfen Gebote der Wirklichkeit stoßen und daher lieber in die Öde der Phantasterei verfliegen, wo sie keine Gesetze zu befolgen findet als eigne, engere, kleinere, die des Reim- und Assonanzen-Baues. Wo einer Zeit Gott, wie die Sonne, untergehet; da tritt bald darauf auch die Welt in das Dunkel; der Verächter des All achtet nichts weiter als sich und fürchtet sich in der Nacht vor nichts weiter als vor seinen Geschöpfen. Spricht man denn nicht jetzo von der Natur, als wäre diese Schöpfung eines Schöpfers worin ihr Maler selber nur ein Farbenkorn ist – kaum zum Bildnagel, zum Rahmen der schmalen gemalten eines Geschöpfes tauglich; als wäre nicht das Größte gerade wirklich, das Unendliche? Ist nicht die Geschichte das höchste Trauer- und Lustspiel? Wenn uns der Verächter der Wirklichkeit nur zuerst die Sternenhimmel, die Sonnenuntergänge, die Wasserfalle, die Gletscherhöhen, die Charaktere eines Christus, Epaminondas, der Katos vor die Seele bringen wollten, sogar mit den Zufälligkeiten der Kleinheit, welche uns die Wirklichkeit verwirren, wie der große Dichter die seinige durch kecke Nebenzüge; dann hätten sie ja das Gedicht der Gedichte gegeben und Gott wiederholt. Das All ist das höchste, kühnste Wort der Sprache, und der seltenste Gedanke: denn die meisten schauen im Universum nur den Marktplatz ihres engen Lebens an, in der Geschichte der Ewigkeit nur ihre eigene Stadtgeschichte.
Wer hat mehr die Wirklichkeit bis in ihre tiefsten Täler und bis auf das Würmchen darin verfolgt und beleuchtet als das Zwillingsgestirn der Poesie, Homer und Shakespeare? Wie die bildende und zeichnende Kunst ewig in der Schule der Natur arbeitet: so waren die reichsten Dichter von jeher die anhänglichsten, fleißigsten Kinder, um das Bildnis der Mutter Natur andern Kindern mit neuen Ähnlichkeiten zu übergeben. Will man sich einen größten Dichter denken, so vergönne man einem Genius die Seelenwanderung durch alle Völker und alle Zeiten und Zustände und lasse ihn alle Küsten der Welt umschiffen: welche höhere, kühnere Zeichnungen ihrer unendlichen Gestalt würd' er entwerfen und mitbringen! Die Dichter der Alten waren früher Geschäftmänner und Krieger als Sänger; und besonders mußten sich die großen Epopöen-Dichter aller Zeiten mit dem Steuerruder in den Wellen des Lebens erst kräftig üben, ehe sie den Pinsel, der die Fahrt abzeichnet, in die Hände bekamen.9 So Camoens, Dante, Milton etc.; und nur Klopstock macht eine Ausnahme, aber fast mehr für als wider die Regel. Wie wurden nicht Shakespeare und noch mehr Cervantes vom Leben durchwühlt und gepflügt und gefurcht, bevor in beiden der Blumensame ihrer poetischen Flora durchbrach und aufwuchs! Die erste Dichterschule, worein Goethe geschickt wurde, war nach seiner Lebenbeschreibung aus Handwerkerstuben, Malerzimmern, Krönungsälen, Reicharchiven und aus ganz Meß-Frankfurt zusammengebauet. So bringt Novalis – ein Seiten- und Wahlverwandter der poetischen Nihilisten, wenigstens deren Lehenvetter – uns in seinem Romane gerade dann eine gediegenste Gestalt zu Tage, wenn er uns den Bergmann aus Böhmen schildert, eben weil er selber einer gewesen.
Bei gleichen Anlagen wird sogar der unterwürfige Nachschreiber der Natur uns mehr geben (und wären es Gemälde in Anfangbuchstaben) als der regellose Maler, der den Äther in den Äther mit Äther malt. Das Genie unterscheidet sich eben dadurch daß es die Natur reicher und vollständiger sieht, so wie der Mensch vom halbblinden und halbtauben Tiere; mit jedem Genie wird uns eine neue Natur erschaffen, indem es die alte weiter enthüllet. Alle dichterische Darstellungen, welche eine Zeit nach der andern bewundert, zeichnen sich durch neue sinnliche Individualität und Auffassung aus. Jede Sternen-, Pflanzen-, Landschaft- und andere Kunde der Wirklichkeit ist einem Dichter mit Vorteil anzusehen, und in Goethens gedichteten Landschaften widerscheinen seine gemalten. So ist dem reinen durchsichtigen Glase des Dichters die Unterlage des dunkeln Lebens notwendig, und dann spiegelt er die Welt ab. Es geht hier mit den geistigen Kindern, wie nach der Meinung der alten Römer mit den leiblichen, welche man die Erde berühren ließ, damit sie reden lernten.
Jünglinge finden ihrer Lage gemäß in der Nachahmung der Natur eine mißliche Aufgabe. Sobald das Studium der Natur noch nicht allseitig ist, so wird man von den einzelnen Teilen einseitig beherrscht. Allerdings ahmen sie der Natur nach, aber einem Stücke, nicht der ganzen, nicht deren freiem Geiste mit einem freien Geist. – Die Neuheit ihrer Empfindungen muß ihnen als eine Neuheit der Gegenstände vorkommen; und durch die erstern glauben sie die letzten zu geben. Daher werfen sie sich entweder ins Unbekannte und Unbenannte, in fremde Länder und Zeiten ohne Individualität, nach Griechenland und Morgenland10, oder vorzüglich auf das Lyrische; denn in diesem ist keine Natur nachzuahmen als die mitgebrachte; worin ein Farbenklecks schon sich selber zeichnet und umreißet. Bei Individuen, wie bei Völkern, ist daher Abfärben früher als Abzeichnen, Bilderschrift eher als Buchstabenschrift. Daher suchen dichtende Jünglinge, diese Nachbarn der Nihilisten, z.B. eben Novalis oder auch Kunst-Romanschreiber, sich gern einen Dichter oder Maler oder anderen Künstler zum darzustellenden Helden aus, weil sie in dessen weisen, alle Darstellungen umfassenden Künstlerbusen und Künstlerraum alles, ihr eignes Herz, jede eigne Ansicht und Empfindung kunstgerecht niederlegen können; sie liefern daher lieber einen Dichter als ein Gedicht.
Kommt nun vollends zur Schwäche der Lage die Schmeichelei des Wahns, und kann der leere Jüngling seine angeborne Lyrik sich selber für eine höhere Romantik ausgeben: so wird er mit Versäumung aller Wirklichkeit – die eingeschränkte in ihm selber ausgenommen – sich immer weicher und dünner ins gesetzlose Wüste verflattern; und wie die Atmosphäre wird er sich gerade in der höchsten Höhe ins kraft-und formlose Leere verlieren.
Um deswillen ist einem jungen Dichter nichts so nachteilig als ein gewaltiger Dichter, den er oft lieset; das beste Epos in diesem zerschmilzt zur Lyra in jenem. Ja, ich glaube, ein Amt ist in der Jugend gesünder als ein Buch – obwohl in spätern Jahren das Umgekehrte gilt. – Das Ideal vermischt sich am leichtesten mit jedem Ideal, d.h. das Allgemeine mit dem Allgemeinen. Dann holet der blühende junge Mensch die Natur aus dem Gedicht, anstatt das Gedicht aus der Natur. Die Folge davon und die Erscheinung ist die, welche aus allen Buchläden heraussieht: nämlich Farben-Schatten statt der Leiber; nicht einmal nachsprechende, sondern nachklingende Bilder von Urbildern – fremde, zerschnittene Gemälde werden zu musaischen Stiften neuer Bilder zusammengereiht – und man geht mit fremden poetischen Bildern um, wie im Mittelalter mit heiligen, von welchen man Farben loskratzte, um solche im Abendmahlwein zu nehmen.
§ 3
Poetische Materialisten
Aber ist es denn einerlei, die oder der Natur nachzuahmen, und ist Wiederholen Nachahmen? – Eigentlich hat der Grundsatz, die Natur treu zu kopieren, kaum einen Sinn. Da es nämlich unmöglich ist, ihre Individualität durch irgendein Nachbild zu erschöpfen; da folglich das letzte allezeit zwischen Zügen, die es wegzulassen, und solchen, die es aufzunehmen hat, auswählen muß: so geht die Frage der Nachahmung in die neue über, nach welchem Gesetze, an welcher Hand die Natur sich in das Gebiet der Poesie erhebe.
Der gemeinste Nachdrucker der Wirklichkeit bekennt doch, daß die Weltgeschichte noch keine Epopöe sei – obgleich in einem höhern Sinne wohl –, daß ein wahrer guter Liebesbrief noch in keinen Roman sich schicke – und daß ein Unterschied sei zwischen den Landschaftgemälden des Dichters und zwischen den Auen- und Höhen-Vermessungen des Reisebeschreibers. – Wir führen alle bei Gelegenheit leicht unser ordentliches Gespräch mit Nebenmenschen; gleichwohl ist nichts seltener als ein Schriftsteller, der einen lebendigen Dialog schreiben kann. Warum ist ein Lager noch kein Wallensteinisches von Schiller, das doch vor einem wirklichen wenigstens nicht den Reiz der Ganzheit voraushat?
Hermes' Romane besitzen beinahe alles, was man zu einem poetischen Körper fordert, Weltkenntnis, Wahrheit, Einbildungkraft, Form, Zartsinn, Sprache; da aber ihnen der poetische Geist fehlt, so sind sie die besten Romane gegen Romane und gegen deren zufälliges Gift; man muß sehr viel Geld in Banken und im Hause haben, um die Dürftigkeit, wenn sie in seinen Werken gedruckt vorkommt, lachend auszuhalten. Allein das ist eben unpoetisch. Ungleich der Wirklichkeit, die ihre prosaische Gerechtigkeit und ihre Blumen in unendlichen Räumen und Zeiten austeilet, muß eben die Poesie in geschlossenen beglücken; sie ist die einzige Friedengöttin der Erde und der Engel, der uns, und wär' es nur auf Stunden, aus Kerkern auf Sterne führt; wie Achilles' Lanze muß sie jede Wunde heilen, die sie sticht.11 Gäbe es denn sonst etwas Gefährlicheres als einen Poeten, wenn dieser unsere Wirklichkeit noch vollends mit seiner und uns also mit einem eingekerkerten Kerker umschlösse? Sogar der Zweck sittlicher Bildung, den sich der ebengenannte Romanprediger Hermes vorsetzt, wird, da er ihm mit einem widerdichterischen Geiste nachsetzt, nicht nur verfehlt, sondern sogar gefährdet und untergraben (z.B. im Romane für Töchter edler Herkunft und in der Foltergeschichte des widerlichen moralischen Selbst-Kerkermeisters Herr Kerker).
Gleichwohl bereitet auch der falsche Nachstich der Wirklichkeit einige Lust, teils weil er belehrt, teils weil der Mensch so gern seinen Zustand zu Papier gebracht und ihn aus der verworrenen persönlichen Nähe in die deutlichere objektive Ferne geschoben sieht. Man nehme den Lebentag eines Menschen ganz treu, ohne Farbenmuscheln, nur mit dem Dintenfasse zu Protokoll und lasse ihn den Tag wieder lesen: so wird er ihn billigen und sich wie von lauen linden Wellen umkräuselt verspüren. Sogar einen fremden Lebentag heißet er eben darum gut im Gedicht. Keinen wirklichen Charakter kann der Dichter – auch der komische – aus der Natur annehmen, ohne ihn, wie der Jüngste Tag die Lebendigen, zu verwandeln für Hölle oder Himmel. Gesetzt, irgendein wild und weltfremder Charakter existierte, als der einzige, ohne irgendeine symbolische Ähnlichkeit mit andern Menschen: so könnt' ihn kein Dichter gebrauchen und abzeichnen.
Auch die humoristischen Charaktere Shakespeares sind allgemeine, symbolische, nur aber in die Verkröpfungen und Wülste des Humors gesteckt.
Man erlaube mir noch einige Beispiele von unpoetischen Repetierwerken der großen Weltuhr. »Brockes irdisches Vergnügen in Gott« ist eine so treue dunkle Kammer der äußerlichen Natur, daß ein wahrer Dichter sie wie einen Reisebeschreiber der Alpen, ja wie die Natur selber benutzen kann; er kann nämlich unter den umhergeworfenen Farbenkörnern wählen und sie zu einem Gemälde verreiben. – Die dreimal aufgelegte Luciniade von Lacombe, welche die Geburthelferkunst12 (welch ein Gegen- oder Widerstand für die Poesie!) besingt, so wie die meisten Lehrgedichte, welche uns ihren zerhackten Gegenstand Glied für Glied, obwohl jedes in einige poetische Goldflittern gewickelt, zuzählen, zeigen, wie weit prosaische Nachäffung der Natur abstehe von poetischer Nachahmung. –
Am ekelsten aber tritt diese Geistlosigkeit im Komischen vor. Im Epos, im Trauerspiel versteckt sich wenigstens oft die Kleinheit des Dichters hinter die Höhe seines Stoffs, da große Gegenstände schon sogar in der Wirklichkeit den Zuschauer poetisch anregen – daher Jünglinge gern mit Italien, Griechenland, Ermordungen, Helden, Unsterblichkeit, fürchterlichem Jammer und dergleichen anfangen, wie Schauspieler mit Tyrannen –; aber im Komischen entblößet die Niedrigkeit des Stoffs den ganzen Zwerg von Dichter, wenn er einer ist.13 An den deutschen Lustspielen – man sehe die widrigen Proben, noch dazu der bessern, von Krüger, Gellert und andern in Eschenburgs Beispielsammlung – zeigt der Grundsatz der bloßen Natur-Nachäffung die ganze Kraft seiner Gemeinheit. Es ist die Frage, ob die Deutschen noch ein ganzes Lustspiel haben, und nicht bloß einige Akte. Die Franzosen erscheinen uns daran reicher; aber hier wirkt Täuschung mit, weil fremde Narren und fremder Pöbel an sich, ohne den Dichter, einige poetische Ungemeinheit vorspiegeln.
– Die Briten hingegen sind reicher – obgleich derselbe ideale Trug der Auslandschaft mitwirkt; und ein einziges Buch könnte uns von der Wahrheit überführen. Nämlich Wallstaffs polite Gespräche von Swift malen bis zur Treue – die nur in Swifts parodierendem Geiste sich genial widerspiegelt – Englands Honoratioren gerade so gemeingeistlos ab, wie in den deutschen Lustspielen unsere auftreten; da nun aber diese Langweiligen nie in den englischen erscheinen: so sind folglich über dem Meere weniger die Narren als vielmehr die Lustspielschreiber geistreicher als bei uns. Das Feld der Wirklichkeit ist eben ein in Felder geschachtes Brett, auf welchem der Autor so gut die gemeine polnische Dame als das königliche Schachspiel, sobald er in einem Falle nur Steine, und im andern Figuren und Kunst, spielen kann. Wie wenig Dichtung ein Kopierbuch des Naturbuchs sei, ersieht man am besten an den Jünglingen, die gerade dann die Sprache der Gefühle am schlechtesten reden, wenn diese in ihnen regieren und schreien, und welchen das zu starke Wasser das poetische Mühlenwerk gerade hemmt und nicht treibt, indes sie nach der falschen Maxime der Natur-Affen ja nichts brauchten, als nachzuschreiben, was ihnen vorgesprochen wird. Keine Hand kann den poetischen, lyrischen Pinsel fest halten und führen, in welcher der Fieberpuls der Leidenschaft schlägt. Der bloße Unwille macht zwar Verse, aber nicht die besten; selber die Satire wird durch Milde schärfer als durch Zorn, so wie Essig durch süße Rosinenstiele stärker säuert, durch bittern Hopfen aber umschlägt.
Weder der Stoff der Natur, noch weniger deren Form ist dem Dichter roh brauchbar. Die Nachahmung des erstern setzt ein höheres Prinzip voraus; denn jedem Menschen erscheint eine andere Natur; und es kommt nun darauf an, welchem die schönste erscheint. Die Natur ist für den Menschen in ewiger Menschwerdung begriffen, bis sogar auf ihre Gestalt; die Sonne hat für ihn ein Vollgesicht, der halbe Mond ein Halbgesicht, die Sterne doch Augen, alles lebt den Lebendigen; und es gibt im Universum nur Schein- nicht Schein-Leben. Allein das ist eben der prosaische und poetische Unterschied oder die Frage, welche Seele die Natur beseele, ob ein Sklavenkapitän oder ein Homer.
In Rücksicht der nachzuahmenden Form stehen die poetischen Materialisten im ewigen Widerspruch mit sich und der Kunst und der Natur; und bloß, weil sie halb