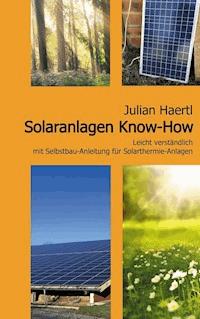9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eulogia Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichte beginnt dort, wo das moderne Leben endet. 2030: Ein weltweiter Stromausfall stürzt die Menschheit ins Chaos. Der junge Collin wird durch eine Verkettung unglücklicher Umstände von seiner Familie getrennt. Für ihn beginnt ein Überlebenskampf in der postapokalyptischen Welt Schwedens. Diese Reise beginnt dort, wo das moderne Leben endet: Wohin soll man gehen, wenn kein Ort mehr sicher scheint? Woran soll man glauben, wem vertrauen, wenn alte Werte nicht mehr zählen? Eine Kommune Überlebender erscheint als letzter Zufluchtsort und als Chance für einen Neuanfang. Aber hinter der friedlichen Fassade verbergen sich nicht nur Hoffnung und Pioniergeist, sondern auch Misstrauen und zwielichtige Gestalten. Nichts ist, wie es scheint. Wer ist Freund, wer ist Feind? Collins Mut und Vertrauen werden immer wieder auf die Probe gestellt, während er nichts unversucht lässt, um seine Familie wiederzufinden. Mysteriöse Dinge geschehen und der erste Mord in der sicher geglaubten Umgebung lässt nicht lange auf sich warten. Ein packender Roman über das Überleben in einer Welt ohne Strom, in der Gewissheiten schwinden und neue Erkenntnisse entstehen – und neue Freundschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
© Julian Haertl
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der ausschließlichen Zustimmung des Autors. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verwertung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
ISBN Print: 978-3-96967-382-9
ISBN E-Book: 978-3-96967-383-6
Originale Erstausgabe 2023© by Eulogia Verlags GmbH
Eulogia Verlags GmbHGänsemarkt 4320354 Hamburg
Lektorat: Sandra PichlerSatz und Layout: Tomasz DębowskiCover: Shutterstock.com – NanyMartin bearbeitet von Aleksandar Petrović
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Inhaltsverzeichnis
1. Endlich eine gute Figur
Eigentlich war die ganze Misere ein Befreiungsschlag. Aber dass es so kommen würde, wie es kam, hätte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen können.
Mein Name ist Jakob. Ich bin seit 47 Jahren auf diesem Planeten und habe eigentlich auch vor, noch etwas länger zu bleiben.
Erst mal zum Guten: Die Superreichen, sofern es noch welche gibt, können heute mit ihrem Geld und Einfluss nichts mehr anfangen. Ich will nicht sagen, dass die Machtgeilheit einiger von ihnen zu alledem geführt hat, aber es nimmt im Ranking der Möglichkeiten durchaus einen Platz weit oben in den Top Ten ein, denn der Einfluss dieser selbsternannten Eliten hat bedeutend zu den letzten größeren Verwerfungen der Vergangenheit geführt. Außerdem hat die Geschichte gezeigt, dass es schon immer so gewesen ist – Stichwort „spätrömische Dekadenz“.
Einige hatten vielleicht vorgesorgt – wahrscheinlich sogar viele, aber damit haben sie bestimmt auch nicht gerechnet. Die bekannte Weisheit „Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt“ werden die wenigsten von ihnen berücksichtigt haben – vor allem nicht diejenigen, die dachten, sie wären der Nabel der Welt. In ihrer empathielosen Welt von privaten Thinktanks sind sie jetzt, wenn sie noch leben, genauso aufgeschmissen wie wir, denn trotz üppig bezahlter Berechnungen, Prognosen und Gutachten werden sie diese Sache trotzdem nicht auf dem Schirm gehabt haben. Sicherlich kam auch noch eine Verkettung unglücklicher Umstände hinzu, aber darüber zu spekulieren, hilft den Übriggebliebenen auch nicht weiter.
Aber ganz sicher sind einige, die sich selbst als Elite der Welt sahen, über ihren eigenen Hochmut, ihren Neid und ihren Größenwahn gestolpert. Dass ihr Geld jetzt nichts mehr wert ist, ist in ihren Augen vielleicht das kleinere Übel – der Macht- und Kontrollverlust sicher das größere.
Genau, die Übriggebliebenen. Einer davon bin ich. Ach ja, das hätte ich fast vergessen zu erwähnen: Ich habe in den letzten drei Jahren 18 Kilo abgenommen und halte dieses Gewicht sogar erstaunlicherweise. In fast jedem Haus steht eine Waage. Ihr wisst schon, die alten mit Zeiger, die eigentlich ewig halten. Die funktionieren natürlich noch – im Gegensatz zum Fernseher. Warum wollten die Leute immer so genau wissen, wie viel sie wiegen? Wenn ich beim Pinkeln meine Füße nicht mehr sehen kann, wird es wohl spätestens Zeit zum Abspecken.
Gut, ich gebe zu: drei bis vier Kilo mehr würden mir besser stehen, denn auch Spiegel sind in jedem Haus zu finden. Aber ich bin nun beim besten Willen nicht auf dem Weg zu einem Schönheitswettbewerb.
Leider war es das auch schon mit den positiven Dingen. Positive Dinge, für die ich jeden Tag dankbar bin, sind genau die, für die schon die Höhlenmenschen dankbar waren – falls nicht auch schon deren Geschichte gelogen ist. Aber wer weiß das schon, und wen interessiert es heute noch? Zumindest weiß ich, dass es zu diesem Zeitpunkt viele Menschen gibt, die heute auch nicht viel anders leben, als es angeblich die Höhlenmenschen getan haben.
Die letzten Jahre, bevor das Ereignis – ich weiß leider nicht, wie ich es anders nennen soll – passierte, waren schon reichlich merkwürdig. Immer neue Krisen hatten sich in den letzten fünfzehn Jahren aufgetan: Zuerst wurde die Pharmaindustrie gefüttert, dann hatte wiederum die Rüstungsindustrie Hunger bekommen. Die Banken waren als Nächstes dran, weil sie ja so notleidend waren – immer alles hübsch verpackt in zunehmend unglaubwürdigere Narrative. Irgendwann war das Geld, das bis zur Unendlichkeit vermehrt worden war, nichts mehr wert. Die Renten mussten gerettet werden, die Krankenhäuser, Altenheime und so weiter.
Nur die Menschen selber wurden nicht gerettet. Sie wurden zunehmend skeptischer, aggressiver und wussten keinen Ausweg aus der Misere. Schulen, Kindergärten und Fahrdienste waren Schnee von gestern. Die Bildungsinfrastruktur war am Ende. Alten- und Krankenversorgung waren nur noch für Reiche – und Rente nur noch was für Blöde, die daran glaubten. Kurz: Die Religion namens Staat war am Ende.
Wir schreiben, wenn ich richtig mitgezählt habe, das Jahr 2033. Meiner bescheidenen persönlichen Einschätzung nach befinden wir uns wohl offensichtlich kurz nach dem Zenit der modernen „Menschheit“. Erst ging alles langsam und dann immer schneller den Bach herunter und endete geradezu rasant in einem echten Desaster. Zweifelsohne ist seit drei Jahren die Hölle los – gefühlt eher seit zehn, denn Scheißjahre scheinen mindestens dreimal so lang zu sein. Mein innerer Kompass ist offensichtlich kaputt, anders kann ich mir nicht erklären, dass ich ihm auch schon vor dem Ereignis nicht mehr folgen, geschweige denn vertrauen konnte. Wir waren einfach da, wo wir waren, und es passierte einfach das, was passierte. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich wohl auch an dieses Szenario denken können, und wir hätten uns besser darauf vorbereiten können. Doch es ist sowieso nur eine Vermutung. Irgendwann werden wir wissen, was es wirklich war. Vielleicht.
Wir leben seit vielen Jahren in Schweden, unserer Wahlheimat. Die endlose Weite dieses Landes, die niedrige Bevölkerungsdichte und viele andere Umstände haben uns damals hierhergezogen. In einer immer verrückter werdenden Welt war es vielleicht eine waghalsige Entscheidung gewesen, aber Deutschland war ja nicht allzu weit weg. Doch es dauerte nicht lange, bis wir unser Heimatland sowieso mieden. Rückblickend gesehen, war es sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung. Offensichtlich funktionierte mein Kompass damals noch.
Seit vier Monaten bin ich nun auf der Suche. Es ist kalt geworden, eindeutig ein Nachteil an Skandinavien. Doch in den letzten drei Jahren wurde es früher kalt. Und es blieb länger kälter. Ich kann nur spekulieren, woran das liegt.
Mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich habe ihn zwar nicht losgeschickt, aber ich habe Schuld daran, dass er gegangen ist. Also ist es meine Aufgabe, ihn zu finden. Eigentlich hatten wir uns geschworen, unsere Basis, unser Reich, unseren Hof, auf dem wir uns schon vorher auf fast alle Eventualitäten vorbereitet hatten, nicht zu verlassen. Es kam dann doch völlig anders, als ich mir das hätte vorstellen können.
Ich hatte ohnehin keine andere Wahl als loszugehen, denn nach vielen quälenden Wochen der Ungewissheit bekommt wahrscheinlich jeder Hummeln im Hintern. Zu Hause warten und nichts zu wissen, nichts beeinflussen zu können, ist einfach total zermürbend. Mir blieb also gar nichts anderes übrig.
Die letzten Tage hielt mich nur noch die Planung meiner Aktion auf. Nichts ist schlimmer als loszugehen und nach einigen Kilometern festzustellen, dass man etwas Elementares vergessen hat. Außerdem beschlich mich ein merkwürdiges Gefühl der Vertrautheit mit meiner neuen Situation, die mich davon abzuhalten schien, etwas an ihr zu ändern.
Seitdem ich hier wartend alleine die Stellung hielt, drohte ich offenbar wahnsinnig zu werden. Ich habe jetzt seit drei Monaten niemanden mehr gesehen, was an sich schon eine heftige Umstellung war. Ohne Austausch von Worten kommt es mir vor, als ob meine eigene Stimme laut gesprochen oder nur im Kopf ein und dasselbe wäre. Die Übergänge verlaufen fließend.
Ich muss dringend wieder mit anderen Menschen sprechen. Aber wo sind sie? Nach dem Ereignis mussten wir wirklich viele vom Hof jagen – die meisten sogar mit Androhung von Waffengewalt. Aber seit über einem Jahr ist keiner mehr gekommen. Wir kamen dank unserer guten Vorbereitung klar, doch an einige Sachen hatten wir eben nicht gedacht, sonst wäre ich jetzt nicht allein. Und mein Sohn auch nicht.
Es ist meine Schuld und es nagt an mir, dass meine Frau Mala mit Lenni, der gerade erst acht geworden war, bevor sie losgingen, wegen meiner Krankheit unterwegs und noch nicht wieder aufgetaucht sind. Ich war praktisch komatös gewesen: hohes Fieber, eine eiternde Wunde und kaum noch bei Bewusstsein. Es war richtig von ihr, loszugehen. Es war falsch von mir, krank und hilflos zu sein. Das Schlimmste aber war, dass ich zwei Tage, nachdem ich praktisch todkrank war, wieder ziemlich lebendig wurde. Ich ärgerte mich so darüber, dass ich an den darauffolgenden Tagen schneller wieder zu Kräften kam, als mir eigentlich lieb war. Und alles wegen dieser dummen Sache.
In der ersten Woche, in der ich allein war, habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Eigentlich nur, um mir sicher zu sein, nichts durcheinanderzubringen. Es gefällt mir, irgendwie sortiert es meine Gedanken, und es hilft mir, nichts Wichtiges zu vergessen.
2. Totalausfall
Das Ende des ersten Sommers nach dem Ereignis war gekommen, und wie immer zu dieser Zeit bereiteten wir uns auf den Winter vor. Inzwischen machten wir alles, wirklich alles selber. Was wir nicht selber machen konnten, „liehen“ wir uns kurzerhand von den leerstehenden Häusern in der Umgebung. Noch war es abends einigermaßen lange hell, sodass wir noch ganz gut alle Dinge, die wir brauchten, organisieren konnten.
Ich war meistens mit Collin unterwegs. Er würde bald seinen dreizehnten Geburtstag feiern, und ich hätte mir in drei Teufels Namen zum Aufwachsen eine bessere Welt für ihn gewünscht! Fremde Häuser und Höfe zu durchstöbern und Sachen zu klauen, war nicht das, was ich mir für ihn als Lehrplan vorgestellt hatte.
Aber jetzt war es wichtig für ihn, zu lernen, wie man sich in so einer Welt am besten durchschlägt. Auch ich musste es noch lernen. Und so wie jedes Kleinkind beim Laufenlernen regelmäßig hinschlägt, mussten offensichtlich auch wir ab und zu herbe Rückschläge einstecken, aufstehen und weitergehen.
Einige Erfahrungen im Besorgen von lebensnotwendigen Dingen hatten wir schon. Die Feststellung, ob ein Haus, ein Hof oder ein Industriegebäude wirklich verlassen war, nahm Zeit in Anspruch. Collin hatte etliche Stunden damit verbracht, einfach nur zu observieren. Ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gefühl, wenn ich ihn alleine ein Haus beobachten ließ. Doch er war stets bewaffnet und konnte mit der Waffe auch umgehen. Vor allem konnte er schnell laufen.
Vorletztes Jahr, das Jahr nach dem Ereignis, war es tatsächlich einmal knapp gewesen: Wir hatten Mala von der Aktion nichts erzählt, doch ich denke, sie hat es uns angesehen, aber aus Liebe zu uns nichts gesagt. Collin beobachtete damals ein Haus etwa sechs Kilometer von unserem entfernt. Alle umliegenden Häuser und Höfe hatten wir observiert – und ehrlich gesagt: geplündert. Natürlich nur dann, wenn auch nach einigen Monaten keiner der Besitzer mehr die Objekte benutzte.
Das erste Haus, welches ich geplündert hatte, war das von unserem nächsten Nachbarn gewesen. Etwas über einen Kilometer entfernt lag das Haus am Ende einer langen Einfahrt direkt im Wald. Der ehemalige Besitzer war ein unsympathischer und irgendwie unheimlicher Zeitgenosse gewesen. Er besaß eine Horde nerviger Hunde für die Jagd, die er im Zwinger hielt und die ständig kläfften. Meistens war er allein, da er es anscheinend mit keiner Frau länger als einige Monate aushielt – oder die Frauen nicht mit ihm, so genau wussten wir das nicht.
Er hatte sich einige Tage nach dem Ereignis selbst zur Strecke gebracht, indem er zuerst seine Hunde und anschließend sich selbst den Fangschuss verpasst hatte. Ich denke im Nachhinein, er hätte sich und seine Meute wohl auch ohne das Ereignis irgendwann erledigt.
Zwei Tage nach dem Ereignis war er noch kurz zu uns rübergekommen und wollte sich nach unserem Wohlergehen erkundigen. Ob wir zufällig Schmerzmittel im Haus hätten, wollte er damals wissen; was wir verneinten. Er könne gegen Munition oder Diesel tauschen. Nun ja, Diesel und Munition hatten wir selber, und ich fragte ihn, was wir mit Diesel sollten. Diesel sei auch sehr gut zum Heizen geeignet; doch ich merkte schnell, dass das Gespräch zu keinem konstruktiven Ergebnis führen würde, und wimmelte ihn ab. Soviel ich wusste, hatte er keine chronische oder schmerzhafte Erkrankung, und ich war froh, als er wieder ging.
Wir hörten die Schüsse spät am Abend bei der Kartoffelernte, einige Tage nach seinem Besuch.
„Geh mal rüber und sieh nach. Und nimm dein Gewehr mit!“, bat mich Mala.
Ich spare mir hier lieber, von der Sauerei zu berichten, die mich auf seinem Hofplatz erwartete und mir gründlich sowohl den Tag als auch den Appetit auf das Abendbrot verdarb.
Aber im Nachhinein führte diese Sauerei für uns einige Tage später durchaus zu etwas Gutem, nachdem ich mich von dem Schock erholt hatte. Wir retteten bei einem nachbarschaftlichen Ehrenbesuch viele gute Dinge für unsere Vorratskammer, unsere Werkstatt und unseren Waffenschrank. Auch Hundefutter für unseren Hund Chillow hatten wir jetzt fast im Überfluss.
Nun aber zurück zu dieser Sache, die beinahe ins Auge gegangen wäre: Collin war in regelmäßigen Abständen bei dem Objekt gewesen, was wir nun – mittlerweile über ein Jahr nach unserer ersten Plünderung bei unserem Nachbarn – beobachteten. Auch ich war so oft wie möglich mit dabei. Es reichte normalerweise, Objekte in regelmäßigen Abständen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu beobachten. Ging jemand hin oder kam jemand heraus? Waren im Winter Fußspuren im Schnee zu sehen? Waren Geräusche zu hören oder leuchtete in der Dämmerung das Licht von Kerzen? All diese Dinge beobachteten wir.
Ich holte Collin ab, der die Lage wie folgt einschätzte: „Unauffällig wie immer!“
„Dann können wir morgen rein“, lautete auch mein Urteil. Also gingen wir am nächsten Tag in das Haus.
Etwas Schnee fiel und erschien in diesem Jahr irgendwie weißer als früher. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass die Farben sich verändert hatten: Der Himmel war blauer und selbst die Bäume und das Gras schienen im Sommer grüner zu sein. Vielleicht lag es daran, dass es keine Kondensstreifen mehr gab, die sich wie früher sonst immer zu einem graublauen Schleierhimmel ausgefächert hatten.
Unser Ziel war eine kleine Hütte, wahrscheinlich ein Ferienhaus. Eigentlich keines der Objekte, von denen wir uns viel versprachen. Doch gerade in diesen waren oft Vorräte an Kerzen und Diesel oder Benzin für Generatoren zu finden. Auch das gute alte Petroleum war ein gefragter Rohstoff in diesen Zeiten ohne Strom. Es war kälter als sonst um diese Jahreszeit. Ständig schneite es, und Temperaturen unter null Grad waren in diesem Spätoktober an der Tagesordnung.
Wir brachen die Tür mit einer Brechstange auf. Das dauerte nur wenige Sekunden, und wir fanden gleich hinter der Haustür einen Schrank mit Kerzen, Petroleum, Streichhölzern und Müllsäcken – endlich Müllsäcke: Die hatten wir schon lange auf der Liste. Ein Leben ohne Müllsäcke ist machbar, aber nicht erstrebenswert.
Wir packten alles in unsere Rücksäcke und gingen weiter, als Collin mich warnte: „Papa! Da kommt jemand.“
Ich guckte aus dem Küchenfenster und erkannte drei Männer und eine Frau, auch ohne genauer hinzusehen, in dunklen Klamotten auf das Haus zukommen. Mindestens einer von ihnen hatte ein Gewehr geschultert. So genau konnte ich das nicht erkennen. Jetzt musste alles ganz schnell gehen, um uns eine direkte Konfrontation zu ersparen.
Ich lud meine .22-Pistole durch und flüsterte: „Wir gehen hinten raus, durchs Fenster, schnell!“
Zeitgleich bewegten wir uns zum Wohnzimmer und ich versuchte, ein Fenster zu öffnen. „Scheiße! Die Farbe hat es zugeklebt.“ Ich schlug seitlich mit der Faust dagegen und das Fenster öffnete sich langsam.
Collin warf ich in meiner Angst praktisch aus dem Fenster und sprang hinterher.
Wir rannten los, um uns in der ungefähr hundert Meter entfernte Tannenschonung in Sicherheit zu bringen. Mir war sofort klar, dass die Fremden uns gehört haben mussten und unsere Spuren im Schnee sehen würden. Doch wir erreichten die Deckung schneller, als ich gedacht hatte.
Ich drehte mich um und sah noch, dass einer der Fremden aus dem offenen Fenster schaute.
Dann hörten wir laute Stimmen aus dem Haus, und uns war klar, dass sie uns nicht gesehen hatten.
Völlig atemlos kamen wir bei unseren Fahrrädern an und machten uns auf den Rückweg.
„Guck mal, Papa, da sind Autospuren im Schnee“, keuchte Collin.
Ich war total außer Atem und keuchte etwas wie „Grrrott“, mehr brachte ich nicht raus.
Das Wichtigste war, jetzt so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Gott sei Dank fing es wieder an stark zu schneien, sodass man unsere Fahrradspuren nicht lange sehen konnte. Ein eisiger Wind tat sein Übriges.
„Sag Mama nichts davon, sonst macht sie sich unnötig Sorgen, wenn wir wieder einmal losmüssen. Die haben uns nicht gesehen und können unsere Spuren nicht verfolgen.“ Ich schlug vor, erst mal eine Pause vom fluchtartigen Rückzug unserer Rohstoff-Beschaffungs-Aktionen zu machen.
Collin stimmte zu.
Auch diese brenzlige Aktion war nun schon über eineinhalb Jahre her. Wir hatten trotz des Schreckes wieder recht schnell unsere Arbeit aufgenommen und einige Erfolge verzeichnen können. Einmal hatten wir in einem Erdkeller eines luxuriösen Einfamilienhauses viele Konserven, Seife, Zahnpasta, Duschgel und sogar einige Pakete Toilettenpapier finden können. In anderen Häusern fanden wir flaschenweise guten italienischen Rotwein, Munition, Waffen, Medikamente und anderen Kram, den wir gut gebrauchen konnten.
Es lohnte sich für uns trotz der Gefahr absolut, denn kurz nach dem Ereignis hatten wir versucht, in die nächstgelegene Kleinstadt zu kommen, was keine gute Idee gewesen war: Die zwei Lebensmittelläden, die Apotheke und die Tankstelle waren geplündert und teilweise sogar abgefackelt worden. Wir sahen mehrere bewaffnete Leute und waren schneller wieder weg, als wir gekommen waren.
„Definitiv kein sicheres Pflaster“, meinte ich damals zu Collin, aber eigentlich hatte ich auch nichts anderes erwartet.
Ich war einige Zeit später nochmal alleine dort gewesen, aber sofort an der Stadtgrenze umgekehrt, nachdem ich einige Schüsse und Schreie gehört hatte. Der Risiko-Nutzen-Faktor war offensichtlich eher auf unserer Seite, wenn wir es weiterhin so machten, wie wir es nun seit einigen Monaten taten. Das eine schlechte Erlebnis mit den fremden Eindringlingen war sicherlich eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen. Ich vermutete, die Leute wollten dasselbe wie wir, und wir waren sicher nur zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Objekt gewesen. Doch die Reifenspuren gaben mir zu denken. Fuhren doch noch Autos? Es ließ mir keine Ruhe.
Bei dem Objekt, welches wir als Letztes beobachteten, gab es einen Trumpf. Vor dem etwas heruntergekommenen Bauernhaus, ungefähr acht Kilometer entfernt von unserem Haus, unserer Basis, parkte ein alter Mercedes 190 D. Es musste ein Modell aus den späten Sechzigern sein. Meiner Theorie nach müsste eigentlich jeder Saugdiesel noch fahren, da sie, bis auf die Batterie zum Starten, keinerlei Elektronik verbaut hatten, die für die Funktion des Motors wichtig wäre. Vorausgesetzt, der Motor funktionierte noch. Ich hielt insgeheim schon länger nach so einem Oldtimer Ausschau, doch bis auf alte Traktoren, die sich schlecht anschieben ließen und uns auch nicht wirklich mobil machen würden, hatten wir noch nichts gefunden. Unsere Mission war es, nachdem wir das Haus gründlich observiert, geplündert und nach dem Autoschlüssel gesucht hatten, den Wagen durch Anschieben zu starten. Und ja, wir waren erfolgreich. Wir fanden tatsächlich den Autoschlüssel. Zum Glück stand der Wagen mit der Nase voran Richtung einer abschüssigen Einfahrt – perfekt! Ich war total aufgeregt, ein bisschen wie vor meiner ersten Fahrstunde.
Ich öffnete die Tür und wies Collin an: „Wenn ich ‚Jetzt‘ sage, musst du anschieben!“
„Klar, Papa, kein Problem!“
Ich öffnete die Tür. Ein muffiger und leicht schimmeliger Geruch schwoll mir entgegen. „Puh! Erst mal lüften. Die Karre stinkt wie Oma unterm Arm.“
Collin lachte. „Lass dir Zeit, wir haben es doch nicht eilig.“
Nach einigen Minuten des Auslüftens setzte ich mich in den Wagen und rief: „Jetzt, schieb!“
Der Wagen bewegte sich nicht. Ich stieg aus und ließ mir von meinem Sohn erklären, er hätte alles gegeben. Also kletterte ich abermals ins Auto und kontrollierte, ob ich die Handbremse gelöst hatte. In dem Moment gab der Fahrersitz unter mir nach, und ich spürte ein Reißen im rechten Oberschenkel. Ich schrie vor Schmerzen. Ich war im Fahrersitz eingesunken, und eine Metallfeder des Sitzes musste sich ein kleines Stück in mein Fleisch zwischen Oberschenkel und Pobacke gedrückt haben.
Der alte Sitz war offensichtlich völlig hohl von innen. Schon beim ersten Hinsetzen hatte ich die Federn des Sitzes im Hintern gespürt, mir aber nichts weiter dabei gedacht. Wahrscheinlich hatten die Mäuse im Laufe der Zeit die gesamte Schaumstofffüllung aufgefressen, sodass der Sitz eigentlich nur noch aus Spiralfedern und Stoff bestanden haben musste. Warum fressen die Viecher Schaumstoff, fragte ich mich.
Ich schrie erneut auf, als ich mich aus meinem Folterstuhl befreite.
„Was ist los, Papa? Du blutest ja. Was ist passiert?“ Collin war sofort zur Stelle.
„Die Scheißmäuse haben den Sitz gefressen, und ich habe mir eine Sitzfeder in den Oberschenkel gejagt.“
Mit blutiger Hose und gedämpfter Stimmung gingen wir zu den Fahrrädern zurück.
„Ich glaube nicht, dass ich fahren kann“, bemerkte ich und beschloss, den Drahtesel lieber zu schieben.
Und so dauerte es mehr als drei Stunden, bis wir wieder zu Hause waren. Der einsetzende Schneefall wurde stärker und auch der Wind wurde schärfer. Wir waren wirklich völlig fertig an diesem verfluchten Abend Ende Oktober. Daran war nicht nur der Schnee, sondern auch meine Dummheit schuld.
Mala kam besorgt aus der Haustür, sobald wir den Hofplatz erreichten. „Was ist passiert? Warum kommt ihr so spät? Ich habe mir Sorgen gemacht.“
„Mama, Papa hat sich eine Feder in den Hintern gejagt. Ich glaube, du musst ihm helfen!“
Malas Gesichtsausdruck erspare ich mir hier zu beschreiben.
„Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe mich an einem verrotteten Autositz verletzt, wahrscheinlich von Mäusen oder Ratten völlig ausgehöhlt“, versuchte ich die Sachlage aufzuklären.
„Kommt erst mal rein, es ist ja arschkalt geworden“, meinte sie; und arschkalt war genau der richtige Ausdruck. Wir lachten, weil es sich irgendwie passend anhörte und setzten uns drinnen vor den warmen Kamin. Na ja, Mala und Collin setzten sich, ich blieb stehen und erzählte dann die ganze Geschichte. Nachdem mich Mala behandelt, die Wunde desinfiziert und mit einem Verband versorgt hatte, konnte ich an diesem Abend erstaunlich gut schlafen.
Am nächsten Tag dachte ich ernsthaft darüber nach, die Aktion „Autobergung oder ein Neuwagen für Papa“ doch noch abzuschließen, doch ich war zunächst mit Schneeschieben und anderen wichtigen Dingen der Tagesroutine beschäftigt. Abends waren die Schmerzen am Oberschenkel kaum auszuhalten. In der Nacht konnte ich kaum schlafen, und am nächsten Morgen kam ich nicht aus dem Bett.
„Du hast ja Fieber, lass mich mal die Wunde sehen“, bat Mala. Sie holte einen frischen Verband und Desinfektionsmittel. Ich war froh, dass wir so gut auf alle Eventualitäten vorbereitet waren, und bereute zugleich, dass ich mich durch diese Aktion jetzt wie gerädert fühlte.
Mala versorgte meine Wunde und verband sie neu. „Du bleibst heute lieber im Bett“, entschied sie. „Du hast Fieber und die Wunde ist entzündet. Ich gebe dir was von dem Zeugs. Wie heißt es doch gleich?“
„Artemisia! Wirkt antibakteriell und antiviral. Für uns war es immer eine gute Alternative zu Antibiotika“, ergänzte ich, als wäre es ein Werbeslogan. Ich fühlte mich schwach und beschissen, nahm etwas von dem Zeug und schlief wenig später ein.
Als ich wieder aufwachte, dämmerte es. Ich wusste nicht, ob es morgens oder abends war. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren und rief nach Mala: „Ich habe kein Fieber mehr, Schatz!“
Nachdem sie nicht antwortete, versuchte ich aufzustehen. Meine Beine waren aus Gummi. Mein Hintern tat immer noch höllisch weh, aber es war besser geworden. Ich sackte wieder zurück ins Bett. Neben mir stand eine Trinkflasche mit Strohhalm, die ich noch nie gesehen hatte. Nach einiger Anstrengung schaffte ich es, mich auf die Bettkante zu setzten. Wenige Minuten später stand ich, merkte aber sofort, dass mir schwindelig wurde.
Ich beschloss, es langsam anzugehen und rief nochmal vorsichtig nach Mala. Meine Stimme versagte nach „Ma–“, und ich merkte, wie trocken mein Hals war.
Keine Antwort. Dafür hörte ich komische Geräusche von draußen, die sich anhörten, als ob jemand mit einem Vorschlaghammer auf unsere Scheune einschlug. Ich musste sehen, was da los war. Etwas benebelt und mit aller Kraft schaffte ich es, hochzukommen. Ich sah aus dem Fenster und wunderte mich, dass der ganze Schnee geschmolzen war.
Mit Mühe schaffte ich es weiter zur Haustür und sah vorsichtig hinaus. Ich sah Collin, er hackte Holz. Ich versuchte, ihn zu rufen, brachte aber keinen Laut hervor. Meine Kehle war zu trocken. Also pfiff ich auf den Fingern; das klappte.
Er drehte sich um und sah mich an, als ob er ein Gespenst sehen würde. „Papa!“, rief er, ließ die Axt fallen und rannte auf mich zu – besorgt und überglücklich, mit Tränen in den Augen. „Papa, ich dachte, du würdest es nicht schaffen“, schluchzte er und umarmte mich mit voller Kraft, sodass ich kaum Luft bekam.
„Was ist denn los? Wo sind Mama und Lenni?“, fragte ich gequält.
„Das ist eine lange Geschichte. Das erzähle ich dir gleich, okay?“ Das Zittern in seiner Stimme machte mich nervös. Irgendetwas stimmte hier nicht, und ich musste jetzt wissen, was es war. „Komm erst mal mit, es sind mindestens minus drei Grad, wir setzen uns besser vor die Küchenhexe“, schlug Collin vor und stützte mich beim Gehen.
„Papa, du warst über zwei Wochen krank! Mama ist mit Lenni Antibiotika suchen gegangen. Sie meinte, das Zeug, das wir immer nehmen, würde nicht mehr helfen, und ansonsten würdest du sterben. Ich bin so froh, dass du aufgewacht bist.“
„Wie spät ist es eigentlich? Und wann ist Mama mit Lenni los?“
„Es ist kurz vor vier laut Sonnenuhr. Mama ist gegen elf mit Lenni losgegangen. Sie haben sich gut vorbereitet: warme Klamotten, Proviant – und auch die Schrotflinte hat sie mitgenommen.“
Mein Puls war jetzt nicht nur im Hintern, sondern auch im Hals deutlich zu spüren. Wie konnte es sein, dass ich zwei Wochen praktisch im Koma gelegen hatte und um mich herum nichts mitbekommen hatte? „Was genau ist passiert? Wieso ist Mama genau heute losgegangen? Gib mir mal bitte etwas zu trinken, Collin, meine Kehle ist so trocken wie der Sand in der Sahara!“
„Wir dachten, du stirbst sonst. Mama sagte, ich soll mich um dich und den Ofen kümmern. Lenni wollte unbedingt mit Mama mitgehen. Chillow haben sie auch mitgenommen.“
„Haben sie gesagt, wo sie hingehen wollten, um Medikamente zu besorgen?“, fragte ich, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken hatte.
„Sie wollten zum Haus von Dr. Magnusson. Mama sagte, dass in seinem Haus sicher was zu finden sei.“
„Das ist mindestens zwölf Kilometer entfernt, und sie sind zu Fuß gelaufen?“
„Ja, sie sind zu Fuß los, Papa. Ich habe noch gesagt, sie sollen lieber die Räder nehmen, aber Mama wollte bei der Glätte und mit Lenni nicht mit dem Fahrrad fahren. ‚Beim Laufen bleibt man warm‘, hat Mama gesagt.“
Das war ganz allein meine Schuld. Diese blöde Idee, wieder einen fahrbaren Untersatz zu haben, war jugendlich-leichtsinnig gewesen. Wir hatten uns nach dem Ereignis fest darauf geeinigt, uns nur auf die wesentlichen Dinge zu beschränken: Nahrung, Wasser und warme Unterkunft sowie die effektive Verteidigung dieser. Dies waren die Dinge, auf die wir uns konzentriert hatten. Dies waren die Dinge, die uns fast drei Jahre lang so gut durch die veränderte Welt gebracht hatten. Klar, die Raubzüge hatten auch einiges dazu beigetragen, aber tatsächlich beraubt hatten wir niemanden – jedenfalls hatten wir alles uns Mögliche getan, um dies sicherzustellen.
Ich war auf dem Weg der Besserung, aber noch schwach, und es war Gold wert, dass mein Junge jetzt da war und mir in meiner Erholungsphase zur Seite stand. Es gab nur ein Problem, denn auch nach vier Tagen waren Mala und Lenni nicht zurückgekehrt. Wir machten uns ernsthaft Sorgen, jede Sekunde, Minute, Stunde etwas mehr.
3. Alles aus
Drei Jahre vorher hatte uns das Schicksal einen Streich gespielt. Wortwörtlich „rien ne va plus“ – nichts geht mehr. Wie beim Roulette hatte die Kugel des Schicksals dieses Kuddelmuddel entschieden. Und nichts ging mehr. Von der einen auf die andere Minute höchstwahrscheinlich, denn das konnte ich nicht mit Gewissheit sagen, genauso wenig, wann genau es zu diesem Ereignis gekommen war. Ich vermute aber, dass es nur wenige Minuten, bevor ich damals morgens aufgewacht bin, passiert sein konnte.
Kein elektronisches Gerät gab mehr ein Lebenszeichen von sich. Kein Auto, Flugzeug oder ein anderes bekanntes Geräusch war an diesem Morgen in der Ferne zu hören. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn wir wohnten sehr abgelegen.
Wie jeden Morgen schlich ich mich um halb sechs leise aus dem Bett, um meine Frau nicht zu wecken. Zuerst dachte ich, als ich mein Handy anmachen wollte, die Batterie sei leer, denn es tat sich nichts.
Draußen war es schon einigermaßen hell. Wie jeden Morgen ging ich in die Küche und setzte Wasser für meinen ersten morgendlichen Kaffee auf. Als ich mich nach fünf Minuten wunderte, dass es noch nicht kochte, stellte ich fest, dass wir keinen Strom hatten.
Merkwürdig, denn zumindest die Solaranlage mit Batteriespeicher, die in der hellen Jahreszeit nahezu hundert Prozent unseres Stroms lieferte, sollte funktionieren. Aber weder das arschteure öffentliche Stromnetz noch die Solaranlage schien Strom zu liefern. Ich überprüfte selbstverständlich die Sicherungen, doch die waren alle in Ordnung.
Ich wollte wie jeden Tag erst mal gemütlich meinen frühmorgendlichen Kaffee trinken, dabei meine Mails checken und langsam wach werden. Ich war alleine schon dadurch mehr als leicht genervt, dass meine Morgenroutine auf diese Weise gestört wurde, aber Not macht erfinderisch und ich begann, die Küchenhexe – die wir eigentlich frühestens im November regelmäßig zum Kochen, Backen und Heizen benutzten – mit Holz zu beladen. Doch das Feuerzeug verweigerte ebenfalls seinen Dienst.
Nun begann ich nach Streichhölzern zu suchen und fand welche in einer Schublade im Wohnzimmerschrank. Mein erster Kaffee hatte jetzt schon mindestens fünf Minuten Verspätung. Die Streichholzschachtel war natürlich leer. Insgesamt fand ich vier leere Streichholzschachteln und einen gebastelten Igel. Es dauerte ein paar Sekunden, um zu erkennen, dass die Stacheln des Igels die Streichhölzer waren. Vorsichtig zog ich dem Igel einen Stachel, natürlich an einer möglichst unauffälligen Stelle. Dann musste ich feststellen, dass das Streichholz nur noch halb so lang war wie es sein sollte. Es war mir egal, Hauptsache, Feuer anmachen und Kaffee trinken.
Zu meinem Erstaunen bekam ich das Streichholz mit einem Anreißen an. Schnell begann ich das zusammengeknüllte Papier in der Küchenhexe damit zu entzünden. Doch so schnell ging das nicht, und ich sengte mir die Fingerkuppe an. Schnell unter den Wasserhahn, um mit kühlem Wasser Abhilfe zu schaffen. Doch nach einer Minute wurde der Wasserstrahl immer dünner. Schnell war mir klar: ohne Strom kein Wasserdruck. Der Schmerz war jetzt einigermaßen erträglich, inzwischen war mir der Kaffee schon fast egal, denn wach war ich jetzt.
Stromausfall. Das war mein erster Gedanke, denn das passierte einigermaßen regelmäßig. Auch das hatten wir vorhergesehen und uns schon vor langer Zeit mit Generator und Solaranlage mit Batteriespeicher gerüstet. Allein schon wegen der exorbitant hohen Strompreise. Schließlich war es sogar offiziell angekündigt worden, dass uns sogenannte Brownouts in den nächsten Jahren immer wieder bevorstehen sollten.
Doch warum zum Henker funktionierte die Solar-Batterieanlage nicht? Ich hatte sie extra so geschaltet, dass sie im Falle von fehlendem Netzstrom diese Lücke sofort schließen sollte. Irgendetwas funktionierte dort nicht. Ich wollte es gleich feststellen, aber nun erst mal meinen Kaffee genießen. Doch dazu sollte es nicht kommen.
Ein unbändiger Knall mit gleichzeitiger starker Erschütterung ließ mich und meinen inzwischen lauwarmen Kaffee erzittern. Nun war mindestens die Hälfte des Becherinhaltes auf meinem Kapuzenpullover gelandet, und trotzdem war ich wacher als nach einer ganzen Kanne Kaffee. Auch mein Herz galoppierte wild und bestätigte mir meine Aufregung.
Was in aller Welt war das? Mein erster Gedanke war: Bombe. Sicher so eine EMP-Bombe, also eine Atombombe, in großer Höhe gezündet, die einen elektromagnetischen Impuls auslösen konnte, der jegliche Elektronik lahmlegt. Waren es die Chinesen, die Russen oder Nordkorea?
Es folgte eine weitere Detonation von welcher Art Bombe auch immer, die in der Ferne explodierte, vielleicht sogar auf das nächstgelegene strategische Ziel in der Nähe. So mein Gedankengang.
Alle waren wach. Offensichtlich war es ein Tag, an dem wohl niemand einen Kaffee brauchte.
„Was ist mit dir passiert, Schatz? Du siehst mitgenommen aus. Und dein Pullover …“ Mala war sichtlich schockiert. „Was war das für ein Knall, oder habe ich nur geträumt?“
Ich berichtete von meiner Theorie des EMP und eines weiteren Bombeneinschlags. „Hol die Kinder, wir sollten erst mal in den Keller gehen! Ich hole das Batterieradio. Ich will später mal sehen, ob wir was empfangen.“
Gemeinsam traten wir vor die Tür. Die Kinder waren sichtlich erschüttert und fragten fortwährend, was los sei. Sie hätten nichts gehört, seien müde. Und warum überhaupt sollten sie heute so früh aufstehen? Kaum waren wir aus der Tür, sahen wir es: eine gigantische Rauchsäule, ungefähr drei bis fünf Kilometer weit weg. Der Rauch war dunkel. Ein Rauch wie von verbrennenden Autoreifen. Es war also höchstwahrscheinlich keine atomare Explosion gewesen, vermutete ich.
Und schon wieder rumste es. Diesmal wesentlich weiter entfernt. Die Erde bebte diesmal nicht. Wir kannten zwar Explosionen und Erdstöße, da in der Umgebung öfter mal gesprengt wurde, aber eine solche Erschütterung war uns bis dato fremd.
„Wir brauchen nicht in den Keller. Ich vermute, es sind keine Raketen oder Bomben, sondern Explosionen, vielleicht verursacht durch den Stromausfall.“
„Welchen Stromausfall?“.
„Wir scheinen keinen Strom mehr zu haben. Selbst das Solar-Batteriesystem scheint nicht zu funktionieren“, erklärte ich ihr. „Bleibt bitte erst mal im Haus, maximal vor der Tür, ich sehe mal nach der Solaranlage.“
Mit zitternden Beinen marschierte ich zum Stromhäuschen, welches ich extra für die Solar-Batterieanlage gebaut hatte. Doch es gab nichts zu sehen. Alles war dunkel und leblos. Kein Display und auch keine Kontrolllampen leuchteten. Ich versuchte, den Generator zu starten, aber weder mit Elektrostart noch nach mehrfachem Reißen an der Startleine gab das Stromaggregat einen Mucks von sich. Das Radio war auch tot, stellte ich wenig später fest.
Bis zu diesem Tag hatten wir alles in unserer Macht Stehende getan, um möglichst autark aufgestellt zu sein. Wir hatten einen Haufen Silbermünzen, weil wir dem Digitalgeld misstrauten. Bargeld gab es so gut wie gar nicht mehr. Daher waren alle möglichen Tauschwährungen für uns schon länger das Mittel der Wahl. Ob Schnaps, Honig oder Zigaretten – wir hatten für jeden Bedarf eine Tauschwährung parat. Bei den Zigaretten bin ich ganz ehrlich: Es gab einen hausinternen, mysteriösen Schwund, den ich aber in der Lage war aufzuklären, wenn mich jemand gefragt hätte.
Dass es letztendlich nie dazu kommen würde, mit jemandem etwas zu tauschen, war uns damals noch nicht klar. Was uns allerdings schon lange klar gewesen war, war die Tatsache, dass es zu einer Art Endspiel kommen würde. Dies aber hatte uns nicht davon abgehalten, zwei Kinder in die Welt zu setzen, und bis wenige Tage vor dem Ereignis hatten wir ernsthaft noch darüber geredet, wie es wäre, noch ein Mädchen zu bekommen. Typisch, wenn die Frauenquote in der Familie ins Ungleichgewicht geriet, machten die meisten Familien sich wahrscheinlich bis zur Menopause Gedanken darüber, wie man dieses Ungleichgewicht wieder ins Lot bringen könnte.
Was an jenem Tag jedenfalls genau passiert ist, war uns damals noch nicht klar. Aber wir wussten instinktiv, dass der Strom nicht so schnell zurückkehren würde, sondern dass es vermutlich Tage, Wochen oder gar Monate dauern würde. Nach der Energiekriese 2023/24 waren viele Leute sensibilisiert. Es würde sich jedoch erst zwei Jahre später herausstellen, dass es sich hier nur um einen weiteren künstlichen Umverteilungsprozess gehandelt hatte, der natürlich rein zufällig stattgefunden hatte. Wir hatten daraus gelernt und uns bestmöglich vorbereitet. Doch dass jetzt kein Saft mehr da war, weder vom Netz oder Generator noch von der Batterie, war eine völlig neue Situation, auf die wir erst einmal nicht vorbereitet waren.
Was konnte so etwas ausgelöst haben? Ein EMP-Angriff, der alle elektronischen Bauteile zerstört hatte, war eigentlich die einzige Antwort. Aber wer sollte uns angegriffen haben? Die globalen Streitigkeiten waren meines Wissens alle bis Mitte der 2020er Jahre ausgetragen worden, denn Rohstoffe waren so knapp und teuer geworden, dass sich eine friedliche Einigung wohl mehr lohnte als sich gegenseitig umzubringen.
Die meisten Länder auf diesem Planeten waren jahrelang hauptsächlich damit beschäftigt, sich selbst, also ihr Volk, irgendwie ruhig zu halten. Aber seit es mit den Subventionen für eine Schuhkarton-große Wohnung inklusive virtuellem Realitätsnetz-Anschluss, kurz VRN, sowie zugeteilter Energie vorbei war, hatten viele, gerade jüngere Leute kaum noch etwas anderes zu tun, als regelmäßig die neuen Treffpunkte – die sogenannten Neurobars – anzusteuern, in denen man sich sozusagen im Reallife treffen konnte, VRN-Zugang hatte und jegliche Art von Drogen konsumieren konnte. Diese Welt war für uns und viele andere nichts Erstrebenswertes, sodass eine ganze Menge Menschen, vor allem Familien, die Städte verlassen hatten und nun versuchten, sich selbst zu versorgen.
Es gab für mich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls absolut keine Antwort auf die Frage, was hier passiert sein könnte, und ich hoffte insgeheim auf eine Verkettung von unglücklichen Umständen, die dafür gesorgt hatten, dass sämtliche Geräte nicht mehr funktionierten. So wie bei einer Überspannung durch einen Blitzschlag.
4. Beratungsgespräch
Wir saßen alle am Küchentisch, Hunger hatte keiner. Es war eine emotionale, ängstliche und wilde Diskussion, soweit ich noch weiß. Ich erinnerte daran, dass vor 120 Jahren kaum ein Mensch Strom hatte und alle wunderbar klargekommen seien. Doch die Explosionen und die Rauchsäule ließen uns keine Ruhe. Wenn es nur der fehlende Strom gewesen wäre, kein Problem, aber auch unsere Batterie-Solarstrom-Anlage war tot.
Trotzdem versuchte ich zu beruhigen: „Solange wir nicht wissen, was genau passiert ist, bleiben wir hier. Und vor allem bleiben wir so ruhig wie möglich. Es wird sich alles sicherlich bald aufklären.“
Doch Mala und ich wussten, dass die Tatsachen eine andere Sprache sprachen. Diesen vermeintlichen Tatsachen mussten wir auf den Grund gehen – und zwar so schnell wie möglich, denn in einem waren wir uns schon immer sehr ähnlich: Ungewissheit mochten wir beide überhaupt nicht. Auf der anderen Seite waren wir uns durchaus bewusst, dass wir nichts jemals genau wissen konnten, denn alles ist immer eine Frage der Wahrnehmung.
Also beschlossen wir nach kurzer heftiger Debatte, zu einer Erkundungstour auszurücken. Je früher, desto besser. Wir mussten einfach herausfinden, was diese Rauchsäule verursachte. Vielleicht war es eine Giftwolke oder was auch immer. Instinktiv wussten wir jedenfalls, dass es der erste Puzzlestein eines sehr großen Puzzles war.
Wir beschlossen, dass Collin und ich Richtung Rauchsäule fahren würden, aber nicht unbewaffnet. Die Situation schien uns dementsprechend brisant. Keiner wusste, ob wir uns vielleicht doch in einem Krieg mit einem anderen Land befanden. Wir diskutierten noch einige Minuten über Sinn und Unsinn der bevorstehenden Aktion, aber kamen schnell zu dem Schluss, dass es wohl kaum eine andere Möglichkeit gab, die Situation besser einzuschätzen. Ich versprach Mala, dass wir versuchen würden, das Gebiet so weit wie möglich zu erkunden; und das so vorsichtig und unauffällig wie möglich.
Ich legte meine Kaliber-30-06-Repetierbüchse in den Kofferraum unseres gerade vor einigen Monaten angeschafften Volvo-XC-60/2-Eco-Diesel-Hybrid und steckte einige Patronen in die Hosentasche. Der Wagen war nicht neu gewesen. Wir kauften nie neue Autos, da wir immer von dem Rabatt, den die ersten Jahre der Laufzeit automatisch hergaben, profitieren wollten.
Collin fragte, ob er Proviant mitnehmen sollte. Ich erwiderte, dass dies unter normalen Umständen keine schlechte Idee sei, aber dass es wohl nicht so lange dauern würde. Jedenfalls hoffte ich das – und wurde eines Besseren belehrt.
Wir stiegen ins Auto, und Mala warf uns eine Kusshand aus der Haustür zu. Neben ihr sah ich das kleine Gesicht von Lenni. Für ihn schien das Ganze wie ein großes Abenteuer zu sein.
Ich setzte mich auf dem Fahrersitz zurecht, schloss die Tür und drehte den Zündschlüssel. Nicht passierte, kein „Rum, rum, rum“ und der Motor läuft, kein Sirren des elektrischen Antriebes, nichts. Ich versuchte es nochmal, wobei mir aber sofort ein Licht aufging: Es konnte also tatsächlich nur ein EMP gewesen sein.
Collin und ich kehrten ins Haus zurück, um einen neuen Krisenrat abzuhalten. Wieder saßen wir am Esstisch und berieten uns.
Die Entscheidung war schnell getroffen. Gott sei Dank hatten wir die Fahrräder noch nicht verkauft, obwohl Mala letztes Jahr gemeint hatte, dass keiner sie mehr benutzen würde. Doch irgendwie hatte ich nie die Zeit und Muße gefunden, die Räder einzustellen und zu verkaufen. Das war jetzt ein strategischer Vorteil. Ich hatte die Räder immer gut gepflegt und stets die Reifen repariert.
Trotzdem stellten wir etwas später fest, dass Collins Rad einen Platten hatte. Jetzt war keine Zeit zum Streiten, obwohl ich immer angespannter wurde. Zum Glück war im Kompressor noch Luft, und der Reifen war schnell wieder aufgepumpt.
Die Rauchsäule schien nicht allzu weit weg, also hängte ich mir meine 30.06 quer über die Schulter und wir fuhren los.
Kaum waren wir einige Hundert Meter gefahren und bogen aus unserem Waldweg, der nur zu unserem Haus führte, auf die geteerte Nebenstraße ab, bekam ich es langsam mit der Angst zu tun.
Collin stellte derweil unentwegt alle möglichen Fragen, und ich spielte ernsthaft mit dem Gedanken, ihn wieder zurückzuschicken. Aber wenn ich recht haben sollte, würde es jetzt auch nicht helfen, ihn und seine Kinderseele zu schonen, denn die Scheiße hatte bereits den Ventilator getroffen – gelinde gesagt.
Wir radelten in Richtung der Rauchsäule. Die Stelle der vermeintlichen Explosion war doch weiter weg, als ich zuerst vermutet hatte. Ich war mir zu dem Zeitpunkt schon sicher, dass wir keine Autos sehen würden.
„Wann sind wir da, ich kann nicht mehr lange, ich bin schon so lange nicht mehr Fahrrad gefahren“, keuchte Collin.
„Guck doch! Es ist direkt da hinten, vielleicht noch zwei Kilometer.“
Wir fuhren jetzt etwas langsamer, denn auch mir wurden langsam die Beine schwer. Wir kamen an eine Lichtung und sahen jenseits davon ein brennendes Teil. Dahinter war der Wald in einer Schneise mit einer Breite von ungefähr hundert Metern verschwunden. Überall qualmte es.
Wir stiegen von den Rädern und machten uns langsam und vorsichtig auf den Weg zu der Stelle der Explosion. Ich kannte diese Stelle von der Elchjagd. Da war nichts gewesen, also kein Gebäude oder eine größere Maschine. Doch jetzt war dort regelrecht ein Krater, keiner von einer Bombe, sondern, wie es für mich aussah, eher von einem Flugzeug.
Wir gingen weiter und Collin wollte wissen, was hier passiert war. Ich äußerte meine Vermutung und er stimmte nickend zu.
„Bleib etwas hinter mir. Wenn ich Leichen sehe, sage ich dir Bescheid, dann bleibst du stehen“, wies ich Collin an.
„Warum sind die Feuerwehr und die Rettungswagen noch nicht hier?“ Die Verunsicherung in Collins Stimme war deutlich zu hören.
„Ich glaube, die haben alle dasselbe Problem. Irgendwas stört die Elektronik“, erwiderte ich ungläubig, denn ich konnte das Gesagte selbst kaum glauben – und was ich sah, ebenso wenig.
Wir gingen weiter. Überall waren Wrackstücke eines vermutlich mittelgroßen Verkehrsflugzeuges zu sehen. Auch Kleidung und Koffer lagen überall herum. Ich konnte eigentlich nur anhand der Einschlagstelle und der Aluminiumteile sicher sagen, dass es sich um ein Flugzeug gehandelt haben musste.
Ich forderte Collin auf, erst mal hier zu warten, und ging einige Minuten allein zur Haupteinschlagstelle. Im verkohlten ehemaligen Waldstück konnte ich Sitzreihen zwischen abgebrochenen Bäumen erkennen. Sitzreihen mit schwarz verkohlten Leichen darin, die noch qualmten. Die Explosion des Treibstoffes der Maschine hatte alles in ein Kriegsszenario verwandelt. Wahrscheinlich war es das sogar. Die Auswirkung einer perfiden Kriegswaffe, die unschuldige Menschen tötete.
Ich hatte genug gesehen, wollte nur noch Collin einsammeln, bevor er das sehen konnte, und Mala erzählen, was passiert war. Hier nach Überlebenden zu suchen, wäre ganz offensichtlich absolut sinnlos.
Ich fand Collin einige Meter entfernt von der Stelle wieder, an der ich ihm gesagt hatte, er solle dort warten. Er kramte in einem Koffer und zeigte mir, was er gefunden hatte. „Guck mal, so einen wollte Lenni schon immer haben.“
Ich wusste nicht, was es war, aber es sah aus wie einer dieser Würfel, an denen man durch geschicktes Drehen die Farben in eine Reihenfolge bringen musste.
„Das ist ein Magicube von Partell. Die machen so coole Sachen. So einen wollte er haben …“
Ich kannte das Teil nicht und hatte jetzt auch weder Zeit noch Ruhe, um darüber nachzudenken. „Nimm ihn mit, so wie es aussieht, wird ihn keiner vermissen“, gab ich nach, während ich mich ständig umsah, um sicherzustellen, dass uns niemand beobachtete. Mir war es lieber, dass wir hier unbeobachtet blieben.
Collin hielt sich den Unterarm vor die Nase, um sich vor dem beißenden Gestank zu schützen. Auch ich rang inmitten dieses Geruchs nach verbranntem Fleisch und brennenden Gummireifen nach frischer Luft. Vergeblich. Lunge und Augen brannten höllisch. Es war nicht auszuhalten. Wir mussten hier weg. Und zwar schnell.
Mit zusammengekniffenen Augen blickte ich noch einmal über das Schlachtfeld. Ich hatte schon eine Menge gesehen, aber das hier war wirklich eine heftige Erfahrung, und ich wünschte, ich hätte Collin nicht mitgenommen. Das hier war kein Abenteuer, sondern eindeutig eine Nummer zu heftig für die Seele eines Kindes. Gott sei Dank hatte er nicht viel mehr als brennende Teile und verstreute Koffer gesehen.
Mir schlotterten zum wiederholten Male an diesem Tag die Beine, als wir zu den Rädern zurückgingen. Nein, ich zitterte ehrlich gesagt sogar am ganzen Körper, versuchte aber, es nicht zu zeigen. Ich wollte Collin nicht noch mehr verstören.
„Was ist hier passiert?“, fragte er wieder.
„Eindeutig ein Flugzeugabsturz, da hat wohl keiner überlebt.“
„Hast du tote Menschen gesehen?“
„Nein, sind wohl alle bei dem Aufschlag und der Explosion verbrannt oder eher gesagt pulverisiert worden“, log ich.
„So möchte ich nicht sterben“, stellte Collin fest.
„Du wirst sicher ein ganz normales Leben haben und sehr alt werden“, antwortete ich, um ihn zu beruhigen. „Bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, ist statistisch im Bereich des Unmöglichen, gerade wenn man so gut wie nie mit dem Flugzeug fliegt.“ Was ich sagte, spielte sich wie automatisch ab. Gedanklich war ich schon ganz woanders.
Wir hatten doch noch einen zweiten Knall gehört. Der Strom war weg. Keine Leute in Autos zu sehen. In meinem Kopf ratterte es ganz gewaltig. Was wir hier sahen, konnte unmöglich alles sein. Es war nur ein kleiner Ausschnitt. Es musste größere Ausmaße annehmen, als wir uns vorstellen konnten. Womöglich befand sich zu diesem Zeitpunkt die ganze Welt im Ausnahmezustand.
Ich beruhigte mich etwas, als wir wieder auf unseren Fahrrädern saßen. Was mich aber gleichzeitig beunruhigte, war die Stille. Diese Stille hatte ich auch schon auf dem Schlachtfeld des Unglückes wahrgenommen. Es war eine surreale Stille, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Wir wohnten schon lange hier draußen. Unser nächster Nachbar war Kilometer weit entfernt von unserem Hof. Doch war fast immer ein Hintergrundrauschen zu hören gewesen: in weiter Ferne fahrende Autos, Flugzeuge oder eine Kettesäge, die wie ein Waldmoped ein paar Runden drehte.
Jetzt aber war es absolut still – irgendwie wunderschön, aber gleichzeitig aufdringlich beängstigend.
Heilfroh war ich, als wir von unserer Erkundung unversehrt wieder zu Hause ankamen.
Mala kam uns sofort entgegen, als sie uns sah. „Seid ihr okay? Was habt ihr gesehen?“
Bevor ich etwas sagen konnte, stürzte Lenni auf Collin zu und fragte ihn: „Hast du es gefunden?“
Ohne ein Wort übergab Collin ihm den Magicube.
„Da ist er ja endlich, guck mal, Mama, das ist er, ich habe ihn mir schon so lange gewünscht“, freute sich Lenni lautstark.
„Er funktioniert aber nicht, habe es schon ausprobiert“, rief Collin ihm hinterher.
Offensichtlich war es Lenni egal. Er lief mit seiner Beute ins Haus und knallte hinter sich die Tür zu.
Die Frage, woher er wusste, dass Collin ihm etwas mitgebracht hatte, stellte ich mir erst viel später.
Collin berichtete: „Mama, da ist ein Flugzeug abgestürzt, alle sind tot!“
„Hat er Leichen gesehen?“, fragte Mala leise in meine Richtung.
„Nein, aber Pulvermenschen hat Papa gesehen, hat er gesagt“, verpetzte mich Collin.
Ich grinste verlegen. „Nein, so war das nicht gemeint, ich vermute, alle sind bei der Explosion des Flugzeugs sofort verbrannt.“
„Geh doch bitte rein und setz uns etwas Wasser auf, die Küchenhexe brennt schon“, bat Mala Collin, dann fragte sie: „Was hast du gesehen, und wo habt ihr dieses Spielzeug her?“
Ich erzählte Mala alles haarklein. Auch von der unheimlichen Stille, dem ekelerregenden Geruch und dass wir keinen einzigen lebenden Menschen gesehen hatten, weder unterwegs noch bei der Absturzstelle. „Kein Auto, kein Garnichts, als ob wir die letzten Menschen auf dem Planeten wären“, schloss ich meinen Bericht.
„Was ist hier los? Wie sollen wir am Samstag zur Hochzeit von Carla kommen? Wie soll das gehen, wenn das Auto kaputt ist?“, fragte Mala aufgebracht.
„Komm, wir gehen erst mal rein und trinken einen Kaffee“, schlug ich vor.
Carla war Malas beste Freundin. Sie heiratete zum zweiten Mal, aber ich vermutete, ihre Hochzeit würde angesichts der Situation sowieso ausfallen, sagte jedoch vorerst nichts weiter dazu.
Später beim Kaffee ging ich dann nochmal auf Malas Fragen ein: „Du weißt selber, dass das Auto nicht kaputt ist. Der Strom ist weg, scheinbar sind alle technischen Geräte defekt. Es kann nur ein EMP oder ein Sonnensturm oder sonst irgendein kosmisches Ereignis gewesen sein, welches dafür verantwortlich ist.“
„Was machen wir jetzt? Wie soll es weitergehen und wann wird es wieder normal?“, fragte Mala mit deutlich zitternder Stimme, und ohne auch nur einen Schluck Kaffee getrunken zu haben.
„Wir sind doch gut vorbereitet; kaum jemand ist so gut vorbereitet wie wir“, versuchte ich die Lage zu deeskalieren.
Das schien sie etwas zu beruhigen. Wir nippten am lauwarmen Kaffee. Sie wusste es, ich wusste es. Uns war schon vor vielen Jahren klar gewesen, dass es irgendwann zu einem Showdown kommen musste.
Doch wir hatten all das nicht nur intuitiv gespürt und geahnt, wir hatten auch dementsprechend gehandelt. Anstatt Sparkonten bei langsam sterbenden Banken zu füttern, hatten wir immer alles Geld, was übrig war, in unseren Hof gesteckt: in unsere Selbstversorgung und in unsere kleine Land- und Forstwirtschaft, in Maschinen, in Vorräte und vor allem in die Solar-Batterieanlage. Ich war damals voller Hoffnung, dass es uns lange Zeit autark machen würde, aber keiner konnte an alles denken. Wir waren es ja schließlich gewohnt gewesen, jederzeit alle Hilfsmittel, Ersatzteile, Nahrungsmittel und was man sonst so braucht, kaufen zu können – einfach mit einem Klick im Netz bestellen, wenn die Kohle stimmte. „Ihnen wird geholfen“, just in time.
Diese Zeit war offensichtlich erst mal vorbei, wie es aussah. „Nun ist jeder auf sich gestellt, und alle, die noch was von der alten Welt wissen, in der es noch keine Erfindungen wie Elektrizität oder Internet gab, werden auch diese Zeit irgendwie überstehen.“ Ich trank meinen letzten Schluck Kaffee. Wir hatten uns etwas beruhigt.
„Sag mal, was für ein Teil habt ihr da mitgebracht?“, fragte Mala plötzlich.
„Ich denke, es ist ein Spielzeug, das nur mit Elektrizität läuft, denn es funktioniert auch nicht. Collin wollte es Lenni unbedingt mitbringen.“
Beinahe den ganzen restlichen Tag verbrachten wir damit, über die neue Situation zu sprechen, vor allem aber darüber, wie wir am besten damit umgehen könnten. Wir alle waren erschöpft und müde und gingen an diesem Tag früh schlafen. In dieser Nacht hatte ich wirre Träume, die mich mehrmals aus meinem Schlaf rissen.
5. Ordnung ist das halbe Leben
Vor dem Ereignis hatte ich mich ausführlich mit sämtlichen Themen beschäftigt, alle möglichen Ratgeber gelesen oder als Hörbuch gehört. Sogar einen sauteuren Online- Kurs zum Thema „Wie Sie mehr Ordnung in Ihr Leben bringen und jeden Tag zwei Prozent effizienter werden“ hatte ich absolviert. Demnach müsste ich heute um die dreißigtausend Prozent effizienter sein – tatsächlich bin ich aber nur um ein paar Tausend Euro ärmer. Na ja, immerhin hatte ich das theoretische Wissen.
In mir herrscht übrigens auch nur teilweise Ordnung. Wir können diese Ordnung nicht erkennen mit unseren vorgegebenen Denkweisen. Die Urvölker im Urwald konnten die Ordnung in der scheinbaren Unordnung erkennen und mit ihr leben. Sie lebten mit dieser Unordnung, aber für sie war es Ordnung; zumindest wurde es mir so erklärt. Die Welt, in der wir uns jetzt befinden, ist dieser Urwald. Wir müssen uns die Ordnung, die wir für unser Leben brauchen, neu erarbeiten. Aber langsam und bedächtig, denn der Urwald hat seine eigene anarchistische Ordnung, die wir nicht erkennen können. Wir müssen lernen, diese Ordnung zu erkennen und uns mit ihr zu verbinden. Dies bedeutet nicht, dass wir uns der Ordnung komplett unterwerfen, sondern dass wir mit ihr wachsen und eine Symbiose bilden. Denn die Ordnung, die wir kannten, war zum Scheitern verurteilt. Sie war die echte Unordnung.
Nach dem Ereignis auch nur ansatzweise eine Ordnung wiederherzustellen, war die größte Herausforderung, die uns jemals bevorstand.