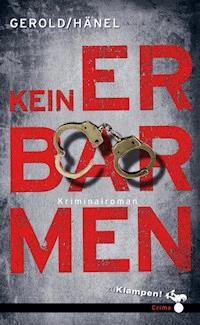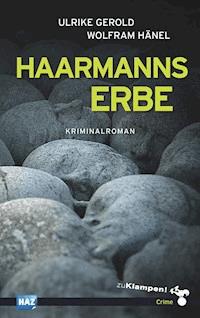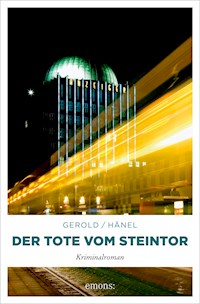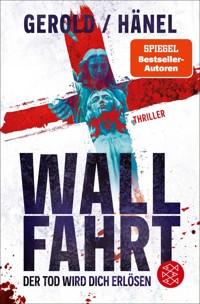
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie sind auf der Suche nach Erleuchtung, doch sie finden den Tod. Der neue Thriller des erfolgreichen Autorenduos Ulrike Gerold und Wolfram Hänel Ein abgelegenes Dorf in den Bergen. Seit sich hier vor einigen Jahren ein Wunder ereignet hat, pilgern immer mehr Menschen auf Sinnsuche dorthin. Auch die junge Journalistin Mara reist an, um eine Reportage über den neuen Wallfahrtsort zu schreiben. Doch die Dorfbewohner sind alles andere erfreut über ihre Recherche, und das spirituelle Seminarzentrum am Hang hoch über dem Dorf wird streng von der Außenwelt abgeschirmt. Mara wird misstrauisch: Was hat das Dorf zu verbergen? Als ein Pilger tot aufgefunden wird, sieht sich Mara plötzlich selbst in tödlicher Gefahr. Und sie ist nicht die Einzige, die in einem perfiden Spiel um Geld und Macht von einem persönlichen Geheimnis gequält wird, dessen Auflösung ihre schlimmsten Albträume übertrifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ulrike Gerold | Wolfram Hänel
Wallfahrt
Der Tod wird dich erlösen
Thriller
Über dieses Buch
Ein abgelegenes Dorf in den Bergen. Seit sich hier angeblich ein Wunder ereignet hat, pilgern immer mehr Menschen auf Sinnsuche dorthin. Auch die junge Journalistin Mara reist an, um eine Reportage über den neuen Wallfahrtsort zu schreiben. Doch die Dorfbewohner sind alles andere erfreut über ihre Recherche, und das spirituelle Seminarzentrum am Hang hoch über dem Dorf wird streng von der Außenwelt abgeschirmt. Mara wird misstrauisch: Was hat das Dorf zu verbergen? Als ein Pilger tot aufgefunden wird, sieht sich Mara plötzlich selbst in tödlicher Gefahr. Und sie ist nicht die Einzige, die in einem perfiden Spiel um Geld und Macht von einem persönlichen Geheimnis gequält wird, dessen Auflösung ihre schlimmsten Albträume übertrifft.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ulrike Gerold und Wolfram Hänel waren lange am Theater, bevor sie zu schreiben begannen. Inzwischen haben sie über 150 Romane, Erzählungen und Bilderbücher veröffentlicht, die in insgesamt 30 Sprachen übersetzt wurden. Bei den S. Fischer Verlagen erschienen zuletzt die Thriller »Rauhnächte« und »Fastenzeit«. Beide Autoren leben und arbeiten zusammen in Hannover und Berlin und sind Mitglieder im PEN Berlin.
Inhalt
Vorspiel auf dem Berg
1. Buch Marja
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
2. Buch Hannah
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
3. Buch Marja und Hannah
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Epilog
4 Tage später
Nachwort
Vorspiel auf dem Berg
Teresa war sich nicht sicher, ob sie noch weiterlaufen sollte. Der Nebel war dichter geworden, sie konnte die Wassertröpfchen auf ihrem Gesicht spüren. Irgendwo ganz in der Nähe krächzte ein Bergvogel, eine Dohle vielleicht. Sie wusste nicht, ob das ständige Rauschen in ihren Ohren von der Schlucht bis zu ihr heraufdrang oder ob es ihr eigenes Blut war, das sie hörte. Sie hatte Angst. Ihr war übel. Ihr Magen krampfte sich immer wieder zusammen, so dass sie sich keuchend krümmte und die Hände auf den Bauch presste, bis der Schmerz nachließ.
Die steinernen Stufen der Treppe waren so glitschig, dass sie mehrmals ausrutschte. Sie musste besser aufpassen, aber sie durfte nicht nach unten sehen, dann wurde ihr schwindlig. Es kam ihr vor, als würde der Nebel sie wie ein feuchtes Tuch umhüllen und ihr die Luft zum Atmen nehmen.
Für einen Moment wusste sie nicht mehr, ob die Stufen aufwärts oder abwärts führten. Alles drehte sich, sie wollte sich festhalten, aber da war nichts, woran sie ihre schweißnassen Hände klammern konnte, nur der undurchdringliche Schleier von Feuchtigkeit und Kälte.
Zitternd versuchte sie, ihren Atem unter Kontrolle zu bekommen, wenn sie jetzt in Panik geriet, war alles vergeblich. Ein plötzlicher Windstoß zerfetzte den Nebel und ließ einzelne Schwaden zurück, eine windschiefe, kaum mannshohe Kiefer tauchte auf, die knorrigen Äste wie zu einem stummen Hilfeschrei erhoben, dahinter die Felsbrocken, wahllos hingestreut von irgendeiner höheren Macht. Vom Schicksal, das sie unwillentlich herausgefordert hatte, als sie auf den Berg gestiegen war. Um zu tun, was man ihr aufgetragen hatte. Weil nur sie das Dorf retten konnte. Ohne sie würden alle verloren sein! Von ihr ganz allein hing es ab, ob sich alles noch zum Guten wendete.
Weil sie auserwählt war, wie der Pfarrer es ihr erklärt hatte. Er hatte ihr auch die Bilder gezeigt, damit sie wusste, was passieren würde. Es waren schöne Bilder, so schön, dass sie nicht länger gezögert hatte, sondern pünktlich mit dem Läuten der Frühmesse die ersten Stufen hinaufgestiegen war.
Von dem Nebel hatte ihr niemand etwas gesagt. Und auch nicht von den Schmerzen in ihrem Unterleib. Von der Übelkeit und der Angst, die sie im Nacken spürte wie eine unerbittliche Faust. Eine Faust, die sie ohne Erbarmen vorantrieb und sie zwang, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Aber sie wusste, dass sie jetzt nicht aufgeben durfte. Nicht schwach werden. Der Pfarrer hatte es im Traum alles vorausgesehen. Gott hatte zu ihm gesprochen! Und Gott hatte ihren Namen genannt. Teresa. Der Pfarrer hatte es ganz deutlich gehört. Es gab niemanden sonst im Dorf mit diesem Namen. Deshalb durfte sie ihre Leute jetzt nicht enttäuschen. Den Pfarrer, den Lehrer, ihren Vater. Das ganze Dorf.
Die Bilder waren so schön gewesen! Sie hatte sie sich lange angesehen. Sich jeden Pinselstrich genau eingeprägt. Die Farben des Gewands, die vorgestreckten Hände, den hellen Strahlenkranz, der die Haare und das Gesicht umspielte und die Gestalt von innen heraus zum Leuchten brachte. So schön, so voller Milde und göttlicher Güte …
Sie wusste nicht, warum sie immer noch wie gebannt auf den Stamm der krumm gewachsenen Kiefer starrte. Als würde der Baum sie zwingen wollen, den Blick nicht abzuwenden. Als würde er ihr das Versprechen geben, dass sie nicht alleine war in der grauen Einsamkeit der Bergwelt. Dass der Baum ihr den rechten Weg zeigen würde, wenn sie ihn nur lange genug betrachtete.
Und dann passierte es. Ein dumpfer Knall, ein leuchtender Feuerball, der direkt vor ihr aufflammte, um gleich darauf schon wieder in tausend Funken zu zerstieben. So plötzlich und unerwartet, dass sie zurückschreckte und die Stufe unter ihrem Fuß verfehlte. Da war nur das lose Gestein, sie fand keinen Halt, für einen Augenblick ruderte sie hilflos mit den Armen. Ihr Herz raste vor Panik, gleich würde sie rückwärts in den Abgrund stürzen. Doch im selben Moment war die Gestalt da, von einem gleißenden Lichtschein umgeben streckte sie ihr die Hände entgegen, um sie festzuhalten. Sie sagte kein Wort, sie lächelte nur und sah aus wie auf den Bildern des Pfarrers, nur viel schöner noch …
Als sie wieder zu sich kam, lag sie so dicht an der Felskante, dass sie den kalten Luftzug aus der Tiefe am ganzen Körper spürte. Zitternd versuchte sie, sich aufzurichten, aber ihr fehlte die Kraft. Auf allen vieren kroch sie zurück zu den Stufen, bis sie in Sicherheit war. Und da kamen ihr auch schon die Männer entgegengeeilt, ihr Vater war als Erster bei ihr und schloss sie in seine Arme, als wollte er sie nie wieder loslassen, sie mit seiner ganzen Liebe umhüllen und um Verzeihung bitten für das, was geschehen war. Aber das musste er nicht, es gab nichts zu verzeihen, sie war ja glücklich, so glücklich wie noch nie zuvor. Sie fühlte sich tatsächlich auserwählt, ihr war die Heilige Jungfrau erschienen, die Madonna, die Mutter Gottes!
»Ich habe sie gesehen«, flüsterte sie, »sie hat mich gehalten, mich in letzter Sekunde gerettet, sonst wäre ich in die Schlucht gestürzt. Aber sie war da, und sie war so schön …«
»Mein liebes Kind.« Der Pfarrer legte ihr segnend die Hand auf den Kopf. »Es ist also alles wahr geworden, was ich gesehen habe! Und so werden wir es allen erzählen, damit auch sie wieder Hoffnung schöpfen können. Es gibt einen Weg, es gibt immer einen, und wenn du auch noch so verzweifelt sein magst. – Aber was ist, was hast du, Kind? Warum siehst du plötzlich so erschrocken aus?«
»Da war noch was anderes, ich hatte es vergessen, aber jetzt weiß ich es wieder! Da war ein Baum, der plötzlich lichterloh gebrannt hat. Es gab einen Knall, und dann Flammen und Funken überall und …«
»Ein Baum«, murmelte der Pfarrer, »ein Baum … Nein, kein Baum, im Nebel sieht alles anders aus!« Wieder legte er ihr die Hand auf den Kopf. »Sie hat einen brennenden Dornbusch gesehen! Ein Zeichen des Schöpfers. Und gleich darauf ist ihr die Heilige Jungfrau erschienen, um sie vor dem Abgrund zu retten.«
»Ein Wunder«, flüsterte der Vater andächtig. »Es ist tatsächlich ein Wunder geschehen.«
Der Lehrer nickte. »Das Wunder von Fischbach, so werden sie es in den Zeitungen nennen. In den Nachrichten, überall.«
1. BuchMarja
Geheimnisse sind noch keine Wunder. (Johann Wolfgang von Goethe)
Vier Wochen später
1. Kapitel
Als Marja die ersten Pilger sah, war es kurz nach acht. Marja war die ganze Nacht durchgefahren, fühlte sich aber erstaunlich fit. Nur ihr Magen meldete sich jetzt. Und sie brauchte dringend einen Kaffee!
Die Bäckerei hatte gerade erst geöffnet, aber schon schwirrten die Wespen über dem Kuchen in der Auslage.
»Wo kommen Sie her?«, wollte die Bäckersfrau wissen.
»Berlin.«
»Lange Fahrt. Ich bin nicht mehr gerne unterwegs bei dem Verkehr heute, und im Dunkeln schon gar nicht.«
»Ich fahre am liebsten nachts. Es ist zwar anstrengend, aber wenigstens stehe ich dann nicht dauernd im Stau. – Ein Brötchen hätte ich auch noch gern, bitte, eine Semmel, meine ich.« Ihr Blick wanderte über den gläsernen Tresen. »Vielleicht eins von denen mit Käse!«
»Ich kann Ihnen auch schnell ein richtiges Frühstück machen, mit Ei und allem«, bot die Bäckersfrau ihr an.
»Wirklich? Das wäre fantastisch, ja!«
»Hart oder weich gekocht? Das Ei, meine ich.«
»So … mittel?«
»Passt. Ich mache Ihnen ein Tablett fertig und bringe es Ihnen raus. Sie können sich draußen in die Sonne setzen, noch ist es nicht zu warm.«
»Vielen Dank! Ach so, und bitte keine Wurst und keinen Schinken, ja? Ich esse kein Fleisch.«
Die Bäckersfrau tat die Information mit einem Schulterzucken ab, als wäre sie Schlimmeres von ihren Kunden gewohnt.
Marja suchte sich einen Platz an der Hausmauer und legte den Kopf zurück. Die Sonne tat gut. Für eine Sekunde schloss sie die Augen, jetzt erst merkte sie, wie müde sie doch war.
Ein Lieferwagen hielt direkt vor ihrem Tisch. Der Fahrer ließ den Motor laufen und verschwand in der Bäckerei. Marja hörte, wie er »zwei Semmeln mit Wildschweinsalami« bestellte. Er duzte die Bäckersfrau. Sie redeten noch ein paar Sätze übers Wetter. Und dass er froh war, heute mal nicht zu dem »Schuppen am Berg oben« zu müssen. »Bin fertig mit der Arbeit bei den Großkopferten, dem Herrgott sei Dank, war genug Nerverei mit denen.«
Als er zurück zu seinem Auto kam, konnte Marja es nicht lassen, laut zu sagen: »Danke für den Dieselqualm. War genau, was mir heute Morgen noch gefehlt hat.«
Der Fahrer blickte sie an, als wäre er sich nicht sicher, was sie überhaupt meinte. Kopfschüttelnd tippte er sich an die Stirn und stieg ein, um weiterzufahren. Auf der Rückseite des Lieferwagens stand in Großbuchstaben: SCHADEN AM DACH? WIR SIND VOM FACH!
Marja überlegte noch, ob der Satz als Werbung wirklich überzeugend war, als die Bäckersfrau das Frühstück brachte. Der Käseteller hätte auch für zwei Leute gereicht, im Brotkorb lagen eine Kaisersemmel, ein Körnerbrötchen, eine Laugenbrezel, ein Croissant, es gab drei verschiedene Marmeladen und ein Schälchen Honig.
»Alles für mich?«, fragte Marja irritiert.
»Freilich. Das Ei bringe ich auch gleich noch. Und schön dumm, dass Sie auf den Bauernschinken verzichten wollen, aber da kann man nichts machen. Ich wünsch einen guten Appetit. Sagen Sie, wenn noch was fehlt! Sie brauchen bloß zu rufen, ich bin im Laden. – Ah, da sind die Spinner ja«, sagte sie im Umdrehen und wies zum Fußweg auf der anderen Straßenseite. Ihre Stimme hatte einen abwertenden Ton, als sie hinzusetzte: »Ich hab mich schon gewundert, wo sie heute bleiben. Aber so geht das hier jetzt jeden Tag, seit das in der Presse stand mit dem Mädchen, das angeblich die Madonna gesehen hat. Als ob das ein Grund wäre, bei der Hitze bis hoch zum Bergdorf zu laufen! In Zelten wohnen sie dort. Und sie sitzen die halbe Nacht lang am Feuer und singen. Mehr will ich gar nicht wissen. Das sind Spinner, alle miteinander, wie ich’s gesagt habe. Die wollen doch hinterher nur erzählen können, dass sie höchstpersönlich dabei waren, bei dem Wunder!« Die Bäckersfrau malte zwei Anführungszeichen in die Luft. »Mehr ist da nicht, alles nur Getue und Geschwätz, glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.«
Marja kamen die Pilger mit ihren Rucksäcken und den derben Stiefeln eher so vor, als müsste man Mitleid mit ihnen haben. Sie suchen nach etwas, das es vielleicht gar nicht gibt, dachte sie, aber sie glauben fest daran, sie hoffen auf Heilung von irgendwelchen Krankheiten, auf … ein Wunder, damit der Lahme sich aus seinem Rollstuhl erheben und der Blinde wieder sehen kann. Damit der Krebs verschwindet, der Alzheimer, die Inkontinenz, das nässende Ekzem, was auch immer. Herr, erlöse uns von dem Übel.
»Warten Sie!« Marja hielt die Bäckersfrau am Ärmel fest. »Sie glauben nicht, dass es das Wunder am Berg tatsächlich gegeben hat?«
»Wen interessiert es schon, was ich glaube?« Sie musterte Marja argwöhnisch. »Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie gehören auch zu denen. Sie sehen nicht so aus!«
»Nicht zu den Pilgern, nein«, beeilte sich Marja zu versichern. »Aber ich will ebenfalls hoch zu dem Dorf, das stimmt. Ich bin … Ich arbeite für eine Zeitung«, entschied sie, einfach die Wahrheit zu sagen. Oder zumindest einen Teil der Wahrheit. »Ich bin Fotografin, der Kollege, der den Artikel schreiben wird, kommt erst in ein paar Tagen. Aber natürlich interessiert es mich, wenn Sie sagen, dass das mit dem Wunder vielleicht alles nur Geschwätz und dummes Gerede ist. Wie kommen Sie darauf? Ich möchte es gerne wissen, wenn da irgendetwas … nicht ganz sauber ist. Es bleibt unter uns, das verspreche ich Ihnen.«
»Sagt jemand von der Zeitung?« Die Bäckersfrau lächelte spöttisch. »Das können Sie sonst wem weismachen, aber ganz bestimmt nicht mir. Essen Sie Ihr Frühstück, sonst ist der Kaffee kalt und schmeckt nicht mehr. Ich bringe Ihnen noch das Ei. Und geben Sie sich keine Mühe, von mir werden Sie gar nichts hören.« Sie fuhr sich mit dem Zeigefinger über die Lippen, als würde sie einen Reißverschluss zuziehen.
Marja war klar, dass jeder weitere Versuch, die Frau auszuhorchen, vergeblich sein würde. Vielleicht hätte sie nicht unbedingt die Wahrheit sagen sollen. Es gab nur zwei Arten von Reaktionen, wenn sie ihren Beruf verriet, entweder sprudelten die Leute nur so vor Mitteilungseifer – oder sie mauerten. So wie die Bäckersfrau. Aber es war ein Versuch gewesen, es hätte auch klappen können. Hatte es nur leider nicht.
Umso überraschter war Marja, als die Frau gleich darauf mit dem Frühstücksei kam und sich dicht zu ihr beugte, um zu flüstern: »Ich an Ihrer Stelle würd mal fragen, was der Vater von dem Madel so macht. Aber das haben Sie nicht von mir, hören Sie?«
Marja ließ sich Zeit mit ihrem Frühstück, während sie vergeblich versuchte, sich irgendeinen Reim auf die Andeutung der Bäckersfrau zu machen.
Zweimal noch zogen Pilger an ihr vorüber, beide Male hatte Marja das Gefühl, dass die Leute begehrliche Blicke auf ihr opulentes Frühstück warfen. Es war ihr fast peinlich, als wäre der üppig gedeckte Tisch vor ihr mehr als unpassend. Weit hinter der zweiten Gruppe kam noch eine Frau, die ihren Mann im Rollstuhl schob. Sein verzerrtes Gesicht zeigte nichts als Angst. Panik. Die Frau tätschelte ihm unentwegt die Schulter oder streichelte seine Wange, während sie selbst offensichtlich Mühe hatte, den Rollstuhl zu schieben. Marja fragte sich, wie sie es jemals alleine auf den Berg hinauf schaffen wollte. Sollte sie die Frau nachher noch mal wiedersehen, würde sie gar nicht anders können, als ihr zu helfen.
Marja war der Appetit vergangen. Sie hatte plötzlich einen Geschmack wie nach Metall im Mund, den sie nicht erklären konnte. Und die Innenseite ihrer linken Hand schmerzte wieder. Aber es war nichts zu sehen, keine Rötung, keine Schwellung. Die Stelle war auch nicht druckempfindlich.
Nach kurzem Überlegen schob sie das Croissant in ihre Tasche, den Rest stellte sie auf das Tablett und brachte es zurück in den Laden, um zu bezahlen. Sie bedankte sich noch einmal für das reichhaltige Frühstück: »Es war sehr lecker, wirklich, aber einfach zu viel. Tut mir leid.«
Dann bat sie darum, sich kurz frisch machen zu dürfen.
In dem winzigen Bad betrachtete sie sich für einen Moment im Spiegel. Als wollte sie ihre Stimmung erforschen, um sich wirklich sicher sein zu können, dass sie von ihrem Plan nicht abweichen würde.
Was sie sah, gefiel ihr, sie war zufrieden mit sich. Was ihr nicht gefiel, sah man nicht, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb zog sie sich sorgfältig die Lippen nach und trug neuen Mascara auf. Deutlich mehr als notwendig, eher wie für die Rolle der exotischen Schönheit auf einer Party. Als wollte sie für die Leute im Bergdorf da oben von vornherein klarstellen, dass sie aus einem Schmelztiegel der verschiedensten Nationen kam und ihre Herkunft nicht verstecken musste.
Obwohl ein Dorf voller Pilger wahrscheinlich kaum rückständiger sein konnte als der Berliner Geschäftsmann, der sie auf einem Empfang der Tageszeitung gefragt hatte, aus welchem Land sie käme: »Sie sehen nicht aus, als wären Sie von hier.«
»Stimmt. Argentinien.« Ihre übliche Antwort auf solche Fragen, wenn sie es nicht der Mühe wert fand, eine Diskussion vom Zaun zu brechen. Tatsächlich war ihr Vater aus Argentinien, die Mutter hingegen so berlinerisch wie nur irgendwer.
Dass Marja selber Südamerika nie gesehen und auch ihren Vater nie kennengelernt hatte, spielte dabei keine Rolle. Meistens war das Thema mit ihrer Antwort sowieso vom Tisch, diesmal allerdings hatte es einen Nachsatz gegeben, den sie so schnell nicht wieder vergessen würde.
»Verstehe«, hatte der Mann gesagt. »Dann haben Sie also Lesen und Schreiben gelernt, nachdem Sie hier zu uns gekommen sind.« Einfach nur eine Feststellung, weil es ja gar nicht anders sein konnte …
Als Marja aus dem Bad wieder in den Laden kam, war die Bäckersfrau gerade dabei, die Wespen von dem Johannisbeerkuchen zu verjagen.
Kurz entschlossen fragte Marja, ob sie vielleicht jemanden wüsste, bei dem sie im Bergdorf unterkommen könnte.
»Am Telefon hat man mir gesagt, dass alle Zimmer in Fischbach vermietet sind, aber vielleicht …« Sie zuckte ratlos mit den Schultern. »Zelte sind nicht so mein Ding.«
»›Alle Zimmer‹ ist ziemlich übertrieben, als hätten sie da überhaupt welche zu vermieten. Aber stimmt schon, ein paar Leute haben tatsächlich Pilger bei sich einquartiert, so wie früher halt, wie in dem Lied. Das kennen Sie doch, oder? Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh, sie vermieten ihre Betten und schlafen auf Stroh!«
Die Bäckersfrau griff nach einem Zettel und kritzelte ein paar Worte. »Hier, gehen Sie damit in Fischbach zur Bäckerei am Marktplatz, da, wo der Brunnen ist. Geben Sie das dem Mann mit der Hasenscharte, das ist mein Bruder. Franz. Sagen Sie ihm einen schönen Gruß, ich hätt’ Sie geschickt.«
»Danke! Und …«
»Er hat ein Zimmer über dem Laden, das leer steht, das weiß ich. Ich wünsch Ihnen viel Glück bei Ihrem Artikel. Finden Sie die Wahrheit heraus!«
Wieder so eine Andeutung, dachte Marja, als sie zurück zu ihrem Auto lief. Noch bevor sie den Motor startete, las sie die Zeilen auf dem Zettel: Sie kommt von mir. Gib ihr das Zimmer und pass auf sie auf. Sie ist in Ordnung.
Kurz hinter dem Ort zweigte die Straße zum Bergdorf ab. Gleich neben dem Straßenschild stand auf einer überdimensionalen Plakatwand FISCHBACH – DORF DES WUNDERS. Mit einem Foto des Dorfes, das wie an den steilen Berghang geklebt wirkte, und einer in leuchtenden Farben gemalten Madonna, die schützend die Hände über die Gassen und Häuser hielt.
Marja wusste nicht, warum ihr bei dem Bild ausgerechnet der Berggeist Rübezahl aus dem Riesengebirge einfiel, freundlich zu den Armen und böse zu denen, die ihn verspotteten oder nicht an ihn glaubten. Vergeblich suchte sie auf dem Foto nach dem modernen Gebäude auf der anderen Seite der Schlucht, wo ja auch das Wunder geschehen war. Dieses »Zentrum für spirituelle Heilung«, das sie mehr interessierte, als sie irgendjemandem erzählen würde. Aber die entsprechende Stelle des Fotos wurde von dem wallenden Gewand der Madonna verdeckt.
Immer wieder überholte Marja vereinzelte Pilger, die zu Fuß unterwegs waren, eine Viertelstunde später hatte sie den Parkplatz erreicht, der mit rot-weißem Flatterband auf einer Kuhweide abgespannt war. Von hier aus durften nur die Dorfbewohner weiterfahren, Pilger und andere Besucher mussten laufen. Ein Wachposten in einer notdürftig gezimmerten Bretterbude sorgte dafür, dass sich jeder an die Anweisung hielt.
Die Autos standen dicht an dicht, erst nach einigem Suchen fand Marja noch einen freien Platz zwischen einem Toyota-Bus und einem verbeulten Ford Transit mit der Aufschrift JESUS LIEBT DICH.
Den Kennzeichen zufolge kamen die meisten Wagen aus Österreich und Süddeutschland, aber Marja sah auch Nummernschilder aus Holland und sogar ein altes BMW-Motorrad mit Beiwagen, auf dessen Tank die schwedische Fahne gemalt war.
Marja war froh, dass sie ihre Sachen in weiser Voraussicht in dem großen Wanderrucksack verstaut hatte – als hätte sie schon geahnt, dass sie ihr Gepäck zu Fuß auf den Berg schleppen musste.
»2 Kilometer« stand auf dem Schild nach Fischbach. Dicht neben der Straße war der Gebirgsfluss, dessen grünliches Wasser zwischen den rund geschliffenen Steinen gurgelnd ins Tal schoss, wie befreit von der feuchtkalten Enge der Schlucht. Eine schmale Holzbrücke führte zur anderen Seite hinüber, von wo aus der Kreuzweg mit den Betstationen nach oben führte. Dort oben war dem Mädchen die Madonna erschienen, kurz vor dem verlassenen Dorf, von dem nur noch Ruinen existierten.
Marja hatte eine Reihe von Bildern im Netz gefunden – sowohl historische Aufnahmen als auch Fotos von diesem »Zentrum für spirituelle Heilung«, das offensichtlich zwischen den Mauerresten der alten Häuser errichtet worden war. Schon über ein Jahr vor dem Wunder, als noch weder an Pilger zu denken gewesen war noch an den Parkplatz mit den in der Sonne glitzernden Autos oder gar die Budenstadt, die sich als schmale Gasse am Ufer des Flusses entlangzog.
Für die frühe Uhrzeit herrschte bereits erstaunlich viel Betrieb zwischen den Buden, vor allem am Stand mit den »handgeschnitzten« Wanderstöcken standen die Pilger Schlange. Und natürlich gab es das übliche Sammelsurium an Devotionalien-Ständen, angefangen mit bunten Heiligenbildchen über noch buntere Madonnenstatuen, Kruzifixe, Rosenkränze und Grableuchten bis hin zu geweihtem Wasser in durchsichtigen Flaschen.
Über einer Bude prangte das Schild: ÈÈN SPREEKT NEDERLANDS.
Für einen Augenblick überlegte Marja, ob sie gleich schon ein paar Fotos machen sollte, entschied sich dann aber anders. Sie musste erst mal den Rucksack loswerden und so ganz nebenbei auch mal die Zähne putzen, sich waschen und zur Toilette. Und dann würde sie gerne ein paar Stunden schlafen, bevor sie entschied, wie sie weitermachen wollte.
Weshalb sie der Bäckersfrau, die ihr das Zimmer bei ihrem Bruder vermittelt hatte, jetzt schon dankbar war! Egal, wie dieses Zimmer sein würde, Marja brauchte sich nur vorzustellen, dass die einzige Alternative wahrscheinlich ein Feldbett in einem Pilgerzelt gewesen wäre. Mal ganz abgesehen von den Dixi-Klos, die es da im Dorf sicher genauso geben würde wie hier am Parkplatz.
Die Straße nach Fischbach führte in engen Kehren steil bergan, schon vor der ersten Serpentine sah Marja die Frau mit dem Mann im Rollstuhl. Aber sie schien Hilfe gefunden zu haben, eine ganze Gruppe anderer Pilger kümmerte sich um sie.
Hoch oben über Marja kreiste in dem wolkenlosen Himmel ein Raubvogel. Sein schriller Ruf kam ihr vor wie eine Warnung.
Er wusste es, seit er vierzehn war. Die anderen wollten Autorennfahrer werden. Fußballspieler. Arzt oder Lehrer, wie die Eltern. Einer sollte den Betrieb von seinem Alten übernehmen. Gas, Wasser, Scheiße. Handwerk hat goldenen Boden und so. Auch ein zukünftiger Polizist war dabei, Kripo natürlich.
Alles völlig normal, wie zu erwarten bei Achtklässlern eines Gymnasiums. Nur seine eigene Antwort war eindeutig aus dem Rahmen gefallen: »Millionär.«
Der Lehrer hatte behauptet, dass das kein Beruf wäre. Aber das war ihm egal gewesen. Er hatte sogar noch einen draufgesetzt. »Als Anfang. Und später dann Milliardär.«
Ist immerhin ein Unterschied von exakt eintausend Millionen. Musste er den anderen erst mal erklären. Er weiß bis heute nicht, ob sie’s kapiert haben. Dass du alles erreichen kannst, wenn du etwas wirklich willst.
Blöd war das mit dem Sitzenbleiben in der Zehnten. Und auch noch gleich zweimal hintereinander! Sie haben ihn abgesägt. Wahrscheinlich, weil er nicht ins Bild passte. Zu aufmüpfig, kein Duckmäuser, keiner, der sich von irgendeinem in die Suppe spucken lässt.
Aber das war’s dann. Kein Abitur. Noch nicht mal Realschulabschluss, nur Hauptschule.
2. Kapitel
Marja war vorsichtig. Sie hielt sich zunächst im Hintergrund und gab weiterhin vor, nur für die Fotos einer Reportage angereist zu sein, der verantwortliche Redakteur sei überraschend krank geworden, würde aber hoffentlich in ein paar Tagen nachkommen. So erzählte sie es auch dem Bäcker von Fischbach, Franz, der ihr das leer stehende Zimmer über seinem Laden mit den Worten vermietet hatte: »Ich mach einfach, was die Schwester will, sie ist schlauer als ich. Sie hat auch wirklich Bäckerin gelernt und sogar Konditorin! Ich bin nur einer, der grad mal einen Blechkuchen mit Marillen hinbekommt, aber die Schwester hat im ganz feinen Hotel in München gearbeitet, als Patissière, nur wollt sie dann doch lieber ihren eigenen Laden da an der Grenze haben, ist weniger Stress, sagt sie immer. Sie kommt alle paar Wochen mal hier herauf, um mich zu besuchen, deshalb auch das Zimmer, das ich nicht vermiete, obwohl ich gerade jetzt gutes Geld damit verdienen könnte. Also, Sie zahlen mir vierzig pro Nacht, ist ja nicht so komfortabel, Sie werden es gleich sehen. Aber dafür haben Sie auch Ihre Ruhe, da bin nur ich im Haus, und die Frau, passt schon. Drei Leute habe ich noch in der Backstube hinten im Hof, wir fangen früh an, drei, halb vier in der Nacht, ab sechs stehen die Pilger schon Schlange, eine Stunde später habe ich keine einzige Semmel mehr im Korb.«
Das Zimmer war tatsächlich äußerst spartanisch eingerichtet, aber das Bett war frisch bezogen, die Matratze nicht durchgelegen. Es gab einen zweiflammigen Gaskocher und einen Waschtisch mit einer Blechkanne, der Wasserhahn war draußen im Flur, neben der Tür zur Toilette, die sich auf dem rückwärtigen Balkon befand und durch ein Milchglasfenster zum Hof hin abgeschirmt war. Von Komfort konnte nun wirklich keine Rede sein, aber das ganze Dorf wirkte ärmlich und wie aus der Zeit gefallen, vor dem Ansturm der Pilger war hier sicherlich kaum jemals ein Tourist gewesen, von einigen anspruchslosen Bergwanderern vielleicht abgesehen.
In Marjas Zimmer deutete nur wenig Persönliches auf die Schwester hin.
Ein Paar Gummistiefel, ein Strohhut auf dem Bauernschrank neben dem Bett. Der Schrank war abgeschlossen, einen Schlüssel konnte Marja nirgends entdecken. Von zwei oder drei Krimis abgesehen, die recht zerlesen wirkten, gab es sonst nur ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto an der Wand über dem beige gestrichenen Holztisch mit den beiden wackligen Stühlen. Marja nahm an, dass das Mädchen mit den langen Zöpfen die Bäckersfrau vom Café an der Grenze war, der Junge neben ihr hatte eine Hasenscharte. Und an die Zimmertür war mit Reißzwecken ein Zeitungsfoto geheftet: eine Hotelküche – und die Frau vom Café mit Pepita-Hose und doppelreihig geknöpfter weißer Jacke, wie sie stolz eine gigantische, turmhohe Torte präsentierte.
In der Wand hinter dem Schrank gab es eine Tür, der obere Teil des Rahmens war gerade noch zu erkennen. Das Nachbarzimmer war angeblich vermietet, allerdings hörte Marja weder am Tag noch in der Nacht irgendein Geräusch von nebenan.
Aus irgendeinem Grund traute sie Franz, dem Bruder, nicht so recht. Das lag vor allem an der Art, wie er sich fast schon zu eifrig um sie bemühte und gleichzeitig doch distanziert blieb, wenn sie ihn etwas fragte. Argwöhnisch. Als würde Marjas Misstrauen auf Gegenseitigkeit beruhen. Wobei sie ihn in Verdacht hatte, ihr heimlich nachzuspionieren, schon zweimal hatte er wie zufällig auf der Treppe gestanden, wenn sie aus ihrem Zimmer kam.
Außer Marja waren noch andere Kollegen im Dorf, und wenn Marja es richtig verstanden hatte, waren sie nicht unbedingt beliebt, vor allem die Fotografen nicht, die wenig Skrupel hatten, »einfach draufzuhalten«, wie es ein Berufskollege mal formuliert hatte. Oder auch: »Mach immer erst das Foto, Leben retten kannst du danach noch.« Es war ihr Job, möglichst reißerische Fotos zu liefern, moralische Bedenken waren da fehl am Platz.
Marja begnügte sich also damit, mit der Canon EOS 90 ein paar Schnappschüsse zu machen, reine Stimmungsbilder, immer darauf bedacht, niemandem zu nahe zu treten. Schon am zweiten Tag ging sie dazu über, lediglich ihr Smartphone zu benutzen, um so noch weniger aufzufallen.
Sie wusste ohnehin aus Erfahrung, dass es oft besser war, nicht allzu viel Interesse zu zeigen. Manchmal musste man auch gar keine konkreten Fragen stellen, einfach nur zuhören, was die Leute so redeten, im Laden, im Café, am Platz. Hier und da ein paar Sätze wechseln, das reichte schon, um genug Informationen zu bekommen, die sich hinterher zusammenfügen ließen. Wie bei einem Puzzle!
Von den anderen Zeitungsleuten hielt sich Marja wohlweislich fern, wenn sie auch zwei, drei bekannte Gesichter sah, Kollegen, die für die überregionale Klatschpresse arbeiteten. Und auf ein paar neue Schlagzeilen hofften! Auf ihre Gesellschaft legte Marja keinen gesteigerten Wert. Das galt für jeden Ort der Welt und für diesen hier ganz besonders.
Während der Tagesstunden war das Dorf wie ausgestorben, die Pilger waren ausnahmslos entweder auf dem Kreuzweg, wo das Wunder geschehen war, oder in dem provisorischen Zeltlager am Berghang. Und die in der Mittagshitze flimmernden Gassen des Dorfes mit den verblichenen Holzläden vor den Fenstern wirkten wie die Kulisse für einen Endzeitfilm, eine Dystopie, der letzte Ort, den es nach irgendeiner fürchterlichen Katastrophe überhaupt noch gab.
Erst auf den zweiten Blick offenbarte sich das Leben hinter den Türen und Fenstern, das Klappern eines Kochtopfs, das Geschrei eines Kleinkindes, das Gedudel des lokalen Popsenders. Eine Frau, die das Fenster aufstieß, um die Blumen auf dem steinernen Sims zu gießen, ein Mann, der seine Fahrradreifen aufpumpte, ein paar Schulkinder, die in einer schattigen Ecke Münzen gegen die Hauswand warfen. »Klimpern« hieß das Spiel zu ihrer Kindheit in Berlin, Marja hatte keine Ahnung, was sie hier dazu sagten, als sie fragte, verstand sie die Antwort nicht.
Am Marktplatz mit dem Brunnen saßen ein paar alte Männer rauchend unter der Markise vorm Café, eine sehr junge Mutter schaukelte ihr Kind im Kinderwagen – so musste es in Fischbach früher gewesen sein, dachte Marja, friedlich und still, vielleicht zu friedlich, zu still, zu abgeschieden vom Trubel der Welt, wie abgehängt, nicht mehr dazugehörig.
Im Laden hatte Marja ein paar alte Postkarten entdeckt, Schwarz-Weiß-Fotos, ein Ochsenkarren auf der Dorfstraße, mit Blumen geschmückte Kühe beim Almabtrieb, so was. Ein Hochzeitspaar vor der Kirche, er mit Lederhosen, sie im Dirndl …
Es war alles schön auf eine berührende Weise, fast schon kitschig. Und gleichzeitig zeigte es deutlich, wie rückständig sie hier noch vor wenigen Jahren gewesen waren.
Vielleicht war das auch der Grund, warum den Leuten das Wunder mehr als nur willkommen gewesen war – und wieso sie jetzt alles taten, um diese unverhoffte Fügung des Schicksals bestmöglich zu nutzen. Oder war sie gar nicht so unverhofft gewesen? Und gaben sie nicht nur jetzt alles, um ihr Wunder zu vermarkten, sondern hatten vielleicht schon vorher dem Schicksal ein wenig auf die Sprünge geholfen? Das war die Frage, wegen der Marja hier war.
Die eine Frage. Die andere stand im Moment nicht zur Debatte. Noch nicht. Immer einen Schritt nach dem anderen, so hatte es Marjas Großmutter ihr jedes Mal gepredigt, wenn sie mal wieder zu viel auf einmal wollte. Ihre Großmutter, an die sie noch so viele Fragen gehabt hätte, die sie nun nicht mehr stellen konnte.
Unwillkürlich warf sie einen Blick auf ihre Handflächen. Die Haut sah ganz normal aus, und trotzdem spürte sie einen seltsamen Druck. Dieses taube Gefühl, das sie schon kannte, gleichzeitig ein Kribbeln, wie eine Nervenreizung.
Vom Berghang herüber schallte Musik aus den Lautsprechern, über die auch die Abendandacht gehalten wurde. Ein vielstimmiger Chor, ein Kirchenlied. Marja kannte die Melodie, erinnerte sich aber weder an den Text noch an den Titel. Sie war nicht religiös, sie ging nicht mal mehr Weihnachten in die Kirche. Aus gutem Grund, das letzte Mal hatte sie hinterher wochenlang das Bild von Jesus am Kreuz vor Augen gehabt. Die Dornenkrone, das Blut, das über sein Gesicht lief, der tiefe Schnitt an seiner linken Seite zwischen den Rippen, das Blut aus den aufgerissenen Wunden an seinen Händen und Füßen, wo die Nägel die Haut, das Fleisch, die Knochen durchbohrt hatten.
Auch hier am Marktplatz gab es ein solches Kruzifix, das viel zu realistisch die Wundmale der Kreuzigung zeigte. Allein deshalb schon blickte Marja nicht zu dem Bethäuschen hinüber. Es würde noch hart genug für sie werden, wenn sie morgen den Kreuzweg bis zur obersten Station emporsteigen würde. Morgen oder übermorgen. Sobald sie genug Mut dafür gesammelt hatte.
Die Musik aus dem Zeltlager wurde für einen Moment lauter und brach dann mit einem hässlichen Knacken ab. Nur um gleich darauf mit doppelter Lautstärke wieder einzusetzen. Irgendjemand probierte offenbar die Verstärkeranlage aus. Die Männer vor dem Café murrten genervt, der Wirt trat vor die Tür und sah mit gerunzelter Stirn zu den Zelten hinüber. Marja musste an eine Zeile aus Goethes Zauberlehrling denken: »Die Geister, die ich rief, werd’ ich nun nicht los …« Fast rechnete sie schon damit, dass der Wirt zu dem brummenden Dieselgenerator hinübermarschieren würde, um den Pilgern den Strom abzustellen. Aber dann hob er nur kurz die Faust und verschwand wieder in seinem Bistro.
Marja hatte gestern mit ihm gesprochen, ein paar wie zufällig hingesagte Sätze am Tresen, während sie einen »Verlängerten« trank, einen starken Espresso mit heißem Wasser dazu. Der Wirt war auch der Bürgermeister des Dorfes – und der Vater des Mädchens, dem die Heilige Jungfrau erschienen war. Ohne dass Marja fragen musste, erzählte er ihr, wie stolz er auf seine Tochter war, durch die der Herrgott selbst das ganze Dorf hatte segnen lassen: »Er hat uns ein Zeichen geschickt, dass wir nicht aufgeben sollen. Dass es Hoffnung für uns alle gibt, auch in so schlimmen Zeiten wie diesen.«
Es klang wie auswendig gelernt. Marja meinte sich zu erinnern, den nahezu gleichen Wortlaut bereits in einem der ersten Zeitungsberichte über »Das Wunder von Fischbach« gelesen zu haben.
»Und das Zentrum drüben auf dem Berg?«, hakte sie nach. »Das existiert doch schon länger, und ich frage mich gerade, ob es da vielleicht auch schon mal so etwas … wie ein Wunder gegeben hat? Immerhin heißt es ja ›Zentrum für spirituelle Heilung‹. Ich weiß nichts weiter darüber, aber es ist doch auf demselben Berg, auf dem Ihrer Tochter die Heilige Jungfrau erschienen ist …«
Sie hatte gar nicht vorgehabt, sich nach dem Zentrum zu erkundigen. Noch nicht. Es war eine spontane Entscheidung gewesen. Aber ihre Frage war offensichtlich so unpassend, dass der Wirt sie für eine Sekunde nur anstarrte, bevor er mürrisch erwiderte: »Mit denen haben wir nichts zu tun. Interessiert uns auch nicht, was die machen.«
Das war’s. Ende des Gesprächs. Der Wirt hatte ihr den Rücken zugedreht und begonnen, mit dem Geschirrtuch seine Espressomaschine zu polieren. Wenn Marja sich nicht täuschte, war die chromglänzende Apparatur noch so gut wie fabrikneu – und gehörte wohl zu den unverhofften Segnungen, die der Herrgott dem Dorf zugedacht hatte!
Die Musik aus dem Zeltlager war verstummt. Ein paar Pilger stellten die Bänke und Stühle für die tägliche Andacht im Freien auf. Auch der Dorfpfarrer stand bei ihnen, Marja konnte ihn unschwer an seinem schwarzen Gewand und dem weißen Kragen erkennen. Ein älterer Mann, sicherlich schon über sechzig, seine krummen Schultern wirkten, als würde er persönlich alle Last dieser Welt auf ihnen tragen. Marja hatte bereits in Erfahrung gebracht, dass die Tochter des Wirts an diesen Andachten nicht teilnahm. Wer sie sehen und mit ihr sprechen wollte, musste sich auf einer Liste an der Kirchentür eintragen und einiges an Geduld mitbringen. Die »Sprechzeiten« waren in den beiden frühen Morgenstunden, noch vor Schulbeginn und auf fünf Minuten pro Person begrenzt, das Mädchen war nie alleine, sondern immer in Begleitung des Pfarrers oder ihres Lehrers.
Für die Presseleute gab es Sondertermine am Kreuzweg, an eben der Stelle, an der der fünfzehnjährigen Teresa die Heilige Jungfrau erschienen war.
Wer wollte, konnte in einer der Buden am Rand des Zeltlagers oder unten am Kreuzweg ein Foto des Mädchens kaufen, das von ihr persönlich signiert war. Es gab auch billige Medaillons mit dem Bild der Heiligen Jungfrau auf der Vorder- und dem des Mädchens auf der Rückseite, Teresas Gesicht prangte auf jeder Flasche mit »Heiligem Wasser« aus der Schlucht, selbst T-Shirts mit ihrem Konterfei und dem Satz Ich will fest auf Gott vertrauen gab es inzwischen.
Alles war perfekt organisiert, schon mehrmals hatte sich Marja gefragt, wie die Dorfleute es in so kurzer Zeit überhaupt geschafft hatten, diese gewaltige Werbemaschinerie aus dem Boden zu stampfen. Fast schien es, als wären sie bereits auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen. Zieh keine voreiligen Schlüsse, ermahnte sie sich selber, du bist Journalistin, mach deine Arbeit, und mach sie vor allem ordentlich. Du schreibst keine Romane, in denen du erfinden kannst, was immer du willst, sondern du berichtest über Tatsachen. Und du musst den Dingen so lange auf den Grund gehen, bis du die Wahrheit kennst.
Teresa irgendwo allein anzutreffen, war unmöglich, selbst auf dem Weg zur Kirche oder zur Schule wurde sie immer von einem Erwachsenen begleitet, meistens vom Vater oder der Mutter.
Marja machte sich kaum Hoffnungen, das Mädchen unter vier Augen sprechen zu können, sie würde sich wohl oder übel in die Liste an der Kirche eintragen müssen. Und sie bezweifelte, dass sie bei dem kurzen Gespräch irgendetwas erfahren würde, was nicht dem offiziellen Text entsprach.
Es war eher ein Zufall, dass ihr dann am späten Nachmittag der Junge auffiel, der im Schatten der Häuser mit gesenktem Kopf an den Pilgern vorüberlief, die vom Kreuzweg zurückkamen. Er sah aus wie die meisten Jungen im Dorf, schlaksig, Jeans und Sneaker, merkwürdig war allerdings, dass die Sneaker pink waren – und dass er trotz der Hitze die Kapuze seines Hoodies über den Kopf gezogen hatte.
Das ist kein Junge, dachte Marja im nächsten Augenblick, das ist ein Mädchen, und es kommt aus der Gasse, die hinter dem Bistro entlangführt. Das ist sie selber, das ist Teresa!
Marja war überzeugt, dass sie sich nicht irrte. Sie wartete eine Lücke in dem ihr entgegenkommenden Pilgerstrom ab und folgte dem Mädchen. Vielleicht war das die Gelegenheit, mit der sie schon nicht mehr gerechnet hatte!
Teresa schien ein bestimmtes Ziel zu haben. Oder eine Verabredung! Sie rannte fast bergab, Marja bemühte sich, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Wenigstens blickte sich Teresa nicht um, als würde sie gar nicht auf den Gedanken kommen, dass ihr jemand folgen könnte. Aber dann war sie an der nächsten Biegung plötzlich verschwunden!
Es dauerte einen Moment, bis Marja hinter der Leitplanke auf der rechten Straßenseite den schmalen Pfad entdeckte. Ein von Unkraut überwucherter Tierpfad, der steil nach unten in die Schlucht zu führen schien. Und da war deutlich der Abdruck einer Chucks-Sohle auf dem Boden zu erkennen!
Marja musste aufpassen, schon nach wenigen Metern wurde der Pfad so steinig, dass sie auf dem losen Geröll mehrmals wegrutschte. Ein Stück weiter dann hatte sie durch das Buschwerk hindurch einen freien Blick nach unten. Teresa war bereits bei den Felsbecken unterhalb des Wasserfalls angelangt und turnte über mehrere große Steinbrocken hinweg auf die andere Seite hinüber. Von dort führte der Pfad deutlich erkennbar in engen Serpentinen in die Richtung, in der sich der Kreuzweg befinden musste. Marja meinte, hinter den krumm gewachsenen Kiefern eine der Betstationen auszumachen – Teresa wollte offensichtlich dahin, wo ihr die Madonna erschienen war. Oder …
Der nächste Gedanke ließ Marjas Herzschlag unwillkürlich steigen. Sie schirmte die Augen mit der Hand gegen die Sonne ab. Es stimmte! Vielleicht führte der Pfad gar nicht zum Kreuzweg hinüber, sondern direkt zu dem verlassenen Dorf, dessen Ruinen sich weit oben als gezackte Silhouette vor dem tiefblauen Himmel abzeichneten. Das alte Fischbach aus dem Mittelalter, mit dem aus viel Glas und Beton errichteten Seminarzentrum, das zwischen den Mauerresten der verfallenen Häuser wie ein Raumschiff von einem fremden Stern wirkte. Oder wie ein gigantischer gläserner Schneewittchensarg, dachte Marja.
Hastig stieg sie weiter bergab, für eine Weile war Teresa von Buschwerk und Felsbrocken verborgen. Erst als Marja bereits zwischen den Wasserbecken war, sah sie das Mädchen wieder. Schon weit oben und nicht mehr auf dem Pfad, sondern auf einem steilen Abhang, wo sich irgendwann im Winter oder Frühjahr eine Gerölllawine ihren Weg gebahnt hatte.
Und Teresa war nicht mehr alleine! Mit wenigen Schritten Abstand folgte ihr ein Mann, dem sie zu entkommen versuchte.
Am Anfang hat er erst mal bei seinem Vater gearbeitet. In der Apotheke am Stadion. Da ist ihm auch klargeworden, wie er sein Ziel doch noch erreichen kann. Irgendwelche Pillen und Säfte waren auch gerade voll im Trend. Bisschen um den Körper kümmern. Mehr Leistung bringen. Höher, schneller, weiter. Sein Motto!
Die Chance war einfach zu gut. Also voll rein ins kalte Wasser. Er hat viel von seinem Alten gelernt. Heimlich, im Hinterzimmer. Offiziell ging ja nicht, nur mit Hauptschule.
Den Rest hat er sich selbst beigebracht. Vermarktung und Vertrieb. Spannende Sache, wenn du praktisch mit nichts anfängst. Viel Klinkenputzerei! Und voller Einsatz, vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über.
Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Mit Ende dreißig hat er seine erste Million gemacht. Zehn Jahre später waren es schon über 500. Die Milliarde hat er inzwischen auch. Zu den reichsten Deutschen zählt er sowieso, und es wird nicht mehr lange dauern, bis sein Name in der Liste »The World’s Billionaires« steht.
Sie sollten sich alle mal verdammt warm anziehen, wenn sie glauben, dass aus einem, den sie nur mit Hauptschule nach Hause schicken, nichts werden kann.
Er ist das beste Beispiel dafür, dass der alte amerikanische Traum auch hier funktioniert. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Haha! Nur dass er es noch nie in seinem Leben nötig hatte, einen Teller abzuwaschen, von dem er nicht selber gegessen hat.
3. Kapitel
Als Marja die Geröllhalde erreichte, hatte sie das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals hinauf, ihre Beine zitterten vor Anstrengung.
Teresa und der Mann standen schräg über ihr, vier oder fünf Meter voneinander entfernt. Teresa hielt einen Stein in der erhobenen Hand.
»Geh weg oder ich werfe! Lass mich in Ruhe, hau ab, ich will nicht mit dir reden!«
Der Mann versuchte, sie zu beschwichtigen – und er bot ihr Geld! »Hundert Euro! Überleg mal, was du dir dafür alles kaufen kannst! Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten, und ich will ein Foto von dir!« Er zog einen weiteren Geldschein aus der Tasche seiner Military-Weste: »Zweihundert! Komm schon, so leicht verdienst du nie wieder zwei Grüne …«
Als Marja ihn jetzt im Profil sah, erkannte sie ihn. Ronald Kriwinski, ein Journalist, der seine Artikel an verschiedene Zeitungen verkaufte, vornehmlich an Krawallblätter wie die BILD. Marja mochte weder ihn noch seine Texte, die häufig genug unter die Gürtellinie zielten.
Womöglich hatte er den gleichen Verdacht wie Marja, was das Wunder von Fischbach anging – und offenbar war er dem Mädchen ebenfalls gefolgt, um sie alleine zu erwischen und ihr irgendetwas zu entlocken, was für ein paar reißerische Zeilen reichte. Er würde kaum mehr als zwei, drei Sätze von ihr brauchen, den Rest würde er ohne jeden Skrupel einfach erfinden.
Im selben Moment, in dem er sein Handy zückte, um Teresa mit dem Stein in der Hand zu fotografieren, richtete sich Marja auf: »Stopp! Lassen Sie das! Das Mädchen hat deutlich gesagt, dass sie nicht mit Ihnen reden will. Und sie möchte auch ganz sicher nicht von Ihnen fotografiert werden! Also verschwinden Sie bitte!«
Teresa schien Marjas plötzliches Auftauchen als selbstverständlich anzusehen, fast als hätte sie damit gerechnet, dass ihr jemand zu Hilfe kommt.
»Ja«, stieß sie hervor und machte einen Schritt auf den Reporter zu. »Hauen Sie ab!« Drohend hob sie wieder den Stein.
Kriwinski ignorierte sie völlig, sein Interesse galt nun ausschließlich Marja.
Sie glaubte nicht, dass er sie erkennen würde. Seit sie ihm das letzte Mal begegnet war, hatte sie sich die langen Locken abgeschnitten, außerdem trug sie Outdoor-Klamotten und eine Sonnenbrille.
»Wer bist du denn? Kenne ich dich irgendwoher? Kollegin, oder was?«
»Nein«, erwiderte Marja, »Kollegen sind wir ganz sicher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns kennen. Ich kenne keine Leute, die halbwüchsigen Mädchen auflauern und sie bedrohen.«
»Jetzt krieg dich mal wieder ein, ja? Ich mache nur meine Arbeit.«
Marja drehte sich zu Teresa. »Hat er dich bedroht?«
Teresa nickte eifrig. »Ja, hat er. Voll fies.«
»Und er hört nicht auf, dich zu belästigen, obwohl du ihn mehrmals gebeten hast, dich in Ruhe zu lassen?«
»Genau, ja.«
»Dann rufe ich jetzt die Polizei.« Marja zog ihr Handy aus der Tasche.
Kriwinski hob beschwichtigend die Hände. »Was soll der Quatsch? Das meinst du doch nicht ernst! Bist du bescheuert?«
Ohne etwas zu erwidern, blickte Marja zu Teresa. »Polizei ist bei euch 133, richtig?«
»Passt.« Das Lächeln, das sie Kriwinski zuwarf, hätte triumphierender nicht sein können. Aber er hat es mehr als verdient, dachte Marja, während sie den Ziffernblock aufrief.
Kriwinski reagierte, noch bevor sie die erste Drei getippt hatte. »Stopp, hört auf mit der Show! Ich geh ja schon, ihr könnt euch abregen. Aber ich merk mir dein Gesicht!«, setzte er im Umdrehen an Marja gewandt hinzu. »Man trifft sich nämlich immer zweimal, du … du …«
»Du was? Sag es ruhig, nun mach schon.« Marja hob wieder ihr Handy. »Ich hab auf Aufnahme gedrückt.«
Für eine Sekunde hatte sie den Eindruck, dass er ihr das Smartphone aus der Hand schlagen wollte. Aber dann beließ er es bei einer drohenden Gebärde und machte sich an den Abstieg über das lose Geröll der Lawinenspur.
Der Stein, den Teresa hinter ihm herwarf, prallte nur wenige Zentimeter neben ihm auf und sprang dann mit einem lauten Klacken weiter nach unten. Ohne sich umzudrehen, zeigte ihnen Kriwinski den ausgestreckten Mittelfinger.
»Ich hätte ihn getroffen, wenn ich gewollt hätte«, versicherte Teresa. »Aber danke, dass du mir geholfen hast.« Erst jetzt blickte sie Marja richtig an. »Der Typ war echt eklig. Und dann warst du plötzlich da. Genauso wie … wie …« Ihre Augen irrten zwischen der Schlucht und dem Hang hin und her, an dem der Kreuzweg lag.
Marja sah, wie sie heftig schluckte und ihre Unterlippe zu zittern begann. »Ganz ruhig, Mädchen, es ist alles gut. Wollen wir uns einen Moment hier hinsetzen? Warte, nimm meine Hand, ich halte dich.«
Vorsichtig half sie Teresa, sich auf einem größeren Felsbrocken niederzulassen. Als das Mädchen haltlos anfing zu weinen, legte Marja ihr den Arm um die Schultern.
»Ganz ruhig«, wiederholte sie. »Alles ist gut, Kleine. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, du …«
»Aber du bist nicht …« Teresa blickte Marja mit weit aufgerissenen Augen an. »Bist du nicht, oder?«
Es war klar, was sie meinte.
»Bin ich nicht«, erwiderte Marja leise. »Ich wohne oben bei euch im Dorf, in dem Zimmer über der Bäckerei. Beim Franz.«
Teresa nickte. »Gut. Ich dachte schon …« Sie brach ab und presste die Lippen zusammen. Als dürfte sie nicht darüber sprechen.
»Nein, sieh dir meine Bergschuhe an, und die Trekkinghose! Von meinem völlig verschwitzten Uralt-T-Shirt mal ganz abgesehen.«
»Der Pfarrer hat gesagt, sie … hat vielerlei Erscheinungen.«
»Aber ganz sicher nicht mit kurzen schwarzen Haaren und Sonnenbrille!«
Teresa musste lachen. »Nee, das stimmt. Nicht mit Sonnenbrille und der Frisur.« Sie wischte sich hastig über die Augen. »Sorry, war blöd von mir, weißt du, ich muss jeden Tag daran denken, was passiert ist«, sprudelte sie plötzlich los. »Sie fragen mich ja auch dauernd danach, die Pilger und die Leute von der Zeitung und vom Fernsehen und alle! Sie wollen es immer wieder hören. Zuerst fand ich’s ja auch gut, weil ich so stolz war, dass ich sie gesehen habe. Aber jetzt hab ich keine Lust mehr, ich will, dass es wieder so ist wie vorher. Normal halt. Deshalb bin ich auch gerade heimlich vom Dorf weg. Ich wollte nur mal … alleine sein. Und dann war plötzlich dieser Typ da.«
»Jetzt ist er weg, also komm, denk nicht mehr dran.« Marja zögerte kurz, sie war sich nicht sicher, wie Teresa reagieren würde. Aber es war einen Versuch wert! Ohne den Arm von Teresas Schulter zu nehmen, sagte sie fast flüsternd: »Erzähl mir von früher, wie es hier war. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gespielt? Weißt du, ich komme aus einem Dorf im Norden von Deutschland. Wir haben als Kinder zum Beispiel das Stoppelfeld angezündet, und ich hatte einen Freund, der hat die Hühner von unserem Nachbarn betrunken gemacht, mit Brot, das er in Schnaps getaucht hatte …«
»Du meinst, so wie bei Max und Moritz?«
»Genau so, daher hatte er ja die Idee. Hat ziemlichen Ärger gegeben damals.«
Teresa kicherte. »Das kann ich mir vorstellen. Nee, so was haben wir nicht gemacht. Nur so andere Sachen, so Quatsch halt, nichts Schlimmes. Nur einmal, da haben die Jungen alle heimlich in den Dorfbrunnen gepinkelt. Das war aber doof, weil wir da immer unser Wasser geholt haben, bevor die Leitungen hier hoch gelegt wurden. Und rausgekommen ist es, weil die Jungen nichts trinken wollten und sich auch nicht waschen oder die Zähne putzen.« Sie kicherte wieder.
Auch Marja lachte. Um dann wie beiläufig zu fragen: »Viel Geld hatte niemand bei euch im Dorf, oder?«
Teresa nickte. »Ich hab das als Kind gar nicht so gemerkt, das war ja alles ganz normal für uns hier. Ich hab’s erst kapiert, als ich in die Schule unten im Tal gekommen bin und mitgekriegt habe, wie es bei den anderen aus meiner Klasse zu Hause war. Und es ist auch immer schlimmer geworden im Dorf, viele sind einfach weggezogen und … Ich hab mir oft gewünscht, dass wir auch wegziehen würden. Meine ganze Familie. In die Stadt oder so. Aber mein Vater wollte nicht. Und der Pfarrer hat auch immer gesagt, dass es bestimmt irgendwann wieder besser werden wird, wenn wir nur fest genug daran glauben.«
Teresa nahm einen Stein und ließ ihn über die Geröllhalde springen. Zusammen beobachteten sie, wie der Stein in der Schlucht verschwand. Als Marja noch überlegte, was sie fragen könnte, um das Mädchen zum Weiterreden zu bringen, sagte Teresa: »Außerdem wollten sie sich etwas überlegen, mein Vater als Bürgermeister und noch ein paar Männer, wie wir mehr Touristen hierherholen könnten, so Leute wie den Millionär, der immer zum Wandern gekommen ist. Wir wussten aber erst gar nicht, dass er Millionär ist, erst als er den Berg mit dem alten Dorf oben gekauft hat, um sein dämliches Zentrum zu bauen, war es irgendwie klar, dass er Geld wie blöd haben muss.«
»Was?« Marja spürte, wie ihr eine Gänsehaut über den Rücken kroch. »Ihr habt den Berg an jemanden verkauft?«
»An den Typen mit dem Zentrum, ja. Aber mein Vater meint, sie haben ihm das sowieso alles viel zu billig verkauft, das wussten sie nur damals noch nicht, da waren sie froh, überhaupt Geld zu kriegen. Wir glauben alle, dass er uns reingelegt hat! Vor allem, weil er auch nichts davon gesagt hat, dass er da dieses Zentrum bauen will, wo immer nur so ganz Superreiche hinkommen, die mit dem Hubschrauber hergeflogen werden! Und keiner von uns darf da hoch! Erst war es noch nicht so schlimm, da hatten sie nur überall Schilder stehen. Aber seit die Pilger da sind, haben sie hohe Zäune und Kameras und so Security-Typen.«
Teresa deutete mit dem Kopf zum Berg hinter ihnen. Dann beugte sie sich plötzlich ganz dicht zu Marja und flüsterte: »Willst du ein Geheimnis wissen? Ich sag’s dir, weil du mir geholfen hast, aber du musst mir versprechen, dass du es niemandem erzählst. Versprichst du es?«
»Ich sage niemandem was, versprochen.«