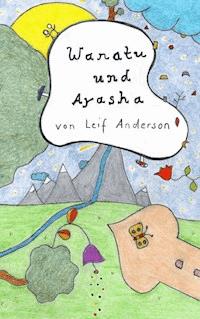
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Junge, ein Mädchen, die suchen, die leiden. Doch wer sucht, der wird auch finden. Denn schlaget ein Herz in deiner Brust, stellest du dich der Dunkelheit, die versucht dich in Ketten zu legen, Lernest du ein Kleinod, dein Herz zu schützen, so werden dir schimmernde Flügel erwachsen. Und schweben wirst du, in Ruhe: im Einklang des Erwachens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
I
Die saftig gelben Weizenfelder glänzten in der Abendsonne, als Wanatu die Stadtmauern Ischtars erreichte. Riesig und hölzern versperrten ihm ein Tor und zwei Laternenwächter den Weg. Beide sahen haargenau identisch aus, hatten die gleiche buckelkrumme Nase, kerzengerade Zähne, buschige Augenbrauen und ein schielendes, hin- und herzuckendes Auge.
„Warum noch so spät des Weges?“, fragten sie gleichzeitig.
Wanatu antwortete den Beiden nur:„ Ischtar ist großzügig, Ischtar ist streng“, und wurde von ihnen widerwillig hereingelassen; im vorübergehen erkannte er noch die mürrischen Gesichter der Zwillinge, die ihm ihre vergilbten Zähne und ihren fauligen Atem entgegenwarfen.
„Hey du da, treuer Herr!“, zischte plötzlich jemand aus einer dunklen Ecke; man konnte ihn kaum erkennen, nur die tückische Silhouette seines Schattens, der über die Lehmwand gehuscht war.
„Ich bin bucklig“, sagte er jammernd, „ich trau` mich nicht hinaus; kommt doch zu mir mein Herr!“
Er begann zu schluchzen:„ Helft mir werter Herr, bitte helft mir!“
Im Hintergrund hatte Wanatu ein Schleifen vernommen, irgendetwas das sich kriechend über den Boden bewegte.
„Ein Bettler bin ich, ein armer Mann. Kommt doch her zu mir, ich möchte nicht so gesehen werden, so entstellt“, bat er erneut.
Wanatu hörte wieder das Schleifen, etwas wie ein massiger, runder Körper, der sich wellenförmig vorwärts schleppte. Zudem schien er sich zu reiben, als bestünde er aus harten Drachenschuppen.
„Was seid ihr?“, erkundigte sich Wanatu „ein Wesen halb Mensch halb Echse, seid ihr das Experiment eines Alchemisten?“
Ein Wasserkrug zerklirrte aus der Richtung woher das Schleifen kam.
„Aber nein, ich bin ein Bettler, ein armer Mann, ohne Bleibe ohne Habe. Seid so gut, gebt mir doch ein Talent.“
„Ein Talent ist ein Vermögen wert, es reicht um ein ganzes Stadtviertel zu kaufen!“, antwortete Wanatu.
„Ich hörte ihr habt Truhen voll davon in eurem Haus!“
Aus dem tiefen Schwarz der Ecke machten sich allmählich Konturen bemerkbar – das Schleifen war nun unmittelbar vor der Kante; Wanatu sah sich nur die Andeutungen des Körpers an und verabschiedete sich sogleich:„ Nehmt diese drei Kupferstücke. Ich wünsche ihnen alles Gute, was immer sie auch sind.“
Später dachte Wanatu, als er sich weit von der Torgasse entfernt hatte, dass diese Kreatur mit Sicherheit der misslungene Versuch eines Alchemisten war, einen Mensch mit einem Waran zu kreuzen, und es besser ist, ihr aus dem Weg zu gehen.
Das rege Treiben der Kneipen drang nun beidseitig zu seinen Ohren, die mit bunten Scheiben aus persischen Glasateliers bestückt waren, und das herausströmende Licht der Petroleumlampen verfärbten. Durch ihre hellen Lichtkelche wirbelte herausströmender Tabak in feinen Schwaden hinauf, um sich in der Dämmerung ins Nichts aufzulösen. Inmitten des Dunstes roch Wanatu außerdem Haschisch, welches die Reisenden sehr gerne rauchten.
Doch diese eine Schenke war vor Wanatus Abreise noch nicht da gewesen, vor der eine schwarz-weiße Streunerkatze gemütlich auf einem warmen Stück Erde lag; neben ihr wuchs ein blühender Rosenstrauch empor, der sich bogenförmig um den Eingang wand und an seiner höchsten Stelle spitz zusammen lief. Darüber stand ein Name in großen, goldgeschmiedeten Lettern: Alabasta.
„Ich habe dich bereits erwartet Wanatu“, sagte eine hübsche Frau aus einem geöffneten Fenster; sie lehnte sich ein Stück weit nach vorne, dass sich ihr seidenes Haar im Rhythmus der hintergründigen Gardinen wellte. Mit hellbraunen Augen schaute sie zu den blauen Tulpen, die am Schenkeneingang standen, und schloss sodann ihre Lider. Leicht wie eine Feder fiel eine ihrer goldbraunen Haarsträhnen zu Wanatus Füßen, und flog im nächsten Wimpernschlag gen Westen, zur untergehenden Sonne hinauf.
„Trete doch ein Wanatu, ich seh dir doch die Verlegenheit an, hab nur keine Angst“, sagte sie dann.
Wanatu ging hierauf etwas unbeholfen über eine aus Stein gehauene Treppe, und betrat die Schenke, um dort wieder zwei Stufen hinab zu gehen.
Eine wunderbare Frische erfüllte den Raum, so als säße man in einem üppigen Wald. Der Boden war mit einem marokkanischen Teppich bedeckt, den man mit Rautenmustern verzierte, und in geräumigen Winkeln standen Diwans aus Kaschmir, halbrund um eckige Holztische platziert. Auf jedem der Tische fand man eine andere Wasserpfeife. Eine wurde aus Elfenbein geschnitzt und hatte unten die Form eines Würfels. Eine weitere besaß hauchfeine Wände aus Marmor und war von der Hüfte ab als Pyramide gestaltet. Und noch eine aus Jade, geformt wie ein Halbmond. Jede der Pfeifen war von hohem Wert, vor allem aufgrund der vielen Saphire, die liebevoll ins Material eingearbeitet wurden.
An zwei Tischen hatten sich bereits Menschen beisammen gesellt. Zu Wanatus Linken saßen zwei vom wandernden Berbervolk und zu seiner Rechten drei Schweigsame, die er nicht zuordnen konnte. Wanatu entdeckte zwar Mandelaugen, doch vom Osten her suchten unzählige Leute Obdach in Ischtar, überwiegend um ihre Waren hier feilzubieten. Ihre gelbroten Roben zeigten keine Zugehörigkeit zu einem Clan, noch zu einem religiösen Kult.
„Dort Ayasha schau, das sind Mönche aus dem Swami-Tal“, sagte der weißbärtige Berber schließlich zu einem Mädchen, „das Volk lebt zurückgezogen hinter den Wahali-Gebirgen, dessen eiserne Gletscher unüberwindbar sind, doch diese Leute wissen einen Weg hindurch.“
Nach einer Pause, in welcher der alte Berber vertäumt aus dem Fenster blickte, das in Lila getauchte Himmelsfirmament bestaunend, wandte er sich erneut zu dem Mädchen, und sprach:„ Sie brachten uns das Kunsthandwerk bei. Hast du den wunderbaren Tempel im Stadtinneren gesehen? Zimmermeister aus Ischtar, die bei ihnen in die Lehre gingen, bauten das Gebäude. Und es fehlen noch die Gärten, die lebendigen Vegetationen, die sie immer um ihre Bauten anlegen! Male dir nur aus, wie schön es im nächsten Frühjahr dort aussehen wird, wenn die Pflanzen nach oben sprießen und das Gelände mit Grün bedecken, mit Blüten in hunderten Farben, hunderten Gestaltungen – der Weihrauch aus den vielen, winzigen Öffnungen der Jalis strömt und sich mit dem Duft der aberzähligen Kräuter vermischt.“
Vor dem Fenster erkannte man den Ast eines Ahornbaumes, das Rascheln seiner kräftigen Blätter, die Steinpilze, die aussehend wie halbe Untertassen am Stamm hafteten – eine Treppe bildeten sie, welche in der Baumkrone verschwand.
Wanatu hörte das Mädchen sodann antworten:„ Auf den Türen des Tempels fand ich etliche Mandalas. Sie waren wunderschön Großvater. Später will auch ich bei ihnen in die Lehre gehen.“
„Deswegen sind wir hier Ayasha. Du wirst sie begleiten“, erwiderte ihr Großvater, „uns verbindet ein enges Band mit den Swami-Mönchen.
Die einzigen Menschen denen sie einen Teil ihres Wissens offenbaren, sind die des Berbervolkes. Wenigen ist es vergönnt sie zu Gesicht zu bekommen. Ayasha, von nun an ist deine erste Wanderschaft vorbei.“
Die drei Swami-Mönche standen nun auf und betrachteten Ayasha mit Augen, in denen kein Hass zu entdecken war. Einer der Drei hatte vor sich ein Stück Pergament liegen, Fingerfarben, einen Graphitstift, und ein Stück Kohle – für Ayasha blieb einen Augenblick die Zeit stehen, als sie das vollendete Gemälde betrachtete, die wenigen verspielten Linien, die harmonisch komponierten Farben, der wärmende gute Wille, der nur zu teilen begehrte, ohne etwas dafür zu verlangen.
Als Ayasha die Drei mit ihrem klaren Blick musterte, nickten sie höflich und verlegen, und in dieser einfachen Bewegung von ihnen empfand Ayasha mehr Ausdruck, als von irgendeiner der unzähligen Leute, die ihr bis dahin begegneten.
„Sie wissen was Freiheit bedeutet, sie fühlen es“, dachte Ayasha, „sie sind völlig unabhängig und freuen sich an sich selbst. Es existieren Menschen, die nichts Böses in sich tragen, die das Unsichtbare bezwangen!“
„Ayasha, das Universum ist nicht so weit, wie du es glaubst zu denken. Du befindest dich mitten darin“, sprach ein junger Mönch, bei dem aus der Seitentasche eine Schreibfeder und ein dünnes Büchlein hinaus schauten. Auf seiner Robe war ein Zirkel abgebildet, und aus einem Stoff der Ayasha gänzlich unbekannt war. Die Robe machte den Eindruck, als sei sie wunderbar gemütlich, als kühle das Gewand ihren Träger in der heißen Wüstensonne. Von den Schlüsselbeinen – dort an der Stelle wo die Kapuze mit feinen silbernen Fäden angenäht war – hingen zwei bronzen geflochtene Kordeln herab. Es schien kristallenes Pulver umschwebe sie, als die Lichtstrahlen der Abenddämmerung in den Raum fielen.
„Hallo Ayasha“, sagte der zweite Mönch, dessen Gesicht man nur halb erkannte, er reichte ihr seine Hand zum Gruß und zog sich die Kapuze herunter, dass sein langes, schwarzes Haar sichtbar wurde. Der Mönch vor ihr hatte keine Mandelaugen, war um die dreißig Jahre alt und trug einen kräftigen, krausen Vollbart.
„Ayasha, du wirst Dinge sehen, die du nicht für möglich hieltst, und Fähigkeiten erwerben in denen du Seligkeit findest, die dich ausfüllen, weil du bald entdeckst, wie viel Wundersames in dir steckt, was die Welt in Wahrheit alles zu bieten hat.“
Plötzlich hielt er für einen Moment inne und sah Ayasha tief in die Augen.
„Ich sehe das Leid in dir Ayasha, dass du an dieser Welt und an der Menschheit verzweifelst, doch gibt es Menschen, die aus ihrem Leiden wachsen. Erst wenn du dich dem stellst: deinen Dämonen, beginnt sich etwas zu bewegen. Ayasha, bald lernst du was es bedeutet ein Mensch zu sein.“
Aus der Innentasche seiner Robe holte der zweite Mönch ein Stück weiße Kreide und ging zur Schenkentür. Sein Gang war geschmeidig, so als bewege er sich fließend durch den Äther, nichts hätte ihn aus seiner Andacht lösen können.
Es schien Ayasha, als sei der Mönch eins mit seiner Umgebung, befreit von jeglichem Konflikt, dankbar ein Teil von etwas Ganzem zu sein, dessen Ausmaße sie sich nicht vorzustellen vermochte.
Anschließend dachte Ayasha, für Sekunden von ihren damaligen Begegnungen abgelenkt, die ihr während ihrer Reise zustießen:„ Mehr verzweifel ich an mir selbst, an Yagoba, die Stadt der Zwietracht, welche ich mit meinem Großvater durchritt. Die Bewohner dort quälen sich in ihrer Unzufriedenheit, sogar in ihren Familien streiten sie sich. Sie wissen nicht was Ruhe ist, was es heißt milde gegenüber dem Anderen zu sein. Niemand der seinem Nächsten vertraut, niemand der versucht das Wunderschöne, das der Mensch in sich trägt, zu pflegen, ins Wirkliche zu holen, niemand der sich dieser Anstrengung stellt ... es ist einfacher schlecht zu sein als gut. Doch das was mir am meisten zu denken gibt ist, dass ich ihrer Wut nicht entrinnen konnte, dass auch ich mich dazu verleiten ließ, Gewalt auszuüben, nur um mich vor ihnen zu schützen, weil in den falschen Dingen ich schlicht zu ernst bin.“
Ayasha wurde jäh in ihren Gedanken unterbrochen, als sie die weichen Geräusche der zeichnenden Kreide vernahm. Nach wenigen Augenblicken sagte der Mönch:„ Ich habe dir meinen Namen hier aufgeschrieben in der unsrigen Schrift. Die Kreide übrigens verblasst bald. Du liest meinen Namen von rechts nach links. Also, ich bin Dabu und ich freue mich wieder eine aus meinem Volke willkommen zu heißen. Weißt du, seit fünfzehn Jahren wurde keiner mehr von uns ins Swami-Tal eingeladen. Und habe keine Angst, deinen Großvater wirst du oft besuchen können. Wir werden viel unterwegs sein, besonders weil deine Ausbildung erst beginnt.“
Ayasha wurde es ganz behaglich um die Magengegend, eine warme, herzliche Brise durchströmte ihren gesamten Körper, hüllte sie in einen Kokon voll Geborgenheit, und vor allem war sie glücklich darüber, diese Menschen vor ihr kennen lernen zu dürfen, die jetzt schon Freunde für sie waren, fast wie Brüder, die sie für verloren glaubte.
Dennoch hatte Ayasha Dabu nur halb zugehört, da das geschwungene Schriftbild, welches Dabu in kürzester Zeit auf die Schenkentür warf, sie besonders fesselte.
Es war kursiv geschrieben und in vier Stücke aufgeteilt, die als Ganzes ein „X“ bildeten. Zur Mitte hin woben sich die Stücke herrlich ineinander, so als spiele jedes ihr eigenes Lied. Es war als funkelte ein wallender Stern vor ihr, aus dem sie das Leben selbst anlachte, mit runden, eleganten Schweifen, welche jeweils eigene Noten musizierten.
„Hallo, ich heiße Ayasha!“, freute sich diese, wie weggeblasen war ihre Grübelei, und sogleich umfing sie Heiterkeit.
„Ich mag dein Bild Dabu, auch das deines Gefährten, sie sind wirklich sehr eindrucksvoll. Mir kommt es vor, als malt ihr aus dem Herzen, als wollt ihr aus ganz simplen Dingen etwas Gutes in unsere Welt bringen – als findet ihr Glück darin zu geben, aus dem tiefsten Inneren eurer Seele!“
Ayasha schaute danach zu Boden, da sie so überschwänglich redete, mit Herren die um einiges älter waren als sie; sie schämte sich ein wenig, und dachte sie könnte respektlos wirken.
„Ach Ayasha, ich vergaß: ich bin Baguyo“, lächelte der Mönch, der vorhin das Pergament bemalte. Ayasha spürte das reine Gemüt in ihm, und sofort überwand sie sich. Sie fühlte, wie die klare Luft des Raumes in ihren Brustkorb strömte, und wieder hinaus, wie schwerelos war sie, aufgehoben in einer Gruppe von Menschen, die längst die Bedeutung des Wortes „Lüge“ vergaßen, und sagte weiterhin:„ Ich möchte euch unbedingt begleiten und so viel von euch lernen, wie nur irgend möglich. Ihr beherrscht wahrlich außergewöhnliche Fähigkeiten.“ Dabei dachte Ayasha außerdem an ihren Großvater, den sie bald verlassen müsste:„ Er wird mit Sicherheit zurechtkommen, wenn ich weg bin. Einst erzählte mir mein Großvater: er genieße die Einsamkeit, das Versinken in seinen Geist, das Gewahrsein niemals wirklich alleine zu sein, sobald die Ruhe in ihm einkehrt – die Gedanken, die unzähligen, verstrickten Stränge endlich ihre Spannung lösen.
Dann, erwähnte er noch am Ende, erkenne ich mich selbst, vom Sein umgeben.“
Der dritte und letzte der Mönche, der sich gleich wieder an den Tisch gesessen hatte, und Pfeife rauchte, stand nun auf und bewegte sich buckelig zu Ayasha, einen robusten Gehstock umgriffen, den man aus einer Linde geschnitzt hatte. Das Laufen fiel ihm sichtlich schwer, mit seinem dürren Körper und seinen zittrigen Beinen.
Aber als er sich dann vor Ayasha befand, entwich seiner harten, faltenübersäten Mine ein breites Grinsen, und er sprach schließlich, mit einer freundlich krächzenden Stimme:„ Junge Freundin, zweihundert-und-eins Jahre bin ich jetzt alt, und man rühmt mich stets noch als stärksten Schachspieler unseres Ordens. Ein wunderbares Spiel dessen Regeln ich dir noch beibringen werde. Es wird dir bestimmt gefallen. Ich mag vor allen Dingen die detaillierten, putzigen Spielfiguren, welche extra für mein Brett angefertigt wurden, ihr leises Klacken, wenn sie auf die glatte Oberfläche der regelmäßigen Vierecks-Muster fallen. Auf unseren Rückweg werde ich dir mehr davon erzählen. Aber nun müssen wir aufbrechen Ayasha, wir sind lange genug hier verblieben.“
Ayasha schaute sofort zu ihrem Großvater, dem die Tränen in den Augen standen.
Mahmud, welcher der Name des Großvaters war, wähnte sich um Jahre zurück, als er seine Enkelin bei sich aufnahm, ungewiss ob die Kleine seinem unsteten und widrigen Lebensstil standhalten konnte.
Deswegen freute es ihn umso mehr, dass Ayasha direkt die tausendfältige Natur rings um sich erkundete: den samtweichen Sand, der nur stellenweise Gebiete für sich einnahm – Palmen standen darin, die unterhalb des wärmespeichernden Bodens herzhaft ihre Wurzeln sprießen ließen – die Trauerweiden mit ihren herab hängenden Zweigen, welche gerne an den reichlich vorhandenen Bachläufen ihre silbernen Blätter zum Wind bewegten – die wolkigen Auenwälder, worin rechtwinklige Mammutbäume in die Höhe schossen – die verborgenen Teiche und ihre schwarzen Molche, deren Augen glänzten, sobald sie von unten herauf einen im Tageslicht ansahen; um den Gewässern, versteckt im tanzenden Schilf, schwirrten zahllose anders geartete Libellen hin- und her – und die gewaltigen Ameisenkolonien mit ihren Arbeiterinnen, die alles ihrer Königin gaben, gar ihr eigenes Leben, als auch vieles, vieles mehr, das Ayasha mit der Zeit sammelte und aufhob in ihrer persönlichen Schatzkammer, die sie so oft besuchen konnte, wie es ihr beliebte.
Mahmud ahnte es früher schon, so wie seine Enkelin die Umgebung erforschte, nahezu Alles in sich hinein sog, die Dinge die man im Kleinsten wie im Größten fand, dass Ayasha anders war, voller Neugierde und voller Demut gegenüber den mannigfaltigen Schauspielen, die sich Tag für Tag ihr darboten.
Manchmal fürchtete Mahmud, seine Enkelin fühle sich einsam, ohne Altersgenossen die sie begleiteten, doch im Nu verschwanden seine Sorgen, als er in die staunenden Augen seines jungen Kindes schaute, und darin die Welt sich widerspiegeln sah. Er führte Ayasha an Orte, die zuvor nie ein Mensch gesehen hatte, nicht mal den Mönchen des Swami-Tals bekannt waren; durch seine jahrzehntelange Wanderschaft kannte Mahmud mittlerweile jedes Fleckchen außerhalb Ischtars.
Als Ayasha nun zu ihrem Großvater schritt, um sich schweren Herzens von ihm zu verabschieden, leuchtete Mahmud wieder jene gewaltige Strömung vor den Augen, an der er mit seiner Enkelin stand, eine die sich in die Tiefe eines reißenden Wasserfalls ergoss. Von den kantigen Felshängen baumelten die Blütenstände unzähliger Moose herab, aus denen goldene Pollen hinab rieselten, und, sofern das Glück ihnen hold war, auf eine kahle Stelle landeten, der fast gänzlich bewachsenen Klippen. Darüber bildeten sich ambosartige Wolken, aus denen sich eimerweise der Regen entlud – aus allen Richtungen plätscherte es harmonisch, als die Beiden sich niederließen, die Beine zum Lotussitz gekreuzt.
„In naher Zukunft werden sich unsere Wege trennen Ayasha“, erzählte ihr ihr Großvater damals, „aber kein Abschied wird es sein, denn für dich ist anderes vorhergesehen, deinen Augen ist es bestimmt, noch vieles zu erfahren, Dinge für die ich mich freue. Werde dankbar dafür sein meine Enkelin“, klang der letzte Satz ebenso in Ayashas, wie in Mahmuds Ohren, als Ayasha vorerst ein letztes Mal ihren Großvater umarmte.
Der uralte Mönch, dessen Gewand aus ganz einfachen Leinentuch bestand – man hätte meinen können, er gehöre einer der niedrigsten Kasten Ischtars an – nahm Ayasha nun behutsam bei der Hand und führte sie mitsamt seinem Geleit aus der Schenke.
Die drei Mönche aus dem Swami-Tal verbeugten sich nochmals vor Mahmud und drehten sich schließlich um in Richtung ihrer Reittiere. Doch als der Älteste gerade im Begriff war ihnen den Rücken zuzukehren, blickte dieser scharf in Wanatus Antlitz. Im ersten Moment realisierte es Wanatu nicht, aber die Augen des Ältesten hatten genau das gleiche Aussehen wie die seinigen: die smaragdgrüne Farbe, die immer noch jung und frisch aus dem alten Mann heraus schimmerte.
„Auf Wiedersehen Wanatu“, flüsterte der Älteste, und für Wanatu war es, als könne nur er ihn hören. Außerdem vernahm er noch folgendes:„ Merke dir diesen Namen: Danach entschwand dem Ältesten ein Wort in einer Sprache, die Wanatu gänzlich fremd war. Es waren keine Töne, die man mit den Lippen formte, nicht etwas das man über das Gehör vermittelt bekam. Der Älteste bewegte nicht im Geringsten seinen Mund, und doch wusste Wanatu nun seinen wahren Namen, der ihn mehr an eine warme Melodie erinnerte, an den erhabenen Klang eines Lebewesens, welches zu einer anderen Gattung gehört, und andere Lebensräume bevorzugt.
„Setz dich nur zu mir mein Junge“, sagte Mahmud, als die Abreisenden die Schenkentür verschlossen, und nahm sich einen genüsslichen Zug aus der halbmondförmigen Wasserpfeife.
Sofort verbreitete sich ein wohliger Geruch im Raum, der ähnlich roch wie das Haschisch, welches Wanatu vorhin in den Straßen inhalierte, nur feiner war es, unaufdringlicher, er meinte, eine süßliche Nuance verberge sich darin: ein Hauch von Erdbeere.
„Es war kein Zufall, dass auch du hier warst“, begann Mahmud, nachdem Wanatu sich zu ihm gesetzt hatte.
„Wissen sie junger Herr, welches Glück es sein kann, empfinden zu dürfen, für einen Menschen nur das Beste wünschend, im Gewahrsein des unendlichen Lebens, das sich im Bauch und in unserer Brust versteckt. Ayasha wird es gut haben bei den Mönchen, sie werden wie eine Familie für sie sein“, fügte Mahmud im Anschluss noch hinzu. Er wirkte vollkommen unbekümmert und trug das natürlichste Lächeln auf den Lippen.
„Ich blicke voller Stolz auf meine Enkelin, nicht weil sie in den ehrwürdigen Orden aufgenommen wurde, sondern ihres Wesens wegen, dem edlen Verlangen sich neue Dinge anzueignen, des überquellenden Brunnens wegen, der rein und klar seine Wellen in ihr schlägt.“
Mahmud hielt inne, und die Beiden stellten sich einander vor.
„Genehmige dir einen Zug, ich hatte sowieso vor die Pfeife mit dir zu teilen“, sagte er dann, und bat Wanatu das Mundstück an. Motive von schneeweißen Ringelblumen wurden mit Hingabe auf dessen Oberfläche geritzt, man konnte gar das zarte Liniengeflecht der Blätter erkennen – für Wanatu war es, als bewege sich die Pflanze sanft im Ozean der dunklen Streifen, die sich einmütig um das Holz zogen.
Als Wanatu nun spürte wie der Qualm in seine Lungen drang, ein wonniges Gefühl in seiner Magengrube aufstieg, verließ unvermittelt sein Geist seinen Körper.
Langsam flog er zur Decke hinauf, von wo aus er die Halbglatze Mahmuds entdeckte, sowie seinen Arm, der einige Male das Mundstück zu seinen Lippen führte.
„Dieses Kraut übertrifft all meine Erwartungen!“, rief Wanatu, der nochmals eine rege Wallung verspürte, bevor er vollends die Empfindung seines Gewichtes verlor.
„Solche Medizin findest du nur an bestimmten Orten. Diese Schenke hier zum Beispiel steht erst seit Neuem an diesem Platz, und sie ist derart ins Stadtgebilde Ischtars integriert, dass es kaum jemanden hierhin verschlägt“, erzählte ihm Mahmud, welchen er blechern von unten herauf hörte, „in einem toten Winkel, vergraben in einem undurchsichtigen Gassensystem, gehen die meisten Leute schlichtweg hieran vorbei, ohne auch nur das Geringste von diesem Haus zu erhaschen.“
„Aber für mich war es, dass die Schenke direkt vor mir lag, fast am Ende der Straße, wo sich all die Kneipen aneinanderreihten, bis ich sie letztlich erreichte und die fabelhaften Gemäuer erblickte mit den fein gemeißelten Ornamenten“, erwiderte Wanatu, dessen Glieder mehr und mehr verschwammen. Inmitten seines Bauchnabels bildeten sich kleine konzentrische Kreise, so als werfe man einen winzigen Kieselstein ins Zentrum eines stillen Sees.
„Das wundert mich keineswegs“, antwortete Mahmud und lachte herzhaft dabei, „unbewusst hat es dich zu dieser Stätte verschlagen, beinahe so als wärest du gerufen worden. Nun, höre mir zu Wanatu, du bist nicht ohne Grund hier gewesen ...“
Dann wechselte er unverhofft das Thema, einen Schluck grünen Tee sich genehmigend, den das braunhaarige Mädchen vorhin in einer weißen Prozellankanne servierte. Mahmud betrachtete das feine Relief auf dem Gefäß, die Abbildung verschiedenster, geometrischer Formen.
„Genau ein Jahr ist es jetzt her, als ich mich mit meiner Enkelin dort aufhielt: eine Stadt namens Yagoba.“
„Yagoba“, seufzte Wanatu, „wer hat noch nicht von der Stadt der Zwietracht gehört, doch kenne ich sie nur von Erzählungen, die mir ein ums andere Mal auf den Magen schlugen.“
„Ja, der Ruf der Stadt eilt ihr voraus“, erwiderte Mahmud, doch Wanatu konnte ihn kaum noch hören, denn von weiter Ferne erkannte er nur die glänzende Halbglatze Mahmuds, auf der allmählich zwei Reihen voller Backenzähne heranwuchsen.
„Bevor du dich aber weiter in dies Wagnis hineinstürzt Wanatu“, sagte dann das fertig entwickelte Gebiss, dessen Stimme die gleiche Mahmuds war, „musst du noch einige Berge erklimmen, und reichlich Erkenntnisse sammeln, vor allen Dingen wirst du über deinen eigenen Schatten springen müssen, auf dass du vielleicht, angekommen am Ende deines Weges, dir die letzte Wahrheit gewährt wird.“
Im Nachhall des finalen Satzes schwebte Wanatu immer weiter in die Höhe und durchdrang das Gestein der Decke.
Einem nackten Zimmer begegnete er im Obergeschoss, in dem nur ein Teleskop stand. Das Sichtrohr war aus dem Fenster gestreckt, hatte aber nicht wie gewöhnlich eine gerade Form, sondern schlängelte sich aus dem Fenster hinauf bis zum Dach. Mit aller Mühe zerrte Wanatu seinen vergeistigten Leib zum Teleskop, der nicht mehr federleicht wirkte, eher wie zentnerschwerer Ballast. Auf der Seite des Teleskops – klitzeklein, kaum mit dem bloßen Auge zu erkennen – war das Symbol eines Globus eingraviert im gleichen Zeichenstil der Swami-Mönche.
„Erst heißt es eine Anstrengung am Tage bewältigen, sofern denn eine vorhanden ist, danach darf man sich dem Vergnügen widmen. Also komm Wanatu, ich zeige dir die Welt aus einer anderen Perspektive“, sprach alsdann das Teleskop. Man konnte nicht die Richtung seiner Worte vernehmen, es war mehr als kommuniziere der gesamte Raum mit einem.
Folglich führte Wanatu sein linkes Auge zum Teleskop und wurde wie von einer angenehmen Woge jäh in einen glatten Tunnel getragen, in den Tubus des Teleskops, der bald steil nach oben, bald fast horizontal verlief.
Die Wände waren transparent, sodass Wanatu die sternenüberdachte Landschaft betrachten konnte, die abermilliarden funkelnden Punkte, die sich über dem Firmament erstreckten. Plötzlich wurde er aufwärts geschleudert, dass sich die Umgebung neben ihm in bunte, nachtfarbene Schweife verwandelte, bis er stetig an Tempo abnehmend, schließlich leicht auf die Rückseite des Objektivs stieß.
„Nun wirst du das Gleiche wie ich sehen Wanatu“, verkündete das Teleskop, den milchigen Schleier verdrängend, der fortwährend die Linse trübte, um Wanatu endlich die Herrlichkeit des Universums zu offenbaren. Wanatus Sichtfeld schoss sogleich hinauf aus der Erdatmosphäre, die tausenden, kalten Kilometer überbrückend, kehrte sich um 180°, und zeigte die Erde nun als blauweißen Planeten, der sich als Scheibe im verkehrten Uhrzeigersinn drehte. Wanatu konnte darauf die leuchtende Pracht Ischtars ausmachen und Gebiete darum erkennen, die sich tief verzweigt hinter undurchdringlichen Stellen inmitten einer dschungelähnlichen Fauna versteckten. Aus Kalkstein gehauene Schreine fand Wanatu, die voll mit Lianen überwachsen, sich zärtlich an die dicken Wurzeln der Laubbäume schmiegten. Die verlassen aussehenden Stätten wirkten dennoch wie von Menschenhand gepflegt: das Geäst, welches sich symmetrisch aus den Stämmen fächerte, als auch die Lianen und ihre eleganten Windungen – gleich einer zweiten Haut, schlängelten sie sich um die Kanten der verkalkten Torbögen, dass man imstande war bequem in die Tempel einzutreten. Aber als Wanatu um sich blickte, und sah wie weit sich noch der Äther erstreckte, umfing ihn das Gefühl der Leere.





























