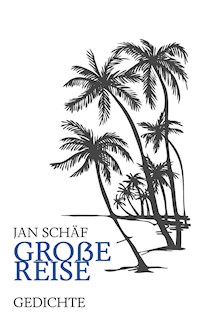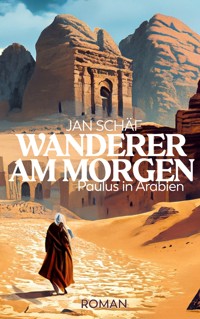
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Saul, Pharisäer und Schriftgelehrter, wird vor den Toren von Damaskus mit der Wahrheit über Gott konfrontiert. Erschrocken und verwirrt, verlässt er das Haus der Anhänger des Neuen Weges und flieht in die Wüste. Dort begegnet er erneut dem Gekreuzigten. Aber auch seinem Widersacher. Von einer Karawane aufgesammelt, erreicht er Petra. Die sagenhafte Stadt der Nabatäer. Hier trifft er auf Gilah, die Tochter des Moab. Saul verliebt sich, doch kann er seiner Bestimmung nicht entrinnen. Das weiß er. So muss er eine Entscheidung treffen. Ist Saul schon bereit dazu? Jeschua, Messias und Erlöser, beginnt seine Mission in dieser Welt. Doch trotz seiner zahlreichen Wunder wollen ihm zunächst nur wenige glauben. Was sie verbindet? Beide sind auf einer Reise, die alles verändern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.
1. Korinther - Kapitel 13
Hinweis für den Leser: Die Benennung der biblischen Namen und Ortsbezeichnungen erfolgt auf Grundlage der Loccumer Richtlinien. Die Bibelzitate sind weitgehend aus der Lutherbibel von 1912 entnommen. Das Gedicht im 4. Kapitel ist ein Zitat aus Gertrud Kolmars Gedicht „Sehnsucht“ aus der Gedichtreihe „Welten“.
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Ein Tag in Galiläa
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Die Taufe des Jeschua
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Die ersten Tage
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Die Hochzeit von Kana
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Der Hauptmann von Kafarnaum
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Die Austreibung des Dämonen
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Hananias
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Nazaret
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Thomas
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Das Gericht zu Magdala
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Auf dem See
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog: Gaza
Prolog: Ein Tag in Galiläa
Der See Gennesaret lag in der Morgendämmerung. Die Berge spiegelten sich in seinem Wasser, die Vögel am Ufer begannen ihr Federkleid zu putzen. Die Fischer schoben mit müden Gliedern die Boote ins Wasser, sie taten es wortkarg und auch ein wenig übellaunig. Wer konnte es ihnen verdenken?
Der Fischer Simon stritt mit seinem Bruder Andreas. Das Boot war zu Wasser gelassen, die Netze am Abend geflickt, es versprach ein schöner Tag zu werden. Doch Andreas wollte nicht mitkommen.
„Was ist mit dir, Andreas?“
„Die paar Fische, die wir da fangen, das kannst du auch allein.“
„Die Fische ernähren uns. Selbst die paar, die wir noch fangen. Hast du das vergessen?“
„Wie soll ich das vergessen? Du sagst es mir doch immer wieder.“
„Nicht oft genug, alter Faulpelz.“
Andreas winkte ab, drehte sich um und ging davon. Simon schnaubte.
„Wohin willst du? Wieder den ganzen Tag in der Sonne liegen und von der Revolution träumen?“
Andreas drehte sich um, lachte ein zorniges Lachen und breitete provozierend die Arme aus.
„Was verstehst du schon von der Revolution?“
„Dass sie keine Fische fängt.“
„Jaja, denk du nur immer ans Fressen.“
Simon verspürte das drängende Gefühl, seinem Bruder nachzulaufen, ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Eine, die er die nächste Zeit nicht vergessen würde. Doch er tat es nicht. Er musste Fische fangen. Soll dieser Idiot bleiben, wo er will, am Ende des Tages stand er doch wieder vor der Tür, wenn der Magen knurrte oder die Nächte unter freiem Himmel zu kalt wurden. Wenn er doch endlich eine Frau fände. Die würde ihm den Kopf schon wieder geraderücken. Doch Andreas Kopf und sein Herz verlangten zurzeit nach anderem. Ideen über das Gericht Gottes. Ja, am abendlichen Herdfeuer redete auch Simon darüber. Doch am Tag musste die Arbeit getan werden.
Immerhin, da gab es den Johannes, der stand im Jordan, taufte die Leute mit Wasser und sagte zu ihnen Worte wie: Schlangenbrut. Verrückt. In seiner Freizeit lebte der Mann in einer Höhle, trug Tierfell, aß Honig und Insekten. Nicht, dass es im Jordan keine Fische gab. Die man fangen und essen konnte.
Vielleicht hatte am Ende Andreas recht, man konnte die Welt verändern oder Fische fangen. Beides zusammen ist wohl nicht möglich. Simon versuchte, diese Gedanken aus dem Kopf zu vertreiben. Die Arbeit musste getan werden. Der Ärger über seinen Bruder verflog.
So stieg er in sein Boot. Der Tag war schön, kein Wölkchen am Himmel, die Vögel flogen mit lautem Geschrei, jetzt mussten nur noch die Fische anbeißen. Doch taten sie es in letzter Zeit immer weniger. Woran das lag, da konnte Simon nur mutmaßen. Vielleicht zu viele Fischer auf dem See, die fischten? Wie der alte Zebedäus dort mit seinen beiden Söhnen.
Die Simon nicht leiden konnte. Wilde Burschen, bei denen ein falscher Blick genügte. Zebedäus hob die Hand zum Gruß. Simon grüßte zurück. Dann stoppte er das Boot und ließ die Netze ins Wasser. Jetzt kam der schönste Teil. Er setzte sich in die Morgensonne, holte ein Kanten Brot und süße Datteln hervor. Während er kaute, blickte er über den See, sah die Berge an seinen Ufern und dankte Gott dafür, in diesem schönen Land zu leben.
Simon dachte nach. Er schämte sich für den Satz, dass die Revolution keine Fische fängt. In der Synagoge hätte der Rabbi wieder hinter seinem Rücken gelächelt. Hätte gesagt, ja, der Simon, der kann Wahrheiten aussprechen. Simon kratzte sich am Kopf. Er muss es umformulieren. Zum Beispiel: ohne Fische keine Revolution. Denn, auch Revolutionäre müssen essen. Aber warum eigentlich Fische? Johannes am Jordan ernährte sich von Heuschrecken. Widerlich ja, hielt aber am Leben. Gut, Johannes war kein Revolutionär, er war Prophet, ohne Zweifel, der, wenn er schon nicht die Welt verändern konnte, vielleicht einen neuen, revolutionären Ernährungstrend auslöste. Simon schmunzelte. Wenn das mit den Fischen im See so weiterging, blieb den Leuten auch gar nichts anderes übrig. Doch wo sollte es mit einem Land hingehen, in dem die Leute sich von Heuschrecken ernährten.
Er war froh, noch nicht in der fischlosen Zeit zu leben. Darüber schlief er ein. Als er aufwachte, stand die Sonne schon weit im Zenit. Schläfrig schaute er über die Reling. Die Netze hingen schlaff im Wasser. Wieder nichts. Verdammt.
Andreas saß unterdessen am Ufer. Etwas abseits, er wollte mit keinem der Fischer, die langsam zurückkehrten, ein Gespräch führen. Es reute ihn, Simon so überheblich behandelt zu haben. Es reute ihn wirklich. Er mochte seinen großen Bruder. Sogar so sehr, dass ihm bei dem Gedanken, er könne eines Tages nicht mehr da sein, Tränen in die Augen stiegen.
Aber Simon dachte immer nur praktisch. Er dachte nie an das Große und Ganze. Niemals sah er über die Hügel um den See, geschweige denn über Galiläa hinaus. Simon ignorierte die Tatsachen. Was geht mich das an, sagte er gerne. Ich habe drei Söhne und zwei Töchter. Eine Frau und eine Schwiegermutter. Ja, die Römer unterdrücken uns, pressen uns aus wie eine Zitrone. Doch sie haben Schwerter, Schilde und Lanzen.
Wissen damit umzugehen. Und ich bin ein Feigling. Außerdem, wenn die Römer uns nicht auspressen, dann macht das jemand anderes. Wenn’s kein Fremder ist, dann die hohen Herrschaften in Jerusalem, die sich unsere Brüder nennen.
Simon hatte damit natürlich recht. Deshalb musste es ja eine Revolution geben. Etwas Neues, etwas Besseres. Andreas war überzeugt, wenn sie erst einmal eine richtige Revolution anstachelten, dann konnte Gott das nicht mehr ignorieren und würde den Messias schicken. Mit diesem an der Spitze wäre ein Sieg der Revolution sicher. Er dachte ja, dass Johannes der Messias ist. Eine Weile hatte Andreas mit ihm am Jordan gelebt. Doch Johannes machte keine Anstalten, etwas anderes zu tun, als zu taufen und den schrecklichen Zustand der Welt und seiner Mitmenschen anzuprangern. Er erinnerte sich noch gut an den Tag, als die Tempelpriester aus Jerusalem herüberkamen. Noch beim darüber Nachdenken, bekam er Wut im Bauch. Diese arroganten Schnösel. Stellten sich am Ufer auf, in ihren schicken, mit Goldfäden durchzogenen Umhängen. Johannes wusch sich gerade das Gesicht im Fluss.
Andreas wusste, dass die Priester Johannes eine Falle stellen wollten. Denn sie waren nicht ohne Grund da. Herodes Antipas, der König von Roms Gnaden, fürchtete sich vor Johannes. Er hasste ihn nicht. Im Gegenteil, er bewunderte ihn.
Herodes sagte das natürlich nicht öffentlich. Aber es war bis außerhalb der Palastmauern gedrungen, dass der König nur anerkennende Worte über Johannes sagte. Doch dann hatte Johannes den König wegen seiner Hochzeit mit Herodias, der Frau von Antipas Halbbruder Boethos, öffentlich kritisiert. Er sagte, diese Ehe wäre eine Sünde. Das konnte Herodes nicht ignorieren. Vor allem, weil auch die Römer inzwischen über Johannes Reden beunruhigt waren. Deshalb schickte Herodes die Priester. Sie sollten Johannes überlisten, sollten ihn zu einer Antwort bringen, die Herodes als Anstiftung zur Revolution oder Gotteslästerung werten konnte, um ihn dafür ins Gefängnis zu werfen. Deshalb fragten ihn die Priester: „Johannes, bist du ein Prophet? Bist du vielleicht sogar der Messias?“ Der Angesprochene schnaubte. Nicht, dass er das Spiel der Priester nicht durchschaute, er würde in jedem Fall die Wahrheit sagen. Deshalb antwortete er: „Ich, der Messias? Ha. Ein Prophet? Lächerlich. Nein, ich bin nichts weiter als ein Rufer. Ein Rufer in der verdammten Wüste.“ Er zuckte mit den Schultern und lachte. „Ich bin nur ein Insekt, das andere Insekten frisst. Geht zurück nach Jerusalem und sagt das eurem König. Und eins sagt ihm auch: Ich taufe mit Wasser, aber ich sage euch, der, der nach mir kommt, der wird mit Feuer taufen.“ An diese Worte dachte Andreas immer mit einem Schauder. Diese aufgeplusterten Priester standen da und hatten Angst. Sie hatten wirklich Angst. Schnell verschwanden sie wieder in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Johannes sah ihnen nicht einmal nach. Was für ein Anblick. Andreas wünschte sich, dass die Worte des Täufers in Erfüllung gehen und der Mann, der mit Feuer tauft, endlich kommt. Er faltete die Hände und bat Gott inständig, dass er noch leben würde, vielleicht sogar noch jung war, wenn dieser Tag anbrach. Der Tag des Messias.
Simon hatte die Netze eingezogen, die paar gefangenen Fische verstaut, das Segel gesetzt und schipperte in Richtung Ufer. Er war frustriert, doch nicht so schlimm, wie er es eigentlich sein müsste. Immerhin: zu Hause wartete seine Frau, die zurzeit nicht gut auf ihn zu sprechen war. Sie würde ihm wieder Vorwürfe machen, ihm raten, sich einen anderen Beruf zu suchen, ihn dann anschreien, er solle keine Ausreden finden und an die immer zahlreicher werdenden Mäuler erinnern, die in seinem Haus auf ihn hungrig warteten. Und seine Schwiegermutter erst. Sie nannte ihn einen Versager. Der auch noch einen zweiten Versager ins Haus gebracht hatte. Das würde Simon wieder zu hören bekommen.
Andreas, der alte Faulpelz, lachte darüber, Simon hingegen trieb es die Tränen in die Augen. Wie konnte man ihn nur einen Versager nennen? Er schuftete von Früh bis Spät.
Machte sich den Rücken krumm. Und wofür? Meckerei zu Hause und das unverschämte Grinsen des Steuereintreibers.
Verdammt. Vielleicht sollte er auf Andreas hören und mit ihm die Revolution einfach beginnen.
Er näherte sich dem Ufer. Dort saß ein Mann. Simon dachte, es ist Andreas, doch nach einem zweiten Blick war es ein Fremder. Der tat plötzlich etwas Merkwürdiges. Er winkte. Simon sah über die Schulter, um zu sehen, wem das Winken wohl galt. Doch da war niemand. Simon dachte sich dabei nichts weiter und winkte, etwas zögerlich, zurück. Der Kiel des Bootes grub sich in den Sand. Simon holte das Segel ein und wollte den einen Korb mit Fischen, die er gefangen hatte, an Land bringen. Der fremde Mann stand plötzlich neben seinem Boot. Simon erschrak und hätte die Fische mit einem Schrei fast wieder in den See zurückgeworfen.
„Mann, hast du mich erschreckt.“
Der Fremde lächelte freundlich, sagte aber kein Wort. Simon stellte den Korb ab. Er wischte sich mit einem Tuch über die Stirn und sagte: „Wer bist du verdammt?“
„Ich bin Jeschua.“
Simon ließ das Gefühl nicht los, dass der Mann nicht alle im Oberstübchen hat. Aber zu Verrückten soll man ja freundlich sein. Sie bringen Glück, so sagt man. Also nickte er und sprach so, wie er zu seinen Kindern sprach: „Ein sehr schöner Name, Jeschua. Guten Tag.“
Simon wendete sich wieder seiner Arbeit zu.
„Guten Tag, Simon“, sagte der Fremde.
Jetzt lief es Simon kalt über den Rücken. Er drehte sich zu dem Fremden, der lächelte weiterhin milde. Gut mein Freund, dachte sich Simon, du kennst meinen Namen und willst ein Spiel spielen. Spielen wir ein Spiel. „Kann ich dir mit etwas behilflich sein?“, fragte er.
„Sicher. Du kannst mir deine Hand geben und mich in ins Boot ziehen.“
Simon kratzte sich am Kopf. Das tat er immer, wenn er gerade nicht weiterwusste. „Warum sollte ich das tun?“
„Wir fahren hinaus auf den See und fangen Fische.“
Simon sah zu dem Korb mit den Fischen, die er an diesem Morgen gefangen hatte.
„Ein paar mehr Fische“, sagte Jeschua.
Simon lachte plötzlich etwas hysterisch. „Ist das wieder einer von Isaaks Scherzen? Wenn ja, sag ihm, er kann mich mal. Und zwar kreuzweise.“
Jeschua schüttelte den Kopf und streckte Simon die Hand entgegen. „Komm schon, alter Griesgram, der Tag neigt sich.“
Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit reichte Simon zu seinem eigenen Erstaunen dem offensichtlich verrückten Mann die Hand und hob ihn in sein Boot.
Gemeinsam stakten sie es vom Ufer weg. Simon setzte das Segel und sie fuhren hinaus auf den See. Jeschua setzte sich auf die Bank am Heck des Bootes, holte unter seinem Umhang einen Laib ungesäuertes Brot hervor, brach es und reichte Simon die andere Hälfte. Er sagte: „Ein herrlicher Tag. Hier am See zu leben und zu arbeiten ist einfach ein Privileg.“
Wollte er sich bei Simon einschmeicheln? „Woher kommst du?“, fragte er.
„Nazaret.“
„Nazaret? Da war ich noch nie. Wie ist es da?“
„Es gibt keinen See.“
Simon schmunzelte. „Ich wohne drüben, in Kafarnaum.
Mit Frau, meinen Kindern und der Schwiegermutter. Na ja und meinem Bruder.“
Jeschua schwieg, doch dann sagte er leise: „Ich glaube, wir halten hier an und fischen.“
Simon sah sich um. Er zuckte mit den Schultern und gemeinsam warfen sie die Netze aus. „Da bin ich aber jetzt mal gespannt wie ein Flitzebogen. Bist du so etwas wie ein Zauberer?“
„Ein Zauberer?“
„Ja … einer von den Leuten, die Dinge können, die andere nicht können. Warzen verschwinden lassen, einen von Zahnschmerzen befreien oder machen, dass die Frau wieder Lust bekommt. So etwas eben.“
Jeschua schüttelte den Kopf.
„Gut, du willst nicht darüber sprechen.“
„Simon, kein Mensch kann zaubern. Wenn es so wäre, gäbe es keine Krankheiten und auch keine ausbleibenden Fische. Die Zauberer würden in goldenen Palästen wohnen und die Menschen wie verrückt davor Schlange stehen.“
„Aber du willst mir doch eine Menge Fische ins Netz lotsen?“
„Das will ich.“
„Siehst du. Meiner Meinung nach benötigst du dafür allerdings Zauberei. Die Fische bleiben seit Wochen weg. Jetzt aber kommt Jeschua aus Nazaret und ich habe plötzlich fetten Fisch im Netz?“
„So ist es“, sagte Jeschua.
Simon sah, dass der Nazarener nicht gewillt war, ihm das genauer zu erklären. „Du bist mir vielleicht einer. Aus dir werd ich noch weniger schlau als aus meiner Frau. Von meiner Schwiegermutter ganz zu schweigen.“
Über das Wasser drangen Rufe. Zebedäus fuhr mit seinem Boot in Richtung Ufer.
„Simon, warst du nicht schon auf dem Weg nach Hause?“
„Habs mir noch mal überlegt. Einen Versuch noch.“
„Das wird nichts. Der See ist nahezu leer. Wir haben kaum etwas gefangen. Aber viel Glück.“
Simon winkte ab und sagte hinter vorgehaltener Hand zu Jeschua: „Das war gelogen. Der alte Geizkragen gönnt doch keinem eine vertrocknete Dattel.“
So ging der Nachmittag dahin. Simon döste in der Sonne.
Jeschua hing seinen Gedanken nach. Die Vögel flogen die wildesten Manöver. Doch dann ruckelte das Boot. Es bekam leichte Schlagseite. Simon öffnete die Augen. „Ich werd verrückt.“
Er stieß Jeschua an, dieser blickte ihn fragend an, Simon nickte und grinste über beide Ohren. Eifrig holten sie die Netze ein. Darin tummelten sich die Fische in Hülle und Fülle. Die Körbe waren mit einem Schlag rappelvoll. Simon jauchzte. Jeschua jauchzte mit ihm.
Die Sonne stieg zum Horizont hinab, als die beiden das Boot auf den Strand zogen. Simon umarmte den verdutzten Jeschua. „Zauberer oder nicht, du bist ein Held, du hast ein Wunder vollbracht.“
Jeschua lächelte Simon an. „Weißt du, Simon, ich möchte heute noch ein Wunder vollbringen. Diesmal aber ein echtes.“
„Übernimm dich bloß nicht, mein Junge.“
„Wir werden sehen.“
„Um was für ein Wunder handelt es sich denn?“
„Ich möchte, dass du alles stehen und liegen lässt, auch diesen Fang hier und mir auf meinem Weg folgst.“
Simon sah zu seinem Boot. Sah die Körbe voller Fische. Er sah vor seinem geistigen Auge, wie er heute Abend zufrieden im Kreise seiner Liebsten saß, seine Frau mit glänzenden Augen, stolz auf ihn, seine Schwiegermutter schweigend und suchend nach dem Fehler in der Erfolgsgeschichte, seine Kinder und er mit vollem Magen und der Gewissheit, dass in seinem abschließbaren Kästchen bald Münzen schepperten, wenn er es schüttelte. Das alles sah er vor seinem geistigen Auge. Eigentlich, so sein erster Impuls, sollte er den, dem er immerhin dieses Glück verdankte, für diesen Wunsch auslachen. Ja, er sollte ihn verdammt noch mal einfach auslachen.
Doch Simon sagte: „Jeschua, ich bin nur ein Fischer.“
„Ich weiß Simon. Und ganz bestimmt ein guter. Ein Fischer wirst du auch bleiben. Doch von nun an wirst du Menschen fischen. Ich mache dich zu einem Menschenfischer.“
Simon war wie betäubt und sah dem Mann in die Augen, der da vor ihm stand. Er hatte ungebührlich langes Haar, der Mund zornig, in den Augen lagen Hoffnung und Glanz. Er hatte diesen Mann in sein Boot gehoben, obwohl er ihn nicht kannte. War mit ihm hinausgefahren, ganz entgegen seiner misstrauischen Art, hatte ihm geglaubt, als er ihm Fisch versprach. Viel Fisch. Und jetzt? Jetzt will dieser merkwürdige Mann, dass er die Früchte, die er eben erst erntete, im Staub liegen ließ. Wozu? „Menschenfischer? Ich verstehe nicht.“
„Das will ich dir sagen. Wir, du und ich, werden hinausgehen und den Menschen von Gott erzählen. Du wirst natürlich jetzt sagen, die Leute kennen doch Gott, was wollen wir da groß erzählen? Doch wir werden ihnen eine neue Botschaft bringen. Wir werden ihnen sagen, dass Gott sie liebt, sich mit den Menschen versöhnen will. Wir werden ihnen von seinem Reich erzählen, dass es bevorsteht und sie sich ändern müssen. Wir werden ihnen sagen, dass der Menschensohn gekommen ist, sie zu lehren und ihnen eine gute Botschaft zu sagen. Simon, wir werden die Welt verändern.“
Simons Herz klopfte so stark, dass er das Gefühl hatte, gleich ohnmächtig zu werden, Tränen stiegen ihm in die Augen und er nahm Jeschua in den Arm und sagte: „Ich will dir folgen, Jeschua aus Nazaret.“
„Ohne zurückzuschauen?“
Simon nickte stumm. Sie luden daraufhin die Körbe aus dem Boot und stellten sie auf den Strand. Andere Fischer, wie die Söhne des Zebedäus, kamen herbeigerannt und bestaunten den Fang des Simon. Kaum jemand nahm seinen Begleiter wahr, der wie ein Schatten am Rande wirkte. Sie staunten, johlten und klopften Simon auf die Schulter. Aber er sah auch ihre Blicke. Er sah in ihnen Verzweiflung, Berechnung, Neid und Hass.
„Leute“, Simon schrie über das ganze Geschnatter, „nehmt euch soviel ihr tragen könnt, es reicht für alle.“
Mit einem Schlag war es still. Doch, nur für einen Augenblick. Dann gab es kein Halten mehr. Die Fischer stürzten sich auf seinen Fang. Simon stand betreten daneben, doch machte sich in seinem Inneren eine Erleichterung breit, die ihm unheimlich war. Der Fang seines Lebens, der ihm ein paar wirklich gute Wochen beschert hätte, löste sich wie eine Herde Schafe auf, unter die der Wolf geraten war. Sie nahmen nicht nur seinen Fisch, auch seine Körbe, für die er gutes Geld bezahlt hatte. Zwei Fische, ein großer und ein kleiner, blieben vor seinen Füßen am Strand liegen.
Jeschua, der sich im Abseits gehalten hatte, trat zu ihm, legte die Hand auf Simons Schulter und sagte: „Komm, wir müssen einiges besprechen.“ Simon seufzte ein sehr tiefes Seufzen.
Zum Sonnenuntergang saßen die beiden am Strand und rösteten die übrig gebliebenen Fische über einem Feuer.
Andreas kehrte zurück. Simon hatte den Bruder beauftragt, seiner Familie Bescheid zu geben, dass er einige Zeit nicht nach Hause kommen könne. Eine Erklärung folge später, Andreas hatte auf Nachfrage von Simons Frau nur den Kopf geschüttelt. Ob sie sich jetzt einen Liebhaber sucht? Dieser Gedanke beschäftigte Andreas auf dem Rückweg zu Simon.
Die Nacht sank auf das Land, an den Ufern des Sees Gennesaret blinkten die Lichter der Dörfer und Städte, die um das Galiläische Meer lagen, wie der See auch genannt wurde.
Es sah aus wie flackernde Kerzen bei geöffnetem Fenster.
Andreas war ganz außer Atem. Sein Bruder, seiner berechenbarer Bruder, hatte plötzlich einen Anfall oder etwas Ähnliches bekommen und verkündet, sich einem Wanderprediger anzuschließen. Lag es vielleicht an den Vorwürfen, die Andreas Simon am Morgen gemacht hatte? Es waren ungerechte Vorwürfe gewesen. Als Kinder waren sich beide einig, dass, wenn sie erwachsen sind, sie die Dinge zum Besseren verändern wollten. Doch es war anders gekommen. Simon heiratete, seine Frau bekam ein Kind nach dem anderen, er wurde Fischer wie sein Vater. Andreas heiratete nicht. Er hielt sich, so sagte er betont augenzwinkernd, in Warteposition. Doch in seinem Inneren rumorte es. Er fühlte sich von Simon verraten. Andreas sagte das seinem Bruder nicht, nun, bisweilen schon, wie heute Morgen. Doch dann schämte er sich, denn, wenn er es sich ehrlich eingestand, seine vermeintliche Warteposition war der Haushalt seines Bruders.
Andreas wusste tief in sich drin, dass er nicht in Warteposition für etwas Weltbewegendes verharrte, sondern einfach nur nicht erwachsen werden wollte. Als Rechtfertigung reagierte er aggressiv und verletzend, wann immer die Mauer seines Scheins auch nur einen kleinen Riss bekam. Missmutig erreichte er das Lagerfeuer am Strand. Der Fremde und sein Bruder saßen lachend in seinem Schein.
Andreas setzte sich nicht. Er sagte: „Ich habe beschlossen, wenn du das willst, dir ebenfalls zu folgen.“
Jeschua nickte. Andreas wertete dies als Zustimmung und setzte sich mit ans Feuer. Er war jetzt voller Elan. „Was hast du vor? Willst du Jerusalem befreien? Die Römer aus dem Land jagen? Wir könnten auch die Priester aus dem Tempel werfen? Verdient hätten es diese korrupten Säcke. Dazu müssten wir aber Waffen besorgen. Wir sollten mit den Zeloten Kontakt aufnehmen.“
„Ruhig Andreas. Du wirst alles rechtzeitig erfahren. Jeschua ist vierzig Tage in der Wüste gewandert. Er hat Gott befragt. Und Gott hat ihm geantwortet.“
„Ist er etwa ein Prophet? Ist er wie Elija? Ist er …“
Simon gebot seinem Bruder still zu sein. Jeschua sah die beiden belustigt an. „Ich glaube, mit euch habe ich mir die richtigen ausgesucht. Doch wir benötigen mehr. Ein paar junge Heißsporne. Burschen, die sich vor nichts fürchten.“
Simon und Andreas sahen sich betreten an. Dann sagte Simon: „Ich weiß, wer. Jakobus und Johannes. Die Söhne vom alten Zebedäus. Man nennt sie die Donnerkinder. Ich kann sie nicht besonders leiden, sie sind arrogant und anmaßend, aber Angst haben die vor niemandem.“
Andreas nickte. „Sie werden sich dir allerdings kaum anschließen. Der alte Geizkragen Zebedäus knechtet sie zwar, doch sie lassen es sich gefallen, weil er etwas zu vererben hat.
Man weiß ja, dass es um seine Gesundheit nicht allzu gut bestellt ist. Böse Zungen behaupten sogar, dass Salome, seine Frau, an einem schnellen Ende ihres Mannes arbeitet. Ich will natürlich nichts behaupten oder unterstellen.“
Jeschua legte sich auf die Seite und schloss die Augen. Andreas fragte: „Glaubst du, dass es die richtigen für uns sind.“
„Es sind die richtigen. Wir sollten jetzt ein wenig schlafen.
Morgen beginnt unsere Mission.“
Andreas stupste seinen Bruder an der Schulter. Dieser ballte vor Freude die Faust.
Sie lagen schon eine Weile unter dem glitzernden Band der Milchstraße. Das Feuer knisterte, doch Simon konnte, im Gegensatz zu Andreas, nicht einschlafen. Er blickte zu Jeschua. Doch auch er hatte die Augen geschlossen. Trotzdem sagte er: „Jeschua, denkst du, dass Andreas und ich würdig sind für die neue Zeit? Wir lästern über unsere Nachbarn.
Sagen schlimme Dinge über sie. Und das ist noch harmlos.
Ich habe meine Frau betrogen. Mehrmals. Außerdem habe ich einmal eine meiner Töchter geschlagen, weil sie mich genervt hat. Das tut mir heute schrecklich Leid, weißt du.“
Jeschua schlug die Augen auf. „Simon, wenn du es bereust, wird alles wieder gut. Glaub mir, eure Herzen, die gefallen Gott besonders. Schau dir oben die Sterne an. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum sie so unordentlich am Himmel sind?“
Simon schüttelte den Kopf. „Noch nie. Du hast recht. Ein einziges Chaos.“
Jeschua rieb sich die Arme, als ob er fröre. „So hat Gott die Welt erschaffen. Groß und klein, dick und dünn. Jung und Alt. Schön und hässlich. Alles dabei. Alles durcheinander.“
Simon drehte sich auf den Rücken und blickte zum nächtlichen Himmel. „Trotzdem wunderschön.“
Jeschua richtete sich auf, schaute nach oben und sagte: „Danke Simon.“
1
Die Wüste ist ein Greifvogel. Sie schwebt, schlägt mit den Flügeln, schreit in die Weite. Und plötzlich.
Stille. Der Vogel hat das Opfer in seinen Krallen, beginnt es zu verspeisen. Nicht ohne Wachsamkeit. Die Wüste ist ein Greifvogel. Ist Gott ein Greifvogel?
Der Wanderer durchquerte das Nichts. Es war ihm, als bewege er sich auf der Stelle. So viele Schritte. So viel Anstrengung. Alles umsonst? Und was war das Ziel dieser Reise? Wohin ging er? Inmitten einer Leere, in der es, da war er sich sicher, Stimmen gab. Von außen betrachtet schien der Wanderer ruhig. Gleichmäßig zog er seine Spur. Doch in seinem Innersten, da tobte ein Meer. Er selbst war nicht die See, er war das Schiff, welches in grauen Fluten seinem Schicksal entgegenschlingerte. Aber was sollte das für ein Schicksal sein? Ein goldenes, duftendes Land oder der Meeresboden, in einsamer Dunkelheit? Egal. Keine Fragen mehr: Gott ist ein Greifvogel!
In seinen Krallen wird er den Wanderer tragen, dorthin, wo Gott meint, dass er sein sollte. Er fühlte die Krallen, er fühlte sie mehr als alles andere, der mächtige Schlag des Jägers hatte ihn verwirrt, ohne Bild von Zukunft war er, die Orientierung verloren, kaum einen Meter weit konnte er sehen.
Der Esel, mit dem er von Damaskus aufbrach, wurde ihm vor Tagen gestohlen. Nahrung und Wasser gingen zur Neige.
Die Wüste ist ein Greifvogel, der mit seiner Beute spielt. Die Tage, brütend heiß, die sternenklaren Nächte, eisig kalt. Seine Kleidung hielt die Hitze des Tages am Rande des gerade noch erträglichen, die nächtliche Kälte aber, sie kroch unter die Haut, ganz tief bis in die Knochen kroch sie, dass einem die Zähne ununterbrochen klapperten. In den Nächten nicht der einzige beunruhigende Ton. Hätte er doch noch sein Zelt.
Von eigenen Händen genäht, dieses wunderbare Zelt, welches einem das Gefühl gab, die Welt draußen zu lassen. Einen abgetrennten Bereich für das furchtsame Ich. Die unbegreifliche Höhe von Gottes Schöpfung nicht in ihrer ganzen Tragweite spüren zu müssen, von der einem die funkelnden Lichter am Nachthimmel eine Ahnung geben.
Doch dieses Zelt war genommen. Räuber, zwei Tage, nachdem er den Anschluss an die Karawane verloren hatte, in deren Begleitung er von Damaskus her reiste. Die Räuber kamen auf Kamelen und lachten über seinen Esel. Sie sagten, sie täten einem von zwei Eseln einen Gefallen, ließen ihn aber, zu seiner Verwunderung, am Leben, gaben ihm sogar etwas (steinhartes) Brot und einen Schlauch, gefüllt mit Wasser. Alles andere jedoch, nahmen sie. Auch das Schwert, seine Rüstung und die heiligen Schriftrollen. So vieles hätte er verschmerzen können. Aber ausgerechnet diese Dinge. Wenn er daran dachte, traten ihm Tränen in die Augen. Was hatte er aber auch erwartet? War ER nicht an den See Gennesaret gekommen und hatte Simon aufgefordert, IHM zu folgen. Dem Fischer blieb nicht einmal Zeit, nach Hause zu gehen, der Frau Bescheid zu sagen, ein paar Sachen zu packen. Selbst das mit den ausstehenden Steuern musste warten. Das war alles nicht ungefährlich, besonders das mit den Steuern. Und er selbst? War er nicht bequem mit Gepäck und im Gefolge von Damaskus aufgebrochen? Der Wanderer hätte an Simon denken sollen, als er seine Pläne im Haus der Gemeinde von Isaiah schmiedete. Hätte daran denken sollen, dass Umkehr für IHN Abkehr heißt, dass ER, ihn so einfach nicht davonkommen ließ.
Die Wüste ist ein Greifvogel, der das Fleisch von den Knochen seines Opfers zupft. Warum, so fragte er sich, hatten die Räuber ihm Essen und Trinken gegeben? Aus Grausamkeit? Damit sich sein Leiden und die Erkenntnis, jetzt sterben zu müssen, hinzog? So wird es sein. Warum musste er aber auch den Anschluss an die Karawane verlieren? Nun, er war auf seinem Esel eingeschlafen. Als er aufwachte, fror er entsetzlich. Der Esel stand einfach da, die Sonne stieg soeben am Horizont empor und, er merkte es schnell, es herrschte, außer einem Säuseln, Stille. Er sah sich um. Doch niemand war zu sehen. Er rief. Mehrmals. Immer lauter.
Doch niemand gab Antwort. So stieg er von seinem Esel und bekam einen Wutanfall. Besser, einen Schreianfall. Vor allem über sich selbst, weil er eingeschlafen war (wie konntest du nur), aber auch über die Gemeinheit des Karawanenführers, dem er gutes Geld zahlte und der versprach, besonders auf ihn achtzugeben. Als er sich halbwegs beruhigt hatte, kam ihm eine Idee. Er suchte im Sand nach den Spuren der Karawane. Und tatsächlich, er fand sie. Einen Schrei der Erleichterung ausstoßend, stieg er auf seinen Esel und folgte der Spur. Doch, das Säuseln des Windes erhob sich zu einem Wind, der nicht nur die Spur verwischte, sondern, als daraus ein Sturm entstand, ihn völlig desorientierte. Er fand einen Felsen, der aus der Landschaft ragte, dankte Gott, baute unter großen Mühen sein Zelt im Windschatten des Felsens auf und kroch hinein. An Schlaf war nicht zu denken. Er versuchte zu beten. Das gelang, er betete lange, dann schlief er ein. Als er aufwachte, sah er ein Gesicht im Zelteingang, dass mit wenig Zähnen lachte. „Guten Morgen, der Herr“, sagte der Mann und lachte erneut. Als die Räuber abzogen, wunderte der Wanderer sich, noch am Leben zu sein. Doch dann kam ihm ein Gedanke. Natürlich. Er kann gar nicht sterben.
Nicht jetzt, nicht morgen. Er muss ja zunächst seine Aufgabe erledigen. Aber warum gerade ich? Er schrie es hinaus: „Warum ich?“ Was für eine dumme Frage. Sagte er sich und sank resigniert zu Boden. Warum gerade ich nicht?
Zunächst nahm er ihn nicht wahr. Dann leugnete es sein ausgelaugter Geist. Und in dem Moment, als er davor stand, registrierte er es mit Unglauben. Ein Turm ragte vor ihm in den Himmel. Er kniff die Augen zusammen, beschirmte sie mit der Hand, um sich die Aussicht, die sich bot, genauer anzusehen. Über einer Zinne des Turmes, der wie ein abgebrochener Zahn in den Himmel stach, hing eine Wolke. Der Himmel hatte seit Tagen keine Wolke gesehen, zumindest keine, die ihm aufgefallen wäre, jetzt, über diesem Turm, wirkte sie daher wie ein Fehler. Auch wie ein Fehler wirkte der Turm, nicht allein deswegen, dass er hier, mitten in der Wüste stand, nein, es war der Felsen, auf dem er stand. Dieser ragte wie eine halb vergrabene Tischplatte aus dem sandigen Boden, die ein Riese schräg hineingerammt hatte. Er fragte sich, welchem tollkühnen Baumeister die Idee gekommen war, auf diesem schwierigen Gelände ein Gebäude zu errichten. Um den Turm herum spross es grün. Nicht diese farblosen, garstigen Sträucher der Wüste. Nein, richtiges Grün. Dazwischen sogar Blumen, flatternd im Wüstenwind.
Er lauschte. Hörte er da ein Plätschern? Er ging dem Geräusch nach und tatsächlich, nah beim Turm sprudelte zwischen den Felsen eine kleine Quelle hervor. Der Wanderer stieß einen Freudenschrei aus. Er trank gierig. Das Wasser war kühl und köstlich. Er füllte seinen Wasserschlauch auf.
Gott ist ein Greifvogel, der gnädig ist. Mit neuem Leben angesteckt, schaute er sich um. Am Horizont sah er zwischen den roten Felsen des Gebirges eine Stadt. Eine prächtige Stadt mit Säulen und Kuppeln. Er vermochte nicht zu sagen, ob es eine Täuschung ist, eine Luftspiegelung oder wie die Menschen der Wüste sagen: Fata Morgana.
Die Sonne stand schon weit über dem Zenit, der Wanderer beschloss, sich erst am nächsten Tag auf den Weg zu machen. Der Turm war mehr, als er erhoffen konnte, zumal, erneut Wind aufkam. Vielleicht ein weiterer Sandsturm? Er drückte sich durch den Spalt einer zerbrochenen Holztür in eine dunkle und kühle Stille. Eine Stille mit Echo. Eine brüchig aussehende Treppe führte nach oben. Vorsichtig stieg er hinauf. Sand rieselte. Eine Etage weiter oben angekommen, sah er, wie durch ein großes Fenster, verschlossen mit einem von außen blickdichten Holzgitter, Licht streute. Der Wanderer fühlte sich müde. Er kauerte sich an eine Wand. Fror er etwa? Es war kühl hier, aber nicht kalt. Nein, die Kälte kam von woanders. Vielleicht aus seinem Inneren? Er seufzte, die Augenlider wurden ihm schwer.
Seine Füße gruben sich in weiches Gras. Über ihm spannte sich der nächtliche Himmel. Glitzernd und schweigend. Bäume und Sträucher zu beiden Seiten des Weges, nur Schatten waren sie, Kulissen, so kam es ihm in den Sinn, doch die Geräusche des Windes, die Geräusche der Tiere sprachen eine andere Sprache. In der Luft lag ein zarter Duft von Eukalyptus. Auch einen Hauch Minze. Zu seiner linken schlängelte sich eine Schlange um einen Baum. Zu seiner rechten sah er schemenhaft einen Papagei mit gelben, funkelnden Augen.
Überall auf diesen schattenhaften Kulissen tanzten Lichtflecken wie im Wasser wabernder Froschlaich. Glupschaugen, die ihn beobachteten. Sie schwammen von oben nach unten, dann, von unten nach oben.
Der Wanderer trat durch ein Tor in eine große Halle. Wie bei einem römischem Amphitheater senkten sich die Stufen zu einer Bühne hin. An der Wand hinter der Bühne stand ein auf die Seite gelegtes Kreuz gelehnt. Das Licht des Raumes auf sich ziehend. Davor im Halbschatten saß ein Mann. Es war der Teufel. In seltsamer Kleidung. Er lächelte den Wanderer an. Auf dem Kreuz tanzten Glupschaugen.
„Ist dies die Hölle?“, fragte der Wanderer.
Der Teufel sah sich um und sagte: „Stellst du dir die Hölle so vor?“
Die Augen des Teufels wechselten beständig Form und Farbe, der Wanderer sah sie wie durch den Boden einer Glasflasche. Aber nur die Augen. Was ihn schauderte. Der Wanderer setzte sich auf die unterste Stufe des Amphitheaters.
„Wenn dies nicht die Hölle ist, wo bin ich hier dann?“,
fragte er.
„Ich denke, du bist in einem Traum“, sagte der Teufel.
„Warum bist du in meinem Traum?“, fragte der Wanderer.
„Um dich zu warnen“, sagte der Teufel.
„Wovor?“, fragte der Wanderer.
„Vor dir selbst“, sagte der Teufel.
Der Wanderer schüttelte den Kopf und fragte: „Weshalb?“
„Weshalb? Was liegt denn vor dir? Hat ER dir die ganze Wahrheit gesagt, bevor du IHM leichtfertig dein Wort gabst?
Es auch nur mit einer einzigen Zeile erwähnt? Die Schmerzen, die Einsamkeit, die Erniedrigung, ja, ich möchte nicht vorgreifen, den Tod selbst. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass ER dich für jeden einzelnen Stein, der Stephanus traf, hundertfach büßen lässt?“
Der Wanderer ließ sich nichts anmerken. Die Schule des Gamaliel war ein mächtiges Schild. Selbst gegen den Teufel.
In seinem Inneren aber bekam das Schiff Schlagseite. Turmhohe Wellen schlugen über die Reling. Wasser lief in die Kabinen.
„Saul“, sagte der Teufel ernst, „Gott hat keine liebende Seite. Er ist ein rachsüchtiges Ekel. Und der einzige, der zwischen seiner Rache und dir steht, bin ich. Der Teufel.“
Der Wanderer blickte in die tanzenden Augen seines Gegenübers. Er fand keine andere Bewegung in diesem Gesicht.
„Ich frage mich, warum du mich umstimmen willst? Sieh mich an. Meine Kleidung ist zerrissen, mein Schwert gestohlen, mein Herz blutet aus jeder Pore und in meinem Kopf sausen die Gedanken in einem Tempo, dass ich Angst habe, jeden Augenblick den Verstand zu verlieren. Und das Schlimmste daran ist, keiner der Gedanken trifft sich. Keiner verbindet sich miteinander. Und ein Feigling bin ich dazu.
Ich sollte auf dem Weg nach Jerusalem sein, die Zwölf treffen, ihnen erzählen, was ER mir aufgetragen hat. Aber ich tue keines dieser Dinge. Ich verstecke mich, hier, mitten in der Wüste.“
„Und das zurecht. Wenn du mit deiner Geschichte in Jerusalem hausieren gingst, was würde wohl passieren?“
„Die Zwölf würden mich vermutlich davonjagen. Und dann in der ganzen Stadt erzählen, dass ich ein Lügner und Betrüger bin.“
„Genau das würden sie tun. Und zwar mit Genugtuung für alles, was du ihnen angetan hast. Aber auch die Pharisäer sind nicht mehr gut auf dich zu sprechen. Und wenn wir schon einmal dabei sind, was erst werden die Sadduzäer sagen? Oder die ganz normalen Leute in Jerusalem?“
„Alle würden einander dazu aufstacheln, mich zu töten.“
„Siehst du, damit beantwortest du dir deine Frage selbst.
Was ich von dir will? Es ist ganz einfach, ich will dich vor dir selbst beschützen.“
„Warum solltest ausgerechnet du mich beschützen wollen? Es wäre mir neu, dass du so etwas tust. Und schon gar nicht umsonst.“
„Ja, ich gebe zu, einen klitzekleinen Hintergedanken habe ich. Nur einen kleinen. Versprochen.“
„Ich weiß schon, was du von mir willst.“
„So?“
„Du willst, dass ich SEINE Aufgabe ignoriere.“
„So ist es.“
„Ist das nicht sinnlos? Ich bin mir sicher, dass ER dann einen anderen für diese Aufgabe findet.“
„Da bin ich mir nicht so sicher“, sagte der Teufel scharf.
„Gibt es eine Belohnung für mich, wenn ich tue, was du willst? Vielleicht die gleichen Angebote, die du IHM in der Wüste gemacht hast? Unendliches Essen, durch die Luft fliegen, alle Königreiche der Erde gehören ab sofort mir?“
„Warum so zynisch? Ich finde das alles nicht schlecht.“
„Tut mir leid. Wie ER habe auch ich kein Interesse.“
„Kannst du mir verraten, wie man daran kein Interesse haben kann? Aus Steinen Brot zaubern, durch die Luft fliegen und Beherrscher der Welt zu sein. Denke doch einmal nach. Und denke dabei auch gleich noch daran, wer ich bin.
Was ich dir stattdessen bereiten könnte.“
„Ich habe darüber nachgedacht. Und ich weiß, was du mir bereiten kannst. Meine Antwort lautet: nein.“
Die Augen des Teufels waren nun klar zu erkennen. Dafür verlor der Mund seine Form.
„Gut, um ehrlich zu sein, das alles wollte ich dir auch gar nicht anbieten. Möchtest du wissen, was ich dir anbieten will?“
„Eigentlich nicht? So doll kann es ja jetzt nicht mehr sein.“
„Du bist sehr selbstsicher, Saul aus Tarsus. Aber du täuschst dich“, sagte der Teufel, „selbstverständlich, zu viel Futter sorgt für Verstopfung, umherfliegen wie eine Stubenfliege macht kirre und blöde Königreiche verfallen ohnehin.
Das ist natürlich nichts für einen schlauen Kopf wie dich.
Doch, auch ein Mensch mit einem so messerscharfen Verstand wie du, hat ein Herz. Das weiß ich. Und bei dir weiß ich es besonders. Und ich weiß, wie sehr du darunter leidest, es noch niemals verschenkt zu haben.“
„Da täuschst du dich, Verwirrer. Ich habe mein Herz verschenkt. An Gott, wie du sicherlich weißt.“
„Oh, wie immer sehr sehr nobel, Pharisäer. Doch ich rede nicht von dieser Art Liebe. Die ich dir auch nicht stehlen will, wenn sie dir so wichtig ist. Auch, wenn ich sie mir recht einseitig vorstelle. Nein, ich rede von der Liebe zu einem anderen Menschen. Von Begehren, von Verführung, von Lust und vom Glück fleischlicher Genüsse.“
„Sag bloß, du hast vor, mir eine Frau anzubieten?“
„Mann, Frau, wer weiß das so genau. Ich biete dir die Liebe zu einem anderen Menschen an.“
„In dieser Einöde?“
„Verletze nicht meinen Intellekt. Nein, suche die Stadt der Märchen und Träume. Die rote Stadt, die versteckte Stadt, die unterirdische Stadt. Ich habe sie dir vor dem Turm gezeigt. Suche sie und … ach, ich verrate lieber nicht zu viel, du wirst schon sehen.“
Die Augen des Teufels, sein Mund, sein ganzes Gesicht verschwammen. Undeutlicher auch die Umgebung. Töne verschmolzen. Ganz entfernt Glockenläuten. Und ein Knistern. Ein Knacken. Der Ton eines Feuers. Der Duft von Essen.
Ein Licht in der Ferne.
„Saul, wach auf.“
2
„Wach auf, Saul!“
Ein Schiff fand Sand unter seinem Kiel.
Lief auf, kam mit knirschendem Geräusch zum Halten. Der Wanderer öffnete die Augen. Ein Feuer flackerte. Knisterte. Schatten tanzten. Geräusche von Sand auf Stein, der Stein siegte, verschwommen ein Mann ihm gegenüber, hinter der Flamme. Eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Köstlicher Duft nach Essen. Und tatsächlich, ein Kessel über dem Feuer.
„Riecht wunderbar, findest du nicht auch?“, sagte der andere.
Er nahm einen Stock und rührte in der blasenschlagenden Flüssigkeit.
Saul sah sich um. Er erinnerte sich. Das war der Raum in dem Turm, in dem er, die letzten Kräfte aktivierend, vor dem aufkommenden Sandsturm geflüchtet war. Doch der Sturm schien vorbei, denn von draußen drang kein Ton.
„Wer bist du?“, frage Saul den anderen und rieb sich den schmerzenden Kopf.
„Ich bin es“, sagte der andere.
„Du bist es? Und wer ist, ich?”
„Ich bin, der ich bin.“
Man konnte dem Wanderer das Erschrecken ansehen.
„Ach, falls du dich fragst, der Teufel ist nicht in der Lage, mich vorzutäuschen“, sagte der andere.
Er zog den Kessel aus dem Feuer und hängte ihn am Stativ ein, stand auf, setzte sich auf den Fenstersims und sah durch das hölzerne Gitter. Saul blickte gierig zum Kessel.
„Lass die Suppe noch ein wenig abkühlen. Dann verbrennst du dir nicht den Mund.“
Saul erhob sich, drückte den Rücken durch und ging ebenfalls zum Fenster, behielt den anderen dabei genau im Blick. Er würde zu gern wissen, was unter der Kapuze verborgen ist. Doch zu fragen, traute er sich nicht. So schaute er ebenfalls auf das Gitter. Kalte Nachtluft strömte herein. Und wenn man ganz genau hinschaute, konnte man sogar draußen den schwarzen Himmel mit blinkenden Sternen sehen.
„Ich wüsste zu gern, was sie bedeuten, diese Sterne“, sagte Saul.
„Leben, Saul. Sie bedeuten Leben“, sagte der andere.
Saul hatte schon gehört, dass konkrete Antworten von ihm nicht zu erwarten waren. Antworten, die sofort einen Sinn ergaben, die genau erklärten, A ist gleich A, weil A die und die Eigenschaften hat. Aber nein, wie im Jerusalemer Tempel wird man nie bis ins hochheilige Heiligtum vorgelassen, kann niemals mit eigenen Augen sehen, was über den Inhalt des Raumes gemunkelt wird.
So schwiegen sie eine Weile, bis der andere sagte, es wäre Zeit, die Suppe zu kosten. Sie setzten sich wieder ans Lagerfeuer. Jeschua holte eine Kelle und zwei Schalen unter seinem Mantel hervor und füllte sie. Dann nahm er frisches Brot (woher nahm er nur all die Sachen?), brach es und reichte die eine Hälfte Saul. Es duftete wirklich köstlich und Saul stiegen Tränen in die Augen über die Aussicht etwas zu essen zu bekommen, außer steinhartem Brot. Sie aßen schweigend. Nicht einmal zum Essen nahm der andere seine Kapuze ab. Das Geschirr klapperte. Die Stille zwischen ihnen sorgte bei Saul für eine unangenehme Spannung, die sich von Augenblick zu Augenblick steigerte. Der Andere, der hatte seine Kapuze, mit der er sein Gesicht verstecken konnte, er selbst trug nur einen lächerlichen, abgetragenen Turban. Der Wanderer überlegte fieberhaft, was er Jeschua fragen könnte.
Und da waren mehr Fragen als Sterne am Himmel. Vielleicht sogar mehr Fragen als Sandkörner in der Wüste. Aber den Anfang für all seine Fragen, den fand er nicht. Es war so, als würde er versuchen, das erste Sandkorn am Anfang der Wüste zu finden. Doch etwas musste er fragen. Wenn er es nicht tat, das wusste er, würde Jeschua irgendwann aufstehen, ihm für die gemeinsame Zeit danken, um dann einfach fortzugehen. Er hatte da entsprechende Dinge gehört. Warum also nicht frei heraus?
„Der Teufel hat hervorragende Argumente“, sagte Saul.
„Das stimmt. Ausgezeichnete Argumente. Rationale Argumente. Argumente, gegen die man eigentlich nicht viel haben kann.“
„Er hat dir wirklich alle Königreiche der Welt angeboten?“
„Das hat er.“
„Und mit dem Fliegen, du musst zugeben, du wärst bedeutend schneller bekannt gewesen als mit Dämonenaustreibung oder Heilung eines Unheilbaren. Stell dir mal die Gesichter der Tempelpriester vor.“
Jeschua lachte. „Ich glaube, sie hätten mich am fliegenden Fuß festgehalten und mich des Bundes mit dem Teufel beschuldigt. Und sie hätten sogar recht gehabt.“
Wieder Stille. Saul sah sich interessiert die Decke des Raumes an und sagte mit einem Seufzer: „Was nun?“
Der Andere ließ sich mit der Antwort Zeit. „Du hast die roten Felsen gesehen. Suche bei ihnen den Eingang zu einer Stadt mit dem Namen Petra. Dort wirst du eine Entscheidung treffen.“
„Der Teufel riet mir genau das Gleiche.“
„Dann ist ja alles in Ordnung“, sagte Jeschua.
Saul sah zum Fenster. Das erste Licht des Tages fiel in den Raum. Er sah den anderen an. Der nahm endlich seine Kapuze ab. Das Gesicht schien Saul verändert. Es war härter und menschlicher als an dem Tag vor Damaskus. Damals war es von Licht umkränzt. Von Licht durchflutet. Er selbst im Staub liegend, geblendet und sich verblüffte Erkenntnis mit niederschmetternder Angst mischte. Das Gefäß des Körpers sich mit brennender Scham füllend, schließlich die schwarzen und weißen Schatten in seinen Augen, die sich in der ausbreitenden Dunkelheit verloren. Sein Gegenüber jetzt war ein normaler Mann. Nicht viel Besonderes an ihm.
Schmal, jüdisch, mit großen, dunklen Augen, die ihren jugendlichen Glanz noch nicht verloren hatten.
Ernsthaftigkeit lag in ihnen, Verständnis auch und, nur zu erahnen: spöttische Herausforderung.
„Ich habe Angst, Jeschua.“
„Ich weiß, Saul. Deshalb werde ich bei dir sein. Achte nur auf die Spuren im Sand neben dir. Achte aber vor allem auf dein Herz. Das scheint mir ganz schön wackelig.“
Saul lächelte und sah zu Boden. Spuren im Sand neben mir? Ich habe hingeschaut. Da gab es keine Spuren. Nur Sand und diesen Turm. Rechtzeitig. Das stimmt. Ohne den Turm wäre er verloren gewesen. Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich ihn diesem leeren Viertel finde.
„Geh jetzt, draußen wartet eine Gelegenheit“, sagte Jeschua.
Der Wanderer sah den anderen unschlüssig an. Nach einer Weile schulterte er seine Tasche, wandte sich zur Treppe, hielt inne und schaute noch einmal zurück. Jeschua blickte ins flackernde Feuer. Nein, der Teufel konnte das hier nicht sein, dachte Saul. Der Teufel hat Glupschaugen, strahlend vielleicht, aber sie waren kalt, ohne Einladung, ohne Versprechen, dass alles gut wird.
„Danke für die Suppe“, sagte Saul.
Der andere lächelte, nickte ihm zu.
Saul verließ den Turm. Er bedeckte seine Augen gegen die Morgensonne und konnte nicht glauben, was er sah. Vor dem Turm lagerte eine Karawane. Und damit die Geräusche von Menschen und Tieren. Ein vielstimmiges, zunächst disharmonisch scheinendes Konzert auf verstimmten Instrumenten. Doch bald darauf, man musste nur eine Weile hinhören, mischten sich alle Töne zu einem Klangteppich. Dem Klangteppich von Mensch und Tier in der Wüste.
Dann hörte der Wanderer einen Schrei, er blickte nach oben und sah einen Greifvogel, der sich von den Zinnen des Turms erhob. Saul grüßte und schaute ihm nach. Dann wandte er sich dem Lager der Karawane zu. Man hatte ihn schon bemerkt, offensichtlich war bei einigen Männern eine Diskussion über Saul entstanden. Er ging zu der Gruppe, fragte auf Griechisch nach dem Ziel der Karawane.
„Hey, du bist doch nicht zufällig ein Spion? Möchtest wohl auskundschaften, ob wir lohnenswerte Beute sind?“,
fragte ein Mann.
Saul kam plötzlich in den Sinn, was für ein merkwürdiges Bild er abgeben musste. Ein Mann in abgerissener Kleidung, das Gesicht von der Sonne versengt, das einst glatt rasierte Kinn durch einen wilden Bart verunstaltet, trat aus einem Turm mitten in der Wüste. Wenn er herausgekrochen wäre, nach einem Schluck Wasser winselnd, das wäre normal gewesen. Keiner hätte sich gestört. Wäre er schreiend, mit einem Messer zwischen den Zähnen aus dem Turm gelaufen, niemand hätte sich gewundert. Doch er kam wie jemand, der am Morgen sein Haus verlässt und die Nachbarn grüßt.
Er verneinte die Frage der Männer freundlich und bat sie, ihm zu zeigen, wer die Karawane führte. Sie wiesen auf ein Zelt, welches Saul bereits aufgefallen war. Es war rot, mit einer goldenen Ornamentleiste, viel größer als die winzigen Zelte drumherum. Es schien noch im Aufbau begriffen, denn eine Zeltwand wehte im Wind und gab den Blick ins Innere frei. Vielleicht war es aber auch nur in einem schlechten Zustand. Der Wanderer bedankte sich mit ausgesuchter Höflichkeit und ging, von den misstrauischen Blicken der Männer begleitet, auf das Zelt zu. Selbstbewusst trat er ein.
In der Mitte saß ein Mann vor einem niedrigen Tisch. Auf dem Tisch stand ein kleines Gefäß mit Räucherstäbchen, die einen scharfen Duft nach Weihrauch im Raum verbreiteten.
Der Mann trug einen beigen Turban. Das hagere Gesicht von einem, mit grauen Fäden durchzogenen, schwarzen Bart eingerahmt. Die Nase ein Blitz, in den Augen Donner. Ein Perser. Er schrieb auf einem, vor ihm aufgerollten Papyrus und schien Saul nicht zu bemerken. Der wartete geduldig. Die Höflichkeit gebot es. Nach einer Weile schaute der Perser auf und musterte den Wanderer.
„Wer bist du?“, fragte er.
„Saul von Tarsus.“
„Was sucht Saul von Tarsus soweit von seiner Heimat in dieser Wüste?“
„Ich bin auf dem Weg nach Petra. Ich komme aus Damaskus. Dort hatte ich mich einer Karawane angeschlossen.“
„Die einzige Karawane, die ich hier sehe, ist meine. Und ich bin mir sicher, in Damaskus niemanden mit dem Namen Saul von Tarsus mitgenommen zu haben.“
Saul nickte betrübt: „Ich wollte der Karawane auf einem Esel folgen. Eine dumme Idee, ich weiß. Man hatte mir gesagt, ein Esel sei genügsamer als ein Pferd und daher für die Wüste besser geeignet. Der Betrüger, welcher mir den Esel verkaufte, bemerkte wohl, dass ich nichts von der Wüste weiß.“
„Nun, jetzt weißt du mehr. Immerhin hast du es von Damaskus bis hierher geschafft. Aber sage mir eins, Fremder, warum sollte ich dir diese Geschichte glauben?“
„Weil sie wahr ist. Ich weiß, du und deine Leute da draußen glauben, ich bin ein Spion einer Räuberbande, welcher von diesem Turm aus Karawanen ausspioniert. Das klingt einleuchtend, die Wahrheit aber ist, ich selbst wurde vor einigen Tagen von Räubern bestohlen. Sie nahmen meinen Esel und … alles war mir lieb und teuer ist. Wenigstens hatten sie ein Herz und ließen mir etwas Brot und Wasser.“
„Seltsame Räuber.“
„In der Tat.“
„Was willst du in Petra?“
Saul sah den Perser mürrisch an. Dieser hatte sich wieder seinen Notizen zugewandt.
„Mir eine Arbeit suchen.“
Der Perser nickte. „Ein Neubeginn in einer fremden Stadt.“ Er lachte. „Welche Art von Arbeit schwebt dir denn vor? Berater für Wüstenreisen?“
„Zeltmacher. Diesen Beruf habe ich von meinem Vater gelernt.“
Der Perser sah Saul listig an. „Du bist Zeltmacher?“
„Ja, ein ziemlich guter“.
„Mein Junge, wenn dem so ist, dann bist du wirklich ein Glückspilz. Ich kenne nämlich einen Mann in Petra, der an deinen Fertigkeiten interessiert ist. Was hältst du davon? Ich bringe dich zu ihm.“
„Das tust du doch bestimmt nicht aus reiner Nächstenliebe?“
„Nächstenliebe? Noch nie gehört. Nein, ich bringe dich nach Petra, stelle dich diesem Mann vor und du reparierst inzwischen mein Zelt. Du hast ja gesehen, in welchem Zustand es ist. Eine Schande. Ich schäme mich dafür.“
Saul konnte nicht glauben, was er da hörte. Er jubilierte innerlich, ließ sich von außen jedoch nichts anmerken. Da öffnete sich doch plötzlich ein Weg für ihn.
„Was gibt es da zu überlegen?“, fragte der Perser.
„Nichts. Ich werde dein Zelt reparieren. Du wirst mehr als zufrieden sein.“
„Das ist ein Wort. Lass uns diesen Handel mit einem Handschlag und einem Schluck Shiraz besiegeln.“
Es wurde dann doch mehr als ein Schluck. Der Perser, welcher den klangvollen Namen Vahid Schams ad-Din trug, war froh, nach wochenlangen Zusammensein mit den rauen Gesellen seiner Karawane wieder ein Gespräch mit einem offensichtlich gebildeten Mann führen zu können. Einem Mann mit Geheimnissen. Als Perser liebte er Geheimnisse.
Am nächsten Tag ritt Saul, hoffend, im Alkoholrausch nicht zu viel von sich preisgegeben zu haben, mit müden Augen und schweren Gliedern auf einem Kamel Richtung Süden.
Auf die roten Berge zu. Denn, sie waren keine Fata Morgana, wie er noch in jüngster Vergangenheit befürchtet hatte.
3
Die Wüste ist ein Greifvogel, der zuschaut. Eine Karawane beladen mit Gewürzen aus Indien, Schmiedearbeiten aus Syrien, Perlen aus dem Roten Meer und vor allem Weihrauchharz aus Arabiens Süden. Grimmige Männer auf freundlich schauenden Kamelen. Ein stolzer Perser unter einem Sonnenschirm und ein nachdenklicher Mann mit Nadel und Faden. Die Wüste ist ein Greifvogel, der sich wundert.
Die roten Berge kamen immer näher. Hinter diesen Bergen lag die Wüste Negev, dann der Sinai und später das geheimnisvolle Ägypten. Die Welt war weit. Saul erschien sie zu weit. Er dachte an die Stunden, als das hier alles begann.
Er wollte sagen: Schlamassel. Doch er wagte es nicht. Alles fing an diesem langweiligen Sonntagnachmittag an, als er die Hohepriester überzeugte, die geflohenen Anhänger des Stephanus in Damaskus aufzuspüren, um sie hinter Schloss und Riegel zu bringen. Er zog die griechische Rüstung seines Vaters über, die dieser ihm zum Abschluss seines Studiums bei Rabban Gamaliel geschenkt hatte, legte ein Schwert an und brach mit Soldaten des Hohen Rates von Jerusalem in Richtung Damaskus auf. Nach einer mehrtägigen Reise, lag sie dann vor ihnen, die Perle des Morgenlandes, mit ihren glänzenden Kuppeln und den hoch aufragenden Tempeln. Saul hatte triumphierend seinem Pferd die Sporen gegeben, dann aber traf ihn aus dem Nichts ein gleißender Lichtstrahl. Sein erschrockenes Pferd richtete sich wiehernd auf und warf seinen Reiter in den Staub. Er versuchte sich aufzurichten, doch sein Körper schmerzte, er schmeckte Blut. Noch immer war da dieses Licht, heller als die Sonne. Er beschirmte mit der Hand die Augen, doch zwischen seinen Fingern sickerte das Licht weiß und scharf. Bald bot die vorgehaltene Hand keinen Schutz mehr, alles löste sich in einem gleißenden Licht auf. Dann sah er ihn. Er stieg vom Himmel. Er war in ein langes Gewand gekleidet und um die Brust hatte er eine goldenen Gürtel. Sein Haar und sein Bart waren so weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen wie eine Feuerflamme.
Seine Füße glichen dem Golderz, als wären sie im Schmelzofen glühend gemacht, und seine Stimme klang wie das Rauschen vieler Wasser. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete, wie wenn die Sonne in ihrer Kraft scheint. Saul hörte eine Stimme, doch der Mund des Wesens bewegte sich nicht. Die Stimme dröhnte fast unerträglich in seinem Kopf: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul stammelte: „Herr, wer bist du?“. Die Gestalt am Himmel verlor ihren Feuerblick, menschliche Augen schauten den in den Staub geworfenen an. Die Stimme, eben noch dunkel und grollend, wurde weich und freundlich: „Ich bin es, Jeschua, den du verfolgst. Doch Saul, das ist jetzt vorbei. Steh auf und suche in Damaskus das Haus des Judas in der Langen Straße. Frag nach einem Mann namens Hananias.“ Saul verstand nicht recht. Er wollte etwas sagen, doch das Licht verschwand, er sah sein Pferd, sah die Soldaten, die sich über ihn beugten. Plötzlich war ihm, als ob jemand ihm ein Tuch über die Augen legte. Er hörte nur noch Stimmen. Besorgt klingende Stimmen. Sie schienen sich allerdings von ihm zu entfernen. In diesem Moment traf es ihn mit der Wucht eines Hufschlages. Nein, es würde kein fernes, goldenes, duftendes Land sein. Das erwartete ihn nicht. Saul schrie, doch es war nur ein stiller Schrei, denn er verlor das Bewusstsein. Er berührte den Meeresboden in einsamer Dunkelheit.
Vahid Schams ad-Din lenkte sein Wüstenschiff an die Seite von Saul und sagte: „Bei Duschara, was bedrückt dich, mein Freund?“ Saul sah den Perser verdrossen an. Milde blickte dieser zurück.
„Hattest du jemals den Drang, den Ort, an dem du dich gerade befindest, so schnell wie möglich zu verlassen?“, fragte Saul.
Vahid lachte laut auf. „Das ist die Wüste, mein Junge, diesen Ort will man immer schnell verlassen.“
„Das meine ich nicht.“
„Ich weiß. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin Karawanenführer. Das, was du da eben gefragt hast, gehört sozusagen zu den Grundvoraussetzungen meines Berufes. Aber warum wolltest du denn Damaskus so schnell wie möglich verlassen? Schwierigkeiten?“
„Auch. Doch es waren mehr die Erwartungen. Ich wusste nicht, wie ich sie erfüllen kann.“
„Und jetzt bereust du es?“
„Kann ich nicht sagen.“
Vahid nickte verdrossen und sagte: „Weißt du, vor den Dingen wegzulaufen, die einen bedrücken, ist selten eine gute Idee. Und das sagt dir einer, der das praktisch schon sein ganzes Leben lang tut. Damit dir das aber nicht passiert, bringe ich dich nach Petra zu meinem Freund, dem Karawanenausrüster. Da bekommst du Gesellschaft und ein Ziel. Einen Beruf. Und, wer weiß, vielleicht findet sich eines Tages auch ein hübsches Mädchen. Das soll vorkommen. Besonders in deinem Alter. Weißt du, nichts ist grausamer für einen jungen Mann, der nicht gebraucht wird. Nirgendwo hingehört. Da kommt im Oberstübchen einiges durcheinander.
Daraus sind Kriege entstanden, mein Freund.“
„Das Komische an der ganzen Sache ist, ich hatte ein Ziel.
Ein großes sogar.“
„Oh, ein Ziel hatte ich auch einmal. Weißt du, was mein Ziel war? Nein? Ich verrate es dir. Mein Ziel war es, Bordellinhaber zu werden. Doch, aus einem mir unbekannten Grund, kam immer was dazwischen. Vielleicht gut so. Wer weiß. Und, was wolltest du sein? Ein Soldat? Du sprachst von einer Rüstung und einem Schwert.“
Saul dachte nach und sagte: „Ja, ich wollte ein Krieger sein …“. Dann schwieg er.
„Genau, verrate mir lieber nicht zu viel. Wahrscheinlich bist du einem König oder Kriegsfürst davongelaufen. Eines Tages finden sie heraus, dass ich dich kenne. Dann wird man mich foltern, um deinen Aufenthaltsort zu erfahren.“
Saul schüttelte den Kopf. „Du hast wirklich eine blühende Fantasie.“
„Ich bin Perser, mein Freund. Schon vergessen. Eine blühende Fantasie bekommen wir mit der Muttermilch.“
So plauderten die beiden noch ein wenig. Vahid erzählte von den Göttern und wie er zu ihnen betete. Er erzählte es auch, um Saul ein wenig zu beeindrucken, denn Vahid hatte das Gefühl, dass der Junge ein sehr frommer junger Mann sei. So erzählte er freimütig, dass er immer zu den Göttern bete, in deren Land er sich gerade befindet. In Griechenland betet er zu den griechischen Göttern, Zeus und Aphrodite zum Beispiel, in diesem Land, dem Land der Nabatäer, zu Duschara. Im Land der Juden betet er zu Jahwe, allerdings nicht so gern, denn dieser Gott war ihm unheimlich. Jahwe duldet keine anderen Götter neben sich. Das hieß, wenn er eine Woche zuvor zu Dionysos gebetet hatte, konnte es gefährlich sein, heute zu Jahwe zu beten. Denn der galt als äußerst rachsüchtig und verzieh kaum. Vahid betete trotzdem, denn bisher war immer alles gut gegangen. Wahrscheinlich nahm Jahwe sein Gebet gar nicht wahr, sind doch die Juden sein erwähltes Volk und jeder weiß, dass Jahwe schon genügend mit ihnen zu tun hat.
Vahid freute sich auf Petra. Und auf seinen Freund, den Karawanenausstatter. Und dessen Gesicht, wenn er ihm sagen würde, dass er einen Juden in der Wüste aufgesammelt hat, der auch noch Zeltmacher ist. Sein Freund hatte ihm schon mehrfach gesagt, dass er glücklich darüber wäre, wenn er einen halbwegs fähigen Zeltmacher bekäme, der fleißig, ehrlich und zuverlässig ist. Und, das fügte er jedes Mal hinzu, wenn der Zeltmacher Jude wäre, wäre das, das allergrößte.
Denn er selbst war Jude. Vahid fragte sich, ob Jahwe ihn jetzt beobachtete. Er wusste um die grausamen Geschichten, die in den Büchern der Juden über diesen Gott geschrieben standen. Es schadete also nicht, wenn er etwas tat, was Jahwe günstig stimmten könnte.
Saul hingegen freute sich nicht auf Petra. Er bereute jetzt, von Damaskus aus nach Arabien aufgebrochen zu sein.
Isaiah, der Prediger, hatte ihm davon abgeraten, ihn gebeten, nach Jerusalem zu gehen und dort mit den Aposteln zu sprechen. Nicht nur, dass diese sicherlich erleichtert wären zu hören, dass Saul die Verfolgung der Anhänger des Neuen Weges aufgegeben, und, dass er auch von Jeschua einen Auftrag bekommen hat. Doch Saul kamen Bedenken. Würden die Apostel ihm glauben? Sicherlich nicht unumwunden. Das wäre die eine Sache. Die andere, aber entscheidende: War er schon bereit für seine Aufgabe? Und die erschreckende Antwort darauf, nein, er war nicht bereit. Ganz und gar nicht. Er hatte es sogar bereut, sein Augenlicht zurückbekommen zu haben. Damals, in Damaskus, im Haus des Judas, auf einem weichen Bett, in einer stillen Ecke, die Welt um ihn dunkel, das war ihm angenehm. Denn solange er dort im Dunkeln hockte, Träumen und Erinnerungen nachhängend, hatte niemand Fragen gestellt. Sie haben ihn bedauert, ihn gefüttert, ihn gestreichelt. Doch das war mit der Rückkehr seines Augenlichtes vorbei. Das zurückkehrende Licht schmerzte, es war, als ob eine Lampe genau auf ihn gerichtet wurde. Noch unangenehmer aber war, dass er sich jetzt einigen Fragen stellen musste. Und das Schlimme daran war, er musste auch Antworten geben. Wo er gar keine hatte.
Das Kamel schaukelte und die roten Berge kamen näher und näher. Die Sonne warf ihr abendliches Licht, ließ die Berge leuchten. Saul dachte an die Tage seiner Kindheit. Da