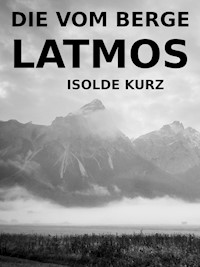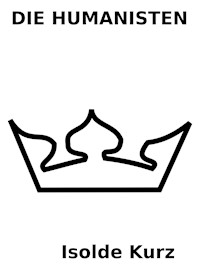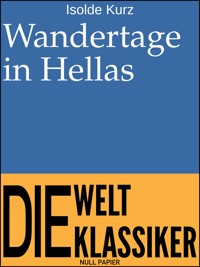
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Wandertage in Hellas
1913 München bei Georg Müller
Isolde Kurz
Wandertage in Hellas
1913 München bei Georg Müller
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-48-5
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Triest – Piraeus
Athen
Ägina und Salamis
Eleusis
Menidhi-Acharnä
Kap Sunion
Die Argolis
Korinth und der Isthmus
Delphi
Nach Olympia
Ein arkadischer Frühlingstag
Besuch in Theben
Chalkis
Letzte Tage in Athen
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Widmung
Mit deiner Milch, versprengte Griechin, sog ich den Traum von Griechenland, als Wiegenlieder umrauschten mich homerische Gesänge, und meine dämmernden Gedanken wandtest du Hellas zu. Nicht Bänder und Juwelen und was sonst Mutterlust den Töchtern schenkt, gabst du der deinen, doch das lautre Gold der Dichtung häuftest du auf sie und liessest bei Göttern und Heroen sie erblühn, die Glückliche, gabst Iphigenien ihr zur Spielgefährtin und Antigone. Des Lebens tiefre Schönheit lernt’ ich frühe von dir, die grossen schmerzgenährten Freuden, und dass kein Glück der Brust genügen kann, wenn es den Dämon nicht in uns beglückt. Lang war dein Tag und reich an Wundern. Jauchzend warfst du in Opferflammen dich und stiegst verjüngt hervor. Zu deiner Höhe drangen die kleinen Sorgen nicht, und für die grossen gab dir dein Platon Trost. Dein Kinderherz, das nie den hohen Ernst vom Lächeln trennte, blühte nur seliger zwischen Gräbern auf, denn die das Leben dir entfernte, gab der Tod dir ganz zurück. Dir war das Altern nur wie ein Kleiderwechsel; ewig jung lebtest du fort mit Genien und Heroen und wusstest nichts von Zeit. Das Siechtum kam und brach dich nicht, es sänftigte zum Frieden den allzuhohen Schwung der Seele nur. Und süsser reifte deines Lebens Frucht und höher strahlten deine Heldenaugen, und deine Liebe hielt dich fest im Licht. Für immer, dacht’ ich, müsste sie dich halten. Umsonst, die Stunde rann. Da, auf dem Estrich, erscholl ein unerbetener Schritt. Du hobst das Haupt: Bist du es, alter Thanatos? Wohlan, ich murre nicht, doch wär’ es schön, ein Weilchen zu verziehn. – Der stand und staunte, gerührt, dass ihn einmal, den Allverhassten, ein Strahl des Lächelns traf. Bescheiden trat er zurück und harrte noch im Vorgemach. Wie heilig war dir die geschenkte Stunde. Zu allem Lebenden sprachst du noch einmal: Ich liebe dich! – und hobest einmal noch zu allem Hohen, Herrlichen die Arme, mit Genien sprachst du noch und mit Heroen, und in die letzten Träume folgten dir des Sophokles Gestalten. Also festlich schiedst du hinweg, die Höhen glühten all von deinem Licht. – Als es verglommen war, fiel jäher Frost herab, die Welt vereiste. Auf deinen Hügel, Heilige, leg’ ich nun dies Buch von Hellas, dein ist jedes Wort und dir vertraut, du warst ja mit dabei! Als mich die jonischen Gewässer wiegten, als ich zum ersten Mal den Pallasberg erstieg und Salamis vor meinen Augen aufglänzt’ im Meere mit den Schwesterinseln, vernahm ich deine Stimme, denn du sangst und jubeltest in mir. Werd’ ich auch nie dein Auge strahlen sehn auf diesen Blättern, weil es zur Sonne heimgekehrt, doch fühl’ ich dein Lächeln ringsumher, wenn ich dir sage: Die schönen Mären, die dem Kinde du erzählt, sind alle, alle wahr! Ich sah den Isthmus, wo des jungen Theseus Hand den Räuber Sinis zwang, ich sah die Stelle, wo rastend sass die mütterlichste Göttin, ich sah den Weg, auf dem Antigone lebendig einging in des Hades Haus. So heimatinnig sah das heilige Land mich an, weil jeder Schritt mich dein gemahnte. Dort gab zum ersten Mal der Traumgott dich zurück, dort schmolz das Eis, von dem ich starrte, dort wärmte mich zuerst die Sonne wieder. In deinen Blumenhügel, wo dein Geist am liebsten weilt, bei der Tyrrhenerwelle, die, wenn sie anrauscht, von der jonischen erzählen kann, hab’ ich ein Reis gesenkt, das aufspross im Geröll der Pallasburg. Du nahmst und sandtest es nach Mondenfrist versechsfacht wieder, überschwenglich warst du ja stets im Geben, und in tauiger Frühe des schönsten Tags stand die Toskaner Magd am Beet und rief und sagte fromm: »Ein Wunder!« Ein Wunder wahrlich war’s, denn eine Blume war über Nacht erblüht, wie keine noch der Boden trug, die schönste Griechenblume, aus Sonnenschein gewoben, safranfarben wie Festgewänder der Athenerinnen, wenn sie, vom Reiterzug umbraust, der Göttin den heiligen Peplos brachten. Einen Tag nur stand sie inmitten ihrer irdischen Schwestern, die Fremdlingin, und schloss den Kelch für immer. Aus mütterlichen Reichen, wo du liebend am ewigen Wachstum schaffst, war sie gekommen als Botin, dass du nicht vom Lethebecher getrunken, dass auch bei den Unsichtbaren du liebend, wirkend dich im Sein erhältst.
*
Forte dei Marmi, Herbst 1912.
Triest – Piraeus
Kalt bläst der Wind aus dem Karstgebirge, zerfetzte graue Wolken ziehen über den Himmel, nur auf Schloss Miramar liegt Sonnenglanz, während wir durch den unruhigen Wellengang des Hafens von Triest ins offene Meer steuern.
Unser »Baron Beck« vom österreichischen Lloyd ist überfüllt mit Reisenden, die sich zum Orientalistenkongress nach Athen begeben. Da die Gelegenheit so einzig günstig ist, hat meine alte Schutzherrin Pallas Athene auch mich im Handumdrehen zur Orientalistin umgeschaffen und mich mit der Kongresskarte, vor der sich alle Riegel öffnen, auf dem »Baron Beck« eingeschifft. Zum Begleiter gab sie mir meinen alten Freund Ernestos, der mich in meiner Frühzeit die griechischen Dichter im Urtext lesen lehrte und mir schon damals den Traum von Griechenland träumen half. Als klassischer Philologe konnte er sich in aller Eile noch vor Abgang des Schiffes in den Besitz von so viel Neugriechisch setzen, als wir beide an Ort und Stelle brauchen werden.
Das Festland ist schon weit zurückgeblieben, aber meine alten Dolomiten leuchten mir noch in nie gesehenem Glanze, bis tief herab mit Schnee bedeckt. Gleich ungeheuren silbernen Riesenburgen stehen sie über der Küste und schauen uns noch stundenlang nach. Wie die letzte Abendsonne über ihnen versprüht, wird das Meer dunkelstahlblau mit weissen Schaumkronen. Links im Osten erscheint seltsam unwirklich der istrische Küstensaum mit dem dunklen Strich der niedrigen Bergwälder, hinter denen der Monte Maggiore aufragt, und dem Leuchtturm auf vorgeschobener Spitze; gegenüber in klarerer Zeichnung das gebirgige Ufer Italiens. Doch bevor die mit Ungeduld erwartete Küste von Dalmatien in Sicht kommt, versinkt alles in Dunkelheit.
Ein Blick in meine Kajüte hatte mir zeitig jede Hoffnung auf Nachtruhe benommen. Das Schiff war so voll, dass man unser viere in den engen Raum gepfercht hatte. Jetzt fand ich darin noch einen Turm von Hutschachteln allerneuesten Umfangs aufgebaut, jeden Zollbreit Fussboden mit Kleidungsstücken besät, und eine Luft, die nicht zu atmen war. Ich beschloss also, die Nacht auf Deck zu verbringen, und Freund Ernestos, in dessen Kajüte die Dinge nicht viel besser standen, leistete mir Gesellschaft. Um Mitternacht wurde der Wind so stark, die Feuchtigkeit so durchdringend, dass wir uns die Lehnstühle nach dem leeren unteren Schiffsraum, der als dritte Klasse benutzt wird, bringen liessen. Dort lagen nur wenige vermummte Gestalten, die ich zuerst für Säcke hielt, in der Ecke auf Pritschen umher. Doch nach einer Stunde war auch dort der feuchtkalte Zugwind unerträglich geworden, und es blieb uns nichts übrig, als uns in unser Geschick und in unsere Kabinen zu fügen. Ich hatte noch einen Schwerttanz zwischen den aufgerichteten grossen Stahlspiessen der am Boden liegenden Hüte aufzuführen, ehe ich auf der Leiter mein Bett erklomm.
Durch überlautes Geschäker in triestinischem Italienisch vor der Zeit geweckt, bot sich mir der unerfreulichste Anblick: zwei Damen waren von der Seekrankheit stumm und regungslos niedergestreckt; die dritte Lärmende, die zu einer der Stillen sprach, hatte sich des gemeinsamen Waschgeräts und aller übrigen Gebrauchsgegenstände in einer Weise bemächtigt, die es unmöglich und auch nicht mehr wünschenswert machte, sich derselben gleichfalls zu bedienen. Meine höfliche Bitte um etwas Platz hatte eine unhöfliche Antwort und vermehrte Ausbreitung ihrerseits zur Folge. Keine Rettung, als den Ort zu räumen und mich ins Badekabinett zu flüchten, wohin mir bald eine Dame aus Berlin nachkam, die gleichfalls vor ihren Zellengenossinnen floh. Welche Aussicht auf die drei weiteren Nächte, die noch an Bord zu verbringen waren!
Der ganze Tag vergeht uns auf hoher See. Man sieht nichts als die schwarzblaue, geheimnisvolle Flut, die um das Schiff her durch den vorquellenden Schaum weisslich geädert erscheint, ein seltsamer Anblick, wie wenn farbiger Marmor flüssig geworden wäre. Um 11 Uhr nachts wird in Brindisi angelegt: viele Lichter am Quai, italienischer Hafenlärm, durchtönt vom Gesang deutscher Matrosen, dann wird eine Treppe niedergelassen, und zu unserem Schrecken ergiesst sich noch ein ganzer Strom von Orientalisten in unser Schiff, die alle bis Patras mitfahren wollen, aber keine Kabinenplätze bekommen können. Esszimmer und Rauchsalon werden zu Schlafsälen für die Herren verwandelt; wo die Damen unterkommen, bleibt ein Rätsel. Ich quartiere mich im Badekabinett ein, wo mir der Stewart auf meine Bitte ein Brett mit Kissen über die Wanne legen lässt, weil ich unter keinen Umständen mehr mit der triestinischen Huldin in einem Raume schlafen will.
Das Gute hat ein solches Lager, dass man am Morgen nicht verschläft. Ich bin in der Frühe unter den ersten auf Deck und staune die Berge von Albanien an, die sich in herrlichen Formen zu unserer Linken erheben, lichter, zarter als irgend etwas je im Süden Gesehenes, wie aus zartgrauem Duft gewoben. In Santi Quaranta wird angelegt. Hier ist schon der Orient. Eine Menge Albanier in der bekannten malerischen Tracht kommen an Bord, ein gebundenes Lämmchen mit sich führend, das sie, wie ich fürchte, unterwegs zu verzehren gedenken, denn Ostern ist vor der Tür. Diese ganze bunte Welt wird unten in der dritten Klasse verstaut und verschwindet zunächst unseren Blicken.
Am Mittag erreichen wir die schöne Bucht von Korfu, die der stolze Pantokrator überragt. Bevor wir einfahren, erleben wir eine sonderbare Überraschung. Aus der Tiefe des Schiffes tauchen erst einzeln, dann in immer wachsender Anzahl korfiotische Bootsleute und Träger auf, die uns geräuschvoll in italienischer Sprache ihre Dienste für die Landung anbieten. Es ist, als hätte das Meer sie auf unser Schiff gespien, denn wir sind noch weit vom Land, und man begreift nicht, wo sie herkommen. Als wir uns der Einfahrt nähern, hat ihr Ansturm etwas Betäubendes und so Gewalttätiges, dass man meinen könnte, wir seien von Piraten gekapert. Erst später in Griechenland, wo der gleiche Vorfall sich vor jeder Landung wiederholte, erfuhr ich, wie es die Leute mit Hilfe der Matrosen fertig bringen, sich an einem ausgehängten Seil schon auf hoher See in den fahrenden Dampfer einzuschwärzen.
Beim Ausbooten in Korfu wird das Drängen und Schreien dieser Wilden nur immer ärger; man muss achtgeben, dass man nicht von der Schiffstreppe ins Meer gestossen wird. Wir lassen uns zu Wagen, denn die Zeit ist knapp, in die schöne Phäakeninsel hineinführen. Die Fahrt geht zwischen üppigen Olivenhainen durch, doch scheint mir der vielbewunderte Ölbaum von Korfu nicht mächtiger als der im Lucchesischen. Grüne Wiesen und Weideplätze, von Agaven umsäumt, wechseln mit dürrem Ackergelände, dessen lockere, gelbliche Scholle aussieht, als wolle sie sich in Staub auflösen. An den Rainen blüht viel stark riechender Asphodelos, der aber bei weitem nicht die Höhe des römischen erreicht. Zuerst wird beim Achilleion haltgemacht, das wir nicht betreten können, weil die Kaiserflagge darüber weht. Darauf lässt man uns noch die Aussicht von Gasturi bewundern, und dann geht es im Trab nach der Spitze einer Landzunge, die von einem dort aufgestellten alten Geschütz Canone heisst. Von hier aus zeigt man die Bucht, wo der Stromgott den vom Schwimmen erschöpften Odysseus freundlich ans Gestade rettete, und wo dann die königliche Jungfrau Nausikaa sich des Verstürmten erbarmte. Das reizende, ganz mit Zypressen bewachsene Felseninselchen Pontikonisi (Mäuseinsel), das zwischen dem offenen Meere und einer tiefen Einbuchtung gerade Canone gegenüber liegt, galt von alters her für das Phäakenschiff, das der Meergott zur Strafe für die Rettung des Odysseus auf der Heimkehr im Angesicht aller Phäaken versteinerte. Deutsche wollen darin auch Böcklins »Toteninsel« erkennen, die so viele Vorbilder in der Natur hat und doch ganz aus der Fantasie des Künstlers entsprungen ist. Eine hesperische Scholle, dieses Korfu oder Kerkyra, wie es jetzt wieder heisst, das mich wie ein abgesprengtes, verklärtes Stück Italien anmutet. Noch sehe ich nichts, das meiner erhabeneren Vorstellung von griechischer Landschaft entspräche.
Bei einem kleinen Ausgrabungsfeld neben einer Kirche wird noch einmal haltgemacht, und wir besichtigen auch den neuen Fund, den sie schon ins Museum verbracht haben: einen grotesken archaischen Gorgonenfries, der die griechische Kunst einmal von der Seite wilder Fantastik zeigt.
Mehr will die knappe Frist uns nicht gewähren. Der »Baron Beck« hat schon das erste Zeichen gegeben, und braune Phäakensöhne, die ihren ›ruderberühmten‹ Vorfahren Ehre machen, führen uns durch hohen Wogengang flink und sicher zu unserem Schiff zurück.
Langsam geht die Fahrt auf der schmalen Wasserstrasse zwischen der langgezogenen korfiotischen Küste, die im Vorüberfahren immer neue Gestalten annimmt, und den schönen Bergen von Epiros hin. Bis wir das offene Meer erreichen, sinkt schon der Abend.
Inzwischen ist es unten, wo die Albanier verstaut sind, lebendig und laut geworden. Solange es hell war, hockten sie schweigend am Boden und spielten Karten oder schliefen. Jetzt sind sie mit einemmal auf den Beinen und geben sich dem Genusse des Tanzes hin. Zuerst dreht sich nur ein Soldat zum rhythmischen Händeklatschen der anderen, bald aber tanzt ein ganzer Reigen junger Männer Hand in Hand, in langsamen Bewegungen, hinter denen man doch eine verhaltene Leidenschaft fühlt, zu halblautem Gesange. Alle anderen, Männer und Frauen, umstehen sie in gespannter Aufmerksamkeit, und wir Passagiere sehen unter der offenen Tür gleichfalls zu, bis uns der Brodem vertreibt, den diese zusammengekeilte, knoblauchduftende Menschheit ausströmt. Unterdessen sind die Sterne aufgegangen. Die Inseln Paxos und Antipaxos sind das letzte, was sich deutlich erkennen lässt.
Als Paxos in Sicht kam, sagte eine Stimme auf unserem Schiff: »Der grosse Pan ist tot!« und weckte in unseren Herzen das Echo der rätselhaften Klage, die einst über dieses Wasser erscholl. In den Tagen des Tiberius, wo das alternde Hellenentum in sich selbst erseufzte wie ein morscher Baum, der den ersten Axthieb spürt, da geschah es, dass ein griechisches Handelsschiff mit vielen Reisenden, das nach Italien wollte, plötzlich durch eine Windstille in der Nähe dieser Inseln festgehalten wurde. Es war Abend wie heute, aber die meisten waren noch wach und tranken, als man plötzlich von Paxos her eine Stimme vernahm, die den Steuermann, einen Ägypter mit Namen Thamûs, anrief. Darüber verwunderten sich alle, und Thamûs, dem die Sache nicht geheuer war, gab erst auf den dritten Anruf Antwort, worauf es mit angestrengter Stimme herüberrief: »Wenn du Palodos vorüberkommst, so melde, dass der grosse Pan gestorben ist.« – Die an Bord befiel ein Schauder, und alle ratschlagten, ob das Gebot auszuführen sei oder nicht. Der Steuermann aber entschied, wenn der Wind günstig sei, so wolle er still an dem Ort vorüberfahren, trete aber eine Windstille ein, so wolle er tun, wie ihm geheissen sei. Als sie zur Stelle kamen, flaute der Wind von neuem ab, und alle Segel hingen schlaff, da rief der Steuermann Thamûs vom Hintersteven nach dem Lande: »Der grosse Pan ist gestorben!« Alsbald erhob sich ein gewaltiges Jammern und Stöhnen, mit Lauten des Erstaunens untermischt, nicht wie von einem einzelnen, sondern wie von einer ganzen Volksmenge. Der Vorfall, der durch die vielen Zeugen in Rom bald ruchbar wurde, verbreitete eine allgemeine Bestürzung, und selbst in das verschlossene Gemüt des sphinxenhaften Tiberius schlich das Grauen, dass er seine Philosophen zusammenrief, um mit ihnen über die Sache zu grübeln; denn was kann es für den Menschen Unheimlicheres geben, als wenn er seine Götter sterben sieht!
Mein Herz aber gab Antwort jener Stimme auf unserem Schiff und sagte:
»Der grosse Pan ist nicht tot, der grosse Pan kann niemals sterben. Habe ich ihn nicht selber so manchen Sommertag am glühenden Strande des Mittelmeers im Schilficht sitzen sehen und zugehört, wie er auf seiner Hirtenpfeife den Reigen des grossen Stirb und Werde spielt? Der grosse Pan lebt, nur dass er nicht mehr in bocksfüssigem Unverstand einhertollt mit Nymphen und Hirten. Schön und schreckhaft thront er, wie ihn Signorelli gemalt hat, den Sternenmantel um die Brust geschlagen, oben Gott und unten Tier. Die Jugend bringt ihm ihre Sehnsucht, und das Alter bringt ihm seine Leiden, alle Erinnerungen wollen zu ihm, und alle Träume suchen ihn, er aber lächelt sein unnennbares Lächeln und erwidert auf alles: Ich weiss es. Seine Augen blicken schmerzvoll, und eine tragische Glorie strahlt um sein Haupt, weil der Unvergängliche nur Vergänglichen das Leben gibt.« –
Mond und Sterne auf dem Jonischen Meer. Unsere Geschwindigkeit ist jetzt so gross, dass das Wasser reissender als der reissendste Strom an uns vorüberschiesst. Seine grossen Wogen sind schwarzblau, von weissem Schaum übergossen. Man könnte schwören, dass sie es sind, die so wild hinrasen, nicht wir, sie fordern unwiderstehlich zum Wettlauf auf, und man kommt taumelnd am Ende des Schiffes an, indes die eben durchgeschlüpfte Welle schon weit entfernt ist; wie der Augenblick dahinterbleibt mit dem, was eben noch unser war, während wir unaufhaltsam vorwärts ins Dunkle rasen.
Mehr eine Ahnung als ein Gesichtsbild taucht zu unserer Linken die Insel Leukas auf mit dem geisterhaften Felsen, in dessen Nähe Homer den Eingang zum Hades kannte. Umschwirren ihn wohl soeben die Seelen der Freier, die Hermes mit erhobenem Stab zu den Asphodeloswiesen der Unterwelt führt? Oder wälzt die unter ihm brandende Welle die Leiche der Sappho mit sich, die hier von ihrem Liebesgram die Heilung fand? Wir brauchen es ja heute nicht zu wissen, dass auch der Todessprung der Lesbierin vom leukadischen Felsen in das Reich der Fabel gehört.
Die Erscheinung ist vorüber. Jetzt ist nichts mehr vorhanden als der hundertäugige Sternenhimmel und die nachtschwarze Woge, die unter uns hinrauscht.
Auch auf unserem Schiff ist schon alles zur Ruhe. Nur aus den Maschinenräumen dringt Licht, und oben flattre ich noch allein als nächtlicher Schemen auf dem Verdeck in Dunkelheit und wachsender Kälte. Vielleicht dass ich heute doch in der Kajüte schlafen kann, denn unsere Zahl hat sich vermindert. Ich öffne leise die Tür. Aber die Luft, die mir da entgegenschlägt, treibt mich alsbald wieder hinaus und in das Badekabinett. Ich besteige meine Pritsche auf der Wanne und denke an den göttlichen Dulder, der vor mir diese Wasser befahren hat und der manchesmal noch viel schlechter gebettet war.
Die aufgehende Sonne findet uns im Hafen von Patras, der von Dampfern und Seglern aller Nationen bedeckt ist. In der kühlen Morgenbeleuchtung erscheint das Meer grün mit weissen Kämmen. Drüben am ätolischen Ufer erhebt sich der schönste Berg, den ich jemals gesehen habe; seine Formen sind so kühn und edel, dass er das Auge nicht loslässt. Er heisst Warássowa, aber im Altertum trug er den Namen Chalkis, der ihm besser stand. Neben ihm ragt ein zweiter, beinahe ebenso schöner, der Klókowa.
Bis ich auf Deck steige, sind unsere Reisebekannten schon alle verschwunden und mit ihnen die Mehrzahl der Passagiere, die sämtlich auf dem Landweg nach Athen wollen. Vor uns liegt jetzt der schönste Teil der Fahrt, die Umschiffung des Peloponnes, die wegen der Winde am berüchtigten Kap Matapan oder Tänaron von minder seefesten Reisenden lieber vermieden wird. Dies der Grund, warum wir nur noch wenige Köpfe an Bord sind – wenigstens scheint es so, da alle Kajüten der ersten und zweiten Klasse leer stehen. Aber was ist das für eine neue Gesellschaft, die mit einem Male die leeren Plätze auf Deck besetzt? Der Orient, den wir ganz vergessen hatten, ist aus dem Bauche des Schiffes ans Tageslicht gedrungen und macht sich breit, wo eben noch europäische Kultur geherrscht hat. Schlanke, kräftige Männer und schönäugige Frauen, in buntgestreifte Decken gehüllt, liegen auf allen Lehnstühlen und am Boden umher, ein Anblick voll Reiz, den man jedoch lieber aus der Entfernung bewundern möchte. Hätte ich nicht gesehen, mit welchen Strömen von Meerwasser die Schiffsjungen jeden Abend die Planken des Verdecks überfluten, so müsste ich mich fragen, wie der »Baron Beck« jemals wieder europäische Gesellschaft beherbergen soll. Es sind auswandernde Albanier mit ihren Familien, die in Konstantinopel Arbeit suchen. Möge ihnen das Schicksal günstig sein. Mit welcher Genügsamkeit sie leben, haben wir schon gestern durch die grosse Luke des Verdecks beobachten können. Nur muss ich leider feststellen, dass das Lämmchen unterdessen verschwunden ist.
Mein Reisegefährte hat sich mit erhöhtem Eifer in Grammatik und Wörterbuch versenkt, seit in Kerkyra die ersten griechischen Laute sein Ohr erreichten. Ich suche mir den albanesenfreiesten Winkel im Schiff und bin für diesen ganzen Tag nur noch Auge.
Alles ist strahlend und tiefernst zugleich. Selbst das Meer ist noch schöner geworden, seitdem es sich das jonische nennt; die Wellenkronen heben sich in noch vollendeterer Form wie in dunklen Stahl getrieben, eine flüssige, immer wechselnde Metallplastik. Jonische Inseln, Vorhallen des Tempels Hellas. Durchsichtig und blassschimmernd wie Opale liegen sie da in ihrer Morgenschönheit, so fein von Form und so zart von Farbe, wie das gepriesene Schönheitsland Italien nichts Gleiches hat.
Für einen kurzen Augenblick ist Ithaka aufgetaucht; jetzt gleiten wir an Kephallenia hin und staunen lange das stilvoll kühne Bergprofil seiner südöstlichen Spitze an, das sich von beiden Seiten in gleichgeschwungenen Bogen nach dem Meere senkt und in der Mitte in einer breiten, turmartigen Erhöhung gipfelt. Dann erscheint Zante oder Zakynthos, bei Homer die »wälderreiche«, von hier aus fast kahl mit schroffer Gebirgskette und steilen Vorhügeln, und ihr gegenüber am elischen Ufer das Kap Chelonatas. Und nun für lange Zeit nichts mehr als Wasser und Himmel, bis die messenische Küste ins Meer heraustritt, vom Ägaleon gekrönt. Es geht der Insel Sphakteria und der Bucht von Navarin oder Pylos entgegen. Welch eine Gruppierung von mächtigen Inselmassen mit ausgewaschenen Steilküsten, die Höhlen und Felsentore bilden, von flachgewölbten grünen Inselchen, von breiten und schmalen Wasserstrassen, von fantastisch gezackten, korallenähnlichen Klippen im Meer, um die ringsher eine weiss aufblitzende Brandung wogt. In diesem Gewässer wurde 1827 die Freiheit Neu-Griechenlands geboren; vielleicht fahren wir eben jetzt über Trümmer der zerstörten Türkenflotte hin. Am Festland ragt auf steiler Höhe ein altes Venetianerkastell mit derbem Mauerwerk und Zinnen. Navarin hiess der Ort noch im vorigen Jahrhundert, aber heute wieder mit seinem alten Namen Pylos. Dort hat man von alters her den Wohnsitz des greisen Nestor gesucht, doch von dem sandigen Gestade, das man nach Homer erwarten muss, ist wenigstens von hier aus nichts zu sehen. Schon halb im Dämmerungsschleier tauchen neue Berggestalten auf, die sich nicht mehr erkennen lassen. Das Dunkel sinkt, und das Meer wird öde. Aber oben sieht mit tausend Augen der Himmel von Hellas nieder.
Hast du es denn deinem Schicksal wirklich zugetraut, kleingläubiges Herz, dass es dir vergönnen würde, im Piraeus zu landen? Sahst du es nicht bis zum Augenblick der Abfahrt lauern, wie es dir schnell noch den Plan vereitle? Und als du auf hoher See schwammst, warst du nicht darauf gefasst, dass es sich noch als Schiffbruch neidisch zwischen dich und dein Ziel stelle? Siehe, kleingläubiges Herz, nun bist du schon in den griechischen Gewässern, und nur eine Nacht trennt dich noch vom Anblick Athens. Wenn dich jetzt noch etwas kränkt, so ist es nur der Gedanke, dass du zwischen Kap Malea und der Kythereinsel durchfahren wirst, ohne sie zu sehen, von den myrtoischen Wellen in Schlummer gewiegt.
Aber wohl tut es doch, jetzt endlich in der vierten Nacht wieder einmal auf einem menschlichen Lager zu ruhen und im Alleinbesitz der Kajüte zu sein.
Zwar die Albanier, die immer ungebundener unser Schiff durchschwärmten, und deren Neugier so gross war, dass sie sogar, während wir speisten, die Köpfe durch die Fenster des Esssals streckten, schufen mir einiges Bedenken, denn es widerstrebte mir, die Kajütentür zu verriegeln. Aber ich schob meinen Schiffskoffer vor den offenen Ausgang, befahl meine Habe Gott und entschlummerte friedlich.
Athen
Im Angesicht der attischen Berge bin ich erwacht. Dieses noch blauere Wasser ist der Saronische Golf mit Kap Sunion und den Inseln Ägina und Salamis; wir dampfen schon dem Piraeus entgegen. Unsere Augen suchen und finden die Akropolis. Jetzt werde ich niemals mehr das Schicksal neidisch nennen.
Was ist das für ein längliches, schroffes, völlig nacktes Inselchen, das sich ganz nahe zu unserer Linken wie eine Schranke vorlegt und auf seinem vordersten, nach Athen gewandten Ende den Leuchtturm trägt? Eine innere Stimme nennt mir augenblicklich den Namen, aber mein Mund wagt ihn nicht auszusprechen, so überwältigend ist die Gewissheit dieser Nähe. Nur halblaut treten mir die Worte des Äschylos auf die Lippen:
Ein kleines Eiland liegt vor Salamis, Zur Landung schwierig, wo auf steilem Strand Der reigenfrohe Pan zu wandeln liebt.
Hier an dem Felsen der kleinen Psyttaleia brach sich die ungeheure Macht des Perserkönigs, und aus den salaminischen Gewässern, die dahinter wogen, stieg ein neues und schöneres Hellas herauf.
Vor der Einfahrt in den Piraeus wiederholt sich der Überfall von Korfu: die Träger und Bootsleute kommen in Masse an Bord, bevor das Schiff anlegt. Gedränge, Geschrei, aber diesmal in griechischer Sprache, Boote, die um uns her wimmeln wie hungrige Haie. Wie werden wir uns jetzt durchschlagen? Da tönt schon aus einem Boot mein Name herauf, und ein Kommissär schwingt mir ein Brieflein entgegen, indem er mir auf französisch zuruft, zu warten, bis er an Bord komme und uns hole. Ein gutes Zeichen zum Einstand, das uns gleich das Gefühl des Fremdseins nimmt. Aus dem Brieflein erfahre ich, dass hilfreiche Hände unseren Weg geebnet haben und dass für unser Unterkommen in der überfüllten Stadt auf das beste gesorgt ist. Wir werden mit unseren Koffern ausgebootet, im Eilschritt durch das Zollamt geführt, in einen zweispännigen Wagen gesetzt und rollen auf der Piraeusstrasse nach Athen hinein.
Scharfer Wind, der uns entgegenweht, unendlicher Staub auf schattenloser Strasse, dürftiger Baumwuchs, harte magere Ackerscholle, deren gelbgraue Farbe sich an Häusern und Gemäuer wiederholt, das ist der erste Eindruck vom attischen Boden. Aber von oben sieht tröstlich die Akropolis herunter. Der kleine Fluss, den wir eben überschritten haben, kann kein anderer als der Kephissos sein. Dort glänzt schon eine Grabstele zwischen den Bäumen durch, und ich erkenne im Vorüberfahren den herrlichen Stier vom Dipylon. Sonst ist alles noch so verwirrend. Die fremde Sprache, an deren lebendigen Laut das Ohr noch nicht gewöhnt ist, wogt um uns her wie ein unschiffbares Meer. Nicht einmal die Aufschriften an Strassen und Läden lassen sich mit einem Blicke lesen, sie wollen entziffert sein. So erreichen wir das Hotel auf dem Omóniaplatz, wo für uns die Zimmer bestellt sind, und unsere erste Sorge ist jetzt, die Uhren vorzurücken, die gegen die griechische Zeit um fünfunddreissig Minuten nachgehen.
Der Mégas Aléxandros oder Alexandre le Grand ist ein gutgeführter Gasthof zweiten Ranges, der sich über die Dauer des Kongresses mit den Preisen des ersten schmückt. Die Verständigung macht keine Schwierigkeit, denn der Portier, ein Grieche mit seltsam unveränderlichem Lächeln, wie das der Krieger vom Äginetengiebel, spricht vollkommen deutsch, und der Zimmerkellner, der uns als zweiter in Empfang nimmt, kann einige Brocken französisch, wogegen der Ephebe, der die Stelle des Stubenmädchens vertritt, nur griechisch versteht. Hier ist Rhodus, hier heisst es tanzen. So oft ich etwas brauche, muss ich mir zuvor bei Freund Ernestos, der selber auf dem glatten Boden des Neugriechischen die ersten Gehversuche macht, die nötigen Wörter holen, ehe ich zu klingeln wage. Dann hört der Jüngling mich mit tiefer Hochachtung an, und wenn ihn die Lachlust überwältigt, so entschlüpft er wie ein Wiesel. Wie soll man sich auch gleich zurechtfinden in einem Lande, wo nicht einmal die Post mehr »Post«, sondern tachydromeíon heisst? Dafür ist die Anrede Kyría, die mich überall empfängt, wie ein schönes neues Kleid, in dem die Trägerin sich selbst als eine neue Person erscheint. Noch wundersamer mutet es mich an, dass mein Reisegefährte der Kyrios ist, ein Wort, das ich sonst nur in Bezug auf das höchste Wesen kannte.
Von meinem Zimmer geht der Blick über eine gerade Strassenflucht hinweg unmittelbar auf die Akropolis mit Parthenon und Erechtheion. Unter dem Fenster aber senkt sich’s schwarz in eine mit kleinen Eisenbahnwagen ausgefüllte Tiefe; das ist der Piraeusbahnhof, zu dem man auf vielen Stufen von der Athenastrasse hinabsteigt.
Sobald die langwierige Mittagstafel aufgehoben ist, wandern wir durch das im Festschmuck prangende Neu-Athen dem Pallasberg entgegen. Zu verfehlen ist er nicht; in gerader Linie führt die Athenastrasse auf ihn zu. Bald tut ein Platz mit byzantinischer Kirche sich auf, und gleich danach finden wir uns vor den Säulen der Stoa des Hadrian. Stünden sie irgendwo auf italienischem Boden, so würden wir gewiss nicht vorübereilen; aber jetzt zieht es uns unaufhaltsam weiter. Der Weg hebt sich schon, da wird unsere Eile durch einen sonderbaren Lärm unterbrochen. Aus niedrigen, doppelt vergitterten Fenstern werden lange Holzlöffel vorgestreckt, und Stimmen tönen aus der Tiefe: grazia, Madama, grazia!