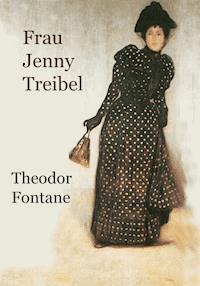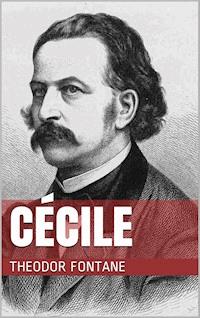Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Band der "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" steht das Oderland im Fokus. Theodor Fontanes malerische Beschreibungen der Landschaft rund um den Oderbruch wechseln sich ab mit spannenden Geschichten über die umliegenden Orte und die dort ansässigen Familien. Die märkische Schweiz und ihre Sehenswürdigkeiten, so etwa das Städtchen Buckow, erwachen durch Fontanes einzigartigen Erzählstil zum Leben – von der ersten Seite an. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Fontane
Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Das Oderland
Saga
Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Das Oderland
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1863, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997453
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Vorwort zur dritten Auflage
Die neue (dritte) Auflage von »Oderland« hat mir erwünschte Gelegenheit geboten, auch diesem Bande, wie Band I, eine seinem Titel in größerer Genauigkeit entsprechende Gestalt zu geben. Es wurden alle Kapitel – bis auf eines: »Schloß Kossenblatt« Schloß Kossenblatt, wiewohl örtlich einem andern Landesteile (Beeskow-Storkow) zugehörig, mußte hier inhaltlich, um der Biographie des Feldmarschalls von Barfus einen Abschluß zu geben, mit aufgenommen werden. –, die sich aus benachbarten Landesteilen hier eingedrängt hatten, ausgeschieden und durch andre, die dem Oderlande beziehungsweise dem Lande Barnim-Lebus ihrem Stoffe nach angehören, ersetzt. Es sind dies namentlich die Kapitel: »Gusow«, »Küstrin«, »Prenden«.
Und auch diesmal wieder hat diese strenger durchgeführte lokale Begrenzung einige Vorteile mit sich gebracht oder wenigstens nicht ausgeschlossen, und wie Band I es mir gestattete, die Tage des großen Königs in einer gewissen, wenn auch selbstverständlich, der ganzen Anlage des Werkes nach, vielfach eingeschränkten und lückenhaften Ausführlichkeit zu schildern, so hat Band II es mir ermöglicht, die Tage des Großen Kurfürsten in einer ähnlich bedingten Vollständigkeit zu geben. In »Prenden«, »Friedersdorf«, »Gusow«, »Tamsel«, »Möglin« und »Prädikow« steckten, lokaliter eingekapselt, die Lebensgeschichten der Sparrs, Görtzkes, Derfflingers, Schönings und Barfus', und in diesen Lebensgeschichten wiederum lebte die Geschichte der ganzen Zeit.
Auch in Zukunft werd ich ähnliche Zusammenfassungen, die Darstellung ganzer Epochen innerhalb eines engen Rahmens, als wünschenswertes Ziel im Auge behalten.
Für heute beschränk ich mich auf den Wunsch, diesem zweiten Bande der »Wanderungen« auch in seiner neuen Gestalt die Zustimmung alter Freunde gewahrt zu sehen.
Berlin, 18. Oktober 1879
Th. F.
Das Oderbruch und seine Umgebungen Von Frankfurt bis Schwedt
Saßen all auf dem Verdecke,
Glocken klangen, alte Zeit,
Und der Himmel wurde blauer,
Und die Seele wurde weit.
Zwischen Frankfurt und Stettin ist während der Sommermonate ein ziemlich reger Dampfschiffverkehr. Schleppschiffe und Passagierboote gehen auf und ab, und die Rauchsäulen der Schlote ziehen ihren Schattenstrich über die Segel der Oderkähne hin, die oft in ganzen Geschwadern diese Fahrt machen.
Von besonderer Wichtigkeit sind die Schleppdampfer. Handelt es sich darum, eine wertvolle Ladung in kürzester Frist stromauf zu schaffen, so wird ein Schleppschiff als Vorspann genommen, und in vierundzwanzig Stunden ist erreicht, was sonst vielleicht vierzehn Tage gedauert hätte. Ihre eigentlichen Triumphe aber feiern diese Schleppschiffe, wenn sie, wie von ohngefähr, plötzlich inmitten einer kritisch gewordenen Situation erscheinen und durch ihre bloße Erscheinung die Herzen der geängstigten Schiffer wieder mit Hoffnung erfüllen. Sie sind dann, was der Führer für den Verirrten, was der Zuzug für die Geschlagenen ist, und beherrschen natürlich die Situation. Diese Situation ist fast immer dieselbe: entweder hat der Rettung erwartende Kahn sich festgefahren und müht umsonst sich ab, wieder flott zu werden, oder aber, er ist in ein mit Flößen verfahrenes Défilé geraten, so daß jeden Augenblick ein Zusammenstoß zu gewärtigen steht. Im ersteren Falle handelt es sich um Kraft, im anderen Falle um Geschick und Schnelligkeit, um das Bedenkliche der Lage zu überwinden, und der Schleppdampfer ist in der glücklichen Verfassung, beides, je nach Bedürfnis, bieten zu können. Aber freilich – gegen Zahlung. Nun beginnen die tragikomischsten Unterhaltungen, die man sich denken kann. Sie werden vom Kajütendach des Oderkahns einerseits, andererseits vom Radkasten des Dampfers aus geführt. Der geängstigte Schiffer hebt zunächst einfach seine Hand in die Höh, alle fünf Finger deutungsreich ausspreizend. Der Mann auf dem Radkasten schlägt eine verächtliche Lache auf und donnert seinen Befehl zu größerer Eile in den Maschinenraum hinunter, bis das bittende »Hallo« des Schiffers ihn wieder zu einem »stop« bestimmt. Der Schiffer hebt jetzt seine Hand mit den gespreizten Fingern zweimal in die Luft. Dasselbe Lachen als Antwort. So geht es weiter, bis der Kahnführer, der, namentlich wenn er zwischen Holzflößen steckt, seinen Ruin vor Augen sieht, die Summe bewilligt, die der Kapitän des Dampfers zu fordern für gut befindet. Diese Forderungen wechseln, da der letztere, mit scharfem Auge, je nach dem Grad der Gefahr, auch die Taxe bestimmt. Es kommt vor, daß der geängstigte Schiffer seine fünf Finger zehnmal erheben, das heißt also, seine Befreiung aus dem verfahrenen Défilé mit fünfzig Talern preußisch bezahlen muß.
Die Schleppdampfer, wie hieraus genugsam erhellen wird, spielen also auf der Oderstrecke, die sie befahren, die Doppelrolle des Retters und des Tyrannen, und im Einklang mit dieser Doppelrolle ist auch die Empfindung, mit der sie seitens der Schiffer betrachtet werden. Man liebt sie oder haßt sie. Alles, je nachdem die Gefahr im Anzuge oder glücklich überwunden ist. Die am Horizont heraufdämmernde oder wieder verschwindende Dampfsäule wird erst als Hoffnungsbanner begrüßt, dann als abziehende Piratenflagge verwünscht. Dazwischen liegt die Rettung. Nichts ist kürzer als Dank. Die Kapitäne wissen das; aber als praktische Männer kennen sie keine Empfindelei und halten sich schadlos beim nächsten Fall. Sie haben zudem die ruhige Überlegenheit der herrschenden Kaste.
Die Schiffer blicken, wie wir gesehen haben, mit geteilter Empfindung auf den Schleppdampfer – nicht so die Floßführer. Diese geben sich ungeschwächt einer einzigen Empfindung, und zwar ihrem polnischen oder böhmisch-oberschlesischen Hasse, hin. Sie können es wagen. Das Floß, das an manchen Stellen die halbe Breite der Oder deckt, kann wohl den Schleppschiffen, aber das Schleppschiff kann nie und nimmer dem Floße gefährlich werden. Wenigstens nicht ernstlich. Es liegt also kein Grund vor, weshalb sie mit ihrer Abneigung hinter dem Berge halten sollten. Und zu dieser Abneigung ermangelt es nicht an triftigsten Gründen. Die Schleppdampfer nämlich, weil sie den Flößen in Wahrheit weder nützen noch schaden können, begnügen sich damit, die reizbare slawische Natur zu nergeln und zu ärgern. Wie Reiter, die lustig durch einen Tümpel jagen, alles, was in der Nähe ist, nach rechts und links hin mit Wasser und Schlamm bespritzen, so jagen hier die Dampfer an dem schwerfällig zur Seite liegenden Floß vorüber und unterhalten sich damit, das Floß unter Wasser zu setzen. Die zur Seite gedrückte Welle eilt, immer höher werdend, auf das Floß zu; jetzt trifft sie den ersten Balken und spritzt hoch auf. Aber nicht genug damit; die Hälfte der Welle gleitet unter dem Floß hin fort, und überall da, wo eine Lücke sich bietet, nach oben tretend, setzt sie, an sechs, acht Stellen zugleich, das Floß unter Wasser. Nun sollte man glauben, die Flößer müßten gleichgültig sein gegen ein solches Fußbad; aber als wär es Feuer, sieht man jetzt die Besatzung des Floßes auf den Bäumen und Querbalken hin und her springen, als gält es, vor ihrem bittersten Feinde zu fliehen. Diese Zickzacksprünge nehmen sich ebenso komisch wie malerisch aus. Mit vielem Geschick wissen sie immer eine Stelle zu treffen, wo ein Querbalken, ein Holzblock oder am liebsten einer jener Erd- und Rasenhügel sich vorfindet, deren viele sich nicht nur über das Floß hin ausbreiten, sondern auch einen wesentlichen Teil der häuslichen Einrichtung desselben bilden. Bei dieser häuslichen oder wirtschaftlichen Einrichtung des Floßes hab ich noch einen Augenblick zu verweilen.
Die Gesamtökonomie eines solchen Floßes besteht aus zwei gleich wichtigen Teilen, aus einem Kochplatz und einem Aufbewahrungsplatz, oder aus Küche und Kammer. Beide sind von gleich einfacher Konstruktion. Der Kochplatz, der Herd, besteht aus dem einen oder andern jener eben erwähnten Erdhügel, das heißt aus ein paar Dutzend Rasenstücken, die morgens am Ufer frisch abgestochen und wie Mauersteine neben- und aufeinandergelegt wurden. An jedem Morgen entsteht ein neuer Herd. Den alten Herdstellen aber gönnt man ihren alten Platz und benutzt sie entweder als Inseln, wenn die Wellen kommen, oder nimmt sie auch wohl, nach einigen Tagen, als Herdstelle wieder auf. Auf diesem improvisierten Herde wird nun gekocht, was sich malerisch genug ausnimmt, besonders um die Abendstunde, wenn die Feuer wie Irrlichter auf dem Wasser zu tanzen scheinen. Ebenso wichtig wie der Kochplatz ist der Aufbewahrungsplatz. Seine Konstruktion ist von noch größerer Einfachheit und besteht aus einem halbausgebreiteten Bündel Heu. Auf dieser Heuschicht liegen die Röcke, Jacken, Stiefel der Floßleute, und ausgerüstet mit diesen primitivsten Formen einer Küche und Kammer, machen die Flößer ihre oft wochenlange Reise.
Nach dieser Beschreibung wird es jedem klar sein, was eine solche Dampfschiffsneckerei für die Floßleute zu bedeuten hat. Jede aus den Lücken des Floßes hervorbrodelnde Welle spült nicht bloß über die Füße der Betroffenen hin, sondern schädigt sie auch wirklich an ihrem Hab und Gut, als handele es sich um eine Überschwemmung im kleinen. Hier fährt das Wasser zischend in das Herdfeuer und löscht es aus, dort hebt es das Heubündel mitsamt seinen Garderobestücken von unten her in die Höhe und tränkt es entweder mit Wasser oder schwemmt es gar hinweg. Das weckt dann freilich Stimmungen, die der Vorstellung von einer wachsenden »Fraternität« des Menschengeschlechts völlig hohnsprechen und zu Unterhaltungen führen, von denen es das beste ist, daß sie im Winde verklingen.
Soviel von den Schleppschiffen. Von geringerer Bedeutung sind die Passagierboote, die übrigens, wie sich von selbst versteht, gelegentlich die Rolle tauschen und auch ihrerseits als »Retter« und »Tyrannen« ganz in der oben geschilderten Weise debütieren.
Die Passagierboote gehen von Frankfurt aus zweimal wöchentlich, Mittwoch und Sonnabend, und machen die Fahrt nach Küstrin in zwei, nach Schwedt in acht, nach Stettin in zehn Stunden. Die Benutzung erfolgt mehr stationsweise und auf kleineren Strecken als für die ganze Tour. Schon deshalb, weil die Eisenbahnverbindung die Reisenden eher und sicherer ans Ziel führt. Eher unter allen Umständen, und zwar um so mehr, als es bei niedrigem Wasserstande vorkommt, daß die Fahrt auf Stunden unterbrochen oder gar wohl ganz eingestellt werden muß. Die Regulierung des Oderbetts, ein in den Zeitungen stehend gewordener Artikel, würde diesem Übelstande vielleicht abhelfen und eine Konkurrenz der Dampfschiffe mit der Eisenbahn möglich machen. Damit hat es aber noch gute Wege; Flußregulierungen sind nicht unsre starke Seite, und so werden sich die beiden Passagierboote, die jetzt das Bedürfnis decken, noch längere Zeit mit dem Publikum behelfen müssen, das jetzt zu ihnen hält. Dies Publikum, wenn auch nicht zahlreich, ist immerhin mannigfach genug. Tagelöhner, die auf die Güter, Handwerker, die zu Markte ziehen, dazu Kaufleute und Gutsbesitzer, auch gelegentlich Badereisende, besonders solche, die in den schlesischen Bädern waren. Nur eine Klasse fehlt, der man sonst wohl auf den Flußdampfern unserer Heimat, besonders im Westen und Süden, zu begegnen pflegt: der Tourist vom Fach, der eigentliche Reisende, der keinen andern Zweck verfolgt, als Land und Leute kennenzulernen.
Dieser »Eigentliche« fehlt noch, aber er wird nicht immer fehlen; denn ohne das unfruchtbare und mißliche Gebiet der Vergleiche betreten zu wollen, so sei doch das eine hier versichert, daß an den Ufern der Oder hin allerlei Städte und reiche Dörfer liegen, die wohl zum Besuche einladen können, und daß, wenn Sage und Legende auch schweigen, die Geschichte um so lauter und vernehmbarer an dieser Stelle spricht.
Sehen wir selbst.
Es ist Sonnabend um fünf Uhr morgens. An dem breiten Quai der alten Stadt Frankfurt, hohe Häuser und Kirchen zur Seite – das Ganze mehr oder weniger an den Kölner Quai zwischen der Schiffbrücke und der Eisenbahnbrücke erinnernd –, liegt der Dampfer und hustet und prustet. Es ist höchste Zeit. Kaum daß wir an Bord, so wird auch das Brett schon eingezogen, und der Dampfer, ohne viel Kommando und Schiffshallo, löst sich leicht vom Ufer ab und schaufelt stromabwärts. Zur Linken verschwindet die Stadt im Morgennebel; nach rechts hin, zwischen Pappeln und Weiden hindurch, blicken wir in jenes Hügelterrain hinein, dessen Name historischen Klang hat trotz einem – Kunersdorf. Wir werden noch oft, während unserer Fahrt, an dieses Terrain und diesen Namen erinnert werden.
Der Morgen ist frisch; der Wind, ein leiser, aber scharfer Nordost, kommt uns entgegen, und wir suchen den Platz am Schornstein auf, der Wärme gewährt und zugleich Deckung gegen den Wind. Es ist nicht leicht mehr, ein gutes Unterkommen zu finden, denn bereits vor uns hat ein Gipsfigurenhändler, mit seinem Brett voll Puppen, an ebendieser Stelle Platz genommen. Er ist aber umgänglich, rückt sein Brett beiseite und wartet auf Unterhaltung. Das Puppenbrett bietet den besten Anknüpfungspunkt. König und Königin; Amor und Psyche; Goethe, Schiller, Lessing; drei »betende Knaben« und zwei Windhunde, außerdem, alle andern überragend, eine Aurora und eine Flora bilden die Besatzung des Brettes. Der Aurora sind ihre beiden Flügel, der Flora das Bouquet genommen; beides, Bouquet und Flügel, liegen, wie abgelegter Schmuck, zu Füßen der Figuren.
»Was geht denn so am besten?« eröffne ich die Konversation.
»Ja, das ist schwer zu sagen, mein Herr«, erwidert der Figurenmann (der sich durch das hierlands selten gebrauchte »mein Herr« sofort als ein Mann von gewissen »Allüren« einführt), »es richtet sich nach der Gegend.«
»Ich dachte, König und Königin.«
»Versteht sich, versteht sich«, unterbricht er mich lebhaft, als sei er mißverstanden, »königliches Haus und Goethe-Schiller immer voran. Selbstverständlich.«
»Aber außerdem?«
»Ja, das war es eben, mein Herr. Hier herüber« – und dabei deutete er, nach rechts hin, in die Sandgegenden der Neumark hinein –, »hier herüber verkauf ich wenig oder nichts, nur dann und wann einen ›betenden Knaben‹. Ich könnte von meinem Standpunkt aus sagen« – und dabei überflog ein feines Lächeln sein Gesicht –, »wo der gute Boden aufhört, da fängt der ›betende Knabe‹ an.«
»Nun, da gehen diese wohl ins Bruch«, erwiderte ich lachend, indem ich auf Flora und Aurora zeigte.
»Aurora und Flora gehen ins Bruch«, wiederholte er mit humoristischer Würde. »Auch Amor und Psyche.«
Ich nickte verständnisvoll.
Wir standen nun auf und traten an die Schiffswandung. Er sah, daß ich einen Blick in die Landschaft tun wollte, und wartete, bis ich die Unterhaltung wieder aufnehmen würde.
Das linke Oderufer ist hüglig und malerisch, das rechte flach und reizlos. Der eigentliche Uferrand ist aber auch hier steil und abschüssig und die Wandung mit Weidengebüsch besetzt. Inmitten des gelblichen, um die Sommerzeit ziemlich wasserarmen Stromes schwimmen Inseln, und die Passage erweist sich, selbst bei genauer Kenntnis des Fahrwassers, als sehr schwierig. Vorn am Bugspriet stehen zwei Schiffsknechte mit langen Stangen und nehmen beständig Messungen vor, die um so unerläßlicher sind, als die Sandbänke ihre Stelle wechseln und heute hier und morgen dort sich finden.
Fluß, Ufer, Fahrt, alles hat den norddeutschen Charakter. Inzwischen ist es heller geworden, die Nebel haben der Sonne Platz gemacht, und mit dem Sonnenschein zugleich dringen, von rechts her, Glockenklänge zu uns herüber. Dorf und Kirche aber sind nicht sichtbar. Ich horche eine Weile; dann wend ich mich zu meinem Nachbar und frage: »Wo klingt das her?«
»Das ist die Siebenzentnerige von Groß-Rade – mein besonderer Liebling.«
»Was tausend«, fahr ich fort, »kennen Sie die Glocken hier herum so genau?«
»Ja, mein Herr, ich kenne sie alle. Viele davon sind meine eigenen Kinder, und hat man selber erst Kinder, so kümmert man sich auch um die Kinder anderer Leute.«
»Wie das? Haben Sie denn die Glocken gegossen? Sind Sie Gürtler oder Glockengießer? Oder sind Sie's gewesen?«
»Ach, mein Herr, ich bin sehr vieles gewesen: Tischler, Korbmacher, dazwischen Soldat, dann Former, dann Glockengießer; nun gieß ich Gips. Es hat mir alles nicht recht gefallen, aber das Glockengießen ist schön.«
»Da wundert's mich doppelt, daß Sie vom Erz auf den Gips gekommen sind.«
»Mich wundert es nicht, aber es tut mir leid. Wenn der ›Zink‹ nicht wäre, so göß ich noch Glocken bis diesen Tag.«
»Wieso?«
»Seit der Zink da ist, ist es mit dem reellen Glockenguß vorbei. In alten Zeiten hieß es ›Kupfer und Zinn‹, und waren's die rechten Leute, gab's auch wohl ein Stück Silber mit hinein. Damit ist's vorbei. Jetzt wird abgezwackt; von Silber ist keine Rede mehr; wer's billig macht, der hat's. Der Zink regiert die Welt und die Glocken dazu. Aber dafür klappern sie auch wie die Bunzlauer Töpfe. Ich kam bald zu kurz; die Elle wurde länger als der Kram; wer noch für Zinn ist, der kann nicht bestehen, denn Zinn ist teuer, und Zink ist billig.«
»Wieviel Glocken haben Sie wohl gegossen?«
»Nicht viele, aber doch sieben oder acht; die Groß-Radener ist meine beste.«
»Und alle für die Gegend hier?«
»Alle hier herum. Und wenn ich mir mal einen Feierabend machen will, da nehm ich ein Boot und rudere stromab, bis über Lebus hinaus. Wenn dann die Sonne untergeht und rechts und links die Glocken den Abend einläuten und meine Glocken dazwischen, dann vergeß ich vieles, was mir im Leben schiefgegangen ist, und vergeß auch den ›Turban‹ da.« – Dabei zeigte er auf die runde, kissenartige Mütze, die die Gipsfigurenhändler zu tragen pflegen und die jetzt, in Ermangelung eines anderen Platzes, der Goethe-Schiller-Statue über die Köpfe gestülpt war.
So plaudernd, waren wir, eine Viertelstunde später, bis Lebus gekommen. Der Gipsfigurenmann verabschiedete sich hier, und während das Boot anlegte, hatt ich Gelegenheit, die »alte Bischofsstadt« zu betrachten.
Freilich erinnert hier nichts mehr an die Tage früheren Glanzes und Ruhmes. Die alte Kathedrale, das noch ältere Schloß, sie sind hin, und eines Lächelns kann man sich nicht erwehren, wenn man in alten Chroniken liest, daß um den Besitz von Lebus heiße Schlachten geschlagen wurden, daß hier die slawische und die germanische Welt, Polenkönige und thüringische Herzöge, in heißen Kämpfen zusammenstießen und daß der Schlachtruf mehr als einmal lautete: »Lebus oder der Tod«. Unter allen aber, denen dieser Schlachtruf jetzt ein Lächeln abnötigt, stehen wohl die Lebuser selbst obenan. Ihr Stadtsiegel ist ein »Wolf mit einem Lamm im Rachen«; die neue Zeit ist der Wolf, und Lebus selbst ist das Lamm. Mitleidslos wird es verschlungen.
Lebus, die Kathedralenstadt, ist hin, aber Lebus, das vor dreihundert Jahren einen fleißigen Weinbau trieb, das Lebus existiert noch. Wenigstens landschaftlich. Nicht daß es noch Wein an seinen Berglehnen zöge, nur eben der malerische Charakter eines Winzerstädtchens ist ihm erhalten geblieben.
Die Stadt, so klein sie ist, zerfällt in eine Ober- und Unterstadt. Jene streckt sich, so scheint es, am First des Berges hin, diese zieht sich am Ufer entlang und folgt den Windungen von Fluß und Hügel. Zwischen beiden, am Abhang, und, wie es heißt, an selber Stelle, wo einst die alte Kathedrale stand, erhebt sich jetzt die Lebuser Kirche, ein Bau aus neuer Zeit. Die »Unterstadt« hat Höfe und Treppen, die an das Wasser führen; die »Oberstadt« hat Zickzackwege und Schluchtenstraßen, die den Abhang bis an die Unterstadt hemiedersteigen. Auf diesen Wegen und Straßen bewegt sich ein Teil des städtischen Lebens und Verkehrs. Gänse und Ziegen weiden dort unter Gras und Gestrüpp; Frauengestalten, zum Teil in die malerische Tracht des Oderbruchs gekleidet, schreiten bergab; den Zickzackweg hinauf aber steigt eben unser Freund, der Gipsfigurenmann, und seine »Aurora« schimmert im Morgenstrahl.
Nun aber Kommandowort vom Radkasten aus, und unser Dampfer schaufelt weiter.
Lebus liegt zurück, und wir treten jetzt, auf etwa eine Meile hin, in jenes Terrain ein, wo Stadt und Dorf, zu beiden Seiten des Flusses, an die Tage mahnen, die jenem Kunersdorfer 12. August vorausgingen und ihm folgten. Es sind drei Namen vorzugsweise, denen wir hier begegnen: Reitwein, Göritz und Ötscher, alle drei mit der Geschichte jener Tage verwoben.
In Reitwein erschien am 10. August die Avantgarde des Königs, um eine Schiffbrücke vom linken aufs rechte Oderufer zu schlagen. Man wählte dazu die Schmälung des Flusses, wo die alte Stadt Göritz, malerisch am Hügelabhang, dem Dorfe Reitwein gegenüberliegt. Am 10. abends erschien der König selbst und führte seine Bataillone (sechzig an der Zahl) ans andre Ufer; die Kavallerie ging durch eine Furt. In Göritz aber blieb General Flemming mit sieben Bataillons zur Deckung der Schiffbrücke zurück. Zwei Tage später, am Abend des 12., befanden sich die Trümmer der geschlagenen Armee an derselben Furt, an derselben Schiffbrücke. Aber das Spiel war vertauscht; statt von links nach rechts, ging es jetzt von rechts nach links. Die Brücke, die am Abend des 10. von Reitwein nach Göritz vorwärts geführt hatte, führte jetzt, am Abend des 12., von Göritz nach Reitwein zurück.
Der König verbrachte die Nacht, eine Viertelmeile südlich von der Schiffbrücke, im Dorfe Ötscher; er schlief auf Stroh in einer verödeten Bauernhütte. Auf dem Rücken Rittmeisters von Prittwitz, der ihn gerettet, schrieb er mit Bleistift die Worte an den Minister Finckenstein: »Alles ist verloren, retten Sie die königliche Familie; Adieu für immer.« Anderntags nahm er Quartier in Reitwein, damals noch den Burgsdorfs gehörig. Hier war es, wo er die berühmte, an den General Finck gerichtete Instruktion aufsetzte, in der er den Prinzen Heinrich zum Generalissimus ernannte und den Willen aussprach, daß die Armee seinem Neffen schwören sollte.
An diesen Plätzen führt uns jetzt unsere Fahrt vorüber. Ötscher, wiewohl nah gelegen, verbirgt sich hinter Hügeln, desto malerischer treten Reitwein und Göritz hervor. Schöner freilich muß der Anblick dieses Bildes gewesen sein, als die alte Göritzer Kirche, ein berühmter Wallfahrtsort, auf der Höhe des Hügels lag und sich mit der Kirche von Reitwein drüben begrüßte. Aber Göritz und seine Kirche sind in jedem Sinne von ihrer Höhe herabgestiegen. Keine Wallfahrer kommen mehr, und als sei es nicht länger mehr nötig, das berühmte Wallfahrtshaus, die Kirche, schon von weither sichtbar zu machen, hat man die neue Kirche (nachdem die alte, kurz vor der Zorndorfer Schlacht, von den Russen zerstört worden war) in der Tiefe wieder aufgebaut.
Die Göritzer Kirche hat uns zu guter Zeit an die Russen und die Zorndorfer Schlacht gemahnt; denn wir verlassen eben das Kunersdorfer Terrain, um in das von Zorndorf einzutreten.
Was wir zunächst erblicken, ist Küstrin, turmlos, grau, in dünne Nebel gehüllt die alte neumärkische Hauptstadt, um deren Rettung es sich handelte, als am 21. August 1758 der König von Schlesien her am linken Oderufer erschien. Alle Namen zu beiden Seiten des Flusses erinnern auch hier an Tage bitterer Bedrängnis und schwer erkauften Siegs.
Zuerst Gorgast am linken Oderufer. In Gorgast war es, wo der König seine chiffonniert aussehenden Truppen mit den glatt und wohlgenährt dastehenden Regimentern Dohnas vereinigte und sein Mißfallen in die Worte kleidete: »Meine sehen aus wie Grasteufel, aber sie beißen.«
Weiter flußabwärts die Fähre von Güstebiese. Ein wenig poetischer Name, aber doch voll guten Klangs. Hier setzte der König seine Regimenter über, als er von Küstrin aus jenen glänzenden Bogenmarsch ausführte, der ihn, genau da, wo der Gegner einen Frontangriff erwartete, plötzlich in den Rücken desselben führte.
Rechts hin, fast am Ufer des Flusses entlang, dehnt sich die Drewitzer Heide – ein grüner Schirm, der das eigentliche Schlachtfeld dem Auge des Vorüberfahrenden entzieht. Dahinter liegen die Dörfer und Stätten, deren Namen mit der Geschichte jenes blutigen Tages verwoben sind: die Neudammsche Mühle, der Zaber- und Galgengrund, endlich Zorndorf selbst.
Wir haben Küstrin passiert – ein scheuer Blick nur traf jenen halb verbauten Wallgang zwischen Bastion König und Bastion Brandenburg, wo am 6. November 1730 Kattes Haupt in den Sand rollte –; auch das Schlachtfeld liegt bereits hinter uns, das achtundzwanzig Jahre später diesen Terrainabschnitt zu historischem Ansehen erhob, und wir fahren nun, als hätten sich die Flußufer vorgesetzt, durch Kontraste zu wirken, in jene friedlich-fruchtbaren Gegenden ein, die, vor 100 oder 150 Jahren noch ein ödes, wertloses Sumpfland, seitdem so vielfach und mit so vielem Recht die Kornkammern unseres Landes genannt worden sind. Das Oderbruch dehnt sich auf Meilen hin zu unserer Linken aus.
Der Anblick, den es, im Vorüberfahren, vom Fluß aus gewährt, ist weder schön und malerisch, noch verrät er eine besondere Fruchtbarkeit; gegenteils, das Vorland, das sich dem Auge bietet, macht kaum den Eindruck eines gehegten Stück Wiesenlands, während die Raps- und Gerstenfelder, die sich golden dahinter ausdehnen, dem Auge durch endlose Damm- und Deichwindungen entzogen werden. Durch Damm und Deiche, die freilich, indem sie die Niederung gegen ihre früheren Überschwemmungen schützten, erst den Reichtum schufen, der sich jetzt hinter diesen Linien verbirgt.
Der Reichtum dieser Gegenden offenbart sich uns nicht in seinen goldenen Feldern, aber wir erkennen ihn doch an seinen ersten und natürlichsten Folgen – an den Dörfern, die er geschaffen. Da gibt es kein Strohdach mehr, der rote Ziegel lacht überall aus dem Grün der Wiesen hervor, und statt der dürftig hölzernen Kirchtürme des vorigen Jahrhunderts, die kümmerlich wie ein Schilderhaus auf dem Kirchendach zu sitzen pflegten, wachsen jetzt in solidem Backsteinbau – die Campanellen Italiens oft nicht unglücklich kopierend – die Kirchtürme in die Luft. An diesem Reichtume nehmen die Dörfer des andern (rechten) Oderufers teil, und ansteigend an der Hügelkette gelegen, die sich eine Meile unterhalb Küstrin am rechten Oderufer hinzuziehen beginnt, gesellen sich Schönheit und malerische Lage, viel mehr, als man in diesen Gegenden erwartet, zu dem Eindruck des Reichtums und beinahe holländischer Sauberkeit.
Nun sind wir über Amt Kienitz (ein altes Dorf, vor zwei Jahrhunderten dem General Görtzke, dem »Paladin des Großen Kurfürsten«, gehörig) und nun über Kloster Zellin hinaus; der Fluß wird schmäler, aber tiefer, und das Landschaftsbild verändert sich. Der Barnim liegt hinter uns, und wir fahren in die Uckermark hinein, wo sich uns Uferlandschaften erschließen, sehr ähnlich denen, wie sie die Stettiner Umgegend dem Auge bietet. Andere Namen, in nichts mehr an die triviale Komik von »Güstebiese« oder »Lietzegöricke« erinnernd, tauchen auf – Namen voll poetischem Klang und Schimmer: Hohensaaten, Raduhn und Hohen-Kränig.
Der Fluß, bis dahin im wesentlichen in einem Bette fließend, fängt an, ein Netz von Kanälen durch die Landschaft zu ziehen; hierhin, dorthin windet sich der Dampfer, aber eh es uns noch gelungen ist, uns in dem malerischen Wirrsal zurechtzufinden, tauchen plötzlich weiße Giebelwände, von Türmen und hohen Linden überragt, aus dem Landschaftsbilde auf. Noch eine Biegung, und das übliche Hoi-ho, das immer laut wird, wenn das Schiff sich einer Landungsstelle nähert, läßt sich aufs neue vernehmen. Eine alte Holzbrücke, mit Hunderten von Menschen besetzt, sperrt uns den Weg; ein Fangseil fliegt über unsere Köpfe weg, dem Brückengeländer zu; der Dampfer legt an. Ein Drängen, ein Grüßen, dazwischen das Läuten der Glocke. Vom linken Ufer her aber wirft ein weitläuftiger Bau, in Bäumen und Laubgängen halb versteckt, sein Spiegelbild in den Fluß. Es ist das alte Markgrafenschloß. Wir sind in Schwedt.
Das Oderbruch
1. Wie es in alten Zeiten war
Wasser, Wasser überall,
Die Tiefe selbst verfaulte,
Schlammtiere krabbeln zahllos rings
Auf schlammiger Moderflut.
Freiligrath, nach Samuel Taylor Coleridge
Am Westufer der Oder, nach rechts hin vom Flusse selber begrenzt, nach links hin von den Abhängen des Barnim-Plateaus wie von einem gebogenen Arm umfaßt, liegt das Oderbruch. Es ist eine sieben Meilen lange und etwa zwei Meilen breite Niederung, die, ihrem Hauptbestandteile nach, in ein hohes und niederes Bruch, das Oberbruch und das Niederbruch, zerfällt. An diese beiden schließt sich noch, nach Norden hin, also flußabwärts, das Mittelbruch. Diese Bezeichnung ist schlecht gewählt und wird die Ursache beständiger Verwechselungen. Als »Mittelbruch« vermutet man es im Zentrum, zwischen dem Ober- und Niederbruch gelegen, während es doch, umgekehrt, am äußersten Flügel des Bruches liegt. Seinen Namen, der besser einem andern Platz machte, hat es wahrscheinlich daher, weil es inmitten zweier Oderarme sich ausbreitet. Neueren Arbeiten, namentlich einem vorzüglichen Aufsatze des Geheimen Rat Wehrmann, »Die Eindeichung des Oderbruches«, entnehme ich, daß man angefangen hat, diese schlechte Bezeichnung »Mittelbruch« in amtlichen Erlassen wenigstens ganz fallenzulassen. Man spricht nur noch von einem Ober- und Niederbruch, und so ist es in der Ordnung.
Das Bruch ist ein Bauernland, eine Art Dithmarschen aber adlige Güter blicken rundum, wie von hoher Warte, in das schöne, fruchtbare Bruchland hinein. Eine ganze Anzahl dieser auf der Höhe gelegenen altadligen Güter werden wir noch in ausführlicheren Schilderungen kennenlernen; nur ihre Namen sowie die Namen der alten, zum Teil ausgestorbenen Familien, die ihnen im Laufe der Jahrhunderte zu Ruhm und Ansehn verhalfen, mögen schon hier eine Stelle finden. Auch einem neuen Namen werden wir begegnen: Albrecht Thaer. Es wird dem Leser, mit bloßer Hülfe dieser Aufzählung, der Reichtum historischen Lebens entgegentreten, der sich hier, unmittelbar am Rande des Bruchs, auf dem Raum weniger Meilen zusammenfindet. Ich folge der Linie von Nord nach Süd.
Von allen diesen Punkten, selbst von Buckow aus, das am meisten zurückgelegen liegt, ermöglicht sich ein Blick in die fruchtbare Tiefe; dabei wechselt der Charakter der Landschaft so oft und so anmutig, daß jeder, der am Rande des Plateaus, etwa von Freienwalde bis Seelow, oder selbst bis Frankfurt hin, diese Fahrt zu machen gedenkt, einer langen Reihe der mannigfachsten und anziehendsten Bilder begegnen wird.
Eine solche Fahrt auf der Höhe hin werden wir mehrfach zu machen haben, und manche dieser Fahrten (zum Beispiel der Weg von Falkenberg bis Freienwalde) wird uns Gelegenheit zu dem Versuch eines Landschaftsbildes geben; heute jedoch ist es das Bruch selbst, das in der Tiefe gelegene Bauernland, das uns beschäftigen soll, und wir werden erst bei den alten Zuständen dieses Sumpflandes, dann bei seiner Eindeichung und Entwässerung, endlich bei seiner Kolonisierung zu verweilen haben.
Alle noch vorhandenen Nachrichten stimmen darin überein, daß das Oderbruch vor seiner Urbarmachung eine wüste und wilde Fläche war, die, sehr wahrscheinlich unsrem Spreewalde verwandt, von einer unzähligen Menge größerer und kleinerer Oder-Arme durchschnitten wurde. Viele dieser Arme breiteten sich aus und gestalteten sich zu Seen, deren manche, wie der Liepesche bei Liepe, der Kietzer und der Kloster-See bei Friedland, noch jetzt, wenn auch in sehr veränderter Gestalt, vorhanden sind. Das Ganze hatte, dementsprechend, mehr einen Bruch- als einen Waldcharakter, obwohl ein großer Teil des Sumpfes mit Eichen bestanden war. Alle Jahre stand das Bruch zweimal unter Wasser, nämlich im Frühjahr um die Fastenzeit, nach der Schneeschmelze an Ort und Stelle, und um Johanni, wenn der Schnee in den Sudeten schmolz und Gewitterregen das Wasser verstärkten. Dann glich die ganze Niederung einem gewaltigen Landsee, aus welchem nur die höher gelegenen Teile hervorragten; ja selbst diese wurden bei hohem Wasser überschwemmt.
Wasser und Sumpf in diesen Bruchgegenden beherbergten natürlich eine eigne Tierwelt, deren Reichtum, über den die Tradition berichtet, allen Glauben übersteigen würde, wenn nicht urkundliche Belege diese Traditionen unterstützten. In den Gewässern fand man: Zander, Fluß- und Kaulbarse, Aale, Hechte, Karpfen, Bleie, Aland, Zährten, Barben, Schleie, Neunaugen, Welse und Quappen. Letztere waren so zahlreich (zum Beispiel bei Quappendorf), daß man die fettesten in schmale Streifen zerschnitt, trocknete und statt des Kiens zum Leuchten verbrauchte. Die Gewässer wimmelten im strengsten Sinne des Worts von Fischen, und ohne viele Mühe, mit bloßen Handnetzen, wurden zuweilen in Quilitz an einem Tage über 500 Tonnen gefangen. In den Jahren 1693, 1701 und 1715 gab es bei Wriezen der Hechte, die sich als Raubfische diesen Reichtum zunutze machten, so viele, daß man sie mit Keschern fing und selbst mit Händen greifen konnte. Die Folge davon war, daß in Wriezen und Freienwalde eine eigne Zunft der Hechtreißer existierte. An den Markttagen fanden sich aus den Bruchdörfern Hunderte von Kähnen in Wriezen ein und verkauften ihren Vorrat an Fischen und Krebsen an die dort versammelten Händler. Ein bedeutender Handel wurde getrieben, und der Fischertrag des Oderbruchs ging bis Böhmen, Bayern, Hamburg, ja die geräucherten Aale bis nach Italien. Kein Wunder deshalb, daß in diesen Gegenden unter allem Haus- und Küchengerät der Fischkessel obenan stand und so sehr als wichtigstes Stück der Ausstattung betrachtet wurde, daß er, nach gesetzlicher Anordnung, beim Todesfalle der Frau, wenn andres Erbe zur Verteilung kam, dem überlebenden Gatten verblieb.
In großer Fülle lieferte die Bruchgegend Krebse, die zuzeiten in solchem Überfluß vorhanden waren, daß man zu Colerus' Zeiten, ausgangs des sechzehnten Jahrhunderts, sechs Schock schöne, große Krebse für sechs Pfennige meißnerischer Währung kaufte. Zu Küstrin wurde von 100 Schock durchgehender Krebse ein Schock als Zoll abgegeben, bei welcher Gelegenheit der vorerwähnte Colerus versichert, daß dieser Zoll in einem Jahre 325 000 Schock Krebse eingetragen habe. Danach wären denn bloß in dieser einen Stadt in einem Jahre 32½ Millionen Schock Krebse versteuert worden. Im Jahre 1719 war das Wasser der Oder, bei der großen Dürre, ungewöhnlich klein geworden; Fische und Krebse suchten die größten Tiefen auf, und diese wimmelten davon. Da das Wasser aber von der Hitze zu warm wurde, krochen die Krebse aufs Land ins Gras oder wo sie sonst Kühlung erwarteten, selbst auf die Bäume, um sich unter das Laub zu bergen, von welchen sie dann wie Obst herabgeschüttelt wurden. Auch die gemeine Flußschildkröte war im Bruch so häufig, daß sie von Wriezen fuhrenweise nach Böhmen und Schlesien versendet oder vielmehr abgeholt wurde.
Ein so lebendiges Gewimmel im Wasser mußte notwendig sehr vielen anderen Geschöpfen eine mächtige Lockspeise sein. Schwärme von wilden Gänsen bedeckten im Frühjahr die Gewässer, ebenso Tausende von Enten, unter welchen letzteren sich vorzugsweise die Löffelente, die Quackente und die Krickente befanden. Zuweilen wurden in einer Nacht so viele erlegt, daß man ganze Kahnladungen voll nach Hause brachte. Wasserhühner verschiedener Art, besonders das Bleßhuhn, Schwäne und mancherlei andre Schwimmvögel belebten die tieferen Gewässer, während in den Sümpfen Reiher, Kraniche, Rohrdommeln, Störche und Kiebitze in ungeheurer Zahl fischten und Jagd machten. Im Dorfe Letschin trug jedes Haus drei, auch vier Storchnester. Rings um das Bruch und in den Gebüschen und Horsten im Innern desselben fand man Trappen, Schnepfen, Ortolane und andre zum Teil selten gewordene Vögel; über dem allem aber schwebte, an stillen Sommerabenden, ein unermeßlicher Mückenschwarm, der besonders die Gegenden von Freienwalde und Küstrin in Verruf brachte. »Sie schwärmten« – so erzählt Bekmann – »in solcher Menge, daß man in der Luft dicke Säulen von Mücken beobachtete, und gaben ein solches Getöse von sich, daß es, wenn man nicht scharf darauf achtete, klang, als würden in der Ferne die Trommeln gerührt.« Biber und Fischottern bauten sich zahlreich an den Ufern an, und wurden die ersteren als große Zerstörer der später errichteten Dämme, die anderen als große Fischverzehrer fleißig gejagt. Jeder konnte auf sie Jagd machen, wodurch sie gänzlich ausgerottet wurden.
Die Vegetation stand natürlich mit dem ganzen Charakter dieser Gegenden in Einklang: Alle Wasser- und Sumpfpflanzen kamen reichlich vor, breite Gürtel von Schilf und Rohr faßten die Ränder ein, und Eichen und Elsen überragten das Ganze.
Im Spätsommer, wenn sich die Wasser endlich verlaufen hatten, traten für den Rest des Jahres fruchtbare Wiesen zutage, und diese Wiesen, die ein vortreffliches Futter gaben, sicherten, nebst dem Fischreichtum dieser Gegenden, den Bewohnern des Bruchs ihre Existenz. Darüber hinaus ging es nicht, vielleicht deshalb nicht, weil der enorme Reichtum an Fischen und Heu beides halb wertlos machte.
Einzelne benachbarte Kavallerieregimenter zogen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von diesem Heureichtum mehr Vorteil als die Bruchbewohner selbst. Es war damals noch im Schwange, daß die Eskadronchefs selber für die Unterhaltung der Pferde Sorge tragen mußten. Daher bestrebten sich viele der in den Nachbarstädten, auch in der Residenz selbst garnisonierenden Rittmeister respektive Obristwachtmeister, ihre Pferde in den Bruchdörfern auf Grasung zu geben. Zu dem Ende wurden dieselben auf Flößen und zusammengebundenen Kähnen übergeführt. Hauptsächlich waren es drei Regimenter, die Nutzen davon zogen, nämlich das Zietensche, später Göckingksche Husarenregiment sowie die Gensdarmes und die Pfalzbayern-Dragoner. Zuweilen lag in einem Dorfe eine ganze Eskadron. Doch hatten die Dorfbewohner, wie schon angedeutet, wenig Vorteil von solcher Einquartierung, da monatlich im Durchschnitt nur ein Taler Futtergeld pro Pferd gezahlt wurde.
2. Die Verwallung
Graben und Wall
Haben bezwungen das Element
Und nun blüht es von End zu End
Allüberall.
Fische und Heu hatten jahrhundertelang den einzigen Reichtum der Oderbruchgegenden gebildet; die Bewohner hatten davon gelebt, indessen, im großen und ganzen, selbst in guten Jahren kärglich genug. Gute Jahre gab es aber nicht immer. Gab es statt dessen ein Wasserjahr, so daß die Überschwemmungen weiter gingen oder länger andauerten als gewöhnlich, so war Not und Elend an allen Enden.
Zwar wurden schon im sechzehnten Jahrhundert Versuche gemacht, der Wassersnot durch Eindeichung des linken Oderufers, namentlich auf der Straße von Frankfurt bis Küstrin, ein Ziel zu setzen, aber alle diese Arbeiten waren teils auf kleinere Strecken beschränkt, teils mangelhaft in sich. Schon unter der Regierung des Kurfürsten Johann George, etwa um 1593, hatte man mit solchen Verwallungen den Anfang gemacht und Arbeiter aus Holland, Brabant, Schlesien herbeigerufen; die aufgeführten Dämme zwischen Reitwein und dem Küstriner Kietz bewährten sich aber schlecht, und 1613 brach die Oder von neuem durch. Auch der Große Kurfürst zog Holländer und Bewohner der unteren Elbufer, also Leute, die sich auf Damm- und Deichwirtschaft verstanden, ins Oderbruch hinein, ihre sehr beschränkten Mittel indessen reichten nicht aus, eine viele Meilen lange Schutzmauer aufzuführen, ohne welche die Anstrengungen des einzelnen in den meisten Fällen nutzlos bleiben mußten. Nur einige wenige Dominien, die durch kleine Höhenzüge eines natürlichen Schutzes genossen und vielleicht nur an einer schmalen Stelle noch eines Damms bedurften, waren glücklicher und brachten es dahin, sich zu einer Art Festung zu machen, in die das Wasser nicht hinein konnte.
Eine solche kleine Festung, die den Anprall des Wassers glücklich abgeschlagen hatte, lernte König Friedrich Wilhelm I. kennen, als ihn eine Reiherbeize, die er bekanntlich sehr liebte, in dem großen Überschwemmungsjahre 1736 in diese Gegenden führte. Der König sah die Verheerungen, die das Oderwasser angerichtet hatte, sah aber auch zu gleicher Zeit, daß die geschickt eingedeichten Besitzungen seines Staatsministers von Marschall auf Ranft von diesen Verheerungen wenig oder gar nicht betroffen worden waren. Was er in Ranft im kleinen so glücklich ausgeführt sah, mußte bei größeren Mitteln und Anstrengungen auf der ganzen Strecke des Oderbruches, zwischen Frankfurt und Oderberg, möglich sein, und energisch, wie er ans Werk gegangen war, das große Havelländische Loch trockenzulegen, war er jetzt nicht minder entschlossen, auch das Oderbruch zu einem nutzbaren Fleck Landes zu machen.
Er nahm die Sache persönlich in Angriff und beauftragte seinen Kriegsrat Haerlem, einen Holländer, der sich schon durch ähnliche Wasserbauarbeiten ausgezeichnet hatte, ihm ein Gutachten einzureichen, ob das Oderbruch auf seiner ganzen Strecke eingedämmt und gegen Überschwemmungen gesichert werden könne. Haerlems Gutachten lautete dahin: »daß das allerdings geschehen könne; daß die Arbeit aber schwierig, weit aussehend und kostspielig sei«.
Dem König schien dies einleuchtend, und so vertagte er ein Unternehmen, dessen Wichtigkeit er sehr wohl erkannte, mit den Worten: »Ich bin schon zu alt und will es meinem Sohn überlassen.«
Es ist anzunehmen, daß Friedrich II. von dieser Äußerung seines Vaters Kenntnis erhielt und Veranlassung daraus nahm, bald nach seinem Regierungsantritt einesteils zur Entwässerung, andererseits zur Eindeichung des Bruchs Veranstaltungen zu treffen. Dies geschah nach Beendigung des Zweiten Schlesischen Krieges.
Der Plan zur Ausführung des Werkes wurde sehr wahrscheinlich von demselben Manne, Kriegsrat von Haerlem, entworfen, der schon unter Friedrich Wilhelm I. sein Gutachten in dieser Angelegenheit abgegeben hatte; um aber bei einem Unternehmen von solchem Umfange möglichst sicherzugehen, wurde von seiten des Königs noch eine besondere Kommission zur örtlichen Besichtigung und zur Begutachtung des Unternehmens ernannt. Es war dabei der ausdrückliche Befehl des Königs, daß der berühmte Mathematiker Bernhard Euler, dazumal anwesendes Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, an den Beratungen dieser Kommission teilnehmen solle. Der König hatte guten Grund, nach Möglichkeit Autoritäten und berühmte Namen in diese Kommission hineinzuziehen, da er im voraus von dem Widerstande überzeugt war, dem er, wie immer in solchen Fällen, bei den Anwohnern des Bruchs, den adligen und den bäuerlichen, begegnen würde. Etwas von der Opposition, die später, und zwar namentlich von 1748 bis 1752, der am Rande des Oderbruches reichbegüterte Markgraf Karl machte, mochte schon damals zu Ohren des Königs gedrungen sein.
Die Kommission ging ans Werk und stattete ihren Bericht ab. Dieser Bericht, von Schmettau, Haerlem und Euler unterzeichnet, ist umfangreich, aber in Erwägung der Schwierigkeit und Wichtigkeit der Materie verhältnismäßig kurz gefaßt und läuft, hinsichtlich seiner Vorschläge, auf drei Hauptpunkte hinaus:
Alle drei Aufgaben sind im wesentlichen gelöst worden.
Ad 1. Um der Oder einen schnelleren Abfluß zu verschaffen, wurde ihr auf der Strecke von Güstebiese bis Hohensaaten ein neues Bett, und zwar zur Abkürzung ihres Laufs, gegraben. Die Oder nahm früher, das heißt also vor den Arbeiten von 1746 bis 1753 (sieben Jahre, weshalb man von einem in der »Stille geführten Siebenjährigen Krieg« gesprochen hat), auf der eben angegebenen Strecke einen anderen Lauf als jetzt; sie machte, statt in gerader Linie weiterzufließen, drei Biegungen, und zwar zuerst bei Güstebiese nach Westen, dann bei Wriezen nach Norden, endlich bei Freienwalde nach Osten, so daß sie, mehrfach ein Knie bildend, auf ihrem langen Umwege drei Linien statt einer beschrieb. Diesem Umwege, der dem raschen Abfluß hinderlich war, sollte abgeholfen werden; mit anderen Worten, der Lauf des Flusses sollte durch ein neues Bett nunmehr einfach eine gerade Richtung erhalten.
Der Kanal wurde gegraben, und die Oder fließt seitdem in einem neuen Bett, das nur zweieinhalb Meilen statt sechs Meilen Länge hat. Dies ist die sogenannte » neue Oder« zwischen Güstebiese und Hohensaaten (H. S.). Aber das alte Bett wurde durch diesen geradlinigen Durchstich, wie sich denken läßt, nicht absolut wasserleer, es blieb vielmehr Wasser genug in der »alten Oder«, um den verschiedenen an ihr gelegenen Städten und Dörfern mehr oder weniger ihren alten Wasserverkehr zu erhalten. Erst 1832 kam dieser Wasserverkehr in Gefahr. Die Verwallung, wie sie bis dahin bestand, hatte im Lauf der Jahrzehnte verschiedene Mängel gezeigt, und namentlich war der flußabwärts gelegene Teil des Niederbruchs, das sogenannte Mittelbruch, nach wie vor vielfachen Überschwemmungen ausgesetzt gewesen. Dem vorzubeugen, entwarf der Geheime Oberbaurat Cochius schon zwischen 1810 und 1818 einen kühnen Plan, der darauf hinausging, die alte Oder bei Güstebiese zu schließen, das heißt also, einen Riegel vorzuschieben. Dieser vorgeschobene Riegel, ein Damm, eine Zuschüttung, sollte alles Wasser zwingen, im Bett der neuen Oder zu bleiben, und ein teilweises Abfließen des Wassers in das Bett der alten Oder unmöglich machen. Der Plan war kühn, weil die dadurch im Bett der neuen Oder sehr wesentlich wachsende Wassermasse leicht Gefahren (Deichbrüche) im Geleite haben konnte. Außerdem war das Aufhören jeder Wasserverbindung, wenn auch das Ganze dadurch gewann, für viele Bewohner des Mittelbruchs eine wenig wünschenswerte Sache. Alles wurde indessen glänzend hinausgeführt. Die wachsende Wassermasse der neuen Oder schuf keine Gefahren, oder man wußte doch diesen Gefahren zu begegnen, und, was ebenfalls wichtig war, eine absolute Trockenlegung der alten Oder erfolgte durch Vorschiebung jenes Riegels ebensowenig, wie sie siebzig Jahre früher durch Grabung des neuen Oderbettes erfolgt war. Die Anwohner, namentlich in den an der alten Oder gelegenen Städten Wriezen und Freienwalde, erfreuen sich nach wie vor einer Wasserverbindung, da teils das Grundwasser, teils auch ein geschicktes, alle Bruchgewässer sammelndes Kanalsystem das Bett der alten Oder, trotz der Coupierung (Zuschüttung) bei Güstebiese, mit Wasser speist. Ausbaggerungen und Tieferlegung des Betts halfen nach.
Man darf sagen, daß sich die Herstellung eines geradlinigen und dadurch verkürzten Oderbetts (»die neue Oder«) in allen Punkten bewährt hat, nur vielleicht in dem einen nicht, den man dabei zunächst und vorzugsweise im Auge hatte. Man hatte, wie schon angedeutet, von diesem neuen, kürzeren Bett eine Verbesserung des Oderfahrwassers erwartet und gehofft, daß das raschere Fließen des Wassers an dieser Stelle das Flußbett vertiefen, den Strom einengen, konzentrieren und dadurch die Stromkraft steigern werde. Dies alles ist wenig oder gar nicht in Erfüllung gegangen. Der vielfach versandete Fluß ist nach wie vor mehr breit als tief, die Schiffahrt nach wie vor schwierig, oft ganz unterbrochen, und sogar die Kanalanlage selbst hat ihren ursprünglichen Charakter zum Teil verloren und ist breiter und infolge davon wieder flacher und sandiger geworden.
Ad 2. Die zweite Aufgabe war die Anlegung von » tüchtigen Dämmen«. Das sogenannte Oberbruch, wie wir gesehen haben, hatte solche Dämme schon. Es handelte sich also vorwiegend um Eindämmung des Niederbruchs, eine Aufgabe, die dadurch so kompliziert wurde, daß nicht nur die »neue Oder« auf ihrer Strecke von Küstrin bis Saaten, sondern vor allem auch die sich in weiten Windungen durch das Land ziehende »alte Oder« eingedämmt werden mußte. Große Anstrengungen und große Geldsummen waren dazu erforderlich. Endlich glückte es. Die Gesamtstrecke der hier im Nieder-Oderbruche angelegten Deiche beträgt über zehn Meilen. Diese Deiche waren nicht gleich anfangs, was sie jetzt sind, weder an Höhe noch Festigkeit. So kam es, daß auch nach Anlage derselben verschiedene große Überschwemmungen stattfanden, zum Beispiel 1786 und 1838. Auch jetzt noch ist die Möglichkeit solcher Überschwemmungen nicht ausgeschlossen: ein Dammbruch kann stattfinden, oder die Höhe des Wassers kann die Höhe der Dämme übersteigen. Indessen verringert sich diese Möglichkeit von Jahr zu Jahr, da die Dämme, wie nach immer verbesserten fortifikatorischen Prinzipien gemodelte Festungen, alljährlich an Ausdehnung und Widerstandskraft gewinnen.
Ad 3. Die dritte Aufgabe war, das Binnenwasser abzufangen. Dies war kaum minder wichtig als die Anlegung der Dämme. Die Dämme schützten gegen die von außen her hereinbrechenden Fluten; aber sie konnten nicht schützen gegen das Wasser, das teils sichtbar in Sümpfen, Pfuhlen und sogenannten »faulen Seen« dastand, teils als Grundwasser unter dem Erdreich lauerte, jeden Augenblick bereit, zu wachsen und an die Oberfläche zu treten. Um diesem Übelstande abzuhelfen, ohne den eine eigentliche Trockenlegung nicht möglich war, bedurfte es eines ausgedehnten Kanalsystems. Auch ein solches wurde geschaffen. Zahllose Abzugsgräben, kleine und große und unter den verschiedensten Namen, wurden hergestellt, die sämtlich in den sogenannten »Landgraben« und mittelst desselben, an Wriezen und Freienwalde vorüber, in die »neue Oder« mündeten. Zum Teil sind es auch wohl diese Gräben, die das tiefer gelegene Bett der »alten Oder« mit Wasser speisen und dasselbe vor völligem Austrocknen schützen. Dies ganze Kanalsystem, ebenso wie die Verwallung, ist im Lauf der Jahrzehnte vielfach verbessert worden, und weite Strecken, die noch vor vierzig Jahren eine durchaus unsichere Heuernte gaben, zeigen jetzt um die Sommerzeit die schönsten Raps- und Gerstenfelder.
Das Wesentliche dieser Arbeiten – die selbstverständlich nie ganz ruhten und bis diesen Tag fortgesetzt werden – war bereits vor Ausbruch des Siebenjährigen Krieges beendet. Niemand ahnte damals, was im Laufe der Zeit durch den Einfluß von Luft und Sonne, durch den Fleiß der Bewohner, durch Verstärkung der Dämme, durch Erweiterung und bessere Richtung der Abzugsgräben aus diesem Landesteile werden würde – man hielt es überwiegend nur zum Graswuchs und zur Weide geeignet. Der Brief eines Reisenden, der das Bruch im Jahre 1764 passierte, gibt Auskunft darüber. Der Brief lautet:
»So angenehm auch diese Gegend geworden (denn es ist die ebenste Pläne, die Wege mit Weiden besetzt, wie auch die Deiche, und zwar mit mehreren Reihen, nicht nur auf dem Kamm, sondern auch auf der Böschung zu beiden Seiten, damit sie von den verwachsenen Wurzeln eine mehrere Festigkeit bekommen), so haben die neuen Dörfer doch mehrfach schon durch Überschwemmung gelitten, so daß man mit Kähnen die Einwohner retten oder ihnen doch, da sie auf die Böden ihrer Häuser geflüchtet, zu Hülfe kommen mußte. Der eingedeichte Acker dürfte wohl mit der Zeit der Wische in der Altmark ähnlich werden; aber noch ist er es nicht... In den ersten Jahren gab der Roggen fast gar kein Mehl, sondern lauter Kleie, und die Gerste taugte gar nicht zu Malz, weil es lauter Lagerkorn gewesen war.«
Seitdem ist es unser eigentliches Gerstenland geworden. Neuerdings blüht in ihm die Rübenkultur. Große Zuckerfabriken existieren auf den Ämtern, und immer neue Unternehmungen treten ins Leben. Der Anblick dieses fruchtbaren Landesteiles aber ruft immer wieder die Worte des großen Königs in unser Gedächtnis zurück: »Hier hab ich im Frieden eine Provinz erobert.«
3. Die alten Bewohner
Alte Zeit und alte Sitt
Hielt mit dem Neuen nicht länger Schritt,
Aber sieh da, das alte Kleid
Hat länger gelebt als Sitt und Zeit.
Das Oderbruch – oder doch wenigstens das Niederbruch, von dem wir im nachstehenden ausschließlich sprechen – blieb sehr lange wendisch. Wahrscheinlich waren alle seine Bewohner, bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein, von ziemlich unvermischter slawischer Abstammung. Die deutsche Sprache war eingedrungen (es ist nicht festzustellen, wann), aber nicht das deutsche Blut. Die Gegend war auch nicht dazu angetan, zu einer Übersiedelung einzuladen. Ackerland gab es nicht, desto mehr Überschwemmungen, und der Fischfang, den die Wenden, wenigstens in diesen Gegenden, vorzugsweise betrieben, hatte nichts Verlockendes für die Deutschen, die zu allen Zeiten entweder den Ackerbau oder die Meerfahrt, aber nicht den Fischfang liebten. Dazu kam, daß die alten Wenden, wie es scheint, von sehr nationaler und sehr exklusiver Richtung waren und den wenigen deutschen Kolonisten, die sich hier niederließen (zum Beispiel unter dem Großen Kurfürsten), das Leben so schwer wie möglich machten.
Über die Art nun, wie die wendischen Bewohner im Innern des Bruches lebten, wissen wir wenig, und das beste Teil unsrer Kenntnis haben wir aus Vergleichen und Schlußfolgerungen zu schöpfen. Die mehr und mehr unter deutsche Kultur geratenden » Randdörfer« – zu denen die » Bruchdörfer« alsbald in dem Verhältnis mittelalterlich-wendischer Kietze standen – hätten uns in ihren Amts- und Kirchenbüchern allerhand aufschlußgebende Aufzeichnungen hinterlassen können; aber es gebrach an dem erforderlichen historischen Sinn, und so ging die Zeit dafür verloren. Diese schloß etwa mit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ab. Ein geübtes Auge würde freilich auch heute noch in der aus den verschiedensten Elementen gemischten Bevölkerung eine Fülle speziell wendischer Eigentümlichkeiten herauslesen können; es gehört aber dazu eine exakte Kenntnis der verschiedenen slawischen und deutschen Stammeseigentümlichkeiten, daß ich es nicht wage, mich in solche Scheidungen und Bestimmungen einzulassen.
Ich gebe zunächst nur das wenige, was ich über die alten wendischen Bruchdörfer und ihre Bewohner als direkte Schilderung aus älterer Zeit her habe auffinden können.
»Die Dörfer im Bruch« – so sagt eine in Buchholtz' »Geschichte der Kurmark Brandenburg« abgedruckte Schilderung (Vorrede zu Band II) – »lagen vor der Eindeichung und Neubesetzung dieses ehemaligen Sumpflandes auf einem Haufen mit ihren Häusern, das heißt also, weder vereinzelt noch in langgestreckter Linie, und waren meistens von gewaltigen, häuserhohen, aus Kuhmist aufgeführten Wällen umzingelt, die ihnen Schutz vor Wind und Wetter und vor den Wasserfluten im Winter und Frühling gewährten und den Sommer über zu Kürbisgärten dienten. Den übrigen Mist warf man aufs Eis oder ins Wasser und ließ ihn mit der Oder forttreiben. Einzeln liegende Gehöfte, deren jetzt viele Hunderte vorhanden sind, gab es im Bruche nicht ein einziges. Im Frühling, und sonderlich im Mai, pflegte die Oder die ganze Gegend zu zehn bis zwölf, ja vierzehn Fuß hoch zu überschwemmen, so daß zuweilen das Wasser die Dörfer durchströmte und niemand anders als mit Kähnen zu dem andern kommen konnte.« (Dafür, daß das ganze Bruch damals sehr oft unter Wasser stand und keine andere Kommunikation als mittelst Kahn zuließ, spricht auch die Einleitung zu der vorstehenden Schilderung. Diese lautet: »Ich habe das Bruch unzähligemal durchreist, sowohl ehedem zu Wasser als auch jetzt, nachdem es urbar gemacht worden ist, zu Lande.«)
Diese Beschreibung, kurz, wie sie ist, ist doch das Beste und Zuverlässigste, was sich über den Zustand des Bruchs, wie es vor der Eindeichung war, beibringen läßt. Der neumärkische Geistliche, von dem die Schilderung herrührt, hatte die alten Zustände wirklich noch gesehn, und so wenig das sein mag, was er in dieser seiner Beschreibung beibringt, es gibt doch ein klares und bestimmtes Bild. Wir erfahren aus diesem Briefe dreierlei: 1. daß das Bruch den größten Teil des Jahres über unter Wasser stand und nur zu Wasser passierbar war; 2. daß auf den kleinen Sandinseln dieses Bruchs Häusergruppen (»in Haufen«, sagt der Briefschreiber) lagen, die uns also die Form dieser wendischen Dörfer veranschaulichen; und 3. daß es kleine schmutzige Häuser, entweder aus Holzblöcken aufgeführt oder aber sogenannte Lehmkaten, waren, die meistens von Kuhmistwällen gegen das andringende Wasser verteidigt wurden.
Man hat dies Bild durch die Hinzusetzung vervollständigen wollen, »daß also nach diesem allen die alten wendischen Bruchdörfer den noch jetzt existierenden Spreewalddörfern mutmaßlich sehr ähnlich gewesen wären«, und wenn man dabei lediglich den Grundcharakter der Dörfer ins Auge faßt, so wird sich gegen einen solchen Vergleich wenig sagen lassen. Die Spreewäldler sind Wenden bis diesen Tag; sie leben zwischen Wasser und Wiese, wie die Oderbrücher vor hundert Jahren, und ziehen einen wesentlichen Teil ihres Unterhalts aus Heumahd und Fischfang; sie leben in stetem Kampf mit dem Element; sie unterhalten ihren Verkehr ausschließlich mittelst Kähnen (der Kahn ist ihr Fuhrwerk), und ihre Blockhäuser, zum Beispiel in den zwei Musterdörfern Lehde und Leipe, sind bis diesen Tag von Kuhmistwällen eingefaßt, die, ganz nach dem Bericht unsres neumärkischen Geistlichen, halb zum Schutz gegen das Wasser, halb zu Kürbisgärten dienen. Daß der Spreewäldler jetzt statt der Kürbisse die besser rentierenden Gurken etc. zieht, macht keinen Unterschied.
Der oben mitgeteilte Brief hat uns ziemlich anschaulich die Lokalität der alten Oderbruchdörfer gegeben; die Frage bleibt noch: Wie waren die Bewohner nach Charakter, Sitte, Tracht?
Zunächst ihr Charakter. Wie gut auch das Zeugnis ist, das noch jetzt an einigen Stellen des Oderbruchs den Überresten der wendischen Bevölkerung im Gegensatz zu den »Pfälzern« ausgestellt wird, so ist es doch nicht sehr wahrscheinlich, daß es vor hundert Jahren und darüber mit diesen von der Welt abgeschnittenen, von jeder Idealität losgelösten Existenzen etwas Besonderes auf sich gehabt habe. Es waren vielleicht gutgeartete, aber jedenfalls rohe, in Aberglauben und Unwissenheit befangene Gemeinschaften, die trotz ihres christlichen Bekenntnisses mit den alten Wendengöttern nie recht gebrochen hatten. Der Aberglaube hatte in diesen Sümpfen eine wahre Brutstätte. Kirchen gab es zwar ein paar; aber der Geistliche erschien nur alle sechs oder acht Wochen, um eine Predigt zu halten, und der Verkehr mit den glücklicheren Randdörfern oder gar mit den Städten, wohin sie eingepfarrt waren, war durch Überschwemmungen und grundlose Wege erschwert. Man darf mit nur allzu gutem Rechte behaupten, daß die Brücher in allem, was geistlichen Zuspruch und geistiges Leben anging, von den Brosamen lebten, die von des Herren Tische fielen. Die Toten, um ihnen eine ruhige Stätte zu gönnen (denn die Fluten hätten die Gräber aufgewühlt), wurden auf dem Wriezener Kirchhof oder auf den Höhe-Dörfern begraben, und die Taufe der Kinder erfolgte vielleicht vier- oder sechsmal des Jahres in ganzen Trupps. Es wurden dann Boote nach der benachbarten Stadt abgefertigt, die dem dortigen Geistlichen die ganze Taufsendung zuführten, wobei sich's nicht selten ereignete, daß von diesen in großen Körben transportierten Kindern das eine oder andere auf der Überfahrt starb.
Die geistige Speise, die geboten wurde, war spärlich und die leibliche nicht minder; Korn wurde wenig oder gar nicht gebaut, die Kartoffel war noch nicht gekannt oder, wo sie gekannt war, als Feind und Eindringling verabscheut; ein weniges an Gemüse gedieh auf den »Kuhmistwällen«, sonst – Fisch und Krebse und Krebse und Fisch. Seuchen konnten nicht ausbleiben; dennoch wird eigens berichtet, daß ein kräftiger Menschenschlag, wie jetzt noch, hier heimisch war und daß Leute von neunzig und hundert Jahren nicht zu den Seltenheiten zählten.
Ein hervorstechender Zug der Wenden, zum Beispiel auch der Spreewaldwenden, ist ihre Heiterkeit und ihre ausgesprochene Vorliebe für Musik und Gesang. Ob eine solche Vorliebe auch bei den Wenden des Oderbruchs zu finden war? Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Eins spricht entschieden dagegen. Volkslieder haben ein langes Leben und überdauern vieles; aber nirgends begegnet man ihnen bei den Brüchern. Diese singen jetzt, was anderen Orts gesungen wird. Keine Spur wendischer Eigenart; woraus sich schließen läßt, daß überhaupt wenig davon vorhanden war.
Das einzige, was sich, ähnlich wie im Altenburgischen, auch hier im Bruche länger als jede andre Spur nationalen Lebens erhalten hat, ist die Tracht. Über diese noch ein paar Worte.
Wir begegnen ihr nicht inmitten des Bruchs, wo sich das Wendentum bis 1747 ziemlich unvermischt erhielt, sondern umgekehrt am Rande, wo die Berührung mit der deutschen Kulturwelt schon durch Jahrhunderte hin stattgefunden hatte. Aber dies darf nicht überraschen. Diese Berührung blieb in den Randdörfern eine spärliche, mäßige, wie sie es immer gewesen war, während das durch Jahrhunderte hin wendisch intakt erhaltene Zentrum, als diese Berührung überhaupt einmal begonnen hatte, durch Masseneinwanderung solche Dimensionen annahm, daß das Wendentum in kürzester Frist darunter ersticken mußte. Die Gäste wurden die Wirte und gaben nun den Ton an. Anders in den Randdörfern, wenigstens in einzelnen derselben. An dem Abhange des Barnim-Plateaus, in der ehemaligen »Derfflingerschen Herrschaft«, liegen noch einige Dörfer, drin sich Überreste wendischer Tracht bis auf diesen Tag erhalten haben. In Vollständigkeit existiert sie nur noch in Quilitz. dem gegenwärtigen Neu-Hardenberg.
Diese Kleidung, soweit die Frauen in Betracht kommen, besteht aus einem kurzen roten Friesrock mit etwa handbreitem, gelbem Rand; ferner aus einem beblümten, dunkelfarbigen, vorn ausgeschnittenen Leibchen und aus einem weißen Hemd, dessen Ärmel bis zum Mittelarm reichen, während Latz und getollter Kragen über Brust und Nacken fallen. Dazu Kopftuch und Schürze. Die Tracht ist alltags und sonntags dieselbe und nur im Stoff verschieden. Alltags: blaue geblümte Kattun- oder Leinwandschürze und Kopftuch von demselben Zeug; sonntags: weiße Schürze und schwarzseidenes Kopftuch. Der rote Friesrock ist das Ständige, und die Schürze ist jedesmal um eine Handbreit länger als der Rock. Wie Alltag oder Sonntag, so macht natürlich auch arm und reich einen Unterschied. Bei den Ärmeren legt sich der Friesrock in wenige, bei den Reichen in viele Falten und erreicht seine Höhe, so wenigstens wird erzählt, wenn er so viele Falten hat wie Tage im Jahre. Für das Leibchen ist Manchester ein sehr bevorzugter Stoff. Weiße Zwickelstrümpfe vollenden den Anzug, und massive silberne Ohrgehänge sind beliebt.
Diese wendische Tracht nimmt sich höchst malerisch aus und ist so ziemlich die kleidsamste unter allen Nationaltrachten, die mir in den verschiedenen Teilen Norddeutschlands vorgekommen sind. Es ist damit kein übertriebenes Lob gespendet, da diese Trachten, sosehr ich sie liebe und sosehr ich ihrer Konservierung das Wort reden möchte, doch vielfach nichts weniger als schön zu nennen sind. Oft sind sie entschieden häßlich. Ich erinnere nur an die Altenburgerinnen, die wie steif ausgestopfte Bachstelzen einherschreiten. Alle diese Nationaltrachten indes, ob schön oder häßlich, sind meist sehr kostspielig zu beschaffen, und dieser Umstand hat entschieden mitgewirkt, der städtischen Mode, will sagen dem billigeren Kattunkleide, den Eingang zu verschaffen. Auch in Quilitz – das, nachdem es dem Staatskanzler Fürsten Hardenberg als Dotation zugefallen war, den Namen Neu-Hardenberg erhielt – würden wir höchstwahrscheinlich einer Wandlung zum Modernen hin begegnen, wenn nicht allerhand Rücksichten eine künstliche Konservierung der alten Sitte herbeigeführt hätten. Schon der Fürst-Staatskanzler selbst, der ein feines Auge für derlei Dinge hatte, hielt darauf, daß die Frauen und Mädchen des Dorfs in der alten wendischen Tracht vor ihm erscheinen mußten, und auch später noch haben alle Mägde, die den bevorzugten Dienst im Schloß antreten wollten, sich zu Mieder, Kopftuch und Friesrock zu bequemen gehabt.
Dem gesamten Oderbruch aber ist als Hinterlassenschaft aus der Zeit wendischer Tracht her das schwarze seidene Kopftuch geblieben, das, jedem jugendlichen Gesichte gut stehend, die Oderbrücherinnen, zum Teil ziemlich unverdient, in den Ruf gebracht hat, ganz besondere Schönheiten zu sein.
4. Die Kolonisierung und die Kolonisten
Es fiel zu leicht euch in den Schoß,
»Zu glücklich sein« war euer Los.
Wie heißt der Spruch im Golden Buch?
»Reichtum ist Segen, und Reichtum ist Fluch.«
Die umfangreichen Arbeiten, die unter Friedrich dem Großen von 1746 bis 1753 ausgeführt wurden, kamen dem gesamten Oderbruche zustatten; in besonderem Maße aber doch nur dem nördlichen Teile desselben, dem Niederbruch. Dies war auch Zweck. Das Oberbruch zwischen Frankfurt und Küstrin war längst unter Kultur; das sumpfige Niederbruch, zwischen Küstrin und Freienwalde, war der Kultur erst zu erobern.
Diese Eroberung des Niederbruchs, mit dem wir uns auch hier wieder ausschließlich beschäftigen, geschah, wie ich schon in dem Kapitel » Die Verwallung« gezeigt habe, a) durch das neue Oderbett, b) durch die Eindeichung, c) durch Abzugskanäle.
Das Niederbruch, vor Ausführung dieser Arbeiten, war ein drei bis vier Quadratmeilen großes Stück Sumpfland, auf dessen wenigen, etwas höher gelegenen Sandstellen sich acht kümmerliche Dörfer vorfanden. Diese waren:
Reetz, Meetz,
Lebbin, Trebbin,
Großbaaren, Kleinbaaren,
Wustrow und Altwriezen.
So, wie hier aufgeführt, wurden diese Dörfer früher geschrieben. Die Rechtschreibung einzelner dieser Namen ist seitdem eine andre geworden: Meetz ist Mädewitz, Lebbin ist Lewin, Großbaaren und Kleinbaaren ist Groß- und Kleinbarnim. In der Volkssprache aber leben die alten Namen noch fort. Man sagt noch jetzt: Meetz, Lebbin und jedenfalls Groß- und Kleinbaaren.
Diesen acht kümmerlichen Fischerdörfern zuliebe konnte natürlich seitens des großen Königs die Entwässerung von drei oder vier Quadratmeilen Sumpfland nicht vorgenommen werden, um so weniger, als er sehr wohl wußte, daß die Reetzer und Meetzer Fischer, wenn er ihnen auch alles entwässerte Land abgaben- und mühelos zu Füßen gelegt hätte, doch, nach Art solcher Leute, nur über den Verlust ihrer alten Erwerbsquellen (Heumahd und Fischerei) geklagt haben würden. Der König verfuhr also anders. Er hatte durch seine