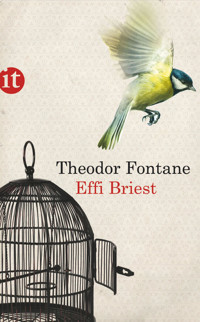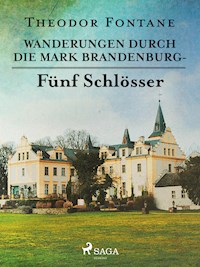
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im finalen Band der "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" dreht sich alles um die fünf Schlösser Quitzöbel, Plaue, Hoppenrade, Liebenberg und Dreilinden. Theodor Fontane verknüpft den Besuch in diesen altehrwürdigen Herrenhäusern mit einer Erzählung über die jahrhundertelange Geschichte seiner brandenburgischen Heimat. Familienhistorie, spannende Legenden und vieles mehr erwarten den Leser – Fontane gelingt im fünften und letzten Teil der "Wanderungen" noch einmal eindrucksvoll die Synthese von Reisebericht und kurzweiliger Geschichtsstunde. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Fontane
Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Fünf Schlösser
Altes und Neues aus Mark Brandenburg
Saga
Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Fünf Schlösser
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1889, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997484
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Vorwort
Fünf Schlösser! Fünf Herrensitze wäre vielleicht die richtigere Bezeichnung gewesen, aber unsere Mark, die von jeher wenig wirkliche Schlösser besaß, hat auf diesem wie auf jedem Gebiet immer den Mut der ausgleichenden höheren Titulatur gehabt, und so mag denn auch diesem märkischen Buche sein vielleicht anfechtbarer, weil zu hoch greifender Titel zugute gehalten werden. Nur Plaue war wohl wirklich ein Schloß.
Das Buch einfach als eine Fortsetzung meiner »Wanderungen« zu bezeichnen oder gar in diese direkt einzureihen ist mit allem Vorbedacht von mir vermieden worden, da, trotz leicht erkennbarer Verwandtschaft doch auch erhebliche Verschiedenheiten zutage treten. In den »Wanderungen« wird wirklich gewandert, und wie häufig ich das Ränzel abtun und den Wanderstab aus der Hand legen mag, um die Geschichte von Ort oder Person erst zu hören und dann weiterzuerzählen, immer bin ich unterwegs, immer in Bewegung und am liebsten ohne vorgeschriebene Marschroute, ganz nach Lust und Laune. Das alles liegt hier anders, und wenn ich meine »Wanderungen« vielleicht als Plaudereien oder Feuilletons bezeichnen darf, so sind diese »Fünf Schlösser« ebenso viele historische Spezialarbeiten, Essays, bei deren Niederschreibung ich, um reicherer Stoffeinheimsung und noch häufiger um besseren Kolorits willen, eine bestimmte Fahrt oder Reise machte, nicht eine Wanderung.
Zu meiner besonderen Freude hat ein glücklicher Zufall es so gefügt, daß die zu verschiedenen Zeiten und ohne Rücksicht auf ein Ganzes entstandenen Einzelarbeiten in ihrer Gesamtheit schließlich doch ein Zusammenhängendes bilden, eine genau durch fünf Jahrhunderte hin fortlaufende Geschichte von Mark Brandenburg, die, mit dem Tode Kaiser Karls IV. beginnend, mit dem Tode des Prinzen Karl und seines berühmteren Sohnes (Friedrich Karl) schließt und an keinem Abschnitt unserer Historie, weder an der Joachimischen noch an der Friderizianischen Zeit, weder an den Tagen des Großen Kurfürsten noch des Soldatenkönigs, am wenigsten aber an den Kämpfen und Gestaltungen unserer eigenen Tage völlig achtlos vorübergeht. Freilich nicht jeder Abschnitt, mit vielleicht alleiniger Ausnahme des ersten (der Quitzowzeit), kommt zu seinem Recht, aber doch immerhin zur Erwähnung, und wenn sich auf dem Gebiete der eigentlichen Landesgeschichte sicherlich breiteste Lücken finden, so finden sich dafür auch Mitteilungen und Beiträge, die vielleicht geeignet sind, auf dem Gebiete der Kulturhistorie vorhandene Lücken zu schließen.
Vielen Gönnern und Freunden – und nicht zum letzten der bei meinen vielen Anfragen nie lässig oder ungeduldig werdenden Lehrerschaft von Wilsnack und Umgegend – bin ich für ihre freundliche Mitarbeit zu lebhaftem Danke verpflichtet, am meisten freilich den Familien Knyphausen (auf Lützburg in Ostfriesland) und Eulenburg, ohne deren Hülfe die Kapitel Hoppenrade und Liebenberg nicht geschrieben werden konnten. – Alle von mir benutzten Bücher sind, meines Wissens, im Texte genannt worden, mit alleiniger Ausnahme (weshalb ich es hier nachhole) des E. Handtmannschen Buches »Neue Sagen aus Mark Brandenburg«, einer trefflichsten Sagensammlung, der ich, in dem Quitzöwel-Abschnitt, den Stoff zur Geschichte von »Quitzow dem Judenklemmer« und überhaupt alles auf die Eldenburg Bezügliche entnommen habe.
Berlin, 20. September 1888
Th. F.
Quitzöwel
1. Kapitel
Dietrich und Johann von Quitzow im väterlichen Hause bis 1385
Ganz in der Nähe der Einmündung der Havel in die Elbe, zwei Stunden unterhalb Havelberg, liegt Dorf Quitzöwel. Ersteigt man, um Umschau zu halten, den Turm der wenigstens an ihrem Giebel noch gotischen alten Kirche, so gewahrt man, nach Norden hin, das reiche, früher zu Bistum Havelberg gehörige Dorf Legde (jenseits desselben die Wilsnacker Wunderblutkirche), während, nach Süden zu, die Rauchfahnen auf und ab fahrender Schleppdampfer die Stelle bezeichnen, wo hinter dem hohen Elbdamm, und deshalb unsichtbar, die Elbe selbst ihren Lauf nimmt. Soweit der Blick in die Ferne. Zu Füßen des uns Umschau gönnenden Turmes aber steigt ein aus Wiesen und Eichengruppen malerisch zusammengestellter Park und aus ebendiesem Park ein Herrenhaus auf: das gegenwärtige Schloß Quitzöwel. Das ist die Stelle, wo die Stammburg der berühmten Quitzowfamilie stand. Überbleibsel der alten Umfassungsmauern werden noch gelegentlich in großen Steinblöcken ausgegraben, und ein bis heute dem modernen Schlosse verbliebenes Stück Wallgraben erinnert an alte, längst zurückliegende Burgtage. Sonst verlautet nichts von Beschaffenheit und Umfang der ursprünglich hier gelegenen Quitzowstätte, während wir über alle diejenigen, die während der sogenannten »Quitzowzeit« diese Stätte bewohnten, verhältnismäßig gut unterrichtet sind. Einer der interessantesten Abschnitte der märkischen Geschichte, vielleicht der interessanteste, hat in einem Mitlebenden, dem Kleriker Engelbert Wusterwitz, einen Chronisten gefunden, und unsere besten Spezialhistoriker, wie Raumer, Riedel, Klöden, haben das uns von Wusterwitz Überlieferte durch Heranziehung urkundlichen Materials bereichert und berichtigt. Wenn trotzdem hier abermals der Versuch einer Darstellung der Quitzowepoche gemacht wird, so geschieht es nicht, weil Neues vorläge, Neues, das vom Standpunkte der Forschung aus dazu auffordern könnte, sondern lediglich in der Absicht den in kleinen und, was schlimmer, in oft unterschiedslosen Details erstickenden Stoff übersichtlicher zu gestalten und durch größere Klarheit und Konzentration seine dramatische Wirkung zu steigern. Erst in den Schlußkapiteln dieses Aufsatzes werd ich in der angenehmen Lage sein, meinen Lesern auch minder bekannt Gewordenes, weil einer andern späteren Epoche Zugehöriges, aus dem berühmten Quitzowhause zur Kenntnis zu bringen.
Wann die Quitzows, deren im Jahre 1295 zuerst Erwähnung geschieht, Dorf und Haus Quitzöwel in ihren Besitz brachten, ist nicht mit Bestimmtheit festzustellen gewesen, ebensowenig wie die Namen und Reihenfolge der Besitzer bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Wir wissen nur, daß, als Kaiser Karl IV. um die Mitte der siebziger Jahre nach Mark Brandenburg kam, Köne von Quitzow, ein »alter und hoflicher Reuter«, wie der Chronist sich ausdrückt, auf Burg Quitzöwel saß. Das Ansehen, das er genoß, so groß es war, war ein rein persönliches und erwuchs ihm weder durch seinen keineswegs ausgedehnten Besitz noch durch seine Geburt. Die Familie zählte zu den Ritterbürtigen, nicht aber zu den »Edlen«, stand vielmehr in Lehnsabhängigkeit vom Hause Putlitz, das seinerseits wieder bei den mecklenburgischen Herzögen zu Lehn ging. In die vielen Fehden, ebenso der Herzöge wie der Putlitze, sah sich Köne von Quitzow als mittel- und unmittelbarer Lehnsträger beständig hineingezogen, dabei »der Not aber sehr wahrscheinlich auch dem eigenen Triebe gehorchend«. Mannigfach begegnen wir seinem Namen in Urkunden und Chroniken, die die Kämpfe jener Zeit beschreiben, aber so viel und oft er zu Kampf und Fehde draußen sein mochte, so viel war er doch auch daheim auf seinem Quitzöwelschen Hause, drin ihm, zu Beginn unserer Erzählung, zwei Knaben und eine Tochter heranwuchsen, Dietrich, Johann und Mathilde, von denen Dietrich 1366, Johann 1370, die Tochter aber, die sich später einem von Veltheim auf Schloß Harpke vermählte, wahrscheinlich zwischen 1366 und 70 geboren war. Der Geburt zweier jüngerer Söhne werden wir in einem folgenden Kapitel Erwähnung tun.
So war, soweit die Familie mitspricht, der Quitzöweler Hausbestand um 1375, ein Hausstand, der sich immer nur auf Wochen und Tage hin erweiterte, wenn die benachbarte Vetternschaft aus Stavenow, Rühstädt und Kletzke zu Begehung einer Familienfeier oder auch wohl zu gemeinschaftlichem Kriegszuge vorsprach. Mit ihnen kamen dann die Putlitze, zwei Brüder, Achim und Busso, deren ohnehin intime Beziehungen zum Quitzöweler Hause noch wuchsen, als sich zwischen Busso von Putlitz' ältestem Sohne Kaspar Gans und den beiden Quitzowschen Söhnen eine Freundschaft herausbildete, von der schon hier gesagt werden mag, daß sie, durch vier Jahrzehnte hin, alles Glück und Unglück des Lebens siegreich überdauerte. Zunächst nahm das vielfache Beisammensein der Knaben, wobei Quitzöwel die bevorzugte Stätte blieb, den Charakter einer gemeinschaftlichen Erziehung an, der es, unter den Plaudereien alter Burgknechte, nicht an Anregungen für die Phantasie fehlte. Dicht vorm Dorfausgange lagen die Segeberge, wo die diesseits der Elbe noch in Macht und Unabhängigkeit verbliebenen Wendenstämme den um 1056 über die Elbe vordringenden Sachsen eine große Schlacht geliefert und den Markgrafen Wilhelm, den Führer der Sachsen, besiegt und erschlagen hatten. Seine Leiche war nicht gefunden worden, und Kaiser Heinrich III. hatte sich sowohl den Tod des Freundes wie den Niedergang seiner Sache derart zu Herzen genommen, daß er darüber starb. Aber schon im nächsten Jahre war ein neues Sachsenheer über die Elbe gegangen, und am Abhange derselben Berge, wo man das Jahr zuvor gestritten, war nun zum zweiten Male gekämpft und den Bergen selbst, auf denen man jetzt gesiegt hatte, der Name der »Sieg-« oder Segeberge gegeben worden. Ausgepflügte Schwerter- und Panzerstücke bewahrheiteten das Erzählte.
Das waren zurückliegende, gelegentlich auch wohl mit Sagenhaftem ausgeschmückte Vorgänge; was aber die Gemüter mächtiger erregte, das war, wenn fahrende Leute des Weges kamen und nach Sitte der Zeit, in Liedern und Balladen, allerlei Geschehnisse berichteten, die sich fern und nah, ja nicht selten in unmittelbarster Nähe, zugetragen hatten. Unter diesen Vorgängen stand damals ein Kampf obenan, der zwischen den sogenannten Harzgrafen und den Stendalern ausgefochten worden war. Einer der Wernigeröder Grafen, dazu die Grafen von Regenstein und von Egeln, hatten sich mit Busso von Alvensleben auf Erxleben und zugleich auch mit Gebhard von Rundstede, der den Führer machte, zu einem Streifzug nach der Altmark hin verbunden, der denn auch wirklich am 3. November 1372 gegen die zur Altmark gehörigen Dörfer Schäpelitz, Badingen, Deetz und Garlipp unternommen wurde. Der Zug war sehr stark, gegen 500 Mann, so daß die sich zum Widerstande zu schwach fühlenden Dörfer die Hülfe der Stendaler anriefen, die denn auch gewährt wurde. Sie kamen. An ihrer Spitze stand Werner von Calve, Bürger oder vielleicht auch Bürgermeister der Stadt. Bei Deetz traf er auf den Feind, der sich hier, samt dem zahlreich geraubten Vieh, hinter einem Berge gelagert hatte. Sofort ging er zum Angriff über, die Grafen in die Flucht schlagend, wobei Busso von Alvensleben auf Seite der Gräflichen und leider auch Werner von Calve auf Seite der Stendaler fiel. Das Lied aber, eines der schönsten aus der Zeit lautete:
Herr Busso von Erxleben sich vermaß
Wohl auf dem Hause, da er saß:
»Wär ich fünfhundert starke,
Ich wollte so viele Kühe wegholen
Wohl aus der alten Marke.
Wüßt ich, wer uns Fußmann wollte sein
In die alte Marke hinein,
Ein Pferd wollt ich ihm geben.«
»Ein Pferd möcht ich verdienen«,
Sprach da Gebhard von Rundstede.
»Ich will Euch führen in ein voll Land,
Das ist unberaubt und unverbrannt,
Da ist wohl viel zu nehmen.
Wir haben viel starke Gewappnete,
Wer sollte da das uns wehren?«
Zu der Hagemühle zogen sie hin,
Bading war ihre von Anbeginn,
Dazu auch Schäpelitze.
Vor Klöden zogen sie vorbei –
Sie zogen nach Garlippe.
Das ward der Badingsche Schulze gewahr,
Er ritt nach Stendal vor das Tor:
»Wohlauf, ihr Bürger alle,
Wollt ihr nichts weiter dazu tun,
Bleibt uns keine Kuh im Stalle.«
Die Bürger von Stendal waren so stolz,
Sie zogen nach Deetz wohl hinter das Holz,
Daß man keinen vorzeit erschaue.
Das beweinte sehr Herrn Bussos Weib
Und so manche stolze Fraue.
Von ihrer wahrscheinlich hoch gelegenen Stellung aus sahen die Stendaler unter ihrem Werner von Calve, daß die Harzgrafen samt dem geraubten Vieh an einem Hügelabhang auf der Feldmark von Klinke lagen, und ohne Rast oder Ruhe zu nehmen, packten sie den Feind...
... Und ehe der Tag zum Abend ging,
Mußte der die Beute lassen.
Sie schlugen Herrn Busso auf den Kopf,
Dazu auf seinen Waffenrock
Und auf seine Pickelhaube.
Da machte manch stolz Gewappneter
Sich flüchtig aus dem Staube.
Werner von Calve, der gute Mann,
Er ritt die Feinde selber an,
Er griff wohl nach dem Schwerte.
»Wer uns ein ehrlicher Mann will sein,
Der steche gut in die Pferde.«
Werner von Calve war in der Mitten,
Er ward wohl durch und durch geritten,
Das war der größte Schade,
Den die von Stendal haben genommen –
Gott gebe ihm seine Gnade.
Bänkelsänger und fahrende Leute, die solche Gesänge vortrugen, zogen viel durchs Land, denn die Zeit zeitigte beständig dergleichen, weil man, im Gegensatz zu der gewöhnlichen Annahme, mehr erlebte wie heutzutage, wo sich das Dasein ausschließlich in große Politik und kleines und kleinstes Haus- und Privatleben teilt. Damals aber gab es noch etwas Dazwischenliegendes, das nicht groß und nicht klein war, das war der nie ruhende Kampf der Stadt- und Adelsgruppen unter- und gegeneinander. Dazu das reiche kirchliche Leben. Alles sprach zu Gemüt und Phantasie. Versuch ich beispielsweise in nachstehendem aufzuzählen, was man auf Burg Quitzöwel in einem Zeitraume von zehn Jahren, und zwar im Umkreise weniger Meilen, erlebte.
1375 weilte Kaiser Karl IV. fast beständig in dem nahe gelegenen Tangermünde, das er beflissen war in einen Kaiserhof umzugestalten. Ein Schloß entstand und eine Kapelle, deren Edelsteinpracht ans Märchenhafte streifte. Mehr als einmal war man von Quitzöwel aus drüben, um den fortschreitenden Bau zu verfolgen und anzustaunen, und wenn dann Dietrich und Johann, und Kaspar Gans mit ihnen, wieder daheim und ihre Herzen und Sinne von dem Erschauten erfüllt waren, so spielten sie, des Reiches Herrlichkeit unter sich teilend, Kaiser und König. »Und so kindisch diese Spiele waren, sie riefen doch allerlei Ideen von Macht und Größe wach, die Wurzel schlugen und fortwuchsen.«
1378 starb der Kaiser, und das ganze Land trauerte, zumeist aber Altmark und Prignitz, denen der Heimgegangene durch alles das, was er für Tangermünde getan hatte, vielfach eine Quelle des Wohlstandes geworden war. Das Jahr darauf erschien der siebzehnjährige Sigismund in der ihm zugefallenen Markgrafschaft Brandenburg, um Eid und Huldigung in Empfang zu nehmen und den Städten und Ständen ihre Privilegien zu bestätigen. Am 17. März war er in Salzwedel, am 27. zu Tangermünde. Von allen. Seiten her strömte man daselbst zusammen, und unter denen, die, zujubelnd, auf dem Markt- und Rathausplatze der Stadt standen, waren auch die Quitzowschen Junker, ahnungslos, daß sie bestimmt waren, sich dereinst der Majestät ebendieses Sigismund gegenüberzustellen. Und abermals ein Jahr, und Berlin ging in Flammen auf: das Rathaus, die Marien- und Nikolaikirche brannten nieder, und ein lateinisches Distichon ging von Mund zu Mund, das in Übersetzung lautete:
Am Tiburtiustag verheerte, Berlin, dich ein Feuer,
Und in Asche versenkt, trauert der Städte Zier.
Das war 1380 am 11. August. Im selben Jahre stand ein Komet am Himmel und predigte Krieg. Und der Krieg kam, und auch die Prignitz sah ihn.
Am 4. März 1381 zog ein von Bassewitz vor Kyritz und bestürmte die Stadt. Und siehe da, schon waren die Mauern erstiegen, als sich die Bürgerschaft noch einmal zu verzweifelter Gegenwehr zusammentat und in einem Ausfall den Feind zurückschlug und besiegte. Dieser aber getröstete sich, »daß ein Engel auf der Mauer gestanden und irdische Kraft und Tapferkeit zuschanden gemacht habe«.Dies 1381er Ereignis fällt in der Überlieferung mit einem gerade dreißig Jahre später stattfindenden, ebenfalls von einem von Bassewitz unternommenen Angriff auf Kyritz zusammen. Dieser zweite von Bassewitz, der des 1381 seitens der Bürgerschaft so tapfer abgeschlagenen Sturmes gedenken mochte, beschloß, diesmal mittelst eines unterirdischen Ganges in die Stadt einzudringen. Es traf sich aber, daß ein schwerer Verbrecher im Stadtturme saß, der hörte das Wühlen und Klopfen und ließ dem Bürgermeister melden, daß er ihm etwas Wichtiges entdecken wolle, wenn man ihm das Leben schenke. Das wurde zugestanden. Und nun erzählte der Gefangene von dem Wühlen und Graben, das er in der Tiefe gehört habe. Zur Sicherheit ließ man eine Trommel bringen und streute Erbsen darauf. Da begannen diese hin und her zu springen von der Erschütterung, die die unterirdische Arbeit verursachte. Nun war man sicher, und als bald danach der von Bassewitz, statt in der Kirche, wie sein Plan gewesen war, auf offenem Marktplatz zutage stieg, wurd er gefangengenommen, entwaffnet und mit seinem eigenen Schwerte hingerichtet. Schwert und Panzer aber befinden sich bis diesen Tag im Rathause, während die Stadt selbst alljährlich am Montage nach Invocavit ihr doppeltes Bassewitzfest feiert.
Das Jahr darauf brachte gleiche Streif- und Raubzüge, die sich diesmal aber gegen das nur zwei Meilen von Quitzöwel entfernte Perleberg richteten. Auch waren es keine Bassewitze, sondern etwelche Königsmarcks (deren einer damals Landvogt der Prignitz war), von denen die Stadt »gehudelt« wurde, wie der Chronist sich ausdrückt.
1383 starb Herzog Heinrich von Mecklenburg auf seinem Schlosse zu Schwerin. Er wurde betrauert als ein großer Verfolger der Räuber und Diebe, »deren er manche selber hängete, damit er sie von ihren Tagen brächte«, Worte, die die Junker auf Quitzöwel in der noch Unbedrohtheit ihrer Hälse lächelnd nachsprachen.
All das waren Vorgänge zwischen 1375 und 85, das eigentliche große Geschehnis jener Zeit aber, insonderheit, soweit die Prignitz mitspricht, war doch die Zerstörung Wilsnacks und der Aufbau der Wilsnacker Wunderblutkirche. Sehen wir, wie sich beides zutrug.
1383, am 16. August, steckte Heinrich von Bülow – ganz nach Art der Bassewitz und Königsmarck, deren Fehde sich gegen Kyritz und Perleberg gerichtet hatte – Dorf Wilsnack in Brand, bei welcher Gelegenheit auch das Kirchlein ausbrannte. Der Priester des Dorfes aber grub einige Zeit danach im Schutt umher, um das eine oder andere vielleicht noch zu retten, und fand auch in einer Vertiefung des steinernen Altars eine Hostienbüchse, deren drei geweihte Hostien weder verbrannt noch verkohlt, sondern wie mit Blut gefärbt waren. Er machte davon Anzeige nach Havelberg hin, und der Bischof Dietrich Mann kam, um sich über das Mitgeteilte zu vergewissern. Er fand alles bestätigt; auch der Erzbischof von Magdeburg stimmte zu, so daß schon 1384, ein Jahr nach dem Brande, das Wallfahrten begann. Als bald danach Johann von Wepelitz, an Dietrich Manns Stelle, den Havelberger Bischofsstuhl bestieg, war das »Heilige Blut von Wilsnack« schon in der ganzen christlichen Welt berühmt. Es kamen Pilger nicht nur aus der Mark und allen Teilen Deutschlands, auch aus Schweden, Dänemark, Norwegen, Polen und Ungarn. Die Ungarn kamen alle Jahr an 400 Mann stark und unterhielten ein Wachslicht von solcher Größe, daß es oben von dem hoch gelegenen Orgelchor her angesteckt werden mußte. Der Andrang war so groß, daß die durch den Dorfbrand verarmten Bauern sich als Gastwirte wieder auftaten, Handwerker gesellten sich ihnen, um für das Sorge zu tragen, was die Tausende von Pilgern brauchten, und so wuchs die Stätte derart daß man ihr Wall und Mauern und ein Stadtrecht gab. Allerlei Mittel dienten ebenso zur Bereicherung der Wilsnacker Kirche wie des Havelberger Stifts überhaupt. Eines dieser Mittel war die Sündenwaage. Jeder wußte mehr oder weniger genau, wieviel er wog; das war sein einfach leiblich Gewicht. Ergab sich nun, daß das Aufsetzen einer entsprechenden Anzahl von Steinen außerstande war, das Gleichgewicht der Waage herzustellen, so rührte das von der Sündenschwere her, deren Extragewicht durch allerlei Gaben balanciert werden mußte. Waren es Reiche, so traf es sich immer so, daß diese Sündenextraschwere ganz besonders groß war. Unter der Waage nämlich befand sich ein unsichtbar in das Kellergewölbe hinabführender Draht, mit dessen Hilfe man die Waage nachgiebig oder widerspenstig machte. Der Zweck rechtfertigte die pia fraus. Eine vielleicht noch größere Einnahmequelle bildeten die »bleiernen Hostien«, die man als »Pilgerzeichen vom Heiligen Blut« in Wilsnack kaufen konnte. Der Ertrag, der hieraus floß, war so groß, daß nicht nur die Wilsnacker Wunderblutkirche, sondern auch eine Prachtkapelle zu Wittstock (wo der Bischof meist residierte) davon bestritten werden konnte, des gleichzeitigen Domumbaus zu Havelberg ganz zu geschweigen. Täuschungen, wie die mit der Sündenwaage, liefen beständig mit unter und in ihrem Gefolge selbstverständlich auch Mißhelligkeiten und Verlegenheiten aller Art. Ein böhmischer Graf, der eine lahme Hand hatte, weihte genesungshalber dem Wunderblut eine silberne Hand, ohne daß die Weihgabe helfen wollte. Trotzdem wurde gepredigt, die silberne Hand habe geholfen, welcher Lug und Trug freilich auf der Stelle bestraft wurde. Denn der Kranke, den man irrtümlich abgereist glaubte, hatte Wilsnack noch nicht verlassen und hob, als er die Lüge hörte, seine lahme Hand auf, um sie dem Volk unter Verwünschungen zu zeigen.
Aber solche Verlegenheiten, so viel ihrer sein mochten, erfuhren immer rasch ihren Ausgleich. Ein von Wenckstern auf Lenzerwische hatte das Wunderblut verspottet und erblindete. Zitternd kam er, seine Sünde zu beichten und seinen erneueten Glauben zu bekennen, und in derselben Stunde kehrte dem Reumütigen das Augenlicht zurück. Unter allen Umständen aber, und das war die Hauptsache, setzten sich die Wallfahrten fort, die, soweit sie von Süden und Westen kamen, an Burg Quitzöwel vorüber mußten und das Ihrige dazu beitrugen, das ohnehin bewegte Leben daselbst immer bunter und anregender zu gestalten. Am meisten für die beiden Söhne Dietrich und Johann.
2. Kapitel
Dietrich und Johann von Quitzow bis zum Tode des Vaters. 1395
1385 wurde den beiden Quitzowschen Junkern ein Bruder geboren (noch nicht der jüngste), der in der Taufe den Namen Conrad empfing. Sein Leben war zu friedlichem Verlaufe bestimmt und endete doch tragisch wie das seiner Brüder. Wir kommen in einem späteren Kapitel darauf zurück.
Den Sommer und Herbst genannten Jahres 1385 verbrachten Dietrich und Johann von Quitzow, von denen jener jetzt neunzehn, dieser fünfzehn Jahre zählte, zu großem Teil auf Schloß Wittenberge, wo sich ihr Spiel- und Jugendgenosse, der etwas ältere Kaspar Gans zu Putlitz, eben damals um die Gunst eines schönen Fräulein von Restorf auf Haus Garsedow bewarb. Freilich vergeblich. Sie war bereits verlobt. Im November waren beide Brüder wieder in Quitzöwel daheim, und wenige Wochen später, zu Beginn der Adventzeit, trafen auch die Rühstädter und Kletzkeschen Oheime zu gemeinschaftlicher Begehung des Christfestes bei Köne von Quitzow ein. Mit ihnen zugleich erschienen Johann von Wepelitz (damals noch nicht Bischof), Otto von Rohr und Claus von Möllendorf, was aber dem festlichen Beisammensein eine ganz besondere Kurzweil und Anregung zu geben versprach, war, daß sich auch fahrendes Volk von zwei Seiten her eingefunden und zu gemeinschaftlichem Spiel in der großen Halle zusammengetan hatte. Da gab es denn einen wahren Wetteifer und Sängerkrieg. Einer aus dem Halberstädtischen sang ein neues Harzgrafenlied, ein Lied auf Graf Dietrich von Wernigerode, der, wegen seiner Räubereien und Viehdiebstähle, von den Magdeburgern bekriegt und nach erfolgter Gefangennahme nicht nur enthauptet, sondern zu besonderer Erniedrigung auch noch an den Füßen gehenkt worden war. Der, der diese Reime rezitierte, war derselbe, der, zehn Jahre früher, das andere schöne Harzgrafenlied von Busso von Alvensleben nach Burg Quitzöwel gebracht hatte, heut aber, sosehr auch das neue Lied ansprach, unterlag er doch einem gleichzeitig mit ihm eingetroffenen Spielmann aus dem Lübischen, der in einer reimlosen und halb dithyrambischen Ballade von den von den Schweden und Dänen und zumeist von der Hansa gefürchteten Seeräubern erzählte, die, seit Jahr und Tag, die Nord- und Ostsee befuhren und um der »Viktualien« willen, womit sie das belagerte Stockholm eine Zeitlang verproviantiert hatten, die Viktualien- oder Vitalienbrüder hießen. Andere nannten sie die »Likedeeler« oder Gleichteiler, weil ihr Raub, wenn er verteilt wurde, zu gleichen Teilen ging. Während des letzten Sommers aber, und das war der eigentliche Inhalt der Ballade, hatten sie gegen ein hochbordiges Orlogschiff der Stralsunder, das sie mit mehreren ihrer kleinen Schiffe tollkühn anzugreifen versuchten, unterlegen, und einige Hundert von ihnen waren gefangengenommen worden. Und nun entstand die Frage, wohin mit ihnen? Auf dem Orlogschiffe, so groß es war, hatte man nicht Ketten und Stöcke genug, um sie zu schließen, und die Gefangenen andererseits bei freier Bewegung zu belassen verbot sich, weil man sich wohl entsann, wie die Vitalienbrüder, bei sehr ähnlichen Gelegenheiten, die schlafende Schiffsmannschaft überfallen und erwürgt hatten. So kam man denn zu dem Entschluß, ihnen gegenüber dasselbe Mittel anzuwenden, das sie selbst einst in einem siegreich gegen die Dänen geführten Kriege, zur Marterung ihrer Gefangenen, erdacht hatten. Man nahm also Tonnen, deren das Schiff mehrere Hunderte hatte, schlug den unteren Boden aus und schnitt in den oberen Deckel ein Loch, gerade groß genug, daß ein Mensch den Kopf durchstecken konnte. Danach preßte man den Vitalienbruder in die Tonne hinein (nur mit dem Kopfe draußen) und schlug nun die Tonne von unten wieder zu. So wurden alle Gefangenen auf Achterdeck aufgestapelt und nach Stralsund abgeführt, wo man sie herausnahm, freilich nur, um ihnen am selben Tage noch in summarischem Verfahren die Köpfe vom Rumpf zu schlagen.
Alle, die dem Vortrage dieser Ballade gefolgt waren, entsetzten sich über die den Seeräubern angetane Marter, ganz übersehend, daß es nur das abenteuerlich Neue, das grotesk Ungewöhnliche war, was sie so stark beeinflußte, während das, was sich tagtäglich um sie her zutrug, verhältnismäßig wenig beachtet wurde, nicht weil es des Schrecklichen, wohl aber weil es des Grotesken und Abenteuerlichen entbehrte. Dessen war die Belagerung, Erstürmung und »Auspochung« des nur fünf Meilen von Quitzöwel gelegenen Rathenow ein gerade damals geführter sprechender Beweis. Wusterwitz berichtet darüber: »Um ebendiese Zeit aber war es, daß von seiten des persönlich abwesenden Erzbischofs Albrecht zu Magdeburg, des Fürsten Sigismund zu Anhalt und des Herrn Johann, Grafen zu Querfurt, die Stadt Rathenow, deren Mauern übel verwahret waren (dabei ganz der mehr als mutmaßlichen Verräterei des Johann von Treskow zu geschweigen) überfallen und eingenommen wurde. Worauf denn von den Kriegsgurgeln großer Übermut mit Verunehrung ehrlicher Frauen und Jungfrauen und viel andere Bosheit begangen worden ist. Bald nach Einnahme der Stadt aber haben alle Bürgersleute dem noch in Magdeburg weilenden Herrn Erzbischof – der ihnen mittlerweile den Friedrich von Alvensleben zum Hauptmann verordnet hatte – schwören und huldigen müssen. Und nunmehro, nach geschehener Huldigung, als die sich sicher fühlenden armen Leute das hervorgeholt, was sie bis dahin versteckt hatten, hat Fürst Sigismund von Anhalt in Abwesenheit des Erzbischofs, aber nicht ohne seinen Rat und Willen, ein öffentliches Gebot ausgehen lassen, daß jeder Bürger, der den Eid geleistet und durch seinen Eid in Pflicht genommen sei, mit Waff und Wehr dem Erzbischof auf seinem Wege nach Rathenow entgegenziehen solle, weil er (der Erzbischof) fürchte, von märkischem Kriegsvolk unterwegs überfallen zu werden. Und als nach diesem Gebote verfahren worden und die mit Waff und Wehr Ausgerüsteten aus dem Stadttore heraus waren, hat man das Tor hinter ihnen geschlossen und keinen wieder zur Stadt hineingelassen, ja man hat ihnen ihre Weiber und Kinder nachgetrieben und alle stracks von Rathenow hinwegziehen heißen. Ach, da hat man ein großes Jammern und viel Wehklage gehört, denn nicht nur Betagte, sondern auch Kranke sind mit ihren Kindern in den harten und kalten Winter hinausgestoßen worden. Und keinem Hungrigen ist ein Bißlein Brot und keinem Durstigen ein Tränklein Wasser geworden; und so sind die meisten verblichen, und nur wenige haben sich durchgeschlagen und Freunde gefunden zu Trost und Hülfe. Mit eins aber ist der Herr Erzbischof, wie man lange voraus verkündigt hatte, wirklich in die Stadt Rathenow gekommen, und was noch von Essen und Trinken übrig gewesen ist, das ist aufgegessen und ausgetrunken und zuletzt aus den leeren Fässern ein großes Freudenfeuer gemacht worden. Und des Herrn Markgrafen zu Brandenburg Wappen hat man besudelt und mit Hohn und Schmach von allen Tafeln gelöschet.«
Das waren Elendsbilder aus der nächsten Nähe der Burg, und wenn das Bild der in die Schiffstonnen eingesetzten Vitalienbrüder auch mehr zur Einbildungskraft der Quitzöwler gesprochen und in ihren Herzen eine lebhaftere Mißbilligung hervorgerufen haben mochte, so läßt sich doch annehmen, daß es den unter alltäglicheren Formen aus Rathenow Vertriebenen, soweit sie hülfesuchend anklopften, an Mitleid und Teilnahme bei der Bewohnerschaft der Burg nicht gefehlt haben wird. Aber Mitleid und Teilnahme waren nicht die Dinge, denen sich die Quitzowschen, auch wenn sie gewollt hätten, auf die Dauer hingeben durften, am wenigsten Köne von Quitzow, dessen spätere Lebensjahre, beinah mehr noch als die voraufgegangenen, ihn zu Bewährung kriegerischer Tat und Gesinnung aufforderten. Am meisten, als das Jahr 1391 einen speziellen Quitzowkrieg, und zwar mit den Herzögen von Lauenburg und Lüneburg, brachte.
Was Veranlassung zu dieser Fehde bot, hüllt sich in Dunkel und mag auch im Dunkel bleiben. Es genügt für uns, daß Lüneburg mit einem Einfall in die Altmark und mit der Wegnahme verschiedener fester Plätze begann. Und kaum daß Schnackenburg und Gartow (das waren die Namen der festen Plätze) genommen waren, als auch schon der Lauenburger Herzog Erich ebenfalls auf dem Plan erschien, um sich, nach erfolgter Vereinigung mit den Lüneburgern, von der Altmark her gegen den älteren Johann von Quitzow, einen Bruder Köne von Quitzows, auf Schloß Kletzke, zu wenden. Alles, was Quitzow hieß, kam jetzt herbei, diese festeste Burg der Familie gegen die Doppelmacht der beiden Herzöge zu schützen, und nur Köne von Quitzow blieb aus, ein momentan überraschendes Ausbleiben, dessen Veranlassung indes sehr bald offenbar werden sollte. Denn als die Bedrängnis der Kletzker Burgleute, die, sich Luft zu schaffen, eben einen Ausfall planten, den höchsten Grad erreicht hatte, zeigte sich unerwartet ein Trupp Ritter und Reisiger im Rücken der Lauenburg-Lüneburger und brachte diesen, in ihr Lager einbrechend, eine Niederlage bei, deren Folge das Abstehen von einer Fortsetzung der Belagerung war. Die zum Entsatz Herbeigeeilten aber waren die Quitzöwler gewesen: Köne von Quitzow samt Dietrich und Johann, die sich hier zum erstenmal an der Seite des Vaters bewährten. An die fünfzig Gefangene wurden eingebracht, und tags darauf war Tedeum, wobei der alte Burgherr erst seinem Gott und bei dem sich anschließenden Festmahle der gesamten Vetterschaft dankte. Der eigentliche Held des Tages aber war Köne von Quitzow, der mit dieser Befreiung von Burg Kletzke nicht nur die letzte, sondern auch die beste kriegerische Tat seines Lebens getan hatte.
Der Rest seiner Tage verlief ebenso friedlich wie häuslich, und was sich von noch zu Nennendem ereignete, war recht eigentlich ein Hausereignis: im Sommer 1392 ward ihm abermals ein Sohn geboren, der vierte, der in der Taufe den Namen Henning empfing. Sechsundzwanzig Jahre nach Dietrich, zweiundzwanzig nach Johann geboren, sah er sich in die nun bald beginnenden Wirren und Kämpfe der eigentlichen Quitzowzeit nicht mit hineingezogen und überlebte den Ruhm und Niedergang seines Hauses.
Als er drei Jahr alt war, starb der Vater: Köne von Quitzow, »der hofliche alte Reuter«.
Und Hennings Brüder: Dietrich und Johann, waren von Stund an die Häupter der Familie.
3. Kapitel
Dietrich und Johann von Quitzow verheiraten sich. 1394 und 1400
Köne von Quitzow starb 1395. Ein Jahr vorher war es ihm noch vergönnt gewesen, die Hochzeit seines Sohnes Dietrich mitzufeiern, der sich am Montage nach Mariä Heimsuchung, den 6. Juli 1394, mit Elisabeth Schenk von Landsberg, Tochter des Schenken von Landsberg auf Schloß Teupitz, vermählte. Dies umfangreiche Schloß, an der Grenze von Mark und Lausitz, würde zu festlicher Begehung der Hochzeit vollkommen ausgereicht haben, Rücksichten aber, die man auf den ausschließlich in der Prignitz begüterten Anhang der Quitzowfamilie nehmen zu müssen glaubte, bestimmten den Vater der Braut, den alten Apitz von Schenk, die Hochzeit statt auf Schloß Teupitz lieber in Berlin stattfinden zu lassen, und zwar um so mehr, als der Bräutigam, Dietrich von Quitzow, den Wunsch ausgedrückt hatte, die Trauung durch den ihm und seiner Familie seit lange befreundeten Berliner Propst Ortwyn an Sankt Nikolai vollzogen zu sehen.
Schon am Sonnabend, den 4. Juli, hatte sich die zahlreiche Verwandtschaft samt vielen ansehnlichen Freunden, geistlichen wie weltlichen Herren, in Berlin eingefunden. Von seiten der Quitzowfamilie waren es: Kuno von Quitzow auf Kletzke, Wedego von Quitzow auf Rühstädt, Claus von Quitzow auf Stavenow und Lüdeke von Quitzow, Propst zu Havelberg, zu denen sich, um nur die hervorragendsten zu nennen, der Havelberger Bischof Johann von Wepelitz, ferner der Spiel- und Jugendgenosse der Quitzowschen Brüder Kaspar Gans zu Putlitz sowie Hans von Rohr auf Schloß Meyenburg, Matthias Sternebeck und Hinrik Grumbkow gesellten. In gleicher oder noch größerer Zahl war der Anhang der Schenken von Landsberg erschienen, unter ihnen Heinrich und Hans von Schenk, Oheime der Braut, Conrad Abt von Zinna, Lippold von Bredow, Hauptmann der Mark, Otto von Kittlitz, Herr zu Baruth, Hans von Bieberstein, Herr zu Storkow und Beeskow, und viele andere.
Der Brautvater, Apitz von Schenk, hatte, gemeinschaftlich mit den lausitzischen Herren, in einem guten und geräumigen Gasthofe Quartier genommen, da die Zimmer desselben aber trotz ihrer Zahl und Geräumigkeit nicht ausreichten, so war, für den eigentlichen Hochzeitstag, noch ein großes, in der Nähe des Heiligengeisthospitals gelegenes Haus in der Spandauer Straße gemietet worden. Der abendliche, das Fest abschließende Tanz sollte dann, altem Herkommen gemäß, auf dem Rathause gehalten werden. Ebenso lieferte das Rathaus die nötigen Tischgerätschaften. Allerdings bestand auch um diese Zeit schon eine Verordnung, die dem immer mehr überhandnehmenden Aufwand entgegentreten sollte, diese Verordnung aber hatte nur für die Bürgerschaft Geltung, während die höheren Stände davon ausgenommen waren. Jedenfalls säumte Herr Apitz von Schenk nicht, von diesem Recht der Ausnahme Gebrauch zu machen. Alles war durch ihn aufs glänzendste hergerichtet worden, und schon am Sonntagabend erschienen, wie zur Vorfeier, die Brautjungfern in den Zimmern Elisabeths von Schenk, um daselbst von ihr bewirtet zu werden. Damit war die Feier eingeleitet. Eine Art Polterabend.
Am folgenden Tage begann das eigentliche Fest und währte von morgens sieben bis abends elf, also durch sechzehn Stunden hin in unausgesetzter Folge. Woraus sich schließen läßt, daß die Lust- und Vergnügungskräfte damals um nichts schwächer waren als heutzutage.
Begleiten wir das Paar und seine Gäste durch den Tag hin.
Um sieben Uhr früh begrüßte Dietrich von Quitzow seine Braut, um ihr ein Paar Schuh und Pantoffeln zu überreichen. Dann schritt man, nach Sitte der Zeit, zum »Brautbade«, welchem festlich arrangierten Zuge (das Badehaus war auf dem Krögel) alle zur Hochzeit Geladenen sich anschlossen. Voran die Stadtpfeifer mit Zinken und Schalmeien, mit Zimbel und Geige. Vor dem Zuge her bewegte sich die Straßenjugend, aber auch Pickelheringe waren da, die Gesichter schnitten, Kobolz schossen, Rad schlugen und jedes alte Mütterchen, das ihnen begegnete, umarmten. So ging es durch die Spandauer Straße hin. In dem Badehause, das sich in zwei große Räume teilte, badeten alle, dann kehrte man, nach einem in dem Obergeschoß eingenommenen Frühmahl, nach dem Brauthause zurück, wo nun Braut und Bräutigam für die Trauung gekleidet wurden. Als dies geschehen, gab Dietrich seiner Braut den Brautkranz, ein Geflecht aus Rosmarin, das man mit Goldschnur und Goldblättchen geziert hatte. Mit diesem Kranze wurde die Braut geschmückt und empfing nun ein Bund Schlüssel als Zeichen ihrer von heut an zu übernehmenden hausmütterlichen Würde. Hierauf wurden vier Wachskerzen angezündet und von vier Gästen gehalten, zugleich aber füllte man einen Becher mit Wein, den Dietrich seiner Braut zu kredenzen hatte. Diese leerte den Becher bis zur Hälfte, verneigte sich dann und gab ihn an Dietrich zurück, der ihn seinerseits bis auf den letzten Tropfen austrank. Alle Gäste wurden während dieser Zeremonie mit Sträußen und Kränzen bedacht und da diese Kränze meist aus Würzkräutern bestanden, so verbreiteten sie Wohlgeruch durch alle Zimmer.
Und nun schickte man sich zum Kirchgange an. Es war drei Uhr geworden und der Weg bis zur Nikolaikirche nicht weit, um aber der Schaulust der Menge zu genügen, machte man einen weiten Umweg, und so kam es, daß der hochzeitliche Zug erst um vier Uhr vor der Nikolaikirche hielt. Die Trauung verrichtete hier, wie festgesetzt, Propst Ortwyn, und als Braut und Bräutigam ihm ihre Namen angegeben und die Frage, »ob sie sich gegenseitig als Mann und Frau begehrten«, mit »ja« beantwortet hatten, sprach er: »Ego conjungo vos in matrimonio, in nomine Dei patris, filioque et spiritu sancti. Amen.« Dann segnete er den Trauring ein, besprengte ihn über Kreuz mit Weihwasser und überreichte ihn Dietrich, der nun den Ring an den Ringfinger der linken Hand seiner Braut steckte. Darauf folgte zunächst ein Gebet dann Anrede an Brautpaar und Versammlung und hierauf erst die Brautmesse, die von den Lehrern, die damals »Schulgesellen« hießen, gesungen wurde. Dann kehrte man, es war mittlerweile fünf Uhr geworden, in derselben Ordnung, wie man gekommen, nach dem Gasthause zurück, von dem aus man sich, nach stattgehabter Einsegnung des Brautbettes (eine Zeremonie, die die Eheschließung erst perfekt machte), nach dem in nächster Nähe gelegenen Hochzeitshause begab.
Hier waren achtzehn Tische zu je zehn Personen gedeckt, darunter ein Trompeter- und Pfeifertisch, zwei Kindertische, zwei Mägdetische, zwei Jungferntische. In der Mitte der Haupttafel saß das Brautpaar, umgeben von seinen nächsten Anverwandten. Die »Schulgesellen«, die schon während der Trauung die Brautmesse gesungen hatten, hatten jetzt das Geschäft der Vorschneider und Zerleger. Possenreißer waren unter die Spielleute verteilt, und immer, wenn die Musik schwieg, suchten sie die Pausen durch Gesichterschneiden, Verrenkungen und Witzreden zu füllen. Unter beständigem Zutrinken wurden Gesundheiten ausgebracht, und um diese Zeit, wo die Herzen fröhlicher gestimmt und zum Geben geneigt waren, erschienen auch die, denen es nach einem Trinkgeld oder Geschenk verlangte. Zunächst kamen die Köche, dann der Bratenmeister mit einer Schüssel, auf welcher, attrappenartig, ein Braten lag. Eigentlich aber war es eine große Ledertasche, drin jeder der Gäste seine Gabe hineintat. Dem Bratenmeister folgte der Kellermeister mit einem großen Humpen, der zu gleichem Zwecke reihum ging. Und dann kamen die Bratenwender, der Schenk, die Schüsselwäscherinnen und endlich die große Büchse für die Armen.
Um sieben Uhr hatte man abgesessen und erhob sich von den Tafeln, sich nunmehro nach dem Rathause zu begeben und in dem großen Saale daselbst zu tanzen. Es war des Jubels kein Ende. Ganz zuletzt aber wurde, nach alter Sitte, der Braut das Strumpfband abgetanzt und zerschnitten unter die Gäste verteilt.
Erst um elf Uhr nachts begleitete man das junge Paar in Prozession nach seinem Gasthause zurück.
Das war 1394.
Sechs Jahre später folgte Johann von Quitzow dem Beispiele seines älteren Bruders Dietrich und vermählte sich mit Agnes von Bredow, Tochter Lippolds von Bredow, Hauptmanns und Verwesers der Mittelmark. Es durfte damals heißen: Felix Quitzowia nube. Die Bekanntschaft mit der reichen, ebenso durch Besitz wie politisches Ansehen hervorragenden Bredowfamilie hatte sich auf der Hochzeit Dietrichs eingeleitet und war seitdem fortgesetzt worden, insonderheit seit 1397, wo beide Brüder einen mehrtägigen Besuch auf dem damals von Lippold von Bredow bewohnten Schloß Neustadt an der Dosse gemacht hatten. Als sie von diesem Besuche heimkehrten, stand es bei Johann fest, um die noch jugendliche Tochter des Hauses werben und in der Bredowfamilie selbst festen Fuß fassen zu wollen, worin er sich durch seinen Bruder Dietrich, dem nichts wünschenswerter erschien als eine derartige Verschwägerung, von Anfang an unterstützt sah. Auch auf Bredowscher Seite zeigte man sich einer Verbindung mit dem mehr und mehr zu Macht und Geltung kommenden Quitzowschen Hause geneigt. Wann die förmliche Verlobung stattfand, wird nicht gemeldet, dagegen wissen wir, daß im August 1400 die Hochzeit in Stadt Brandenburg gefeiert wurde. Die Gäste waren zu großem Teil dieselben wie sechs Jahre früher bei der Dietrich von Quitzowschen Vermählung, nur die lausitzischen Elemente fehlten und wurden durch verschiedene havelländische Familien, unter denen, außer den Bredows selbst, die Rochows und Stechows obenan standen, ersetzt. Die sich über mehrere Tage hin ausdehnenden Festlichkeiten entsprachen im wesentlichen dem, was wir bei Gelegenheit von Dietrich von Quitzows Hochzeit schilderten, und nur in der Mitgift zeigte sich ein Unterschied. Diese war zunächst auf eine hohe Geldsumme festgesetzt worden, als aber die Zahlung derselben an allerlei Schwierigkeiten scheiterte, sah sich Lippold von Bredow bewogen, seinem Schwiegersohne das von Anfang an von diesem bezogene Schloß Plaue zu vollem Besitz zu bewilligen. Über die Tatsache, daß diese Bewilligung mit vielleicht zweifelhaftem Rechte geschah, weil der Erzbischof von Magdeburg sich als rechtmäßigen Herrn des Schlosses betrachtete, geh ich hier hinweg, weil das Hineinziehen oder gar die Betonung solcher nebenherlaufenden, wenn auch relativ wichtigen Dinge den Überblick über den ohnehin an Zersplitterung und unausgesetzten Zickzackbewegungen leidenden Quitzowstoff beständig aufs neue stört. Es kann uns genügen, daß Lippold von Bredow Schloß Plaue tatsächlich abtrat und daß Johann von Quitzow, unmittelbar nach der Hochzeit, wenn auch damals noch nicht als Schloßherr, seinen Einzug in dasselbe hielt.
Dieser Einzug im Sommer 1400 in Schloß Plaue, das von jenem Tag an noch vierzehn Jahre lang von den Quitzows gehalten wurde, war der entscheidende Moment im Leben der beiden Brüder und führte, wie zunächst zu Macht und Größe derselben, so schließlich zu beider Demütigung und Untergang.
4. Kapitel
Die Quitzows auf ihrer Höhe. 1410
Der Einzug in Schloß Plaue war der entscheidende Moment im Leben der Quitzows. So schloß unser voriges Kapitel. Dietrich, der ältere, der bedeutendere, jedenfalls der politisch planvollere der beiden Brüder, kehrte von Brandenburg beziehungsweise von Schloß Plaue nach Quitzöwel zurück, und auf dieser Rückfahrt mochten sich ihm zum ersten Male Gedanken und Wünsche, die bis dahin ein bloßes Spiel seiner Phantasie gebildet hatten, als zu verwirklichende vor die Seele stellen. Und nach Lage der Sache mit gutem Grunde. Denn er durfte sich mehr oder weniger schon damals neben seinem persönlichen auch ein politisch-militärisches Übergewicht zuschreiben, ein Übergewicht, das politisch in seiner Günstlingsstellung zu Markgraf Jobst von Mähren, dem damaligen Landesherrn der Mark (dessen beständiger Geldverlegenheiten er sich allzeit hülfreich erbarmte), militärisch aber zu nicht unwesentlichem Teil in der strategischen Beschaffenheit der ihm zur Verfügung stehenden festen Punkte seinen Grund hatte. Zog man nämlich eine Schräglinie durch die Mark, so war er es, der die beiden Flügel und mit diesen zugleich auch das Zentrum in Händen hielt. Freilich war nur ein Bruchteil davon sein eigen, aber der Einfluß, den er im Westen (Prignitz) auf die gesamte Quitzowsche Vetterschaft samt Kaspar Gans zu Putlitz, im Osten (Lausitz) auf die Schenken von Landsberg und ihren Anhang, im Zentrum (Plaue mit Havelland) auf seinen Bruder Johann und die reich begüterten Bredows übte, war so groß, daß er diese bundesgenössische Kraft seiner eigenen ohne weiteres zurechnen konnte. Das tat er denn auch, und weil sich kein Fehler in seine Berechnung einmischte, so begann jetzt von 1400 bis 1410 eine Periode beispielloser und, soweit man Kleines mit Großem vergleichen darf, an die Napoleonische Zeit erinnernder Erfolge. Diese zehn Jahre heißen die Quitzowzeit und bilden ein wenigstens zunächst noch des tragischen Ausgangs entbehrendes Drama, darin folgende Mitspieler auftraten:
Eine lange Reihe sich um die beiden Hauptgestalten gruppierender Personen! Träfe sich's nun so, daß diese dramatis personae unausgesetzt und ausschließlich an der Seite der Quitzows oder aber umgekehrt unausgesetzt und ausschließlich gegen dieselben gekämpft hätten, so würde sich in der Erzählung dieser Kämpfe, trotz ihrer großen und verwirrenden Ähnlichkeit untereinander, doch, mit Hülfe von Scheidungs- und Gruppierungskunst, etwas wie Klarheit herstellen lassen, da sich's aber leider so trifft, daß die gesamte Reihe der vorstehend aufgeführten weltlichen und geistlichen Machthaber, je nach Vorteil und Sachlage, Bundesgenossen oder Widersacher, will also sagen, heute quitzowsch und morgen antiquitzowsch waren, so haben wir in der Geschichte dieser endlosen Überfälle, Belagerungen, Erstürmungen und Plünderungen ein derartig wirres Durcheinander, einen solchen Rattenkönig von Verschlingungen, daß die Lösung derselben zwar nicht als ein absolut unmögliches, aber doch jedenfalls als ein sehr schwieriges und sehr undankbares Unternehmen anzusehen ist. Undankbar, weil auch im Falle des Gelingens eine Geduldsprobe für den Leser. Denn wer kennt nicht aus eigener Erfahrung die Schrecknisse jener aus hundert Vettern- und Enkelnamen zusammengesetzten Prozeß- und Familiengeschichten, in denen sich alle Kalenderheiligen und alle Geburtstage bis zur Großmutter hinauf ein Rendezvous geben! Aber eine solche mit Namen und Daten gespickte Familienprozeßverwirrung ist eine Kleinigkeit neben der Quitzowkampfverwirrung von 1400 bis 1410, weshalb ich – unlustig, in ein Labyrinth hinabzusteigen, »von dannen keine Wiederkehr« – mich an dieser Stelle darauf beschränke, die Resultate dieser zehnjährigen Anstrengungen einschließlich alles durch Erbschaft, Heirat und Verpfändung Erworbenen aufzuzählen. Am Schlusse des Jahres 1410 hatten die Quitzows folgende Städte, Schlösser und Burgen inne:
Irrtümlichen Überlieferungen folgend, wird sogar von »vierundzwanzig Burgen und Schlössern« gesprochen, die die Quitzows um 1410 besessen haben sollen. Das ist aber übertrieben. Indessen auch das hier Aufgezählte repräsentiert einen Machtzustand, der anderweitig, auf dem weiten Gebiete zwischen Oder und Elbe, wenigstens damals nicht anzutreffen war, und erklärt zur Genüge, daß die hervorragendsten weltlichen und geistlichen Fürsten Norddeutschlands in eine gewisse Notlage gerieten, in der sie sich vor dem Trotz und der Energie dieser märkischen Edelleute beugen mußten.
Es ist Wusterwitz, dessen Chronik wir gerade hierüber die allerinteressantesten Mitteilungen verdanken. Er schreibt: »... Um diese Zeit war es, daß Dietrich von Quitzow, auf daß er ja nicht zu Ruh und Frieden käme, den Herzögen Rudolf und Albert zu Sachsen ›abzusagen‹ für gut fand. Und was als das Schlimmste dabei gelten konnte: beide löbliche Herzöge haben sich solch ungerechten Leuten gegenüber zu jeder Nachgiebigkeit bereit gezeigt und an den Landeshauptmann in Mark Brandenburg geschrieben und sich allenthalben zu Recht erboten, so die Quitzows begründete Klage wider sie hätten. Landeshauptmann über die Mark aber ist in genanntem Jahre (1409) der Herzog Swantibor von Pommern-Stettin gewesen und hat besagter Herzog von Pommern-Stettin mit großer Müh und Arbeit sowohl den Adel wie die Städte der Mark zu Berlin versammelt und zu solcher Versammlung auch den Dietrich von Quitzow berufen und ihm vorgehalten und geraten, daß er die Gerechtigkeitserbietung der Herzöge zu Sachsen annehmen solle. Dietrich von Quitzow aber, als ein Feind und Widersacher aller Gerechtigkeit und alles Friedens, hat solch Erbieten und solche Worte nur verachtet und verlacht.«
In diesem Tone klagt Wusterwitz weiter, zugunsten der sächsischen Herzöge hinzusetzend, daß der anscheinende Kleinmut derselben nicht bloß in der Unzulänglichkeit ihrer Machtmittel, worüber sogar Zweifel gestattet seien, sondern vor allem in ihrer großen Güte (um ihre Leute vor Schaden zu bewahren) und in ihrem gesetzlichen Sinne den eigentlichen und ausschlaggebenden Grund gehabt habe. Denn die Herzöge hätten sehr wohl gewußt, daß eines Landes Obrigkeit nicht allein mit den Waffen, sondern auch durch Klugheit und Gesetzlichkeit gezieret sein solle, weshalb sie, der Klugheit und Gesetzlichkeit zu genügen, zuvörderst allerlei Bündnisse nachgesucht und vor allem die märkischen Städte, die zumeist unter den Quitzows gelitten, zu gemeinschaftlichem Vorgehen aufgefordert hätten.
»Es ist aber aus Furcht vor den Quitzowen«, so fährt er fort, »in der ganzen Mark Brandenburg keine Stadt gefunden worden, die sich mächtig genug gefühlt hätte, den Herzögen zu Sachsen zu Beistand und Hülfe zur Seite zu treten. Denn alle Städte sind mit Quitzowschen Schlössern samt vielen festen Plätzen ihres Anhangs derart umgeben gewesen, daß die Bürgersleute kaum gewagt haben, bei Gefahr ihres Leibes und Lebens, vor den Toren ihrer Stadt spazierenzugehen. Überall hat die Hinterlist gelauert, und so die Bürger und Bauern im Felde gearbeitet haben, haben die Quitzowschen die Leute gefangengenommen und ihnen dabei vorgehalten, daß man sie bloß vorläufig, um dieser oder jener Ursach willen, zu Pfand gesetzt habe. Denn in Auslegungen und Wortstreitigkeiten sind sie jederzeit von einer geschwinden und wunderbaren Klugheit gewesen, so daß sie Bosheit in Einsicht verwandelt und die Gerechtigkeit von der Ehre abgeschieden haben.«
Unter den Städten, die zu der genannten Zeit den Mut eines Bündnisses wider die Quitzows nicht aufzubringen vermochten, waren auch die Schwesterstädte Berlin und Cölln, die durch alle voraufgehenden Jahre hin, und zwar im Gegensatze zu den meisten anderen Bürgerschaften der Mark, um die Gunst der mächtigen Familie gebuhlt hatten. Endlich aber, am 3. September 1410, hatte Dietrich von Quitzow, vielleicht der ewigen Rücksichtnahme, vielleicht auch kleiner Gegenforderungen und Nadelstiche müde, durch Überfall und Viehwegtreibung den Berlinischen gezeigt, daß ihr Wohlwollen und ihre Freundschaft ihm wenig, ihre Furcht aber viel bedeute, was unsern mindestens ebenso von berlinischem als quitzowschen Antagonismus erfüllten Dom-Brandenburger (Wusterwitz) zu nachstehender, ganz ersichtlich von einer gewissen Schadenfreude diktierten Philippika hinriß: »Und nun, Ihr Berlinischen, jetzt endlich seht Ihr's, welch schöne Vergeltung Euch Eure mannigfaltigen Wohltaten gebracht haben. Als die Quitzowschen, zusamt dem Grafen zu Lindow, das Schloß Bötzow gewonnen hatten, ei, wie haben da die Berlinischen praktizieret und Anschläge gemacht, daß die Quitzows wieder zu der Hauptmannschaft in Mark Brandenburg erhoben werden möchten. Ja, wie haben sie da die Quitzows hofieret und traktieret? Da hat man gesehen, wie sie diesen Dietrich von Quitzow zu glänzenden Banketten geladen und ihm zu Ehren den Tisch mit schönen Frauen und Saitenspiel gezieret haben. Und wer ihn nicht hat können zu Gaste laden, ist nicht mehr unter die Reichen gezählt und von ihrer Gesellschaft ausgeschlossen worden. Item, es ist nicht genugsam zu sagen, wie man ihn, ebendiesen Dietrich von Quitzow, mit Laternen, Fackeln und Freudengesängen zu seiner Herberge geführt und ihm einen Abendtanz mit schönen Jungfrauen und Weibern gehalten, desgleichen ihn mit welschem Wein verehret und beschenket hat. Und nun, Ihr Berlinischen, was ist davon kommen? Ohne daß er Euch abgesagt hätte, hat er Euch das Vieh weggetrieben und etliche von Euren Leuten getötet und verwundet und sechzehn Namhaftige gefangengenommen. Und den Nikolaus Wyns, der doch aus einem Eurer besten und altgesessenen Geschlechter gewesen, den hat er als einen öffentlichen Räuber und Dieb behandeln und ihn mit den Füßen in eiserne Fesseln legen lassen.«
So Wusterwitz aus dem Jahre 1410.
Das Quitzowansehen stand auf seiner Höhe.
5. Kapitel
Dietrich und Johann von Quitzow zur Taufe bei Kaspar Gans von Putlitz zu Tangermünde. Der Wendepunkt
So war die Machtstellung der Quitzows, als im selben Jahre noch (1410) ein die Familie schmerzlich und unerwartet treffendes Ereignis den Wechsel der Dinge teils einleitete, teils für die Zukunft verkündete. Was diesem schmerzlichen Ereignis unmittelbar voraufging, waren besondere Fest- und Freudentage gewesen, zwei Taufen, von denen die eine zu Friesack im Dietrich von Quitzowschen Hause, die andere zu Tangermünde bei dem so nahe befreundeten Kaspar Gans zu Putlitz gefeiert worden war.
Die Quitzowsche Taufe, womit die Reihe der Festlichkeiten begann, fand, wie herkömmlich, sechs Wochen nach der Geburt des Kindes statt. Das war am 5. August. Schon drei Tage vorher hatten sich die Geladenen auf Schloß Friesack versammelt, unter ihnen die beiden Schwiegerväter der Quitzowfamilie: Schenk von Landsberg auf Teupitz und Lippold von Bredow auf Neustadt a. D. beziehungsweise Kremmen, dazu der Bischof Henning von Bredow, Bertram von Bredow auf Bredow, Hans von Torgau, Heinrich von Stechow, Albrecht von Uchtenhagen und Werner und Pape von Holzendorf. Was aber der Feier eine besondere Weihe gab, war, daß sich bei dieser Gelegenheit die vier Quitzowschen Brüder, also einerseits Dietrich und Johann, andererseits Conrad und Henning, aller Wahrscheinlichkeit nach auf Jahre hin zum letzten Male zusammenfanden. Es war nämlich beschlossene Sache, daß, unmittelbar nach Schluß dieser Friesacker Taufe, der eben erst von der Havelberger Domschule kommende, nicht mehr als siebzehn Jahr zählende Henning von Quitzow eine Studienreise nach Paris antreten sollte. Den 3. August war Kirchgang. Um zehn Uhr vormittags setzte sich der Zug in Bewegung, voraus Spielleute mit Geigen, Zinken und Schalmeien, wobei der Baßgeiger sein großes Instrument gitarrenartig an einem Bande trug. Dann folgten die Frauen, in deren Mitte Frau Elisabeth von Quitzow ging. In gleicher Ordnung kehrte man ins Schloß zurück, wo den Tag darauf ein verspätetes Mittel-Kindelbier und am 5. die Taufe selbst samt dem eigentlichen Kindelbier abgehalten wurde. Die Herrichtung der Festtafel entsprach dem Glanz des Hauses, trotzdem aber befleißigte man sich einer sonst nicht üblichen Mäßigkeit, weil die bei Kaspar Gans ausstehende Taufe fast im unmittelbaren Anschluß an die Friesacker Tage gefeiert werden sollte.
Schon am 7. August brach man denn auch nach Schloß Tangermünde hin auf. Es waren dieselben Gäste wie zu Friesack, ein überaus glänzender Zug, der in seinem Glanze nicht an die Not des Landes gemahnte. Bewaffnete Knechte ritten vorauf; dann folgten die Ritter und Edelleute mit denjenigen Damen, die zu Pferde gestiegen waren, während die, die nicht Lust zum Reiten gezeigt hatten, die Fahrt zu Wagen machten. Daran schlossen sich die Zofen und Mägde, bis abermals bewaffnete Knechte dem Ganzen einen Abschluß gaben. Im vorderen wie hinteren Zuge wehte das schräggeteilte Quitzowsche Banner, im roten Felde ein weißer und im weißen Felde ein roter Stern. Rathenow war halber Weg. Bei Fischbeck erreichte man die Elbe, zugleich die Stelle, von der aus eine von jenseits gekommene Fähre die Taufgäste nach dem anderen Ufer hinüberbringen sollte. Schloß Tangermünde ragte im Abendhimmel auf. Alles war festlich und die Fähre selbst aufs reichste mit Blumen geschmückt, ja, drüben am Ufer standen Putlitzsche Trompeter und Pauker, die die Gäste schon von fernher mit ihren Fanfaren begrüßten. Aber die Zahl derer, die hinüber wollten, war für die Fähre viel zu groß, und viermal mußte sie den Fluß kreuzen, eh alle drüben waren. Nun ging es auf das jüngst erst von Kaiser Karl IV. erbaute Schloß Tangermünde zu, wo sich die havelländischen Gäste mit denen aus der Altmark und Prignitz vereinigten. Am nächsten Tage folgte der Taufakt in der von prächtigem Gestein funkelnden Schloßkapelle, woran sich, unmittelbar fast, ein ausgewähltes Mahl schloß. Die dabei, nach Sitte der Zeit, vorzugsweise zur Verwendung kommenden Gewürze waren Pfeffer und Safran. Ein anderer charakteristischer Zug der damaligen Kochkunst bestand darin, nichts zu verschmähen und alle Tierteile: Köpfe, Füße, Zunge, Hirn, Lunge, Leber, Nieren, Gekröse, gleichmäßig in Delikatessen umzuwandeln. Dazu die Schaugerichte: turmartige Kuchen aus Pastetenteig, in die man lebendige Vögel hineinsetzte, die dann beim Öffnen wegflogen. Als das Gratias gesprochen war, erhob man sich und traf Anstalten zum Tanz. Den Beginn machte der von zwölf Paaren getanzte Zwölfmonatstanz; dann kam der polnische Tanz, der Kapriolentanz, der Drehtanz, der Taubentanz. Den Schluß aber bildete der Totentanz, der sehr beliebt war und wobei man durchs Los entschied, wer den Toten zu spielen habe. Das Los traf Conrad von Quitzow von Schloß Hohenwalde. Der erschrak, weil er schon während der Reise von Todesahnungen erfüllt gewesen war. Es galt aber, von diesem Erschrockensein nichts zu zeigen, und als er eine kurze Zeit getanzt hatte, fiel er, wie's das Spiel erheischte, mitten im Saal um und spielte den Toten. Und nun schwieg auch die lustige Musik, und ein dumpfer Trauergesang erscholl, während dessen die Damen an den Toten herantraten und ihn küßten. Als er den Kuß auch der letzten empfangen hatte, stand er wieder auf, und der Drehtanz begann in aller Lustigkeit von neuem.
Damit schloß die Feier, und weil das Doppelfest alle Teilnehmer ermüdet haben mochte, rüsteten sie sich am andere Morgen bereits zur Abreise. Ziemlich früh schon erreichte man die Fähre, die, wie drei Tage zuvor, mit Laub und Blumen geschmückt war. Ebenso gebot es sich auch heute wieder, den Übergang in Gruppen zu machen, und nur das »Wie« blieb noch festzustellen. Endlich entschied man sich dahin, auch bei diesem die Rückkehr einleitenden Übergange dieselbe Reihenfolge wie beim Heranzug innehalten zu wollen: zunächst also die voraufreitenden Knechte, dann die Frauen und Ritter, danach die Zofen und Dienerschaften und schließlich die Nachtrabsknechte, die schon auf der Herfahrt den Abschluß gebildet hatten. Ehendiesen Nachtrab sollte Johann von Quitzow, den voraufreitenden Trupp aber der ältere Bruder führen.
Und nach diesem Abkommen wurde verfahren.
Der ganze Vortrupp, vierundzwanzig reitende gewappnete Knechte, ritten auf die Fähre hinauf, und als sie Stand und Ordnung genommen, erschien Dietrich von Quitzow, dem sich, im letzten Augenblicke, sein Schwager Albrecht von Schenk und gleich danach auch sein Bruder Conrad von Quitzow (der Hohenwalder) anschloß. Die Fähre ging tief und hatte nur wenig Bord. Es war außerdem windig, so daß sich die gelben Wogen der Elbe mächtig heranwälzten. In der Tat scheint es, als ob man ein Einsehen von dem Gefahrvollen einer solchen Überlastung gehabt habe; die Fährleute jedoch versicherten einmal über das andere, daß nichts zu fürchten sei, und so stieß man denn unter Zuruf und Tücherwinken der vorläufig noch am altmärkischen Ufer Verbleibenden ab. Alles war guter Dinge, welche frohe Stimmung noch wuchs, als die von Kaspar Gans auch heute wieder bis an die Fährstelle beorderten Trompeter ihre Abschiedsweisen anstimmten. Ein jäher Aufschrei aber, der, vom Fährboot ausgehend, im selben Augenblick auch unter den am Ufer Zurückgeblieben erscholl, übertönte plötzlich die Fanfaren, und als diese schwiegen, sah man von der altmärkischen Seite her das Sinken der Fähre: das Wasser schlug über Bord, und ehe noch an Rettung zu denken oder wohl gar nach anderen Booten auszuschauen war, versank die Fähre vor aller Augen. Sowohl Dietrich von Quitzow wie sein Schwager Albrecht von Schenk warfen sich voll Geistesgegenwart auf ihre Pferde und hatten Kraft und Geschicklichkeit genug, sich bis ans havelländische Ufer zu retten, alles andere aber ging zugrunde: die ganze Knechteschar und mit ihnen Conrad von Quitzow, der den Abend vorher so widerstrebend und ahnungsvoll den Totentanz getanzt hatte. Vergebens, daß man nach seiner Leiche suchte; viele der mit ihm Ertrunkenen wurden gefunden, er nicht, und unter Schmerz und Grauen beschloß man die Taufreise, die so froh und unter so glänzenden Aussichten begonnen hatte. Daheim wurden dem »guten Quitzow«, der sich, im Gegensatze zu seinen Brüdern, einer ziemlich allgemeinen Beliebtheit erfreute, zahlreiche Seelenmessen gelesen, und vielfach beklagte man den Ausgang. Aber andere waren da, die kaum ein Gefühl des Triumphes zurückhalten konnten und in dem grauenhaften Ereignisse das erste Zeichen sahen, daß sich der Himmel gegen die Quitzows wenden wolle. Wusterwitz war unter denen, die dieses Glaubens lebten. Und ihr Glaube war der richtige: die Taufreise nach Tangermünde war der Wendepunkt im Leben der Quitzows, und trotz großer politischer wie militärischer Erfolge, deren sie sich gelegentlich noch zu rühmen hatten, ging es von diesem Tag an mit ihrem Glücke bergab.
Was diesen Niedergang und Fall der Familie herbeiführte, lag ganz außerhalb ihrer Verschuldung, wenn von einer solchen (ich komme weiterhin auf diese Frage zurück) überhaupt die Rede sein kann. Es lag einfach so: das Eintreten bestimmter politischer Ereignisse hatte das Heraufkommen der Familie, ja deren Glanz ermöglicht, und das Eintreten anderer politischer Ereignisse ließ diesen Glanz wieder hinschwinden. Das bedeutsamste dieser Ereignisse war der Tod des mehrgenannten Markgrafen Jobst von Mähren. Er starb den 16. Januar 1411 auf seinem Schlosse zu Brünn, einige sagen durch Gift, und König Sigismund, der 1388, um Geldes willen, die Mark Brandenburg seinem Vetter Jobst überlassen hatte, sah sich nun abermals im Erbbesitze des in genanntem Jahre von ihm abgetretenen Landes.
Hieraus erwuchs der Wechsel der Dinge.
Schon die bloße Tatsache, daß Jobst nicht mehr war, war gleichbedeutend mit Halbierung des Ansehns der Quitzowfamilie, die, ganz abgesehen von dem äußerlichen Machtzuwachs, der ihr aus dem das Jobstsche Regiment kennzeichnenden Verkauf von Schlössern und Städten erwachsen war, besonders auch in der ausgesprochenen Wohlgewogenheit des Markgrafen eine starke moralische Stütze gehabt hatte. Denn ein so schlechter Regent Jobst gewesen, er war und blieb doch immer Landesherr, dessen Autorität dem, der seiner Gunst sich rühmen durfte, zweifellos ein bestimmtes Maß von Schutz und Deckung gab, ein Maß von Schutz und Deckung, das nun plötzlich fehlte.
Jobst war nicht mehr. Diese Tatsache war ausreichend, die Quitzows in ihrer Machtfülle zu schädigen. Was aber diese Schädigung aller Wahrscheinlichkeit nach verdoppeln mußte, war das, daß König Sigismund (inzwischen auch zum Kaiser erwählt), unmittelbar nach Wiederinbesitznahme der schon in seinen jungen Jahren, von 1385 bis 88, von ihm regierten Mark, sich dahin aussprach: »nunmehro für ebendiese Mark auch etwas tun und die gerechten Beschwerden derselben, die sich zu gutem Teile gegen die Quitzows und ihren Anhang richteten, abstellen zu wollen«.
So König Sigismund, der, als er sich in diesem Sinne geäußert, auch nicht länger säumte, den Herrn Wend von Ilenburg