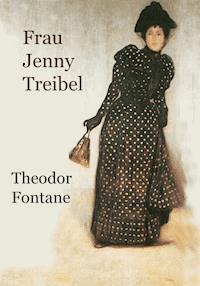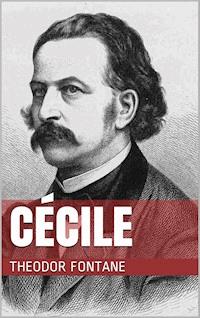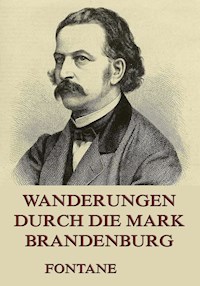
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das fünfbändige Werk Wanderungen durch die Mark Brandenburg ist das umfangreichste des deutschen Schriftstellers Theodor Fontane. Er beschreibt darin Schlösser, Klöster, Orte und Landschaften der Mark Brandenburg, ihre Bewohner und ihre Geschichte. Zwischen 1862 und 1889 erschienen, ist das Werk Ausdruck eines gewachsenen preußischen Nationalbewusstseins und der Romantik. Die Eindrücke und historischen Erkenntnisse, die Fontane während der Arbeit an den "Wanderungen" gewann, bildeten die Grundlage für seine späteren großen Romane wie Effi Briest oder Der Stechlin. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3635
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wanderungen durch die Mark Brandenburg
Theodor Fontane
Inhalt:
Theodor Fontane – Biografie und Bibliografie
Wanderungen durch die Mark Brandenburg
Die Grafschaft Ruppin
Am Ruppiner See
Die Ruppiner Garnison
Rheinsberg
Die Ruppiner Schweiz
An Rhin und Dosse
Auf dem Plateau
Gentzrode
Das Oderland
Vorwort zur dritten Auflage
Das Oderbruch und seine Umgebungen
Jenseits der Oder
Auf dem Hohen-Barnim
Havelland
Vorwort zur zweiten Auflage
Havelland
Die Wenden und die Kolonisation der Mark durch die Zisterzienser
Spandau und Umgebung
Potsdam und Umgebung
Der Schwielow und seine Umgebungen
Spreeland
Vorwort
In den Spreewald
Zwischen Spreewald und wendischer Spree
Die wendische Spree
An der Spree
Rechts der Spree
Links der Spree
Gröben und Siethen
An der Nuthe
Schlußwort
Fünf Schlösser
Vorwort
Quitzöwel
Plaue a. H.
Hoppenrade
Emil von Arnstedt,
Liebenberg
Bilder
Dreilinden
Wanderungen durch die Mark Brandenburg, T. Fontane
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849613105
www.jazzybee-verlag.de
Theodor Fontane – Biografie und Bibliografie
Dichter und Essayist, geb. 30. Dez. 1819 in Neuruppin, gest. 20. Sept. 1898 in Berlin, war, ursprünglich zum Apotheker bestimmt, 1840–43 in der Neubertschen und Struveschen Apotheke in Leipzig und Dresden tätig und machte während dieser Zeit wichtige literarische Bekanntschaften. 1844 bereiste er England, ließ sich dann in Berlin nieder, wo er sich seit 1849 ausschließlich literarischer Tätigkeit widmete. 1852 unternahm er eine zweite Reise nach England, um die altenglische Balladenliteratur an Ort und Stelle zu studieren; es entstand daraus: »Ein Sommer in London« (Dessau 1854). Ein dritter Aufenthalt da selbst (1855–59) war dem Studium der englischen Theater, Kunst und Literatur gewidmet; seine Frucht war: »Aus England. Studien und Briefe« (Stuttg. 1860) und »Jenseits des Tweed. Bilder und Briefe aus Schottland« (Berl. 1860, zusammen mit »Ein Sommer in London« nach Fontanes Tod neu herausgegeben u. d. T.: »Aus England und Schottland«, das. 1899). Von 1860–70 war F. Redakteur des englischen Teiles an der »Neuen Preußischen Zeitung«, daneben durchreiste er seine Heimat, die Mark Brandenburg, durchforschte ihre Städte, Dörfer, Klöster und Schlachtfelder, woraus seine klassischen, in vielen Auflagen erschienenen »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« (Berl. 1862–82, 4 Bde.) entstanden. Später beschrieb er die Waffenerfolge des preußischen Heeres in Schleswig und Böhmen: »Der schleswig-holsteinische Krieg im Jahr 1864« (Berl. 1866) und »Der deutsche Krieg von 1866« (das. 1869–71, 2 Bde.; 2. Aufl. 1871), besuchte 1870 den Kriegsschauplatz in Frankreich und wurde Anfang Oktober in Domremy von Franktireurs gefangen genommen und erst nach drei Monaten vieler Leiden wieder freigelassen. Seine Erlebnisse schilderte er mit ergreifender Kunst in dem Werke: »Kriegsgefangen. Erlebtes 1870« (Berl. 1871, 6. Aufl. 1904). Später schrieb er: »Aus den Tagen der Okkupation; eine Osterreise durch Nordfrankreich und Elsaß-Lothringen« (Berl. 1872, 2 Bde.); »Der Krieg gegen Frankreich 1870–1871« (das. 1874–76, 2 Bde.). Auch als origineller Theaterkritiker (für die Vossische Zeitung) genoss F. großes Ansehen (1870–1890). Wegen seiner Verdienste um die deutsche Dichtkunst wurde ihm 1891, da der Schillerpreis nicht verteilt werden konnte, vom deutschen Kaiser eine Prämie von 3000 Mark verliehen. 1894 ernannte ihn die philosophische Fakultät der Berliner Universität zum Ehrendoktor. Als Dichter ist F. schon 1851 mit »Gedichten« (8. Aufl., Stuttg. 1902) hervorgetreten, doch ist er erst im Alter zu größeren Erfolgen als Erzähler gelangt. Seine »Balladen« (Berl. 1861) zeichnen sich durch große Kraft in der knappsten sprachlichen Form aus. Seine lyrische Muse ist spröde und weich zugleich, darum trifft sie den Soldatenton so gut. Sein origineller Prosastil ist von großer Anschaulichkeit, natürlich und farbenreich. F. erzählt realistisch treu bis zur Rücksichtslosigkeit und doch voller Gemüt. Er wird herb, um ja nicht sentimental zu erscheinen, sein Humor ist echt plattdeutsch. In seinen Erzählungen hat er alle Gesellschaftsschichten Norddeutschlands geschildert; die hervorragendsten sind: »Vor dem Sturm«, Roman aus dem Winter 1812–13 (Berl. 1878, 4 Bde., 3. Aufl. 1898); die Novellen: »Grete Miude« (das. 1880), »Ellernklipp« (das. 1881), »L'Adultera« (Bresl. 1882, 4. Aufl. 1903), »Sch ach von Wuthenow« (Leipz. 1883, 4. Aufl. 1901); die Romane: »Graf Petöfy« (4. Aufl., das. 1903), »Unterm Birnbaum« (Berl. 1885), »Cecile« (das. 1887, 3. Aufl. 1900), »Irrungen, Wirrungen« (das. 1888, 8. Aufl. 1902), »Stine« (das. 1890, 4. Aufl. 1901),»Quitt« (das. 1891), »Unwiederbringlich« (das. 1891, 4. Aufl. 1902), »Frau Jenny Treibel« (das. 1892, 7. Aufl. 1903), »Effi Briest« (das. 1895, 11. Aufl. 1902), »Die Poggenbühls« (das. 1896, 6. Aufl. 1902) und »Der Stechlin« (das. 1899, 10. Aufl. 1903), »Von, vor und nach der Reise«, Plaudereien und kleine Geschichten (das. 1893). Ferner schrieb er: »Christ. Friedr. Scherenberg und das literarische Berlin von 1840–1860« (Berl. 1885) und »Meine Kinderjahre«, autobiographischer Roman (das. 1894, 4. Aufl. 1903), dazu als Fortsetzung: »Von Zwanzig bis Dreißig« (das. 1898). Die »Gesammelten Romane und Novellen« Fontanes erschienen in 12 Bänden (Berl. 1890–91). Aus seinem Nachlass gab Schlenther »Causerien über Theatereindrücke« heraus (Berl. 1904). Vgl. Servaes, Theo dor F. (Berl. 1900); Erich Schmidt, Charakteristiken, Bd. 2 (das. 1901).
Wanderungen durch die Mark Brandenburg
Die Grafschaft Ruppin
Vorwort zur ersten Auflage
»Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen.« Das habe ich an mir selber erfahren und die ersten Anregungen zu diesen »Wanderungen durch die Mark« sind mir auf Streifereien in der Fremde gekommen. Die Anregungen wurden Wunsch, der Wunsch wurde Entschluß.
Es war in der schottischen Grafschaft Kinroß, deren schönster Punkt der Levensee ist. Mitten im See liegt eine Insel und mitten auf der Insel, hinter Eschen und Schwarztannen halb versteckt, erhebt sich ein altes Douglasschloß, das in Lied und Sage vielgenannte Lochleven-Castle. Es sind nur Trümmer noch, die Kapelle liegt als ein Steinhaufen auf dem Schloßhof und statt der alten Einfassungsmauer zieht sich Weidengestrüpp um die Insel her; aber der Rundturm steht noch, in dem Queen Mary gefangen saß, die Pforte ist noch sichtbar, durch die Willy Douglas die Königin in das rettende Boot führte, und das Fenster wird noch gezeigt, über dessen Brüstung hinweg die alte Lady Douglas sich beugte, um mit weit vorgehaltener Fackel dem nachsetzenden Boote den Weg und womöglich die Spur der Flüchtigen zu zeigen.
Wir kamen von der Stadt Kinroß, die am Ufer des Levensees liegt, und ruderten der Insel zu. Unser Boot legte an derselben Stelle an, an der das Boot der Königin in jener Nacht gelegen hatte, wir schritten über den Hof hin, langsam, als suchten wir noch die Fußspuren in dem hochaufgeschossenen Grase und lehnten uns dann über die Brüstung, an welcher die alte Lady Douglas gestanden und die Jagd der beiden Boote, des flüchtigen und des nachsetzenden, verfolgt hatte. Dann umfuhren wir die Insel und lenkten unser Boot nach Kinroß zurück, aber das Auge mochte sich nicht trennen von der Insel, auf deren Trümmergrau die Nachmittagssonne und eine wehmütig-unnennbare Stille lag.
Nun griffen die Ruder rasch ein, die Insel wurde ein Streifen, endlich schwand sie ganz und nur als ein Gebilde der Einbildungskraft stand eine Zeitlang noch der Rundturm vor uns auf dem Wasser, bis plötzlich unsre Phantasie weiter in ihre Erinnerungen zurückgriff und ältere Bilder vor die Bilder dieser Stunde schob. Es waren Erinnerungen aus der Heimat, ein unvergessener Tag.
Auch eine Wasserfläche war es; aber nicht Weidengestrüpp faßte das Ufer ein, sondern ein Park und ein Laubholzwald nahmen den See in ihren Arm. Im Flachboot stießen wir ab und so oft wir das Schilf am Ufer streiften, klang es, wie wenn eine Hand über knisternde Seide fährt. Zwei Schwestern saßen mir gegenüber. Die ältere streckte ihre Hand in das kühle, klare Wasser des Sees, und außer dem dumpfen Schlag des Ruders vernahm ich nichts als jenes leise Geräusch, womit die Wellchen zwischen den Fingern der weißen Hand hindurchplätscherten. Nun glitt das Boot durch Teichrosen hin, deren lange Stengel wir (so klar war das Wasser) aus dem Grunde des Sees aufsteigen sahen; dann lenkten wir das Boot bis an den Schilfgürtel und unter die weitüberhängenden Zweige des Parkes zurück. Endlich legten wir an, wo die Wassertreppe ans Ufer führt, und ein Schloß stieg auf mit Flügeln und Türmen, mit Hof und Treppe und mit einem Säulengange, der Balustraden und Marmorbilder trug. Dieser Hof und dieser Säulengang, die Zeugen wie vieler Lust, wie vielen Glanzes waren sie gewesen? Hier über diesen Hof hin hatte die Geige Grauns geklungen, wenn sie das Flötenspiel des prinzlichen Freundes begleitete; hier waren Le Gaillard und Le Constant, die ersten Ritter des Bayardordens, auf- und abgeschritten; hier waren, in buntem Spiel, in heiterer Ironie, fingierte Ambassaden aus aller Herren Länder erschienen und von hier aus endlich waren die heiter Spielenden hinausgezogen und hatten sich bewährt im Ernst des Kampfs und auf den Höhen des Lebens. Hinter dem Säulengange glitzerten die gelben Schloßwände in aller Helle des Tags, kein romantischer Farbenton mischte sich ein, aber Schloß und Turm, wohin das Auge fiel, alles trug den breiten historischen Stempel. Von der andern Seite des Sees her grüßte der Obelisk, der die Geschichte des Siebenjährigen Krieges im Lapidarstil trägt.
So war das Bild des Rheinsberger Schlosses, das, wie eine Fata Morgana, über den Levensee hinzog, und ehe noch unser Boot auf den Sand des Ufers lief, trat die Frage an mich heran: so schön dies Bild war, das der Levensee mit seiner Insel und seinem Douglasschloß vor dir entrollte, war jener Tag minder schön, als du im Flachboot über den Rheinsberger See fuhrst, die Schöpfungen und die Erinnerungen einer großen Zeit um dich her? Und ich antwortete: nein.
Die Jahre, die seit jenem Tag am Levensee vergangen sind, haben mich in die Heimat zurückgeführt und die Entschlüsse von damals blieben unvergessen. Ich bin die Mark durchzogen und habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt hatte. Jeder Fußbreit Erde belebte sich und gab Gestalten heraus, und wenn meine Schilderungen unbefriedigt lassen, so werde ich der Entschuldigung entbehren müssen, daß es eine Armut war, die ich aufzuputzen oder zu vergolden hatte. Umgekehrt, ein Reichtum ist mir entgegengetreten, dem gegenüber ich das bestimmte Gefühl habe, seiner niemals auch nur annähernd Herr werden zu können; denn das immerhin Umfangreiche, das ich in nachstehendem biete, ist auf im ganzen genommen wenig Meilen eingesammelt worden: am Ruppiner See hin und vor den Toren Berlins. Und sorglos habe ich es gesammelt, nicht wie einer, der mit der Sichel zur Ernte geht, sondern wie ein Spaziergänger, der einzelne Ähren aus dem reichen Felde zieht.
Es ist ein Buntes, Mannigfaches, das ich zusammengestellt habe: Landschaftliches und Historisches, Sitten- und Charakterschilderung, – und verschieden wie die Dinge, so verschieden ist auch die Behandlung, die sie gefunden. Aber wie abweichend in Form und Inhalt die einzelnen Kapitel von einander sein mögen, darin sind sie sich gleich, daß sie aus Liebe und Anhänglichkeit an die Heimat geboren wurden. Möchten sie auch in andren jene Empfindungen wecken, von denen ich am eignen Herzen erfahren habe, daß sie ein Glück, ein Trost und die Quelle echtester Freuden sind.
Berlin, im November 1861.
Th. F.
Vorwort zur zweiten Auflage
Statt eines regelrechten Vorwortes heute lieber ein Wort über »reisen in der Mark«.
Ob du reisen sollst, so fragst du, reisen in der Mark? Die Antwort auf diese Frage ist nicht eben leicht. Und doch würde es gerade mir nicht anstehn, sie zu umgehen oder wohl gar ein »nein« zu sagen. So denn also »ja«. Aber »ja« unter Vorbedingungen. Laß mich Punkt für Punkt aufzählen, was ich für unerläßlich halte.
Wer in der Mark reisen will, der muß zunächst Liebe zu »Land und Leuten« mitbringen, mindestens keine Voreingenommenheit. Er muß den guten Willen haben, das Gute gut zu finden, anstatt es durch krittliche Vergleiche tot zu machen.
Der Reisende in der Mark muß sich ferner mit einer feineren Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet fühlen. Es gibt gröbliche Augen, die gleich einen Gletscher oder Meeressturm verlangen, um befriedigt zu sein. Diese mögen zu Hause bleiben. Es ist mit der märkischen Natur wie mit manchen Frauen. »Auch die häßlichste – sagt das Sprichwort – hat immer noch sieben Schönheiten.« Ganz so ist es mit dem »Lande zwischen Oder und Elbe«; wenige Punkte sind so arm, daß sie nicht auch ihre sieben Schönheiten hätten. Man muß sie nur zu finden verstehen. Wer das Auge dafür hat, der wag' es und reise.
Drittens. Wenn du reisen willst, mußt du die Geschichte dieses Landes kennen und lieben. Dies ist ganz unerläßlich. Wer nach Küstrin kommt und einfach das alte graugelbe Schloß sieht, das, hinter Bastion Brandenburg, mehr häßlich als gespensterhaft aufragt, wird es für ein Landarmenhaus halten und entweder gleichgültig oder wohl gar in ästhetischem Mißbehagen an ihm vorübergehen, wer aber weiß: »hier fiel Kattes Haupt; an diesem Fenster stand der Kronprinz«, der sieht den alten unschönen Bau mit andern Augen an. – So überall. Wer, unvertraut mit den Großtaten unserer Geschichte, zwischen Linum und Hakenberg hinfährt, rechts das Luch, links ein paar Sandhügel, der wird sich die Schirmmütze übers Gesicht ziehen und in der Wagenecke zu nicken suchen; wer aber weiß, hier fiel Froben, hier wurde das Regiment Dalwigk in Stücke gehauen, dies ist das Schlachtfeld von Fehrbellin, der wird sich aufrichten im Wagen und Luch und Heide plötzlich wie in wunderbarer Beleuchtung sehen.
Viertens. Du mußt nicht allzusehr durch den Komfort der »großen Touren« verwöhnt und verweichlicht sein. Es wird einem selten das Schlimmste zugemutet, aber es kommt doch vor, und keine Lokalkenntnis, keine Reiseerfahrung reichen aus, dich im voraus wissen zu lassen, wo es vorkommen wird und wo nicht. Zustände von Armut und Verwahrlosung schieben sich in die Zustände modernen Kulturlebens ein und während du eben noch im Lande Teltow das beste Lager fandest, findest du vielleicht im »Schenkenländchen« eine Lagerstätte, die alle Mängel und Schrecknisse, deren Bett und Linnen überhaupt fähig sind, in sich vereinigt. Regeln sind nicht zu geben, Sicherheitsmaßregeln nicht zu treffen. Wo es gut sein könnte, da triffst du es vielleicht schlecht und wo du das Kümmerlichste erwartest, überraschen dich Luxus und Behaglichkeit.
Fünftens und letztens. Wenn du das Wagstück wagen willst – »füll deinen Beutel mit Geld«. Reisen in der Mark ist alles andre eher als billig. Glaube nicht, weil du die Preise kennst, die Sprache sprichst und sicher bist vor Kellner und Vetturinen, daß du sparen kannst; glaube vor allem nicht, daß du es deshalb kannst, »weil ja alles so nahe liegt«. Die Nähe tut es nicht. In vielen bereisten Ländern kann man billig reisen, wenn man anspruchslos ist; in der Mark kannst du es nicht, wenn du nicht das Glück hast, zu den »Dauerläufern« zu gehören. Ist dies nicht der Fall, ist dir der Wagen ein unabweisliches Wanderungsbedürfnis, so gib es auf, für ein Billiges deine märkische Tour machen zu wollen. Eisenbahnen, wenn du »ins Land« willst, sind in den wenigsten Fällen nutzbar; also – Fuhrwerk. Fuhrwerk aber ist teuer. Man merkt dir bald an, daß du fortwillst oder wohl gar fortmußt, und die märkische Art ist nicht so alles Kaufmännischen bar und bloß, daß sie daraus nicht Vorteil ziehen sollte. Wohlan denn, es kann dir passieren, daß du, um von Fürstenwalde nach Buckow oder von Buckow nach Werneuchen zu kommen, mehr zahlen mußt, als für eine Fahrt nach Dresden hin und zurück. Nimmst du Anstoß an solchen Preisen und Ärgernissen – so bleibe zu Hause.
Hast du nun aber alle diese Punkte reichlich erwogen, hast du, wie die Engländer sagen, »Deine Seele fertig gemacht« und bist du zu dem Resultat gekommen: »ich kann es wagen«, nun denn, so wag' es getrost. Wag' es getrost und du wirst es nicht bereuen. Eigentümliche Freuden und Genüsse werden dich begleiten. Du wirst Entdeckungen machen, denn überall, wohin du kommst, wirst du, vom Touristenstandpunkt aus, eintreten wie in »jungfräuliches Land«. Du wirst Klosterruinen begegnen, von deren Existenz höchstens die nächste Stadt eine leise Kenntnis hatte; du wirst inmitten alter Dorfkirchen, deren zerbröckelter Schindelturm nur auf Elend deutete, große Wandbilder oder in den treppenlosen Grüften reiche Kupfersärge mit Kruzifix und vergoldeten Wappenschildern finden; du wirst Schlachtfelder überschreiten, Wendenkirchhöfe, Heidengräber, von denen die Menschen nichts mehr wissen, und statt der Nachschlagebuchs-und Allerweltsgeschichten, werden Sagen und Legenden und hier und da selbst die Bruchstücke verklungener Lieder zu dir sprechen. Das Beste aber, dem du begegnen wirst, das werden die Menschen sein, vorausgesetzt, daß du dich darauf verstehst, das rechte Wort für den »gemeinen Mann« zu finden. Verschmähe nicht den Strohsack neben dem Kutscher, laß dir erzählen von ihm, von seinem Haus und Hof, von seiner Stadt oder seinem Dorf, von seiner Soldaten- oder seiner Wanderzeit, und sein Geplauder wird dich mit dem Zauber des Natürlichen und Lebendigen umspinnen. Du wirst, wenn du heimkehrst, nichts Auswendiggelerntes gehört haben wie auf den großen Touren, wo alles seine Taxe hat; der Mensch selber aber wird sich vor dir erschlossen haben. Und das bleibt doch immer das Beste.
Berlin, im August 1864.
Th. F.
Vorwort zur Volksausgabe
Wustrau
Da liegen wir zwei Beide
Bis zum Appell im Grab.
Der Ruppiner See, der fast die Form eines halben Mondes hat, scheidet sich seinen Ufern nach in zwei sehr verschiedene Hälften. Die nördliche Hälfte ist sandig und unfruchtbar und, die freundlich gelegenen Städte Alt- und Neu-Ruppin abgerechnet, ohne allen malerischen Reiz, die Südhälfte aber ist teils angebaut, teils bewaldet und seit alten Zeiten her von vier hübschen Dörfern eingefaßt. Das eine dieser Dörfer, Treskow, war bis vor kurzem ein altes Kämmereigut der Stadt Ruppin; die drei anderen: Gnewkow, Karwe und Wustrau sind Rittergüter. Das erstere tritt aus dem Schilf- und Waldufer am deutlichsten hervor und ist mit seinem Kirchturm und seinen Bauernhäusern eine besondere Zierde des Sees. Es gehörte seit Jahrhunderten der Familie von Woldeck; jetzt ist es in andere Hände übergegangen. Der letzte von Woldeck, der dies Erbe seiner Väter innehatte, war ein Lebemann und passionierter Tourist. Seine Exzentrizitäten hatten ihn in der Umgegend zu einer volkstümlichen Figur gemacht; er hieß kurzweg »der Seebaron«. Das Wort war gut gewählt. Er hatte mit den alten »Seekönigen« den Wanderzug und die Abenteuer gemein.
Karwe gehört den Knesebecks, Wustrau dagegen ist berühmt geworden als Wohnsitz des alten Zieten. Sein Sohn, der letzte Zieten aus der Linie Wustrau, starb hier 1854 in hohem Alter. Es gibt noch Zietens aus anderen Linien und überall, wo nachstehend vom »letzten Zieten« gesprochen wird, geschieht es in dem Sinne von: der letzte Zieten von Wustrau.
Wustrau, wie viele märkische Besitzungen, bestand bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts aus vier Rittergütern, wovon zwei dem General von Dossow, eins den Zietens, und eins den Rohrs1 gehörte.
Wann die Zietens in den teilweisen Besitz von Wustrau gelangten, ist nicht mehr sicher festzustellen. Ebensowenig kennt man das Stammgut der Familie. In der Mark Brandenburg befinden sich neun Ortschaften, die den Namen Zieten, wenn auch in abweichender Schreibart, führen. Als die Hohenzollern ins Land kamen, lagen die meisten Besitzungen dieser Familie bereits in der Grafschaft Ruppin. Hans von Zieten auf Wildberg, das damals ein fester und reicher Burgflecken war, war geschworener Rat beim letzten Grafen von Ruppin, und begleitete diesen auf den Reichstag zu Worms. Die Wildberger Zieten besaßen Langen und Kränzlin; andere Zweige der Familie hatten Lögow und Buskow inne und einen Teil von Metzelthin. Die Wustrauer Zieten, scheint es, waren nicht reich; sie litten unter den Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges und der Schwedenzeit. Der Vater Hans Joachims lebte denn auch in noch sehr beschränkten Verhältnissen. Erst Hans Joachim selbst verstand sich auf Pflug und Wirtschaft fast so gut wie auf Krieg und Säbel und machte 1766 durch Ankauf der anderen Anteile ganz Wustrau zu einem Zietenschen Besitztum. Es blieb bei seinem Sohne, dem letzten Zieten, bis 1854. Dieser ernannte in seinem Testamente einen Schwerin zum Erben. Daß dieser der nächste Verwandte war, wurde vielleicht noch von der Vorstellung überwogen, daß nur ein Schwerin würdig sei, an die Stelle eines Zieten zu treten. Albert Julius von Schwerin, der jetzige Besitzer von Wustrau, ward 1859 unter dem Namen von Zieten-Schwerin in den Grafenstand erhoben.
Wustrau liegt an der Südspitze des Sees. Der Boden ist fruchtbar, und wo die Fruchtbarkeit aufhört, beginnt das Wustrausche Luch, eine Torfgegend, die an Ergiebigkeit mit den Linumer Gräbereien wetteifert. Das eigentliche Dorf, saubere, von Wohlstand zeugende Bauernhäuser, liegt etwas zurückgezogen vom See; zwischen Dorf und See aber breitet sich der Park aus, dessen Baumgruppen von dem Dache des etwas hoch gelegenen Herrenhauses überragt werden. Dieses letztere gleicht auf ein Haar den adligen Wohnhäusern, wie sie während der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in märkischen Städten und Dörfern gebaut wurden. Unser Pariser Platz zeigt zu beiden Seiten noch ein paar Musterstücke dieser Bauart. Erdgeschoß und Beletage, ein hohes Dach, ein Blitzableiter, zehn Fenster Front, eine Rampe, das ganze gelb getüncht und ein Wappen oder Namenszug als einziges Ornament. So ist auch das alte Herrenhaus der Zieten, das freilich seinerseits eine reizende Lage voraus hat. Vorder- und Hinterfront geben gleich anziehende Bilder. Jene gestattet landeinwärts einen Blick auf Dorf, Kirche und Kirchhof, diese hat die Aussicht auf den See.
Wir kommen in einem Boot über den See gefahren, legen an einer Wasserbrücke an und springen ans Ufer. Ein kurzer Weg, an Parkgrün und blühenden Linden vorbei, führt uns an den Eingang des Hauses. Der Flur ist durch eine Glaswand in zwei Teile geteilt, von denen der eine, der mit Bildern und Stichen behängt ist, (darunter der bekannte Kupferstich Chodowieckis: Zieten sitzend vor seinem König) als Empfangshalle dient. Der andere Teil ist Treppenhaus.
Wir steigen die eichene, altmodisch-bequeme Treppe hinauf und treten oben in eine nach vornhin gelegene Zimmerreihe ein. Es sind fünf Räume; in der Mitte ein großer vier- oder fünffenstriger Saal, zu beiden Seiten je zwei kleinere Zimmer. Die kleineren Zimmer sind durchaus schmucklos, nur über den Türen befinden sich Ölbilder, Kopien nach niederländischen Meistern. Das ist alles. Das Zimmer rechts vom Saal ist das Sterbezimmer des letzten Wustrauer Zieten. Der historische »alte Zieten« starb in Berlin, und zwar in einem jetzt umgebauten, dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium schräg gegenüber liegenden Hause der Kochstraße.
Das Zimmer links vom Saal heißt das Königszimmer, seitdem Friedrich Wilhelm IV., etwa in der Mitte der vierziger Jahre, die Grafschaft Ruppin durchreiste und in Wustrau und Köpernitz, (auf welch letzterem Gute damals noch die siebzigjährige Marquise La Roche Aymon lebte) einen längeren Besuch machte.
Der große Saal ist die eigentliche Sehenswürdigkeit des Hauses. Alles erinnert hier an den Helden, der diese Stätte berühmt gemacht hat. Eine Kolossalvase zeigt auf ihrer Rückseite die Abbildung des auf dem Wilhelmsplatze stehenden Zietendenkmals, an den Wänden entlang aber gruppieren sich Porträts und Skulpturen der allermannigfachsten Art. Unter diesen bemerken wir zunächst zwei Büsten des »alten Zieten« selbst. Sie stehen in Wandnischen auf hohen Postamenten von einfacher, aber gefälliger Form. Die eine dieser Büsten, ein Gipsmodell vom berühmten Bildhauer Tassaert, ist ein großes Wertstück, durchaus Porträt, das noch bei Lebzeiten des alten Zieten nach der Natur gefertigt wurde, die andere dagegen entstammt der neueren Zeit und erweist sich einfach als eine Marmorausführung des Tassaertschen Modells. Die Arbeit dieses alten Meisters ist ganz vortrefflich, vor allem von einer Lebenswahrheit, die den Schadowschen alten Zieten zu einer bloßen Tendenzstatue herabdrückt. Schadow hat nicht den Husarenvater als Porträt, sondern das Husarentum als solches dargestellt. Von dem Moment ab, wo man den wirklichen alten Zieten (den Tassaertschen) gesehen hat, wird einem das mit einem Male klar. Dies übergeschlagene Bein, diese Hand am Kinn, als ob mal wieder ein lustiger Husarenstreich ersonnen und ausgeführt werden solle, das alles ist ganz im Charakter des Husarentums, aber durchaus nicht im Charakter Zietens, der von Jugend auf etwas Ernstes, Nüchternes und durchaus Schlichtes hatte. Er hatte ein verwegenes Husarenherz, aber die Husarenmanieren waren ihm fremd. Es bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung, daß mit diesem allen kein Tadel gegen den Schadowschen Zieten ausgesprochen sein soll, der – nach der Seite des Geistvollen hin – ganz unzweifelhafte Vorzüge hat, dessen vielbetonte realistische Auffassung aber mehr scheinbar als wirklich ist.
Das Postament der Modellbüste zeigt sich bei näherer Betrachtung als ein Schrein von weiß-lackiertem Holz; ein Schlüsselchen öffnet die kaum bemerkbare Tür desselben. In diesem einfachen Schrein befindet sich der Säbel2 des alten Zieten, nicht jener türkische, den ihm Friedrich II. nach dem zweiten Schlesischen Kriege zum Geschenk machte, sondern ein gewöhnlicher preußischer Husarensäbel. Er zog ihn während des ganzen Siebenjährigen Krieges nur einmal, und dies eine Mal zu seiner persönlichen Verteidigung. Am Tage vor der Schlacht von Torgau, 2. November 1760, als er in Begleitung einer einzigen Ordonnanz auf Rekognoszierung ritt, sah er sich plötzlich von sechs österreichischen Husaren umstellt. Er hieb sich im buchstäblichen Sinne durch und steckte den blutigen Säbel ruhig wieder in die Scheide. Nie sprach er von dieser Affäre. Die Blutflecke, ein rotbrauner Rost, sind noch deutlich auf der Klinge sichtbar.
Kaum minder interessant als dieser im ganzen Kriege nur einmal gezogene Säbel, sind die sechzehn lebensgroßen Bildnisse, die ringsum die Wände bedecken. Es sind die Porträts von sechzehn Offizieren des Zietenschen Regiments, alle 1749, 1750 und 1751 gemalt. Die Namen der Offiziere sind folgende: Rittmeister Langen, von Teiffel, von Somogy, Kalau vom Hofe, von Horn, von Seel, von Wieck, von Probst, von Jürgaß, von Bader; die Leutnants von Reitzenstein, von Heinecker, von Troschke, und die Kornetts von Schanowski, Petri und von Mahlen. Mit Ausnahme des letzteren starben sie alle im Felde; von Seel fiel als Oberst bei Hochkirch, von Heinecker bei Zorndorf, von Jürgaß bei Weiß-Kosteletz; von Wieck starb als Kommandant von Komorn in Ungarn; wie er dort hinkam – unbekannt. Im ersten Augenblick, wenn man in den Saal tritt und diese sechzehn Zietenschen Rotröcke mit ungeheuren Schnauzbärten auf sich herabblicken sieht, wird einem etwas unheimlich zu Mute. Sie sehen zum Teil aus, als seien sie mit Blut gemalt, und der Rittmeister Langen, der vergebens trachtet, seinen Hasenschartenmund durch einen zwei Finger breiten Schnurrbart zu verbergen, zeigt einem zwei weiße Vorderzähne, als wollte er einbeißen. Dazu die Tigerdecke – man möchte am liebsten umkehren. Hat man aber erst fünf Minuten ausgehalten, so wird einem in dieser Gesellschaft ganz wohl, und man überzeugt sich, daß eine Rubenssche Bärenhatz oder ähnlich traditionelle Saal- und Hallenbilder hier viel weniger am Platze sein würden. Die alten Schnurrwichse fangen an, einem menschlich näher zu treten, und man erkennt schließlich hinter all diesem Schreckensapparat die wohlbekannten märkisch-pommerschen Gesichter, die nur von Dienst wegen das Martialische bis fast zum Diabolischen gesteigert haben. Die Bilder, zumeist von einem unbekannten Maler Namens Häbert herrührend, sind gut erhalten und mit Rücksicht auf die Zeit ihrer Entstehung nicht schlecht gemalt. Das Schöne fehlt noch, aber das Charakteristische ist da.
Der große Saal, in dem diese Bilder neben so manchem anderen historischen Hausrat sich vorfinden, nimmt mit Recht unser Hauptinteresse in Anspruch, aber noch vieles bleibt unserer Aufmerksamkeit übrig. Das ganze Schloß gleicht eben einer Art Zietengalerie, und nur wenige Zimmer treffen wir an, von deren Wänden uns nicht, als Kupferstich oder Ölbild, als Büste oder Silhouette, das Bildnis des alten Helden grüßte. Alles in allem gerechnet, befinden sich wohl vierzig Zietenporträts in Schloß Wustrau. Viele von diesen Bildnissen (besonders die Stiche) sind allgemein gekannte Blätter; nicht so die Ölbilder, deren wir, ohne für Vollständigkeit bürgen zu wollen, zunächst acht zählen, sieben Porträts, und das achte ein Genrebild aus der Sammlung des Markgrafen Karl von Schwedt. Es stellt möglicherweise die Szene dar (vgl. Zietens Biographie von Frau von Blumenthal S. 56), wo der damalige Major von Zieten an den Oberstleutnant von Wurmb herantritt, um die Remontepferde, die ihm zukommen, für seine Schwadron zu fordern, eine Szene, die bekanntlich auf der Stelle zu einem wütenden Zweikampfe führte. Doch ist diese Auslegung nur eine mutmaßliche, da die hier dargestellte Lokalität zu der von Frau von Blumenthal beschriebenen nicht paßt. Die sieben Porträts, mit Ausnahme eines einzigen, sind sämtlich Bilder des »alten Zieten«, und deshalb, aller Abweichungen in Uniform und Haltung unerachtet, im einzelnen schwer zu charakterisieren. Nur das älteste Porträt, das bis ins Jahr 1726 zurückgeht und den »alten Zieten«, den wir uns ohne Runzeln und Husarenuniform kaum denken können, als einen jungen Offizier bei den von Wuthenowschen Dragonern darstellt, zeichnet sich schon dadurch vor allen anderen Bildnissen aus. Zieten, damals siebenundzwanzig Jahre alt, trägt, wie es scheint, einen Stahlküraß, und über demselben eine graue Uniform (früher vielleicht weiß) mit schmalen blauen Aufschlägen. Ob das Bild echt ist, stehe dahin. Von Ähnlichkeit mit dem »alten Zieten« natürlich keine Spur.
Wir verlassen nun den Saal und das Haus, passieren die mehr dem Dorfe zu gelegene Hälfte des Parkes, überschreiten gleich danach die Dorfstraße und stehen jetzt auf einem geräumigen Rasenfleck, in dessen Mitte sich die Dorfkirche erhebt. Der Chor liegt dem Herrenhause, der Turm dem Kirchhofe zu. Zwischen Turm und Begräbnisplatz steht eine mächtige alte Linde. Die Kirche selbst, in Kreuzform aufgeführt, ist ein Ideal von einer Dorfkirche: schlicht, einladend, hübsch gelegen. Im Sommer 1756, kurz bevor es in den Krieg ging, wurde der Turm vom Blitz getroffen. Das Innere der Kirche selbst unterscheidet sich von anderen Dorfkirchen nur durch eine ganz besondere Sauberkeit und durch die Geflissentlichkeit, womit man das patriotische Element gehegt und gepflegt hat. So findet man nicht nur die übliche Gedenktafel mit den Namen derer, die während der Befreiungskriege fielen, sondern zu der allgemeinen Tafel gesellen sich auch noch einzelne Täfelchen, um die Sonderverdienste dieses oder jenes zu bezeichnen. An anderer Stelle gruppieren sich Gewehr und Büchse, Lanze, Säbel, Trommel und Flügelhorn zu einer Trophäe. Zwei Denkmäler zieren die Kirche. Das eine (ohne künstlerische Bedeutung) zu Ehren der ersten Gemahlin Hans Joachims, einer geborenen von Jürgaß, errichtet, das andere zu Ehren des alten Zieten selbst. Dies letztere hat gleichen Anspruch auf Lob wie Tadel. Es gleicht in seinen Vorzügen und Schwächen allen anderen Arbeiten des rasch-fertigen, hyperproduktiven Bernhard Rode3, nach dessen Skizze es von dem Bildhauer Meier ausgeführt wurde. Wem eine tüchtige Technik genügt, der wird Grund zur Anerkennung finden; wer eine selbständige Auffassung, ein Abweichen vom Alltäglichen fordert, wird sich nicht befriedigt fühlen. Ein Sarkophag und ein Reliefporträt, eine Minerva rechts und eine Urania links, das paßt so ziemlich immer; ein gedanklich-bequemes Operieren mit überkommenen Typen, worin unsere Bildhauer das Unglaublichste leisten. Wenn irgendein Leben, so hätte gerade das des alten Zieten die beste Gelegenheit geboten zu etwas Neuem und Eigentümlichem. Der Zieten aus dem Busch, der Mann der hundert Anekdoten, die samt und sonders im Volksmund leben, was soll er mit zwei Göttinnen (einige sagen, es seien symbolische Figuren der Tugend und Tapferkeit), die ihn bei Lebzeiten in die sicherste Verlegenheit gebracht hätten. Vortrefflich ist nur das Reliefporträt in weißem Marmor, das sich an dem dunkelfarbigen Aschenkruge des Denkmals befindet, und außer einer im Schloß befindlichen Zieten-Silhouette sehr wahrscheinlich das einzige Bildnis ist, das uns den immer en face abgebildeten Kopf des Alten auch einmal in seinem Profile zeigt. Daß dieses Profil nicht schön ist, tut nichts zur Sache.
Alles in allem, das Marmordenkmal des alten Helden reicht an ihn selber nicht heran; es entspricht ihm nicht. Da lobe ich mir im Gegensatz dazu das schlichte Grab, unter dem er draußen in unmittelbarer Nähe der Kirche schläft. Der Raum reichte hin für vier Gräber, und hier ruhen denn auch die beiden Eltern des alten Zieten, seine zweite Gemahlin (eine geborene von Platen) und er selbst. Das Äußere der vier Gräber ist wenig von einander verschieden. Ein Unterbau von Backstein erhebt sich zwei Fuß hoch über dem Rasen, auf welchem Ziegelfundamente und dann die Sandsteinplatte ruht. Noch nichts ist verfallen. Auch der gegenwärtige Besitzer empfindet, daß er eine historische Erbschaft angetreten hat und eifert getreulich dem schönen Vorbilde des letzten Wustrauer Zieten nach, dessen ganzes Leben eigentlich nur ein Kultus seines berühmten Vaters war.
1786 starb Hans Joachim von Zieten. Achtundsechzig Jahre später folgte ihm sein Sohn Friedrich Christian Emil von Zieten, achtundachtzig Jahre alt, der letzte Zieten aus der Linie Wustrau. Wir treten jetzt an sein Grab4. Es befindet sich unter der schon erwähnten schönen alten Linde, die zwischen der Kirche und dem leis ansteigenden Kirchhofe steht. Hinter sich die lange Gräberreihe der Bauern und Büdner, macht dies Grab den Eindruck, als habe der letzte Zieten noch im Tode den Platz behaupten wollen, der ihm gebührte, den Platz an der Front seiner Wustrauer. Ähnliche Gedanken beschäftigten ihn sicherlich, als er zehn oder zwölf Jahre vor seinem Tode dies Grab zu bauen begann. Ein Hünengrab. Der letzte Zieten, klein wie er war, verlangte doch Raum im Tode. Denn er baute das Grab nicht bloß für sich, sondern für das Geschlecht oder den Zweig des Geschlechts, das mit ihm schlafen ging. Mit Eifer entwarf er den Plan und leitete den Bau. Eine Gruft wurde gegraben und ausgemauert, und schließlich ein Riesenfeldstein, wie sich deren so viele auf der Wustrauer Feldmark vorfinden, auf das offene Grab gelegt. Am Fußende aber geschah die Ausmauerung nur halb, so daß hier, unter Einführung eines schräg laufenden Stollens, eine Art Kellerfenster gewonnen wurde, durch das der alte Herr in seine letzte Wohnung hineinblicken konnte. Mit Hilfe dieser Zuschrägung wurde denn auch später der Sarg versenkt. Als Friedrich Wilhem IV. im Jahre 1844 den schon oben erwähnten Besuch in Wustrau machte, führte ihn der Graf auch an die Linde, um ihm daselbst das eben fertig gewordene Grab zu zeigen. Der König wies auf eine Stelle des Riesenfeldsteins und sagte: »Zieten, der Stein hat einen Fehler!«, worauf der alte Herr erwiderte: »Der drunter liegen wird, hat noch mehr.«
Diese Antwort ist so ziemlich das Beste, was vom letzten Wustrauer Zieten auf die Nachwelt gekommen ist. Einzelne andere Repliken und Urteile (z.B. über die Schadowsche Statue, sowie über Bücher und Bilder, deren Held sein Vater war) sind unbedeutend, oft ungerecht und fast immer schief. Er sah alles zu einseitig, zu sehr von einem bloß Zietenschen Standpunkt aus, um gerecht sein zu können, selbst wenn ihm ein feinerer ästhetischer Sinn die Möglichkeit dazu gewährt hätte. Dieser ästhetische Sinn fehlte ihm aber völlig. Selber eine Kuriosität, brachte er es über die Kuriositätenkrämerei nie hinaus. Sein Witz und Humor verstiegen sich nur bis zur Lust an der Mystifikation. Den Altertumsforschern einen Streich zu spielen, war ihm ein besonderer Genuß. Er ließ von eigens engagierten Steinmetzen große Feldsteine konkav ausarbeiten, um seine Wustrauer Feldmark mit Hilfe dieser Steine zu einem heidnischen Begräbnisplatz avancieren zu lassen. Am Seeufer hing er in einem niedlichen Glockenhäuschen eine irdene Glocke auf, der er zuvor einen Bronzeanstrich hatte geben lassen. Er wußte im voraus, daß die vorüberfahrenden Schiffer, in dem Glauben, es sei Glockengut, innerhalb acht Tagen den Versuch machen würden, die Glocke zu stehlen. Und siehe da, er hatte sich nicht verrechnet, und fand nach drei Tagen schon die Scherben. Solche Überlistungen freuten ihn, und man kann zugeben, daß darin ein Äderchen von der Herzader seines Vaters sichtbar war. Im übrigen aber war er unfähig, zu dem Ruhme seines Hauses auch nur ein Kleinstes hinzuzufügen; er fühlte sich nur als Verwalter dieses Ruhmes, ein Gefühl freilich, das ihm unter Umständen Bedeutung und selbst Würde lieh. Wo er für sich und seine eigenste Person eintrat, in den privaten Verhältnissen des alltäglichen Lebens, war er eine wenig erfreuliche Erscheinung: kleinlich, geizig, unschön in fast jeder Beziehung. Von dem Augenblick an aber, wo die Dinge einen Charakter annahmen, daß er seine Person von dem Namen Zieten nicht mehr trennen konnte, wurde er auf kurz oder lang ein wirklicher Zieten. Er war nicht adlig, aber gelegentlich aristokratisch. Dies Aristokratische, wenn geglüht in leidenschaftlicher Erregung, konnte momentan zu wahrem Adel werden, aber solche Momente weist sein Leben in nur spärlicher Anzahl auf. Sein bestes war die Liebe und Verehrung, mit der er ein halbes Jahrhundert lang die Schleppe seines Vaters trug. In diesem Dienste verstieg sich sein Herz bis zum Poetischen in Gefühl und Ausdruck, wofür nur ein Beispiel hier sprechen mag. Auf dem mit Rasen überdeckten Kirchenplatz, etwa hundert Schritte vom Grabe Hans Joachims entfernt, erhebt sich ein hoher, zugespitzter Feldstein mit einer in den Stein eingelegten Eisenplatte. Und auf eben dieser Eisenplatte stehen in Goldbuchstaben folgende Worte:
Im Jahre 1851 den 23. April stand an dieser Stelle das Blüchersche Husaren-Regiment, um den hier in Gott ruhenden Helden, den berühmten General der Cavallerie und Ahnherrn aller Husaren, Hans Joachim von Zieten, in Anerkennung seiner hohen Verdienste durch eine feierliche Parade zu ehren. Ruhe und Friede seiner Asche! Preis und Ehre seinem Namen! Er war und bleibt der Preußen Stolz.
»Ahnherr aller Husaren« – ein Poet hätte es nicht besser machen können.
Karwe I
»Vivat et crescat gens Knesebeckiana
in aeternum.«
Karl Friedrich von dem Knesebeck
Unser Weg führt uns heute nach Karwe. Es liegt am Ostufer des Ruppiner Sees, und ein Wustrauer Fischer fährt uns in einer halben Stunde hinüber. Ein besonderer Schmuck des Sees an dieser Stelle ist sein dichter Schilfgürtel, der namentlich in Front des Karwer Parkes wie ein Wasserwald sich hinzieht und wohl mehrfach eine Breite von hundert Fuß und darüber haben mag. An dieses Schilfufer knüpft sich eine Geschichte, die uns am besten in das starke und frische Leben einführt, das hier ein halb Jahrhundert lang zu Hause war, und von dem ich Gelegenheit haben werde, manchen hübschen Zug zu erzählen.
Es war im Jahre 1785. Der Sohn des alten Zieten auf Wustrau war Kornett im Leibhusarenregiment seines Vaters und der Sohn des alten Knesebeck auf Karwe war Junker im Infanterieregiment von Kalkstein, das damals in Magdeburg stand. Der Zufall wollte, daß beide zu gleicher Zeit Urlaub nahmen und auf Besuch nach Haus kamen. Die beiden Nachbarfamilien lebten auf dem besten Fuß miteinander und auch die jungen Leute unterhielten einen freundschaftlichen Verkehr. Man sah sich oft und machte gemeinschaftliche Partien. Es war im August, See und Himmel blauten, und der Schilfwald, der sich im Wasser spiegelte, stieg wie eine grüne Mauer aus dem Grunde des Sees auf. An solchem Tage begegneten sich Junker und Kornett am Ufer, plauderten hin und her von der Strenge des Dienstes und von der Lust des Krieges, und kamen endlich überein, in Ermangelung wirklichen Kampfes, zwischen Karwe und Wustrau eine Seeschlacht aufzuführen. Man machte auch gleich den Plan. Die Knesebeckschen sollten von Karwe her heftig angreifen und die Zietenschen bis nach Wustrau hin zurückdrängen, dann aber sollten diese sich rekolligieren und die Knesebeckschen in ihren Schilfwald zurückwerfen. So war es beschlossen. Man schied mit herzlichem Händeschütteln und freute sich auf den andern Tag. Die Eltern nahmen Anteil und beide Dörfer gerieten in Aufregung. Nach Ruppin hin ergingen Einladungen an befreundete Offiziere, Pulver wurde beschafft, und während Kornett und Junker ihre Dispositionen trafen, verwandelten sich die Herrenhäuser von Karwe und Wustrau in Kriegslaboratorien, darin allerhand Feuerwerk, Schwärmer, Raketen und Feuerräder in möglichster Eile hergestellt wurden. So kam der ersehnte Abend. Mit dem Glockenschlage neun liefen beide Flotten aus, jede sechs Kähne stark, das Admiralsboot vorauf. Als man aneinander war, begann die Schwärmerkanonade, vom Ufer her scholl der Jubel einer dichtgedrängten Menschenmenge, und als ein pot à feu seine Leuchtkugeln in die Luft warf, zogen sich verabredetermaßen die Zietenschen nach Wustrau hin zurück. Aber nur auf kurze Distanz. Eh' sie noch in die Nähe des Hafens gekommen waren, wandten sie sich wieder und drei große Raketen fast horizontal über das Wasser hinschießend, gingen sie jetzt ihrerseits mit verdoppeltem Ruderschlag zur Attacke über. Die Karweschen hielten einen Augenblick Stand, aber nicht lange, dann begann ihre Retraite. Die Wustrauschen setzten nach und waren eben auf dem Punkt, die Fliehenden bis in das dichte Schilf hinein zu verfolgen, als ein lautes, staunendes Ah, das vom Ufer her herüberklang, die Verfolgenden stutzen ließ und ihre Blicke nach rückwärts lenkte. Die Sieger waren gefangen. Im Karweschen Schilf hatte sich eine Flotille versteckt gehalten, die der Junker vom Regimente von Kalkstein als Mietstruppe für diesen Tag angeworben und von seinem Taschengelde bezahlt hatte. Es waren Fischerboote von Alt-Friesack her, vierundzwanzig an der Zahl, jedes mit einer Laterne hoch am Mast. In langer Linie kamen sie aus dem Schilf hervor und legten sich quer vor. Das Laternenlicht war hell genug, die Fischergestalten zu zeigen, wie sie da standen mit vorgehaltenem Ruder, bereit, jeden Fluchtversuch zu vereiteln. Die Wustrauschen machten gute Miene zum bösen Spiel und sprangen lachend ans Ufer. Nie wurden Gefangene schmeichelhafter begrüßt. Als sie in den Karweschen Park traten, sahen sie dicht vor dem Herrenhause eine Ehrenpforte errichtet, an deren Spitze das von Lichtern umgebene Bild des alten Zieten leuchtete, darunter die Unterschrift: Voilà notre modèle. Am andern Tage erhielt der Junker von dem Knesebeck eine Einladung nach Wustrau. Der alte sechsundachtzigjährige Zieten, der gemeinhin einen grauleinenen Kittel trug, saß heute in voller Uniform auf seinem Lehnstuhle und rief den eintretenden Junker zu sich heran: »Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Werde so ein braver Mann wie dein Vater.« Knesebeck trat heran und bückte sich, um dem Alten die Hand zu küssen. Dieser aber legte beide Hände auf den Kopf des Junkers und sprach bewegt: »Gott segne dich!« –
Das ist die Geschichte von der Seeschlacht bei Karwe; sie kann es aufnehmen mit manchem großen Sieg. Wer aber am Ruppiner See zu Haus ist, den freut es zu sehen, was auf seinem schmalen Uferstreifen an Männern gewachsen ist.
*
Auch wir kommen heute von Wustrau – minder rasch, aber sicherer, als damals der Kornett von Zieten – und nähern uns, ohne unsere Rückzugslinie gefährdet zu sehen, auf einer der vielen, durch den Schilfwald sich hinziehenden Straßen dem Holzsteg, an dem die Boote anzulegen pflegen. Und nun springen wir ans Ufer und befinden uns in dem Park von Karwe. Er ist ziemlich groß angelegt, mit vielem Geschmack in einem einfach edlen Stile, das Ganze vorwiegend eine Schöpfung unseres »Junkers vom Regiment von Kalkstein«, des am 12. Januar 1848 verstorbenen Feldmarschalls von dem Knesebeck. Dieser ausgezeichnete Mann wird überhaupt den Mittelpunkt alles dessen bilden, was ich in weiterem zu erzählen habe, da er, wie der Hauptträger des Ruhmes der Familie, so auch zugleich derjenige ist, der am segensreichsten an dieser Stelle gewirkt und den toten Dingen entweder den Stempel seines Geistes aufgedrückt oder ihnen durch irgendeine Beziehung zu seiner Person zu einem poetischen Leben verholfen hat. –
Wir haben den Park seiner Länge nach passiert und stehen jetzt vor dem Herrenhause. Es ist einer jener Flügelbauten, wie sie dem vorigen Jahrhundert eigentümlich waren, und erinnert in Form und Farbenton an das Radziwillsche Palais in Berlin. Nur ist es kleiner und ärmer an Rokokoschmuck. Auch das Eisengitter fehlt. Eine hohe Pfauenstange mit einem Pfauhahn darauf überragt vom Wirtschaftshofe her das Dach, und der vorgelegene Grasplatz steht in Blumen; aber trotz dieser Farbenpracht macht alles einen ernsten und beinah düstern Eindruck und läßt uns auch ohne praktische Probe glauben, daß das Karwer Herrenhaus ein Spukhaus sei.
Karwe gehört den Knesebecks in der vierten Generation. Der Urgroßvater des jetzigen Besitzers kaufte es im Jahre 1721 von dem Vermögen seiner Frau und errichtete das Wohnhaus, das wir, wenn auch verändert und erweitert, auch jetzt noch vor uns sehen. Die Umstände, die diesen Kauf und Bau begleiteten, sind zu eigentümlicher Art, um hier nicht erzählt zu werden. Der Urgroßvater Karl Christoph Johann von dem Knesebeck, zu Wittingen im Hannoverschen geboren, trat früh in preußische Kriegsdienste. Er war ein großer, starker und stattlicher Mann, aber arm. Die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. indes war just die Zeit, wo das Verdienst des Großseins die Schuld des Armseins in Balance zu bringen wußte und gemeinhin noch einen Überschuß ergab. Karl Christoph Johann war sehr groß, und so erfolgte denn eine Kabinettsordre, worin die reiche Witwe des Generaladjutanten von Köppen, eine geborne von Bredow, angewiesen wurde, den Oberstleutnant von dem Knesebeck zu ehelichen. Die Hochzeit erfolgte und Karwe wurde, wie schon erwähnt, erstanden. Aber die Huldbeweise gegen den stattlichen Oberstleutnant hatten hiermit ihr Ende noch nicht erreicht. Im Kopfe des Königs mochte die Vorstellung lebendig werden, daß die reiche Witwe bis dahin eigentlich alles und die Gnade Seiner Majestät nur erst sehr wenig getan habe, und so versprach er denn dem jungen Paare das neue Wohnhaus in Karwe einrichten und sogar zum Aufbau desselben die Balken und den Kalk liefern zu wollen. Und wirklich, bald stand das Haus da, und die zugesagte Möblierung erfolgte mit einer Munifizenz, die bei dem sparsam gewöhnten Könige überraschen mußte. Selbst königliche Familienporträts, zum Teil von der Meisterhand Pesnes, wurden geliefert und in einem Empfangssaale des ersten Stocks in das Mauerwerk fest eingefügt. Wir werden gleich sehen, wie wichtig es für den neuen Besitzer von Karwe war, diese stattliche Bilderreihe nicht aufgehängt, sondern eingemauert zu haben. Denn kaum noch, daß einige Monate ins Land gegangen waren, als ein großer Planwagen vor dem Knesebeckschen Hause vorfuhr und den Befehl überbrachte, das durch königliche Munifizenz erhaltene Ameublement wieder zurückzuliefern. Es waren nicht die Zeiten, um solcher Ordre nicht sofort zu gehorchen, und so versanken denn sämtliche Spiegel, Kommoden und Tische, die der gebornen von Bredow bereits lieb und teuer geworden waren, in die Heu-und Strohbündel des draußen harrenden Wagens. Was zu dieser Ordre geführt, ob einfach Laune oder aber die ökonomische Erwägung, »daß der von Knesebeck au fond reich genug sei, um nunmehro sich auch ohne geschenkte königliche Möbel behelfen zu können«, ist nie bekannt geworden. Der Planwagen fuhr ab, und ließ nichts zurück als die eingemauerten Bilder und einen alten Eichentisch, den sehr wahrscheinlich seine Unscheinbarkeit gerettet hatte.
Wir treten nun in das Haus selber ein. Das erste Zimmer mit der Aussicht auf den Park ist das Bibliothekzimmer. Auf schlichten Regalen stehen schlichte Einbände, keine Goldschnittsliteratur zum Ansehen, sondern Bücher zum Lesen, »Krieger für den Werkeltag«. Es sind Bücher und Broschüren, die der alte Feldmarschall in seinem achtzigjährigen Leben gesammelt hat und über deren Inhalt und Richtung seine eigenen Worte Auskunft geben mögen: »Mit meinen Studien in Geschichte, Philosophie und schönen Wissenschaften ging es besser; sie interessierten mich über alles, besonders Geschichte und Lebensbeschreibungen, zu denen auch bis ins späte Alter mir die Neigung geblieben ist.« Die poetische Grundanlage des alten Herrn spricht sich in diesen Worten aus; hätte es je eine schaffende dichterische Natur gegeben, der nicht Biographien und Memoiren die liebste Lektüre gewesen wären! –
Aus dem Bibliothekzimmer tritt man in das dahinter gelegene Empfangs- und Familienzimmer. Es ist groß und geräumig und macht vor allem den Eindruck behaglichen Geborgenseins. An Bildern weist es nichts von besonderem Interesse auf, außer einer Ansicht von dem in der Nähe von Salzwedel gelegenen Schloß Tilsen, dem alten Familiensitze der Knesebecks. Die eigentliche Sehenswürdigkeit dieses Zimmers ist jener alte Eichentisch, der der Versenkung in den Planwagen glücklich entging. Und doch war dies schlichte Wirtschaftsstück das eigentlichste Wertstück des Ameublements, wenn auch damals nicht, so doch jetzt. Dieser Tisch nämlich bildete seinerzeit einen Teil der langen Tafel, an der die Sitzungen des Tabakskollegiums gehalten wurden. Es existieren solcher Tische nur noch zwei, dieser Knesebecksche in Karwe und ein Zwillingsbruder desselben in Potsdam. Eine Decke von braunem schwerem Seidenzeug verhüllt wie billig die eichene Derbheit dieses nicht salonfähigen Möbels, dessen Konstruktion ganz eigentümlicher Art ist. Die Platte besteht aus zwei abgestutzten Dreiecken und ruht auf sechs Füßen, die wiederum ihrerseits zwei Dreiecke bilden. Verbindungshölzer und Eisenkrampen halten das Ganze zusammen und stellen einen Bau her, der allen Anspruch darauf hatte, nicht beachtet zu werden, als die Trumeaux hinausgetragen wurden.
Links neben dem Empfangssaale befindet sich das Arbeitszimmer des gegenwärtigen Besitzers. Es ist sehr klein, etwas geräuschvoll gelegen und selbst zur Nachtzeit ohne wünschenswerte Ruhe. Die »Dame im schwarzen Seidenkleid« nämlich, als welche der Karwer Spuk auftritt, beginnt von hier aus ihren Rundgang, und wer mag ruhig und gemütlich ein Buch lesen, wenn er fürchten muß, die schwarze Frau steht hinter ihm und liest mit, wie zwei Leute, die aus einem Gesangbuch singen.
Über dem Schreibpult im selben Zimmer hängt ein sehr gutes Crayonporträt des Feldmarschalls, und auf einem Tischchen daneben steht ein porzellanenes Schreibzeug mit einer Rosengirlande, ein Geschenk vom alten Gleim, der dem Feldmarschall in seinen Halberstädter Leutnantstagen nah befreundet war.
Zur Rechten des Empfangszimmers ist der Speisesaal. Hier befinden sich neben anderen Schildereien vier Familienporträts: zunächst der Ahnherr des Hauses, einem Grabsteinrelief nachgebildet, das sich in der Kirche zu Hannoversch-Wittingen bis diesen Tag erhalten hat. Unmittelbar darunter hängen die Bilder des Urgroßvaters und Großvaters des jetzigen Besitzers, von denen wir den ersteren als stattlichen und reich verheirateten Oberstleutnant bei der Garde, den andern als Vater des Junkers vom Regiment von Kalkstein bereits kennengelernt haben. Er wurde bei Kolin durch Arm und Leib geschossen und war der, auf den der alte Zieten die schon vorzitierten Worte bezog: »Gott segne dich und werde so brav wie dein Vater.« Unter diesen beiden Porträts hängt das vortrefflich ausgeführte Ölbild des Feldmarschalls von dem Knesebeck, damals (unmittelbar nach dem Befreiungskriege) noch Generalleutnant in der Okkupationsarmee. Das Porträt zeigt in seiner linken Ecke den Namen: »Steuben; Paris, 1814«, kurze Worte, die genugsam für den Wert des Bildes sprechen.
Aus dem Speisesaale treten wir in das angrenzende Wohnzimmer, wo, über dem Schreibtisch der Dame vom Hause, eine Kopie des Correggioschen Christuskopfes auf dem Schweißtuche der heiligen Veronika unsere Aufmerksamkeit fesselt. Das Original bildet jetzt, wenn nicht neuerdings wiederum Änderungen stattgefunden haben, eine Zierde unseres Berliner Museums. Früher hing es im Wohnzimmer zu Karwe, an derselben Stelle, die sich jetzt mit der bloßen Kopie behelfen muß. Interessant ist es, wie das Original in den Besitz der Familie kam. Der Feldmarschall bereiste, wahrscheinlich 1819, Italien und kam nach Rom. Kurz vor seiner Rückreise wurde ihm von einem Trödler ein Christuskopf zum Verkauf angeboten, dessen hohe Schönheit auch seinem Laienauge auf der Stelle einleuchtete. Er kaufte das Bild für eine ansehnliche Summe. Kaum aber war er im Besitz desselben, als sich das Gerücht verbreitete, eins der italienischen Klöster sei beraubt worden – der Correggiosche Christuskopf auf dem Schweißtuche der heiligen Veronika sei fort. Der nächste Tag brachte die amtliche Bestätigung, und Belohnungen wurden ausgesetzt für die Wiederbeschaffung und selbst für den Nachweis des berühmten Gemäldes. Knesebeck begriff die Gefahr und traf seine Vorkehrungen. Das Bild ward in ein Wagenkissen eingenäht, und der glückliche Besitzer, der bis dahin kaum selber gewußt haben mochte, was er besaß, nahm auf seinem neuen Schatze Platz und brachte so sein schönes Eigentum glücklich über die Alpen. Ich kann nicht sagen, wie lange das Bild in Karwe blieb, mutmaßlich nur kurze Zeit. Jedenfalls nahm das Haus Knesebeck, das zu Anfang des 18. Jahrhunderts von den Hohenzollern ein halbes Dutzend Familienporträts geschenkt erhalten hatte, zu Anfang des 19. Jahrhunderts Veranlassung, den Hohenzollern ein Gegengeschenk zu machen und warf (in aller Loyalität sei es gesagt) einen Correggioschen Christuskopf gegen sechs Pesnesche Kurfürsten unzweifelhaft siegreich in die Waage. Friedrich Wilhelm III. akzeptierte in Gnaden das Geschenk und willigte gern in Erfüllung des einen Wunsches, den Knesebeck bei Überreichung des Bildes geäußert hatte, »daß dasselbe nämlich unwandelbar in der königlichen Hauskapelle verbleiben möge.« Diese Zubewilligung ist indessen im Laufe der Zeit entweder vergessen oder aber aus einem Humanitätsgefühle der Hohenzollern »die nichts Schönes für sich allein haben wollen« absichtlich geändert worden. Das Bild gehört nicht mehr der Hauskapelle, sondern dem Bildermuseum an. Nur bei Gelegenheit der Taufe des jungen Prinzen Friedrich Wilhelm, dessen Geburt im Januar 1859 alle loyalen Herzen in Stadt und Land mit Freudigkeit erfüllte, kam auch der Correggio wenigstens vorübergehend wieder zu seinem zugesagten Recht und wanderte auf vierundzwanzig Stunden aus den Museumssälen in den prächtigen Kuppelbau der Schloßkapelle hinüber. –
Wir machen von den Zimmern des Erdgeschosses aus noch einen Rundgang durch die Räume des oberen Stockwerkes, inspizieren im Hof den historischen alten Kaleschwagen, in dem 1812 der damalige Oberst von Knesebeck die berühmte Reise nach Petersburg antrat, um dem Kaiser Alexander zuzurufen: »Krieg und wieder Krieg! Die Quadratmeilen Rußlands sind die Rettung Europas« – und kehren dann in das Empfangs- und Familienzimmer zurück, dessen bequeme Polsterstühle zu einer kurzen Rast einladen. In diesem Zimmer pflegte Knesebeck auch in seinen alten Tagen noch, die Hände auf dem Rücken und den kurzen Sammetrock durch eine Schnur zusammengehalten, mit großen Schritten auf und ab zu gehen. Hier war die Arbeitsstätte seiner Gedanken, hier, wo er im besten Mannesalter sein Gehirn zersonnen hatte, wie Rettung zu schaffen und dem Feinde seines Landes, zugleich dem Feinde alles echten Lebens siegreich beizukommen sei. Und hier fand er es. Hören wir, was er selber darüber schreibt: »Die Karte von Rußland kam nicht von meinem Pult. Ich sah die unermeßliche Fläche, berechnete die möglichen Märsche des Eroberers, und siehe da, die beiden großen Alliierten Rußlands: der Raum und die Zeit, traten mit einer Lebendigkeit vor meine Seele, die mir keine Ruhe mehr ließ. Zur Gewißheit wurd' es mir: so ist er zu besiegen und so muß er besiegt werden.«
Wir alle wissen jetzt, wie praktisch-richtig das poetisch Geschaute jener nächtlichen Stunden gewesen ist. Das glänzendste Zeugnis aber stellt unserem Knesebeck Napoleon selber aus. Dieser hatte den Knesebeckschen Plan gekannt, aber ignoriert. Im Frühjahr 1813 fand folgende Unterhaltung zwischen ihm und dem bis dahin am preußischen Hofe beglaubigten Grafen von St. Marsan statt. Napoleon: Erinnern Sie sich noch eines Berichtes, den Sie mir im Jahre 1812 von einem gewissen Herrn von Knesebeck geschickt haben? St. Marsan: Ja, Ew. Majestät. Napoleon: Glauben Sie, daß er im gegenwärtigen Kriege mitfechten wird? St. Marsan: Allerdings glaube ich das. Napoleon: Der Mensch hat richtig vorausgesehen, und man darf ihn nicht aus dem Auge verlieren.
Das war im Frühjahr 1813. Andere Zeiten kamen, der sechsundvierzigjährige Oberst von dem Knesebeck war ein Siebziger geworden, und statt der Karte von Rußland und vorausberechneter Schlachten und Märsche, lagen jetzt die Memoiren derer auf dem Tisch, die damals mit ihm und gegen ihn die Schlachten jener Zeit geschlagen hatten. Nach einer Epoche reichen und tatkräftigen Lebens war auch für ihn die Zeit philosophischer Betrachtung gekommen. Die Leutnantstage von Halberstadt wurden ihm wieder teuer, das Bild des alten Gleim trat wieder freundlich vor ihn hin, und der Mann, der zeitlebens wie ein Poet gedacht und gefühlt hatte, fing als Greis an, auch jenem letzten zuzustreben, das den Dichter macht – der Form. Ähnlich wie Wilhelm von Humboldt in Tegel, saß der alte Knesebeck auf seinem väterlichen Karwe und beschloß ein bedeutendes und ereignisreiches Leben mit dem Konzipieren und Niederschreiben von Sinn- und Lehrgedichten, von Episteln und Epigrammen.
Sprecht mir doch nur immer nicht:
»Für die Nachwelt mußt du schreiben!«
Nein, das lass ich weislich bleiben,
Denn es lohnt der Mühe nicht!
Was die alte Klatsche spricht,
Die ihr tituliert Geschichte,
Bleibt, beseh'n beim rechten Lichte,
Doch nur Fabel und Gedicht,
Höchstens ein Parteigericht.
Das klingt hart, aber wenn irgendwer kompetent war, so war er es. Es nimmt der Wahrheit seines Ausspruches nichts, daß eine leise Bitterkeit seine Sentenzen gelegentlich färbte:
Wie du gelebt, so geh zu Grabe,
Still, prunklos, wenig nur gekannt.
Was du für Welt, für Vaterland,
Für andere hier getan, sei stumme Gabe –
Des Gebers Name werde nie genannt.
So schrieb er am Abend seines Lebens.
Bis tief in die Nacht hinein saß er an seinem Pult. Die schwarze Frau kam und ging, aber das Knistern ihrer Seide störte ihn nicht; er, der dem großen Gespenst des Jahrhunderts mit siegreichen Gedanken entgegengetreten war, war schußfest gegen die Geister.
Ein Jahr vor seinem Tode ward er Feldmarschall. Drei Jahre früher war ihm ein erster Enkel geboren worden, zu dessen Taufe der König versprochen hatte, nach Karwe zu kommen. Er kam nicht, aber statt seiner traf ein Entschuldigungsbrief ein, dessen Namenszug mit Hilfe eines angehängten Schnörkels in ein Wickelkind auslief. Vor diesem Wickelkind, das natürlich den kleinen Knesebeck repräsentieren sollte, stand der König selbst (ein wohlgelungenes Porträt von königlicher Hand) und machte dem Täufling seine Verbeugung. Darunter die Worte: »Vivat et crescat gens Knesebeckiana in aeternum.«
*
Wir verließen das Empfangszimmer und traten wieder in den Park. An einer der schönsten Stellen desselben hatte uns die Gärtnersfrau ein Nachmittagsmahl serviert: saure Milch mit einer überaus einladenden, chamoisfarbenen Sahnenschicht. Um uns her standen einundzwanzig Edeltannen und neigten sich gravitätisch in dem Winde, der ging. Diese einundzwanzig Tannen pflanzte der alte Feldmarschall im Sommer 1821, als die Nachricht nach Karwe kam, daß Napoleon am 5. Mai auf St. Helena gestorben sei. Auch dies Datum schuf noch eine letzte Berührung zwischen den alten Gegnern; der 5. Mai war der Geburtstag Knesebecks, wie er der Todestag Napoleons war.
Unter den Papieren des Feldmarschalls aber fanden sich bei seinem im Januar 1848 erfolgten Hinscheiden nachstehende Zeilen, die der Ausdruck seines Lebens und vielleicht ein treffendes Motto märkischen Adels sind:
Mit dem Schwerte sei dem Feind gewehrt,
Mit dem Pflug der Erde Frucht gemehrt;
Frei im Walde grüne seine Lust,
Schlichte Ehre wohn' in treuer Brust.
Das Geschwätz der Städte soll er flieh'n,
Ohne Not von seinem Herd nicht zieh'n,
So gedeiht sein wachsendes Geschlecht,
Das ist Adels Sitt' und altes Recht.
Karwe II
Eine Revue vorm alten Fritz
Es war im Frühjahr 1783, so erzählt der Feldmarschall von dem Knesebeck in seinen Memoiren, und die Truppen, die zur Magdeburgischen Inspektion unter General von Saldern gehörten, hatten unweit der Dörfer Pietzpuhl und Körbelitz, auf der sogenannten Pietzpuhler Heide, anderthalb Meilen von Magdeburg, ein Lager bezogen. Es war gegen Mittag und der König konnte jeden Augenblick eintreffen, da er sehr früh am Morgen von Sanssouci aufzubrechen pflegte. Bekanntlich fuhr er mit Bauerpferde-Relais. Die Reise ging trotz des gräulichen Sandes fortwährend in einer Karriere; was fiel, fiel und wurde nur mäßig vergütigt. Sein Quartier nahm er in einem kleinen Häuschen am Nordwestende des Dorfes Körbelitz.
Sobald er ankam, dies wiederholte sich alljährlich, stieg er zu Pferde und ritt gleich zur Abnahme der Spezialrevue zu den Truppen. Die Regimenter, nach der Anciennetät gelagert, standen dann jedes in folgender Ordnung aufmarschiert. Vor dem ersten Zuge des ersten Bataillons zuerst der Kommandeur des Regiments, zu Fuß mit Esponton (nur die Generale waren zu Pferde), hinter dem Kommandeur die Junker des Regiments, die dem Könige noch nicht vorgestellt waren, hinter den Junkern die Rekruten des Jahres nach der Größe in drei Gliedern aufmarschiert. So erwarteten wir ihn jetzt.
Der schönste Frühlingstag glänzte zu unseren Häupten, die weite Heide war mit Zuschauern zu Wagen und zu Pferde überdeckt und der Kräuterduft des Thymian würzte die Luft. Da sah man eine dicke Staubwolke in der Ferne, die sich uns nahte, und stiller und stiller ward es – je näher sie kam. Es war Friedrichs Wagen; bei Körbelitz angelangt, hielt er. Der König stieg zu Pferde.
Es war ein ungeheuer großer Schimmel, ein Engländer, den er dies Jahr noch ritt. Im nächsten Jahre, oder vielleicht auch erst 1785, kam er auf einem kleinen Litauer-Schimmel, Langschwanz. Sowie er zu Pferde war, setzte er es gleich in Galopp, so daß bei dem weit ausgreifenden großen Tiere das ganze Gefolge hinter ihm Karriere ritt.
So kam der siebzigjährige königliche Greis. Ungefähr dreißig Schritt vor der Linie parierte er zum Schritt, nahm das Augenglas, sah die Linie von weitem hinunter, ob alles gut gerichtet war, und nun hielt er dicht vor uns Junkern, ein kleiner alter Mann mit ungeheuren großen Augen und durchdringendem Blick.
Er sah uns an, wandte sich zu Saldern, der unweit von ihm zu Pferde war, und sagte: »Saldern, was sollen die vielen Boucles da? eine Boucle ist genug!« – (Es waren ihm nämlich unsere vier mit Talg und Puder eingespritzten steifen Haarlocken aufgefallen, die wir an jeder Seite des Vorderkopfes trugen. Eine große Haarlocke zur Seite war damals gerade Mode, und jeder von uns dachte daher still bei sich: das ist unser Mann! Von diesem Augenblick an verschwanden denn auch diese vier Perücken-Plagelocken und eine trat an deren Stelle.)
Den Krückstock auf den rechten Fuß im Steigbügel gestemmt, fragte er nun die Fahnenjunker, und es kam zu folgendem Gespräch, mit jedem der Reihe nach.