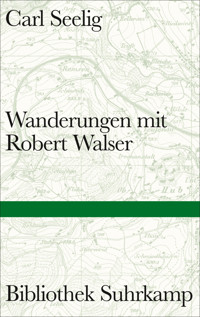
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Carl Seeligs Wanderungen mit Robert Walser prägen das Weiterleben von Robert Walsers Werk bis heute. Sie zeigen den von 1933 bis 1956 in Herisau internierten, für die Welt ›verstummten‹ Dichter als einen bei aller Zurückhaltung höchst selbstbewussten Autor und hellwachen Zeitgenossen. Auf langen Spaziergängen und an gut gedeckten Tischen entfalten die Wanderungen eine Freiheit der Bewegung, der Gedanken und der Sprache, wie sie Walsers Werk von Anfang an bestimmt.
Die vorliegende Neuausgabe bringt den Text in seiner ursprünglichen Gestalt von 1957. Sie zeigt, dass Seelig weit mehr ist als Walsers ›Vormund‹ – nämlich ein international vernetzter Herausgeber und Publizist, der zur Zeit des Nationalsozialismus auch Emigranten wie Alfred Polgar oder Robert Musil unterstützt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Carl Seelig
Wanderungen mit Robert Walser
Herausgegeben von Lukas Gloor, Reto Sorg und Peter Utz
Suhrkamp Verlag
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Unsere Wanderungen
26. Juli 1936
4. Januar 1937
27. Juni 1937
20. Dezember 1937
15. April 1938
23. April 1939
10. September 1940
21. März 1941
20. Juli 1941
11. Mai 1942
28. Januar 1943
15. April 1943
16. Mai 1943
27. Juli 1943
19. Oktober 1943
2. Januar 1944
25. Mai 1944
24. Juli 1944
28. Dezember 1944
9. April 1945
12. August 1945
23. September 1945
30. Dezember 1945
17. Juli 1946
29. Dezember 1946
26. Mai 1947
3. November 1947
4. April 1948
23. Januar 1949
15. April 1949
Bettag 1949
5. Februar 1950
23. Juli 1950
6. April 1952
Weihnachten 1952
Februar 1953
12. April 1953
30. August 1953
27. Dezember 1953
Karfreitag 1954
30. September 1954
Weihnachten 1954
Karfreitag 1955
17. Juli 1955
Weihnachten 1955
Die letzte Wanderung
Weihnachten 1956
Editorische Notiz
Nachwort
Leben in den Anderen
Erste Kontakte mit Robert Walser
Sprecher des verstummten Dichters
Fürsorge und Bemächtigung
Seeligs Werkpolitik
König der Spaziergänger
Zweistimmiger Text
Robert Walser – fotografiert von Carl Seelig
Dank
Literaturverzeichnis
Übersicht der 45 Wanderungen
Zeittafel Carl Seelig
Glossar
Kommentiertes Register
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Unsere Wanderungen
Wie übel ist uns unter den großen Maschinenrädern der jetzigen Welt zumute, wenn wir nicht unserem persönlichen Dasein eine eigentümliche, edle Weihe geben!
Jacob Burckhardt
26. Juli 1936
Unsere Beziehungen leiteten einige nüchterne Briefe ein; kurze, sachliche Fragen und Antworten. Ich wußte, daß Robert Walser anfangs 1929 als Geisteskranker in die bernische Heilanstalt Waldau eingeliefert worden war und seit Juni 1933 als Patient der kantonalen Heil- und Pflegeanstalt von Appenzell-Außerrhoden in Herisau lebte. Ich empfand das Bedürfnis, für die Publikation seiner Werke und für ihn selbst etwas zu tun. Unter allen zeitgenössischen Schriftstellern der Schweiz schien er mir die eigenartigste Persönlichkeit zu sein. Er erklärte sich einverstanden, daß ich ihn besuche. So fuhr ich an diesem Sonntag frühmorgens von Zürich nach St. Gallen, schlenderte durch die Stadt und hörte mir in der Stiftskirche die Predigt über Die Verschwendung des Talentes an. In Herisau läuteten die Kirchenglocken, als ich ankam. Ich ließ mich beim Chefarzt der Anstalt, Dr. Otto Hinrichsen, anmelden und erhielt von ihm die Erlaubnis, mit Robert spazieren zu gehen.
Nun kam der achtundfünfzigjährige Dichter in Begleitung eines Wärters aus einem Nebenhaus. Ich war frappiert über seine äußere Erscheinung. Ein rundes, wie durch einen Blitzschlag gespaltenes Kindergesicht mit rot angehauchten Backen, blauen Augen und einem kurzen, goldenen Schnurrbart. Die Schläfenhaare schon angegraut. Der ausgefranste Kragen und die Krawatte etwas schief sitzend; die Zähne nicht in bestem Zustand. Als Dr. Hinrichsen Robert den obersten Westenknopf zutun wollte, wehrte er ab: »Nein, er muß offen bleiben!« Er sprach in melodischem Bärndütsch, so, wie er es in Biel schon während der Jugendzeit gesprochen hat. Nach ziemlich abruptem Abschied vom Arzt schlugen wir den Weg zum Bahnhof Herisau und weiter nach St. Gallen ein. Es war ein sommerlich-heißer Tag. Unterwegs begegneten uns viele Kirchengänger, die freundlich grüßten. Roberts ältere Schwester Lisa hatte mich darauf aufmerksam gemacht, daß ihr Bruder ungewöhnlich mißtrauisch sei. Was sollte ich tun? Ich schwieg. Er schwieg. Das Schweigen war der schmale Steg, über den wir uns entgegenkamen. Mit glühenden Köpfen wanderten wir durch die Landschaft, eine hügelige, undämonische Wald- und Wiesenlandschaft. Manchmal blieb Robert stehen, um sich eine »Maryland«-Zigarette anzuzünden und schnuppernd unter die Nase zu halten.
Mittagessen im Löchlibad. Erstes Auftauen bei blutrotem Bernecker Wein und Bier. Robert erzählt, daß er in Zürich vor der Jahrhundertwende bei der Schweizerischen Kreditanstalt und bei der Kantonalbank gearbeitet habe. Jedoch nur monateweise, um sich wieder zum Dichten freizumachen. Zwei Herren könne man nicht gleichzeitig dienen. Damals sei sein erstes Buch entstanden, Fritz Kochers Aufsätze, das der Inselverlag 1904 mit elf Zeichnungen seines Bruders Karl herausgebracht habe. Ein Honorar habe er für diese Arbeit nie gesehen, und als sie im Buchhandel liegen blieb, sei sie ziemlich rasch verramscht worden. Seine Abseitigkeit vom literarischen Cliquenbetrieb habe ihm finanziell überhaupt schwer geschadet. Aber der Göttischmus, wie er vielerorts gäng und gäbe sei, ekle ihn einfach an. Dadurch werde der Schriftsteller zum Schuhputzer degradiert. Ja, er fühle es, seine Zeit sei vorbei. Aber das lasse ihn kühl. Wenn man gegen die Sechzig gehe, müsse man sich auf ein anderes Dasein besinnen können. Er habe seine Bücher nicht anders geschrieben als wie ein Bauer, der säe und mähe, pfropfe, Vieh futtre und miste. Aus Pflichtgefühl und um etwas zum Fressen zu haben. »Sie war mir eine Arbeit wie eine andere auch.«
Die produktivste Zeit seines Schriftstellerlebens seien die sieben Jahre in Berlin und die folgenden sieben Jahre in Biel gewesen. Da habe ihn niemand gedrängt und niemand kontrolliert. Alles habe so ruhig wachsen können wie die Äpfel auf dem Apfelbaum. In der menschlichen Haltung sei die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg für die meisten Schriftsteller eine beschämende Zeit gewesen. Ihre Literatur habe einen giftscheißerischen, gehässigen Charakter angenommen. Die Literatur müsse aber Liebe ausstrahlen, gemütlich sein. Der Haß dürfe nicht zur treibenden Kraft werden. Haß sei ein unproduktives Element. Damals, inmitten dieser grämlichen Orgien, habe sein künstlerischer Abstieg begonnen … Man habe die Literaturpreise an falsche Heilande oder an irgendeinen Schulmeister verteilt. Nun gut, dagegen habe er nichts machen können. Aber bücken werde er sich deswegen bis zu seinem Tod vor niemandem. Das Cliquen- und Vetterliwesen erledige sich übrigens immer von selbst.
Zwischen diesen Gesprächen bewundernde Bemerkungen über DostojewskijsIdiot, EichendorffsAus dem Leben eines Taugenichts und Gottfried Kellers männlichkühne Lyrik. Rilke hingegen gehöre auf den Nachttisch der alten Jungfern. Von Jeremias Gotthelf stehen ihm die beiden Uli-Bände am nächsten; manches andere sei für seinen Geschmack zu derbpolternd und moralisierend.
4. Januar 1937
Wanderung über St. Gallen und Speicher nach Trogen, das mir von meiner Kantonsschulzeit her vertraut ist. Mittagessen im Gasthof Schäfli. Zu Ehren meiner mütterlichen Vorfahren, die am rheintalischen Buchberg jahrhundertelang Reben besaßen, bestelle ich eine Flasche vom schweren Buchberger. Als unerwünschte Zugabe Radiogeschmetter; eine schwäbische Komödie. – Nachmittags bei melancholischer Schneestimmung auf den Gäbris, wo ich als Kadettenleutnant mit dem vom Dorfarzt geliehenen, mächtigen Säbel eine lächerliche Figur war. Zeitweise scharfer Ostwind. Robert ohne Überzieher. Auf der Rückfahrt im Zug: sein Gesicht ist jetzt geistig erhellt wie eine angezündete Fackel. Tiefe, schmerzliche Züge von der Nasenwurzel bis zum auffallend roten, fleischigen Mund. Der Bahnhofperron von St. Gallen funkelt von kleinen Kieselsteinen. Robert hat Tränen in den Augen. Heftiger, hastiger Händedruck.
Ausschnitte aus unseren Gesprächen:
Sein Aufenthalt in Zürich dauerte mit Unterbrüchen vom Herbst 1896 bis zum Frühjahr 1903; bald habe er auf dem Zürichberg, bald an der Spiegelgasse und an der Schipfe eine Bude gehabt, bald auch in Außersihl. – Sieben Jahre (von 1906 bis 1913) habe auch sein Aufenthalt in Berlin und weitere sieben Jahre sein zweiter Aufenthalt in Biel gedauert. Schon oft sei ihm aufgefallen, wie in seinem Leben die Zahl 7 periodisch wiederkehre.
In Berlin-Charlottenburg habe er zuerst gemeinsam mit seinem Bruder Karl eine Zweizimmerwohnung gehabt, dann allein. Schließlich weigerte sich der Verleger Bruno Cassirer, ihm finanziell weiterzuhelfen. An seiner Stelle habe während zwei Jahren eine edelherzige, reiche Dame für ihn gesorgt. Nach deren Tod sei er 1913 aus Not in die Heimat zurückgekehrt. Noch lange habe er an die stille Schönheit der märkischen Wälder denken müssen.
In Bern, wo er von 1921 an etwa acht Jahre lang lebte, sei das Althergebrachte für seine dichterische Produktion förderlich gewesen. Negativ habe sich hingegen die Verlockung zum Trunk und zur Behaglichkeit ausgewirkt. »In Bern war ich manchmal wie besessen. Ich jagte wie der Jäger hinter dem Wild den poetischen Motiven nach. Am fruchtbarsten erwiesen sich Promenaden durch Straßen und lange Spaziergänge in die Umgebung der Stadt, deren gedanklichen Ertrag ich dann zuhause aufs Papier brachte. Jede gute Arbeit, auch die kleinste, bedarf der künstlerischen Inspiration. Für mich steht fest, daß das Geschäft der Dichter nur in der Freiheit blühen kann. Meine günstigsten Arbeitszeiten waren der Vormittag und die Nachtstunden. Die Zeit vom Mittag bis zum Abend wirkte auf mich verdummend. Mein bester Kunde war damals die vom tschechischen Staat finanzierte Prager Presse, deren Feuilleton-Redaktor Otto Pick alles von mir brachte, was ich schickte, auch Gedichte, die von anderen Zeitungen wie Bumerangs zurückflogen. Häufig habe ich früher auch den Simplicissimus bedient. Er retournierte zwar wiederholt meine Beiträge, weil er sie zu wenig humorvoll fand. Aber was er behielt, honorierte er gut. Mindestens fünfzig Mark pro Geschichtchen, also kleine Vermögen für meine Tasche.«
Ich: »Vielleicht liefert Ihnen das Milieu der Anstalt und seine Insassen einmal einen originellen Romanstoff?« – Robert: »Ich glaube kaum. Jedenfalls wäre ich unfähig, ihn auszubauen, solange ich selbst darin sitze. Dr. Hinrichsen hat mir zwar zum Schreiben ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Aber ich hocke wie vernagelt darin und bringe nichts zustande. Vielleicht, wenn ich zwei, drei Jahre außerhalb der Anstalt in der Freiheit leben würde, käme der große Durchbruch –.« – Ich: »Wieviel würden Sie denn brauchen, um als freier Schriftsteller leben zu können?« – Robert, nach einigem Nachdenken: »Schätzungsweise 1800 Franken jährlich.« – »Nicht mehr?« – »Nein, das würde genügen. Wie oft habe ich in meiner Jugend mit weniger auskommen müssen! Man kann doch auch ohne materielle Güter ganz ordentlich leben. Verpflichten könnte ich mich allerdings weder einer Zeitung noch einem Verleger. Ich möchte keine Versprechungen abgeben, die ich nicht halten kann. Alles muß ungezwungen aus mir herauswachsen.«
Später: »Könnte ich mich nochmals ins dreißigste Lebensjahr zurückschrauben, so würde ich nicht mehr wie ein romantischer Luftibus ins Blaue hineinschreiben, sonderlingshaft und unbekümmert. Man darf die Gesellschaft nicht negieren. Man muß in ihr leben und für oder gegen sie kämpfen. Das ist der Fehler meiner Romane. Sie sind zu schrullig und zu reflexiv, in der Komposition oft zu salopp. Um die künstlerische Gesetzmäßigkeit mich foutierend, habe ich einfach drauflosmusiziert. Vor der Neuausgabe hätte ich die Geschwister Tanner gern um siebzig oder achtzig Seiten gekürzt; heute finde ich, daß man vor der Öffentlichkeit über seine eigenen Geschwister nicht so intim urteilen darf.« – Ich: »Mit Begeisterung habe ich kürzlich Ihren Jakob von Gunten gelesen. Wo ist er eigentlich entstanden?« – »In Berlin. Zum größeren Teil ist er eine dichterische Phantasie. Etwas verwegen, nicht wahr? Unter meinen umfangreicheren Büchern ist er mir auch das liebste.« – Nach einer Pause: »Je weniger Handlung und einen je kleineren regionalen Umkreis ein Dichter braucht, umso bedeutender ist oft sein Talent. Gegen Schriftsteller, die in Handlungen exzellieren und gleich die ganze Welt für ihre Figuren brauchen, bin ich von vornherein mißtrauisch. Die alltäglichen Dinge sind schön und reich genug, um aus ihnen dichterische Funken schlagen zu können.«
Gespräch über den Dramatiker August von Kotzebue, dessen Grazie und gesellschaftliche Geschmeidigkeit Robert bewundert. Er erinnert sich, daß Kotzebue zu Beginn des 19. Jahrhunderts für ein Jahr nach Sibirien verbannt wurde und darüber ein zweibändiges Memoirenwerk geschrieben hat. Auch sein Ende sei wegen der Ermordung durch den hyperpatriotischen Burschenschafter Karl Ludwig Sand dramatisch gewesen. In seiner Haltung gegen Schiller und Goethe habe Kotzebue als reaktionärer Hemmschuh gewirkt. – Robert glaubt nicht an eine Fortschrittsmöglichkeit der Schweizer Literatur, solange sie im Bäurischen stecken bleibt. Weltmännisch und weltoffen müsse sie werden, ohne den engbrüstigen, der Erde nachkriechenden Hang zum Kleinbäuerlichen. Er lobt Uli Bräker, den armen Mann vom Toggenburg, und seine Shakespeare-Aufsätze. Welch andere und größere Ideale als die heutigen Schriftsteller habe noch Gottfried Keller gehabt, dessen Es wandert eine schöne Sage er vom Anfang bis zum Ende zitiert. Sein Grüner Heinrich bleibe für alle Generationen ein lesens- und liebenswertes, wunderbar erzieherisches Buch. »Eine Angestellte der Anstalt wollte mir kürzlich StiftersWitiko aufzwingen. Aber ich bedeutete ihr, daß ich von einem dickleibigen Roman nichts wissen wolle. Mir genügen Stifters Naturstudien, diese unvergleichlich innigen Beobachtungen, in die er die Menschen so harmonisch hineingestellt hat. Aber was sagen Sie zum Schmerbauch der Josef-Trilogie von Thomas Mann? Wie kann man es nur wagen, einen in der Bibel verwurzelten Stoff derart breitzunudeln?«
Über Revolutionen: »Es ist ein Unsinn, Aufstände außerhalb der Städte inszenieren zu wollen. Wer die Städte nicht besitzt, besitzt nicht das Herz des Volkes. Alle erfolgreichen Revolutionen gingen von den Städten aus. Deshalb betrachte ich es als sicher, daß im spanischen Bürgerkrieg die Regierung den Endsieg erringen wird.«
»Die wilhelminische Aera kam den Künstlern entgegen, sich außenseiterisch und extravagant zu gebärden. Ja, sie verhätschelte die Schrullenhaftigkeit geradezu. Doch auch die Künstler müssen sich einfügen in die Gesetzmäßigkeit. Sie dürfen nicht zu Hanswursten werden.«
27. Juni 1937
Aus der Nebelküche von St. Gallen mit Postauto nach Rehetobel. Von dort zu Fuß nach Heiden und nach dem wie in einer grünen Wiege liegenden Dorf Thal, der Heimatgemeinde meiner mütterlichen Vorfahren. Nach dem Mittagessen durch das Rebgelände des Buchberges hinauf zur Wirtschaft Zum steinernen Tisch, von wo aus man einen weiten Blick ins Bodenseegebiet hat. Später bei heftigem Gewitter durch das idyllische Dörfchen Buchen über den Rorschacherberg nach Rorschach. Heimkehr im Zug.
»Wissen Sie, was mein Verhängnis ist? Passen Sie gut auf! All die herzigen Leute, die glauben, mich herumkommandieren und kritisieren zu dürfen, sind fanatische Anhänger von Hermann Hesse. Sie vertrauen mir nicht. Für sie gibt es nur ein Entweder-Oder: ›Entweder du schreibst wie Hesse oder du bist und bleibst ein Versager.‹ So extremistisch beurteilen sie mich. Sie haben kein Vertrauen in meine Arbeit. Und das ist der Grund, weshalb ich in der Anstalt gelandet bin. – Mir hat halt immer der Heiligenschein gefehlt. Nur mit ihm kann man in der Literatur arrivieren. Irgendein Nimbus von Heroismus, von Duldertum und dergleichen, und schon ist die Leiter zum Erfolg da … Mich sieht man eben unbarmherzig, wie ich bin. Deshalb nimmt mich niemand ganz ernst.«
Zwischenbemerkungen:
»Wenn die Zeitung schmunzelt, weint die Menschheit.«
»Die Natur braucht sich nicht anzustrengen, bedeutend zu sein. Sie ist es.«
»Wieviel Nobelpreis-Bekränzte werden schon längst vergessen sein, wenn Jeremias Gotthelf noch in aller Gemütlichkeit fortexistiert! Solange es einen Kanton Bern gibt, wird es auch einen Jeremias Gotthelf geben.«
»Der Schriftsteller C. F. W.: er sieht aus wie ein Schmierenschauspieler.«
»Das Glück ist kein guter Stoff für Dichter. Es ist zu selbstgenügsam. Es braucht keinen Kommentar. Es kann in sich zusammengerollt schlafen wie ein Igel. Dagegen das Leid, die Tragödie und die Komödie: sie stecken voll Explosivkräften. Man muß sie nur zur rechten Zeit anzünden können. Dann steigen sie wie Raketen zum Himmel und illuminieren die ganze Gegend.«
20. Dezember 1937
Leichter Schneefall. Robert steht ohne Überzieher am Bahnhof, jedoch mit einem wurstartig aufgerollten Regenschirm. Er scheint nicht zu frieren. Wir bummeln durch St. Gallen und steuern in die Gilge, wo wir die einzigen Gäste sind. Robert spricht später noch lange von der stattlichen Kellnerin mit den schielenden Augen, die ihm über den Rücken gestrichen ist. »Wir hätten dort bleiben sollen!« Als ich ihm während des Mittagessens im Marktplatz sage, die Kellnerin, die uns jetzt bediene, sei doch viel hübscher, sie besitze so nette Beine, sagt er: darauf komme es ihm nicht an. Er betrachte die Gesamtheit eines Menschen, vor allem sein Wesen.
Wir probieren in einem Konfektionsgeschäft verschiedene Anzüge für Robert. Der Chef meint, er sei mein Vater. Die Maßkleider passen ihm aber nicht gut, da er einen zu runden Rücken hat. Er wünscht etwas »Bäurisches, auf alle Fälle nichts Auffälliges«. Da ihn das Maßnehmen und Herumfingern an seiner Person immer nervöser macht und sein Kopf rot anzulaufen beginnt, ergreife ich mit ihm die Flucht, ohne etwas gekauft zu haben.
Dunkle bayrische Bierhalle. Kräftiges Bier. Hier gefällt es ihm. Unablässig zündet er sich eine »Parisienne« nach der anderen an. Er frägt mich mit trockener Ironie, ob ich mit der im Verlag Rentsch erschienenen Walser-Auswahl Große kleine Welt ein gutes Geschäft gemacht habe. Rühmt Wieland und Lessing, während ihm Matthias Claudius zu naiv ist. Sagt: »Auf Klassiker war ich nie jaloux. Dagegen auf zweitrangige Schriftsteller, vor allem auf Wilhelm Raabe und Theodor Storm. Denn derlei hätte ich auch machen können, so bürgerlich-gemütliche Geschichten wie sie. Die Saugemütlichkeit ärgert mich an Raabe direkt.« – Ich: »So sind Sie also auch auf Gottfried Keller jaloux?« – Robert, lachend: »Nein, das war ja nur ein Zürcher!«
Ich erzähle ihm, daß er von der Kommission zur Förderung des bernischen Schrifttums eine Ehrengabe erhalten werde. Das freut ihn.
15. April 1938
Robert Walsers sechzigster Geburtstag. Wie ich ihn kenne, würden ihn Glückwünsche nur widerborstig machen. Das Wiedersehen wird im Bahnhofbuffet Herisau mit heißer Käswähe und einem Schoppen eröffnet, wozu Robert bemerkt: »Seit Neujahr habe ich nichts Anfeuerndes mehr getrunken!« In scharfem Tempo brechen wir nach Lichtensteig auf, dem dreißig Kilometer entfernten Hauptstädtchen des Toggenburgs. Wir schlagen schmale, einsame Seitenwege ein, auf denen uns nur wenige Kirchengänger begegnen. Robert bleibt oft stehen, um die Anmut einer Hügelkuppe, die Behäbigkeit eines Wirtshauses, die Bläue des österlichen Tages, die friedliche Abgeschlossenheit eines Landschaftsausschnittes oder eine grün-braune Waldlichtung zu bewundern.
Er muß unzählige Male nießen, da er vor einer Woche durch einen Grippekranken angesteckt wurde. Degersheim, ein schmuckes Dorf. Über einen Hügel nach Lichtensteig, wo wir nach vier Stunden ankommen. Währschaftes Mittagessen in der Nähe des Dorfplatzes; hernach in eine Konditorei, aus der jeder einen Sack »Biberli« heimträgt. Rückfahrt mit Zug nach Herisau. Bier im Bahnhofbuffet, hernach spritzigen Neuchâteler im Eidgenössischen Kreuz, wo sich Robert besonders wohlfühlt. Er lobt den entzückenden, genußreichen Tag und macht bereits Pläne für die nächste Zusammenkunft. Ein Spaziergang nach Wil scheint ihm lohnend. Am Bahnhof gratuliere ich ihm endlich zum Geburtstag. Er schüttelt mir mehrmals die Hand, läuft meinem Zug nach und winkt so lange, bis er um die Ecke verschwunden ist.
Aus den Gesprächen:
In Berlin absolvierte Robert einen Monat lang eine Dienerschule. Er schildert die pagenhafte Feinheit vieler Diener. Der Kammerdiener eines Grafen habe ihn auf ein oberschlesisches, auf einem Hügel gelegenes Schloß engagiert. Unten: das Dorf. Robert mußte die Säle reinigen, Silberlöffel polieren, Teppiche klopfen und als »Monsieur Robert« im Frack servieren. Er blieb dort ein halbes Jahr lang. Die Dienerschule schilderte er später im Tagebuch Jakob von Gunten, wobei er das Milieu in ein Knabeninstitut verlegte. »Aber zum Diener eignete ich mich in meiner schweizerischen Unbeholfenheit auf die Dauer doch nicht.« Als sensationeller Besuch kam einmal die Verfasserin des damals in Mode stehenden Buches Briefe, die ihn nicht erreichten, Freifrau Elisabeth von Heyking, auf das Schloß.
Sein Malerbruder Karl stellte Robert in Berlin nach dieser Dienerepisode den Verlegern Samuel Fischer und Bruno Cassirer vor; Karl war damals durch verschiedene Theaterdekorationen, die er für Max Reinhardt machte, so zu Hoffmanns Erzählungen und Carmen, bekannt geworden. Mit Max Liebermann malte er öfters in Holland und an der Ostsee. Bruno Cassirer animierte Robert, einen Roman zu schreiben. Es entstanden daraufhin die Geschwister Tanner, die Cassirer jedoch nicht besonders gefielen. Ein Kritiker meinte, dieser Walser-Roman bestehe aus lauter Anmerkungen.
Das Gespräch kommt auf Maximilian Harden, für dessen Zeitschrift Die Zukunft Robert ab und zu geschrieben hat. Er rühmt Hardens aristokratisches Wesen und sein Talent, den Zeitcharakter in brillanten Artikeln festzuhalten. Stellt ihn sogar über Ludwig Börne, dessen Sprachmelodie er schätzt; als bedeutendsten Journalisten der deutschen Sprache bezeichnet er Heine, dessen lausbübisches Wesen zu diesem Beruf passe. Er schildert Hardens Abstieg, der logischerweise mit Deutschlands Debacle im Ersten Weltkrieg begonnen habe.
In Zürich habe Robert während wenigen Wochen auf dem Kontor der Maschinenfabrik Escher-Wyß gearbeitet, einige Zeit auch als Diener bei einer vornehmen Jüdin.
Die schönste Zeit bleibe aber für ihn Biel. »Mit den Bielern selbst verkehrte ich wenig. Ich plauderte mit den Fremden, die ins Blaue Kreuz kamen, wo ich in einer Dachstube einlogiert war. Das Zimmer Nr. 27 kostete zwanzig Franken, die volle Pension neunzig Franken. Um mich waren Zimmermädchen, allerhand nette Frauenwesen mit einem leichten französischen Einschlag, der mir lieb war.« – »Warum sind Sie denn von Biel fortgegangen?« – »Ich war zu jener Zeit sehr arm. Auch begannen die Motive und Staffagen, die ich aus Biel und seiner Umgebung schöpfte, allmählich zu versiegen. In dieser Situation schrieb mir meine jüngere Schwester Fanny, daß sie für mich eine Stellung in Bern wisse. Auf dem kantonalen Archiv. Da durfte ich nicht Nein sagen. Leider verkrachte ich mich nach einem halben Jahr mit dem Vorsteher, den ich durch eine freche Bemerkung vertäubte. Er entließ mich, und ich nahm wieder das Schriftstellergewerbe auf. Ich begann nun unter dem Eindruck der wuchtigen, vitalen Stadt weniger hirtenbübelig, mehr männlich und auf das Internationale gestellt, zu schreiben als in Biel, wo ich mich eines zimperlichen Stiles bediente. Der Erfolg war, daß – angezogen vom Namen der schweizerischen Bundesstadt – zunächst viele An- und Aufträge ausländischer Zeitungen für mich einliefen. Es galt, neue Motive und Einfälle zu suchen. Das viele Sinnieren schadete mir aber gesundheitlich. In den letzten Berner Jahren quälten mich wüste Träume: Donner, Geschrei, würgende Halsgriffe, halluzinatorische Stimmen, so daß ich oft laut rufend erwachte. – Einmal wanderte ich um zwei Uhr nachts von Bern nach Thun, wo ich am Morgen um sechs Uhr ankam. Mittags war ich auf dem Niesen, wo ich vergnügt ein Stück Brot und eine Büchse Sardinen vertilgte. Abends war ich wieder in Thun und um Mitternacht in Bern; natürlich alles zu Fuß. – Ein andermal spazierte ich von Bern nach Genf und zurück, einmal in Genf übernachtend. Eine meiner frühesten Reisebeschreibungen galt dem Greifensee, den Johann Victor Widmann im Bund publizierte. Ich fand es schon damals verflucht schwer, gute Reisebeschreibungen zu machen.«
»Eine Dichtung muß sein wie ein schöner Anzug, der dem Käufer flattiert.«
»Peter Altenberg: ein liebes Wiener Würstl. Aber die Auszeichnung ›Dichter‹ könnte ich ihm nicht geben.«
»Die Österreicher wären von den Nazis nicht geschnappt worden, wenn sie einen flotten, charmanten Weiberrock an die Spitze des Landes gesetzt hätten. Jeder wäre darunter geschloffen, auch Hitler und Mussolini. Denken Sie an die Königin Viktoria und an die holländischen Regentinnen! Weibern dienen die Diplomaten immer gern. Wie artig schwänzelnd erst die femininen Österreicher!«
»Von Zeitgenossen möchte ich lieber nichts lesen, solange ich in der Situation eines Kranken bin. Da bleibt Distanz das Angemessenste.« – »Was nützt dem Künstler sein Talent, wenn ihm die Liebe fehlt?«
»Jeremias Gotthelf: es geht mir bei ihm genau so wie der Frau, die Heinrich Pestalozzi in seinem Roman Lienhard und Gertrud sagen läßt: ›De Pfarrer het mi us dr Chile tribe!‹«
Erzählt halb ärgerlich, halb belustigt von einer Frau A., die er noch aus der Jugendzeit kenne und die jetzt die Frau eines gutsituierten Postbeamten sei. Nun lasse sie ihn am Seil herunter, indem sie ihn einerseits mit Fondantschokolade bombardiere und andrerseits in impertinenten Briefen stichle: »Ich kann Sie noch immer nicht recht ernst nehmen!« In Thomas Mann habe sie diesbezüglich einen Verbündeten gefunden, denn er habe ihn in einem Brief kurzerhand zu einem »klugen Kind« degradiert.
23. April 1939
Robert zeigt Lust, einmal ins »Deutsche« zu gehen, nach Meersburg. Aber der kühle, bewölkte Frühlingsmorgen sei eigentlich für eine Fußwanderung wie geschaffen. Ob mir der Marsch nach Wil recht sei. Warum nicht! Mir ist die harmonische Stimmung wichtiger als die Marschrichtung.
Robert hat, wie meistens, den Regenschirm bei sich; sein Hut wird immer schäbiger. Das Band völlig zerfetzt. Er will jedoch keinen neuen haben. Das Neue ist ihm widerwärtig. Er will auch seine defekten Zähne nicht in Ordnung bringen lassen. Das alles ist ihm lästig; ich wage kaum davon zu sprechen, obwohl mich seine Lieblingsschwester Lisa gebeten hat, mich auch um diese Dinge zu kümmern.
Wir machen den Weg Herisau–Wil, ständig plaudernd, in dreieinhalb Stunden. Uns ist, als hätten wir Rollschuhe an, so leicht traben wir vorwärts. Manchmal macht mich Robert auf eine besonders schöne Wiese oder auf Wolkenzüge, barocke Herrschaftshäuser aufmerksam. Er läßt sich auch ohne Widerstand fotografieren. Ich bin baff. Es macht ihn glücklich und lustig, daß wir die sechsundzwanzig Kilometer so schnell hinter uns gebracht haben, nur mit einem Vermouth als »Benzin«. In der ersten Wirtschaft, in der wir uns niederließen, saßen zwei verknitterte, alte Frauen und eine junge. Sie studierten das Radioprogramm und kamen, als wir aufbrachen, an unseren Tisch, um uns die Hand zu schütteln.
Wil. Wir essen Im Hof, haben gewaltigen Hunger und kehren nachher von einer Wirtschaft zur anderen ein. Im ganzen waren es fünf. Robert schlägt vor, daß wir nicht schon um 3½ Uhr nach Goßau zurückfahren. Erst zwei Stunden später. Er möchte, daß wir heute möglichst lange beisammen sind. Er schaut mir jetzt oft in die Augen; das Distanzierte und Trockene, hinter dem er sich gern verschanzt, hat einer stillen Zutraulichkeit Platz gemacht. Sein Zug nach Herisau fährt zwei Minuten nach dem meinigen. Im Moment, als sich mein Zug in Bewegung setzt, macht er ganz ernsthaft zwei tiefe Verbeugungen. Ob er an »Monsieur Robert« denkt, den Schloßdiener? Jetzt mache auch ich zwei Verbeugungen und rufe ihm zu: »Das nächste Mal ins Deutsche!«, worauf er lebhaft nickt und seinen Hut schwenkt.
Zu Beginn des Spazierganges erzählte mir Robert folgende Prozeßgeschichte: Ein Rechtsanwalt in London wurde angeklagt, seine Frau ermordet zu haben. Sein liebenswürdiges und anmutiges Wesen nahm die Richter aber derart für ihn ein, daß ein für ihn günstiges Urteil zu erwarten war. Der Angeklagte war jedoch gegensätzlicher Meinung. Er beschloß, mit seiner hübschen Sekretärin, derenthalben er seine Frau ermordet hatte, nach den Vereinigten Staaten zu fliehen. Auf dem Schiff wurde er verhaftet. Die Verkennung der psychologischen Lage kostete den Rechtsanwalt den Kopf. Denn sein Fluchtversuch machte die Richter mißtrauisch. Sie ließen den Boden der Küche aufreißen und fanden tatsächlich die zerstückelte Leiche. – So hat der Mörder sich selbst um den Kopf gekürzt. Hätte er die Rolle des liebenswürdigen Mannes weitergespielt, so wäre er wahrscheinlich freigesprochen worden. Die Moral: Man kann wohl die Anderen täuschen, sich selber aber täuscht man auf die Länge nie.
»Als ich 1913 mit hundert Franken aus Berlin nach Biel zurückkehrte, hielt ich es für geraten, mich so unauffällig wie nur möglich zu benehmen. Zu triumphieren gab es wirklich nichts. Ich ging Tag und Nacht allein spazieren; dazwischen betrieb ich mein Schriftstellergeschäft. Schließlich, als ich alle Motive abgegrast hatte wie eine Kuh ihre Weide, verzog ich mich nach Bern. Auch dort ist es mir anfangs gut gegangen. Aber stellen Sie sich meinen Schrecken vor, als ich eines Tages von der Feuilletonredaktion des Berliner Tageblatts einen Brief bekam, in dem mir angeraten wurde, ein halbes Jahr lang nichts zu produzieren! Ich war verzweifelt. Ja, es stimmte, ich war total ausgeschrieben. Totgebrannt wie ein Ofen. Ich habe mich zwar angestrengt, trotz dieser Warnung weiterzuschreiben. Aber es waren läppische Dinge, die ich mir abquälte. Immer ist mir nur das geglückt, was ruhig aus mir selbst wachsen konnte und was irgendwie erlebt war. Damals habe ich ein paar stümperhafte Versuche unternommen, mir das Leben zu nehmen. Ich konnte aber nicht einmal eine rechte Schlinge machen. Schließlich war es so weit, daß mich meine Schwester Lisa in die Anstalt Waldau brachte. Noch vor dem Eingangstor habe ich sie gefragt: ›Tun wir auch das Richtige?‹ Ihr Schweigen sagte mir genug. Was blieb mir übrig, als einzutreten?«
»Es ist ein Unsinn und eine Roheit, an mich den Anspruch zu stellen, auch in der Anstalt zu schriftstellern. Der einzige Boden, auf dem ein Dichter produzieren kann, ist die Freiheit. Solange diese Bedingung unerfüllt bleibt, weigre ich mich, je wieder zu schreiben. Damit, daß man mir ein Zimmer, Papier und Feder zur Verfügung stellt, ist es nicht getan.« – Ich: »Ich habe den Eindruck, daß Sie diese Freiheit gar nicht wünschen!« – Robert: »Niemand ist da, der sie mir anbietet. Also heißt es warten.« – Ich: »Hätten Sie wirklich Lust, die Anstalt zu verlassen?« – Robert (zögernd): »Man könnte es probieren!« – Ich: »Wo möchten Sie denn am liebsten leben?« – Robert: »In Biel, Bern oder Zürich – gleichgültig wo! Das Leben kann überall charmieren.« – Ich: »Würden Sie wirklich wieder zu schreiben beginnen?« – Robert: »Auf diese Frage gibt es nur eines: sie nicht beantworten.«
In den letzten Monaten hat Robert SeumesSpaziergang nach Syrakus und seine abenteuerliche Autobiographie, Gottfried KellersRomeo und Julia auf dem Dorfe sowie die Novelle Goethe und Therese des bayrischen Naturlyrikers Martin Greif mit Genuß gelesen. Er sagt: »Der Künstler muß sein Publikum entzücken oder quälen. Er muß es zum Weinen oder zum Lachen bringen.« – Ich erzähle ihm, daß ein schweizerischer Schulmeister einen Roman geschrieben habe, der zeitweise in einem Pariser Bordell spielt. Roberts Reaktion: »Es ist grauslich, worauf impotente Skribenten manchmal geraten!«
Über den Staat: »Mir kommt es philiströs vor, den Staat mit moralischen Ansprüchen zu molestieren. Der Staat hat als Erstes die Aufgabe, stark und wachsam zu sein. Die Moral muß die Angelegenheit des Individuums bleiben.«
Ich: »Wollen wir noch etwas nachtessen gehen?« – Robert: »Wozu? Leberli und Geschnetzeltes können mich nicht aufheitern! Trinken wir lieber noch etwas! Das ist, was mir wohltut. Essen kann ich noch oft genug. Jeden Tag. Aber trinken? Das kann ich nur mit Ihnen!«
10. September 1940
Robert wird immer weißhaariger; am Nacken wachsen ihm schon ganze Büschelchen schneeweißer Haare. Wir stärken uns zunächst mit Bier und zwei Stück Käswähen. Ich schlage ihm vor, nach Teufen – der Gemeinde, in der er eingebürgert ist – zu marschieren. Er erklärt sich einverstanden und frägt: »Auf der Landstraße?« – »Ja, dafür haben Sie doch eine Vorliebe? – Aber es regnet in Strömen, Herr Walser!« – »Umso besser! Man kann nicht immer im Licht gehen.«
Wir ziehen los über Hundwil und Stein. Es schüttet nun wie aus Gießkannen. Einmal stehen wir bei einer Autobusstelle unter, wo auf einer Bank eine alte Frau sitzt, die noch nie Auto und Eisenbahn gefahren ist. Ich unterhalte mich mit ihr. Robert steht stumm daneben und raucht die »Parisiennes«, die ich ihm mitgebracht habe.
Unterwegs sprechen wir über die Mäzenatenfamilie Reinhart in Winterthur. Darauf anspielend, bemerkt Robert später: »Sie sehen heute so reinhartelig aus!« – Ich: »Wieso?« – Robert: »So herrschäftelig, voll Vornehmheitsallüren. Ein bißchen unheimlich!« – »Ich gehe doch am Nachmittag in St. Gallen zur Beerdigung einer Verwandten.« – Robert, trocken: »Eben.«
Sein Gedächtnis für weit zurückliegende Vorkommnisse ist frappant. Er erinnert sich an Dutzende von Namen und Einzelheiten aus dem Leben von Friedrich dem Großen, Napoleon, Goethe, Gottfried Keller und anderen. Daß Keller an seinem 70. Geburtstag die Urschweiz als Aufenthalt wählte, hält er für keinen Zufall. Instinktiv wollte er an diesem Tag dem Herzen seiner Nation nahe sein. – Für Versuche, in der Mundart zu schreiben, habe er, Robert Walser, wenig übrig: »Ich habe absichtlich nie im Dialekt geschrieben. Ich fand das immer eine unziemliche Anbiederung an die Masse. Der Künstler muß zu ihr Distanz halten. Sie muß vor ihm Respekt empfinden. Es muß einer schon ein rechter Tschalpi sein, wenn er sein Talent darauf aufbaut, volksnaher schreiben zu wollen als die andern. – Die Dichter sollten sich grundsätzlich verpflichtet fühlen, edelmännisch zu denken und zu handeln und nach dem Hohen zu streben.« Als unser Gespräch auf Walter Hasenclever übergeht, der in Spanien Selbstmord begangen hat, bemerkt Robert: »Man hetzt nicht ungestraft gegen die Macht der Väter. Hasenclevers Drama Der Sohn habe ich schon in Berlin als eine Beleidigung für alle Väter empfunden. Ewige Gesetze bekämpfen zu wollen, ist ein Zeichen geistiger Unreife. Man riskiert dabei, daß sie sich an einem rächen.«
Robert bewundert an den Diktatoren den sicheren Instinkt für die Staatsraison. Ihre Rücksichtslosigkeit sei ein Naturgesetz, das ihnen erst ermögliche, zu bestehen: »Da die Diktatoren fast immer aus den unteren Volksschichten aufsteigen, wissen sie genau, was das Volk ersehnt. Indem sie ihre eigenen Wünsche erfüllen, erfüllen sie auch die seinigen. – Das Volk liebt es, daß man ihm etwas zuliebe tut, daß man bald väterlich-lieb und bald streng mit ihm ist. So kann man es sogar für Kriege gewinnen.«
»Haben Sie schon bemerkt, wie jeder Verleger nur in einer bestimmten Epoche gedeiht? Die Offizinen Frobenius und Froschauer im Mittelalter; Cotta im aufkommenden Bürgertum, die Herren Cassirer im Dolce jubilo der Vorkriegszeit, Sami Fischer im jungen, vom Kaisertum sich losgürtenden Deutschland, der abenteuerliche Ernst Rowohlt in der Vabanque-Nachkriegszeit. Jeder hat die Atmosphäre, die er für sein Unternehmen braucht und in der er saftig verdient.«
In der Anstalt habe man ihm den Antrag gestellt, zum siebzigsten Geburtstag des Chefarztes Dr. Otto Hinrichsen ein Gedicht zu schreiben. »Aber wie käme ich dazu? Solches Zeug verfertigt man wie J. V. Widmann am besten selbst, und zwar scherzhaft-ironisch. Lesen Sie einmal bei Goethe und Mörike nach! Da kann man lernen, sich selbst mokant zu belächeln.«
Nach drei Stunden erreichen wir Teufen und lassen uns in einer Metzgerei-Wirtschaft bei Geschnetzeltem, Bohnen und Rösti gemütlich nieder. Den ostschweizerischen Weinen zieht Robert einen Fendant vor. Beim schwarzen Kaffee sprechen wir von der Anstalt. Ich: »Ist es Ihnen noch nie aufgefallen, daß es vor allem unverheiratete Männer und Frauen sind, die einen geistigen Knacks haben? Vielleicht wirkt die verdrängte Sinnlichkeit ungünstig auf das Gehirn? Denken Sie an Hölderlin, Nietzsche oder Heinrich Leuthold!« – Robert, zögernd: »Daran habe ich nie gedacht. Vielleicht haben Sie aber recht! – Ohne Liebe ist der Mensch verloren.«
21. März 1941
Fahrt mit der Appenzeller Bahn nach Gais, von dessen nobler Barockarchitektur Robert entzückt ist. Mittagessen in der Krone. Wir werden von einer hochgewachsenen Kellnerin bedient, schlank, mit einem jungen Gesicht, aber ganz grauen Haaren. »Sie hat eine Brust wie ein Schwan!« flüstert mir Robert zu. – Spaziergang nach Teufen, wo die Familie Walser eingebürgert ist. Nach einem Bericht der dortigen Gemeindekanzlei war bereits der Urgroßvater von Robert, der reiche Arzt und Senator Dr. med. Johann Jakob Walser, der von seiner Frau, Katharina Eugster aus Speicher, zwölf Kinder bekam und von 1770 bis 1849 lebte, Bürger von Teufen. Weiter reichen die Bürgerregister nicht zurück. Während wir uns das Dorf ansehen, schneit es; später heitert sich der Himmel auf. Robert will aber von Familiengeschichten nichts wissen; unwillig schüttelt er das Thema ab.
Dagegen erzählt er vom Novellisten und Lyriker Max Dauthendey, der sich an Walt Whitmans weltbürgerliche Brust geworfen habe. »Ich wollte ihn einmal in München besuchen. Aber ich traf nur seine Frau





























