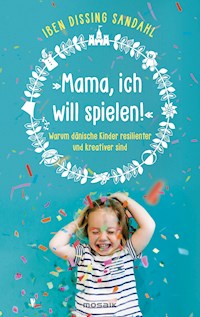9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mosaik
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Worum dreht es sich bei der Kindererziehung? Die Kinder, na klar. Was aber, wenn es in Wahrheit nur wenig um die Kinder, dafür umso mehr um die Eltern ginge? Welchen Einfluss nehmen persönliche Prägung, Ängste und Erwartungen der Erwachsenen auf die Erziehung? Auch die gewünschtesten Wunschkinder würden wir oft genug am liebsten auf den Mond schießen. Dabei sind Kinder sensible Seismograpen für emotionale Spannungen. Eltern, die im Konfliktfall prägende Verhaltensmuster aus der eigenen Kindheit wiedererkennen und bewusst damit umgehen, schaffen den nötigen Abstand für schlichtende Klärung. Sie können ihrem Kind erlauben, sich ohne übermächtigen Erwartungsdruck frei und unbefangen zu entwickeln. Anschaulich, einfühlsam und sehr persönlich beschreiben die international erfolgreiche dänische Erziehungsexpertin Iben Dissing Sandahl und die Psychologin Sarah Zobel, wie eine gelassene und zugleich innige Eltern-Kind-Beziehung entsteht, wie Kinder und Eltern zusammen wachsen. Durch innige Verbundenheit gestärkt, lernen sie selbstbewusst und intuitiv den zunehmend stressiger werdenden Familienalltag und die kleinen und großen Herausforderungen des menschlichen Miteinanders spielerisch zu meistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Iben Sandahl & Sarah Zobel
Warum dänische Eltern entspannter sind
Die persönlichen Erziehungsgeheimnisse der glücklichsten Familien der Welt
Aus dem Dänischen von Christine Heinzius
Die dänische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Det gør ondt i maven, mor bei Gyldendal, Kopenhagen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von den Autorinnen und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorinnen beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Mai 2021
Copyright © 2018 der Originalausgabe: Iben Sandahl und Sarah Zobel
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: DEEPOL by plainpicture; shutterstock / bioraven, Alemon cz, Mickicev Atelje
Redaktion: Manuela Knetsch
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
KF ∙ IH
ISBN 978-3-641-25279-3V001
www.mosaik-verlag.de
Inhalt
Vorwort: Eltern sein
1 Rückblick
2 Ehre sei dir
3 Nur die Ruhe
4 Zuhören
5 Einfühlung
6 Google das!
7 Umarmen
8 Ich bin liebenswert
9 Disziplin
Nachwort: Liebesmanifest für uns Eltern – und für unsere Kinder
Quellen
Literaturliste zur Inspiration und weiteren Vertiefung
»Kinder erteilen uns die besten Glückslektionen. Die ganze Zeit über fordern sie uns auf, den Augenblick zu genießen, weil der nächste anders sein wird.«
MARIANNE WILLIAMSON, US-AMERIKANISCHE AUTORIN, GEB. 1952
Eltern sein
Vorwort
Als Eltern haben wir die bedeutsamste Aufgabe der Welt übernommen. Eine Aufgabe, die sich wie ein fremdes und unbekanntes Land anfühlen kann, für das man als Reiseführer nur die eigene Geschichte sowie viele Träume und Hoffnungen für die Zukunft seiner Kinder zur Verfügung hat.
Es ist ganz normal, sich ängstlich und unsicher zu fühlen, wenn man die Verantwortung für einen kleinen, neugeborenen Menschen trägt und plötzlich nicht mehr ein noch aus weiß. Wo kann man noch mal lernen, wie man zu den besten Eltern der Welt wird?
Wir sind oft unsicher und fragen uns zum Beispiel: Wie lässt sich ein untröstliches Kind beruhigen? Ist es in Ordnung, nicht zu stillen? Wie soll ich die Ticks meines Kindes interpretieren oder seine Angst vor dem Einschlafen? Und wie gehe ich mit all dem um, was mein Kind lernen muss, damit aus ihm ein selbstständiger und robuster Mensch wird?
Es gibt viele gute und relevante Bücher voller Ratschläge und Informationen zum komplexen und oft anstrengenden Elterndasein, aber weil sich das Kinderleben gerade stark verändert und darüber auch diskutiert wird, ist es wichtig, den Tendenzen der Zeit zu folgen.
Es gibt Kinder und Jugendliche, die sich nicht wohlfühlen und die nicht das vom Leben erhalten, was sie sich erhoffen. Die dänische Ministerin für Kinder und Soziales hat erst kürzlich einen Expertenrat zusammengestellt und eine »Erziehungsdebatte« angestoßen, damit wieder einmal über die Rolle der Eltern diskutiert wird – in der Hoffnung, eine Lösung für die Probleme der Elternschaft und für die steigende Anzahl der Kinder, denen es schlecht geht, zu finden.
Traurigkeit, Einsamkeit und Angst sind für viele – auch für Kinder und Jugendliche – zum Normalzustand geworden. Und jeden Tag melden sich Kinder in der Schule aufgrund von Stress krank. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, denen in Dänemark ein Antidepressivum verschrieben wird, ist in den letzten sieben Jahren um 60 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die in der Psychiatrie behandelt werden, ist in den letzten fünf Jahren um 44 Prozent gestiegen.1 Diese alarmierenden Zahlen bestätigen nur, dass Veränderung und ein neuer Fokus nötig sind.
Wir haben dieses Buch im dänischen Original Det gør ondt i maven, mor genannt – »Mama, ich habe Bauchweh« –, weil unsere Gefühle in der Bauchregion sitzen. Wir sagen: »Ich habe Schmetterlinge im Bauch«, wenn wir verliebt sind. Wir verschränken die Arme über dem Solarplexus, wenn wir uns bedroht fühlen oder emotional auf uns aufpassen wollen. Wir glauben, dass viele Kinder und Jugendliche in ihrem Innersten »Schmerzen« haben. Sie haben Schmerzen in ihrem Gefühlsleben und spüren eine große Verunsicherung, weil Heranwachsende in ihrem Leben heutzutage ganz andere Herausforderungen meistern müssen als die Generationen vor ihnen.
Der Magen ist das Kommunikationszentrum des Körpers, wenn es um Gefühle geht, deswegen kann sich ein seelisches Ungleichgewicht oder eine innere Unruhe ganz typisch psychosomatisch zeigen – das heißt, als körperlicher Schmerz, der von psychischem Schmerz verursacht wird. Die psychosomatischen Reaktionen können schwer zu lokalisieren sein, und ihre Behandlung kann bedeuten, dass wir nur die Symptome angehen und nicht die tatsächliche Ursache.
Wenn unser Kind Bauchweh hat oder eine andere Art von innerem Unbehagen empfindet, tendieren wir oft dazu, möglichst schnell eine Erklärung und Lösung für das Problem zu finden – es kann nämlich schwierig sein herauszubekommen, was physischer und was psychischer Schmerz ist. Es ist wichtig, daran zu denken, dass unsere Kinder – und ihre Körper – uns etwas mitteilen möchten, für das sie vielleicht keine Worte finden. Vielleicht verstehen sie selbst nicht, woher ihr Unwohlsein rührt, oder sie kennen schlichtweg keine Begriffe dafür.
Deswegen ist es notwendig, ab und an innezuhalten und sich zu fragen: Habe ich im Moment einen guten Kontakt zu meinem Kind? Spüre ich, was mein Kind bewegt? Höre ich ihm aufmerksam zu? Sehe ich mein Kind und mich inmitten des Alltagsstresses? Diese Fragen helfen uns, unsere Kinder besser zu verstehen.
Zwischen dir und mir
Im Stress des Alltagslebens können wir den engen Kontakt zu unseren Kindern leicht verlieren. Nicht weil wir das möchten, sondern weil wir den Kontakt zu uns selbst verlieren. Wenn wir uns bemühen, alle Fäden in der Hand zu behalten, schwirren unsere Gedanken gezwungenermaßen überallhin, sodass wir abwesend, unaufmerksam oder kurz angebunden wirken. Unsere Kinder reagieren auf diesen Eindruck und die Signale, die sie empfangen. Sie reagieren auf unsere Abwesenheit – und auf unsere Anwesenheit.
Der Kontakt zu uns selbst ist demnach der Ausgangspunkt für den Kontakt zu den Kindern – weswegen dieser Punkt auch einer der wichtigsten ist, die wir in unserem Buch vermitteln möchten. Wenn wir uns selbst nicht spüren, ist es schwer, wirklich präsent zu sein und ein Gefühl dafür zu haben, was unsere Kinder brauchen. Eine enge Beziehung zwischen Kindern und Eltern ist ganz entscheidend.
In einer guten, engen Beziehung geht es um die Energie, den Raum, der zwischen uns entsteht. Es geht darum, ob sich dieser Raum angenehm anfühlt und Geborgenheit vermittelt. Ist es ein Raum, in dem wir ganz präsent sind, wenn wir zusammen sind, und in dem wir uns frei und konstruktiv austauschen können? Wir können diesen Raum nur dann erschaffen, wenn wir als Eltern unsere eigenen Sorgen, Frustrationen, Erwartungen oder Enttäuschungen (alles, was wir oft unbewusst mit uns mitschleppen) eine Weile vernachlässigen können.
Wenn uns das gelingt, begegnen wir unseren Kindern mit offenen Herzen und Ohren und sehen den kleinen Menschen vor uns vielleicht sogar mit ganz neuen Augen. In einer solchen Atmosphäre fühlen sich unsere Kinder gesehen, gehört und völlig anerkannt, und hier blüht die enge Beziehung zueinander auf.
Tiefgehende Beziehungen sind entscheidend. Eine Studie der amerikanischen Harvard University hat gezeigt, dass tiefe und befriedigende Beziehungen glücklichere und gesündere Menschen aus uns machen.2 Wenn wir Menschen um uns haben, denen wir vertrauen und bei denen wir uns geborgen fühlen, reagiert unser Nervensystem mit Entspannung. Es hilft unserem Gehirn, aktiv zu bleiben und emotionalen wie körperlichen Schmerz zu reduzieren. Mehrere Studien belegen außerdem, dass oberflächliche Beziehungen an unseren Energiereserven zehren und eine direkte Ursache für den hohen Stresslevel sind, unter dem viele Kinder und Jugendliche heute leiden. Unsere Kinder wachsen mit den unendlichen Möglichkeiten des Internets auf, darunter auch der Gelegenheit, mit allen möglichen Menschen von nah und fern zu kommunizieren. Freundschaften sind in vielen Fällen rein virtuell. Früher war das anders. Heute versteht man unter der Gemeinschaft mit anderen oft nur schnelle Schnappschüsse und Bekanntschaften, die kommen und gehen.
All die Geschichten, Episoden, Erlebnisse, spaßigen Momente, Erfahrungen, Kontroversen und Vergleiche, die früher eine gute Freundschaft ausmachten, sind heute weniger präsent. Die »harte« Arbeit wird übersprungen, und die ganz wesentliche Resonanz, die sich im direkten, physischen Kontakt ergibt, wenn wir uns in einer Gemeinschaft entspannen, ist nicht mehr so stark und wertvoll wie früher. Die physische Abwesenheit führt oft zu einer starken Einsamkeit – unter Erwachsenen, aber vor allem auch unter Kindern und Jugendlichen. Die Wirklichkeit kann sich leer und gleichgültig anfühlen. Der unverbindliche Kontakt, mit dem viele unserer Kinder heute leben, verhindert, dass sie sich den Menschen in ihrem Umfeld eng verbunden fühlen – und so bleiben sie sich auch selbst fremd.
Ihre Beziehung zu uns Eltern ist umso wichtiger in einer Zeit, in der die Freunde mehr oder weniger abwesend sind, häufig soziale Medien genutzt werden und die Gesellschaft sich im Aufbruch befindet und viele Ansprüche stellt.
Anwesend oder präsent
In einer neueren Untersuchung aus England nehmen wir Dänen, was die Zeit angeht, die wir mit unseren Kindern verbringen, den ersten Platz ein.3 Das können viele von unseren Landsleuten sicher bestätigen. Doch Zeit miteinander zu verbringen bedeutet nicht automatisch, dass die Atmosphäre stimmt und dass das Beisammensein auch bewusst stattfindet und befriedigend ist. Die schlichte körperliche Anwesenheit wird manchmal mit echtem Zusammensein verwechselt.
Wir sitzen alle um den Esstisch herum, ohne wirklich anwesend zu sein. Wir räumen auf, bereiten Pausenbrote zu, holen und bringen Sachen, kümmern uns um die Logistik und das Essen auf dem Tisch – ohne wirklich da zu sein.
Der tiefgehende Kontakt, der der Präsenz zugrunde liegt, ist auch einer der Dreh- und Angelpunkte dieses Buches. Und diese Präsenz entspringt einem verstärkten Bewusstsein. Ein Bewusstsein von uns selbst als Eltern und Menschen und ein Bewusstsein von dem Teil des Elternseins, der eigentlich unbewusst abläuft.
Die äußere und die innere Welt
Viele Jahre hat man sich vor allem auf äußere Faktoren konzentriert – in Bezug auf unsere Kinder, aber auch in Bezug auf uns selbst –, und das entfernt uns von uns selbst und voneinander. Es gibt so viele Anforderungen, alles soll gemessen und gewogen werden, wir sollen leisten und effektiv sein, was bedeutet, dass wir Seiten von uns selbst vergessen, das Unmögliche anstreben und gelernt haben, immer schneller und schneller zu laufen.
Als Eltern können wir schon sehr viel erreichen, wenn wir das Tempo drosseln, den Kontakt zu uns selbst stärken und das fehlende Puzzleteil wiederfinden – nämlich unsere mentale und seelische Gesundheit im Blick zu behalten. Der tiefer gehende Kontakt zu uns selbst und damit auch zu anderen ist nun einmal der entscheidende Anker in einer sehr hektischen und auf Äußerlichkeiten ausgerichteten Zeit.
Wenn wir von der Erziehung unserer Kinder sprechen, handelt es sich in Wirklichkeit um die Erziehung von uns selbst als Erwachsene und um das, was wir aus unserer eigenen Kindheit mitgenommen haben. Ganz automatisch handeln wir nämlich vor dem Hintergrund eigener Erlebnisse und Erfahrungen. Es ist eine Facette der Elternschaft, an die nur wenige von uns denken und der wir uns nur selten widmen. Trotzdem ist es nötig, diesen unbewussten Teil in uns in Worte zu fassen, weil es zu vielen Missverständnissen zwischen unseren Kindern und uns führen kann, wenn wir uns unserer Absichten und Beweggründe nicht bewusst sind. So entfernen wir uns noch weiter voneinander.
Dieses Buch plädiert für das »ganzheitliche« Elternsein. Eine Elternschaft, die daran glaubt, dass Mutter oder Vater zu sein ein flexibler Prozess ist, bei dem wir und unsere Kinder ständig neu herausgefordert werden und lernen. Der Prozess verlangt auch, dass wir Eltern uns selbst gegenüber ehrlich sind, sodass es nicht immer die Kinder sind, die erzogen werden, sondern auch – und in noch stärkerem Maß – wir Erwachsenen, die wir uns selbst wiederfinden sollen.
Liebe und Feinfühligkeit führen zu befriedigenden Beziehungen, und wir sollten die Antworten in uns selbst finden und zu dem stehen, woran wir glauben. Denn nur so können wir den Rahmen und die nötige und klare Disziplin bieten, die unsere Kinder brauchen.
Das neue Elternsein
Als Mütter und Psychologinnen beziehungsweise Psychotherapeutinnen plädieren wir für eine Elternschaft, die sich der Bedeutung eines soliden, inneren Fokus als Fundament eines guten Lebens bewusst ist. Eine Elternschaft, bei der Eltern und Kinder gleichwertige Seelen in einer Partnerschaft sind. Eine spirituelle Elternschaft, die anerkennt, dass Kinder Spiegel sind, die uns erzählen, wie wir als Menschen reifen und wachsen.
Wir beide – die Autorinnen – haben zusammen fünf Kinder im Alter von 2 bis 18 Jahren.
Die eine von uns – Iben Sandahl – erzählt: »Als Lehrerin und Psychotherapeutin arbeite ich seit über 20 Jahren mit Kindern und Jugendlichen. Außerdem bin ich Autorin des internationalen Bestsellers Warum dänische Kinder glücklicher und ausgeglichener sind: Die Erziehungsgeheimnisse des glücklichsten Volks der Welt, der in 25 Sprachen erschienen ist. Die dänische Art der Erziehung ist etwas Besonderes, das hat der gerade genannte Titel gezeigt – auch wenn die dänischen Kinder und Eltern Herausforderungen meistern müssen wie alle anderen. Während ich durch die Welt reise und Vorträge zu dem Buch und meiner Arbeit halte, wird mein Blick auf die Kindererziehung ständig geschärft. Dasselbe geschieht, wenn ich als Bloggerin für das Magazin Psychology Today schreibe. Ich bin verheiratet und habe zwei Teenagertöchter, Ida (18) und Julie (15).«
Die zweite von uns – die Psychologin Sarah Zobel – sagt: »Egal, ob in Führungskursen, im Coaching, bei der individuellen Therapie oder in Eltern-Kind-Kursen – immer spielt die Kindheit eine Rolle. Deswegen ist es so wichtig, den Fokus darauf zu richten. Ich habe drei Kinder – Roberta (17), Vincent (12) und Dallas (2) – und habe bemerkt, wie die unterschiedlichen Herausforderungen im Leben, darunter zum Beispiel meine Scheidung, meine Rolle und Aufgabe als Mutter verändert haben. Zu meinen Leidenschaften, die ich mit meinen Kindern teile, gehören Meditation und Achtsamkeit.«
Wir beide haben Lebenserfahrung und beschlossen, unsere eigene, persönliche Geschichte, das heißt unsere Erfahrungen als Töchter, Mütter und Berufstätige, zum Ausgangspunkt zu machen. Lebenserfahrungen, die voller Herausforderungen und zerbrochener Träume sind, aber auch voller schöner und lebensspendender Augenblicke, durch die wir uns selbst und unseren Kindern nähergekommen sind.
Wir teilen unsere persönlichen Geschichten – sowohl die schmerzhaften als auch die schönen Momente –, weil wir wissen, dass man mit Aufrichtigkeit und Verletzlichkeit andere Menschen am besten erreicht. Aufrichtigkeit und Verletzlichkeit sorgen dafür, dass wir einander achten, reflektieren und verstehen. Durch die ehrlichen Geschichten erkennen wir einander als Menschen – und Eltern – und kommen zu einer Übereinstimmung, anstatt mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und im Elternsein einsam zu werden.
Wir haben uns entschlossen, das Buch rund um den Begriff Liebe aufzubauen, weil sie der Ausgangspunkt der Eltern-Kind-Beziehung ist. Liebe ist der Startpunkt, wenn wir dem Bauchweh, dem Stress, der Verunsicherung und der Einsamkeit von Kindern und Jugendlichen den Garaus machen wollen. Egal, ob wir Eltern, Großeltern, Väter, Mütter, Patchworkfamilien, alleinstehend oder berufstätig sind: Wir möchten uns einsetzen, damit unsere Kinder sich wohlfühlen, wir viele schöne Augenblicke mit ihnen erleben und sie bis in die Seele hinein gesund sind.
Viel Spaß beim Lesen.
Herzliche Grüße
Sarah & Iben
»Nur wenn wir mutig genug sind, die Dunkelheit zu erforschen, werden wir die unendliche Kraft in unserem Licht entdecken.«
BRENÉ BROWN, US-AMERIKANISCHE PROFESSORIN UND AUTORIN, GEB. 1965
1Rückblick
Betrachtung
Worum geht es bei der Kindererziehung? Die einleuchtende Antwort lautet: um die Kinder. Aber was wäre, wenn es bei der Kindererziehung in Wahrheit nur wenig um die Kinder, dafür umso mehr um die Eltern ginge?
Die erste Herausforderung
Wir wünschen uns, dass es unseren Kindern gut geht – nicht nur in unseren Augen, sondern auch in denen aller anderen. Wir wünschen es uns, weil wir sie lieben und das Beste im Leben für sie wollen. Doch selbst wenn wir ihnen das Beste wünschen, wissen wir nicht immer, was das Beste für sie ist, denn es kann leider sein, dass unsere Einstellung zum Wohlbefinden unserer Kinder, zu ihren Wünschen, ihrer Ausbildung und ihrer Karriere auf unseren eigenen Bedürfnissen beruht. Bedürfnisse, die auf unerreichten Träumen, bitteren Erfahrungen oder verletzten Gefühlen basieren können. Deswegen kann unser Elternstil bisweilen einen Unterton im Sinne von »nicht gut genug« bekommen – als wäre unser Kind an sich nicht gut genug und sollte besser die Richtung einschlagen, von der wir meinen, sie sei am besten.
Wenn wir uns fragen, welche Träume oder Ziele wir für unsere Kinder haben, werden wir wahrscheinlich etwas in der Art erwidern: Ich hoffe, dass sie ein gutes Leben führen, glücklich sind, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln, Respekt für andere haben, empathisch und stark sind – oder Ähnliches. Ohne darüber nachzudenken, stellen wir es so dar, als ob einige dieser Qualitäten – oder alle – noch gar nicht im Kind stecken. Dass sie etwas sind, das man entwickeln und erlernen muss. In Wirklichkeit aber finden sich bereits alle Qualitäten in größerem oder kleinerem Ausmaß in unseren Kindern, denn sie alle werden äußerst empfindsam und weit offen für das Leben geboren. Sie sind neugierig, liebevoll, ausdrucksstark und perfekt, so wie sie sind.
Als Eltern sollten wir uns nicht auf die Zukunft konzentrieren und auf das, was den Kindern »fehlt«. Stattdessen sollten wir ihre einzigartige Persönlichkeit, ihre Charaktereigenschaften schützen und ihnen neugierig und vorurteilsfrei gegenübertreten. Sie kennen das sicher von sich selbst: Es engt ein und frustriert, wenn man immer mehr tun soll, wenn man sich weiterentwickeln, mehr leisten und schneller rennen soll. Viele von uns fragen sich, ob ihr Kind
zu scheu
zu still
zu vorsichtig
zu wild
zu unmotiviert
zu desinteressiert
zu unkonzentriert
zu faul
zu unsozial ist.
»Zu«-Gedanken sind ein ganz normaler Ausdruck unserer Unsicherheit, unserer Enttäuschung und unserer Schuldgefühle, weil wir zweifeln, ob wir als Eltern gut genug sind. Unsere Sorgen können natürlich auch berechtigt sein, wenn es um eine besonders schwierige Situation geht und ein Kind zum Beispiel schwerwiegende Probleme hat. Dann suchen wir Rat und Hilfe. In den meisten Familien allerdings ist einfach der Erfolgsdruck zu groß. Die gesellschaftliche Meinung darüber, was »Erfolg« ist und was dazu führt, ist eine schwere Last für unsere Kinder und Jugendlichen. Dieser Erfolgsdruck setzt unerreichbare Standards. So benoten wir in der Schule immer früher, die Kinder müssen sich in den sozialen Medien mit restriktiven Schönheitsidealen auseinandersetzen und treffen schon zu Beginn der weiterführenden Schulen auf die dringliche Frage, was sie gern »werden wollen«.
Außerdem ist es notwendig, dass wir uns fragen: Agiert man als Mutter oder Vater wirklich ganz selbstlos? Selbst wenn wir engagiert sind, uns aufopfern und das Gefühl haben, alles für unsere Kinder zu tun, kommen wir doch nicht um die Tatsache herum, dass es immer auch um uns geht. Es kann unangenehm sein zu erkennen, dass wir aus egoistischen Motiven handeln. Oft erziehen wir auf Basis eines »Ich habe recht«-Standpunktes, was für das Selbstwertgefühl des Kindes richtig schädlich sein kann.
Im Grunde sind es individuelle Bedürfnisse, die uns dazu bringen, Kinder zu bekommen. Diese Erkenntnis kann wichtig für die Eltern-Kind-Beziehung sein, denn das Bedürfnis der Erwachsenen zeigt sich gerade in Situationen, in denen wir es uns erlauben, die Grenzen des Kindes zu überschreiten oder sein Verhalten nicht zu respektieren.
Wenn die Machtbeziehung sich auf ein Verfügungsrecht über die Kinder gründet, dann respektieren wir sie nicht, sondern begehen einen »Übergriff« auf ihr Selbstwertgefühl. Doch wenn wir uns trauen, stattdessen die Perspektive zu ändern, unser eigenes Bedürfnis abzulegen und den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, können wir Wunder bewirken. Macht und Kontrolle hinter uns zu lassen und sie durch Liebe und simples menschliches Verhalten zu ersetzen, befreit unsere Kinder von der Last, »eine bessere Ausgabe unserer selbst« sein oder von uns »in Ordnung gebracht« werden zu müssen. Durch diese Befreiung blüht ein Kind auf.
Elternerziehung
Als Eltern haben wir uns selbst kaum im Blick. Unsere Kinder stehen ja im Mittelpunkt, und wir hätten gern »Werkzeuge«, um sie besser zu verstehen. Doch wenn wir unseren Kindern tief in die Augen sehen wollen, müssen wir zunächst auf uns selbst blicken. Bei der Kindererziehung geht es vor allem um Elternerziehung.
Intuitiv wissen wir sehr wohl, dass es bei uns etwas zu erziehen gibt. Welche Rolle spielt unsere Vergangenheit dabei? Wie stark prägt und beeinflusst unsere eigene Geschichte und Erziehung unsere Rolle als Eltern? »Mist, jetzt klinge ich ja wie meine eigene Mutter!« – diesen Gedanken kennen wir wohl alle. Der Gedanke kann auftauchen, wenn man sich mit seinen Kindern über dieselben Themen streitet, über die man sich schon mit seiner eigenen Mutter gestritten hat, denn wir »benutzen« unser eigenes Gepäck, sobald wir Kinder bekommen. Die Bedienung aus diesem »Werkzeugkasten«, den wir mitbekommen haben, geschieht ganz automatisch und unbewusst.
Aus diesem Grund funktioniert Kindererziehung dann, wenn wir uns auf uns selbst, unsere eigenen Reaktionen und unser eigenes Verhalten konzentrieren und (zunächst) nicht auf das unserer Kinder. Auf diese Weise entsteht eine tiefe Verbundenheit, werden bereits länger andauernde Konflikte gelöst und alte Muster gebrochen. Im Umkehrschluss: Wenn wir selbst nicht als die gesehen werden, die wir waren und sind, können wir dieses Gefühl nicht an unsere Kinder weitergeben.
Die bekannte US-amerikanische Psychologin und Forscherin Brené Brown drückt es folgendermaßen aus: »Wir können unseren Kindern nicht mehr geben, als wir selbst haben.« Deswegen können wir unseren Kindern auch nicht mehr Selbstwertgefühl vermitteln, als wir selbst haben. Wir können sie nicht mehr lieben, als wir uns selbst lieben. Zu erkennen und zu verarbeiten, wie entscheidend unsere innere Landschaft für das ist, was wir unseren Kindern geben, kann hart sein.
Wenn wir im Licht dessen, was das Verhalten unserer Kinder über uns selbst aussagt, versuchen, »uns selbst zu erziehen«, befreien wir uns von unserem Gepäck. Zugleich werden wir auch das Bedürfnis los, ihr Leben bestimmen und kontrollieren zu müssen. Wir erhalten die Chance, Eltern zu werden, die die Vergangenheit hinter sich lassen, die Erwartungshaltung gegenüber ihren Kindern lockern und somit den Druck von ihnen nehmen.
Das Unbewusste taucht auf
Der unbewusste Teil des Elternseins ist der Teil von uns selbst, zu dem wir zwar keinen bewussten Kontakt haben, der unseren Alltag mit Kindern jedoch trotzdem stark prägt. Es sind Gefühle und Normen, die wir früher gehabt beziehungsweise gelernt haben und die sich heute immer noch melden. Das Unbewusste zeigt sich, wenn wir keine Grenzen setzen und nicht Nein sagen können, wenn wir Gefühle nicht ausdrücken können oder wenn wir schließlich einen Wutanfall bekommen. Der unbewusste Teil des Elternseins verursacht oft Konflikte mit unseren Kindern, und er spielt eine Rolle, wenn wir merken, dass wir genau wie unsere Mutter oder unser Vater klingen oder handeln (obwohl wir uns doch geschworen haben, dass wir es anders machen würden!).
Anders ausgedrückt: Das unbewusste Elternsein taucht auf, wenn unsere Kinder auf unsere emotionalen Knöpfe drücken. Diese Knöpfe sind umso wirkungsvoller, wenn wir so tun, als gäbe es sie nicht, und alle Schuld auf das vermeintlich freche kindliche Verhalten schieben. Unsere destruktiven Reaktionen als Eltern verschließen ganz allmählich die magischen, offenen Herzen der Kinder.
Es ist wichtig zu akzeptieren, dass Kinder nicht bewusst auf unsere roten Knöpfe drücken, auch wenn es sich bisweilen so anfühlen kann: »Ich werde rasend, wenn Sofie nicht hinter sich aufräumt, obwohl ich es ihr schon hundert Mal gesagt habe«, oder: »Ich werde richtig wütend, wenn Marius mir ständig widerspricht! Wieso macht er das immer wieder?«
Unsere Kinder sind nur Kinder. Sie haben ihre eigene Gefühlslage, genau wie wir unsere haben. Sie haben kein Interesse daran, dass wir austicken, und finden es auch nicht toll, uns Schuldgefühle zu verpassen. Das ist nicht ihre Absicht. Ihr Verhalten triggert uns lediglich wegen unseres eigenen, emotional ungelösten Gepäcks oder unseres allzu stressigen Lebens. Was uns triggert, liegt immer in unserem eigenen Schmerz begraben. Das zu akzeptieren ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer bewussteren Erziehung und einem engeren Kontakt zu unseren Kindern.
Prägende Erinnerungen (Iben)
Es gibt Dinge, an die man sich nicht gern erinnert. Es sind gewisse Zeitpunkte, Erlebnisse oder Phasen in unserem Leben, die Schuldgefühle, Scham und ein Gefühl der Unzulänglichkeit wecken. Diesen Gefühlen möchten die meisten von uns gern aus dem Weg gehen. Auch ich habe eine solche Geschichte, selbst wenn es etwas beschämend ist, sie zu erzählen.
Als Ida geboren wurde, hätte ich nicht glücklicher sein können. Es war ein schöner Sonntagmorgen, die Sonne strahlte an einem wolkenfreien Himmel, und sie kam schnell zur Welt. Alles war gut gegangen, und wir erhielten unser eigenes Zimmer, wo wir uns ungestört kennenlernen konnten. In der ersten Nacht lagen wir ruhig da, eng verbunden, und schauten einander tief in die Augen.
Obwohl ich damals, als Ida klein war, nicht viele Elternratgeber gelesen habe, hatte ich ganz bestimmte Vorstellungen davon, welche Art Mutter ich gern sein wollte. Intuitiv wusste ich, was ich tun würde, nämlich das, was sich für mich richtig und natürlich anfühlte. Trotzdem bekam ich, genau wie alle anderen Eltern, schnell und unbeabsichtigt das Gefühl, dass mein Kind einer bestimmten Kurve folgen und sich auf eine bestimmte Art verhalten sollte – und an dieser Stelle meldet sich mein schlechtes Gewissen, weil ich Ida verraten habe. Selbstverständlich sollen unsere Kinder wachsen und sich entwickeln, und das tat Ida auch. Sogar überaus gut! Aber ich hatte meine wunden Punkte.
Aber Kinder müssen doch …
Die irritierenden Normen tauchten auf, als Ida älter wurde und sich ihr Charakter mehr und mehr entfaltete. Zunächst taten sie das nicht bei mir, sondern eher bei den Menschen in unserer Umgebung. Normen, wie ein Kind sich eben zu benehmen hatte. »Aber Kinder müssen doch …«
Bei der Liebe geht es jedoch darum, dass wir die, die wir lieben, ganz sie selbst sein lassen. Wir dürfen nicht bloß die Reflexion unserer selbst in unseren Kindern lieben, wenn wir versuchen, sie zu ändern. Doch das verstand ich als junge Mutter einfach nicht.
Nach und nach ärgerte es mich immer mehr, dass Ida sich nicht von mir löste und »ihren Platz in der Menge« einnahm, wie viele andere Kinder ihres Alters. Ein Ärger, der völlig unsinnig war, weil sie nun einmal nicht wild und extrovertiert war.
Ich hatte das Gefühl, dass es Freunden und der Familie schwerfiel, sich mit diesem stillen oder etwas schüchternen Kind zu beschäftigen. Wenn Ida mit anderen Kindern zusammen war, beobachtete sie vor allem und analysierte lieber, als mitzuspielen. Ich bildete mir ein, dass sie zu schüchtern sei.
Ich wünschte mir, sie wäre anders, als sie war, und mehr wie die anderen. Manchmal, wenn sie zu mir kam, um eine Zeit lang auszuruhen und Kraft zu tanken, schubste ich sie von mir und schickte sie mit den Worten zurück: »Jetzt musst du wieder rein ins Getümmel, Schatz.« Ich war hart und abweisend. Nicht immer, aber ich war es – weil ich wollte, dass sie sich anpasste.
In diesen Momenten fiel mir jedoch auf, dass sie enttäuscht und verwirrt war, weil ich sie nicht annahm. Etwas geschah in ihren Augen, mit ihrem Blick. Für andere mag das nach einer kleinen, unwichtigen Kindheitsepisode klingen, aber für mich war es das nicht. Ida war stets fantastisch. Sie hat eine reine und noble Seele, sie ruht fest in sich und ist ein Mensch, der Freude und positive Energie verbreitet – es ging also ganz allein um mich.
Von mir selbst enttäuscht
Mir zieht sich immer noch alles zusammen, wenn ich an diese Zeit denke, weil in dem, was ich getan und gesagt habe, so viel abweisende Energie steckte.
Die meisten von uns kennen Unsicherheit, wenn es um die Erziehung unserer Kinder geht. Wenn wir uns bei unseren Entscheidungen sicher fühlen, loben wir uns selten. Dafür schimpfen wir umso öfter mit uns, wenn wir etwas vermeintlich Falsches machen. Als mir klar wurde, warum ich mich Ida gegenüber so verhielt, tat es mir leid. Das Gefühl, das zurückblieb, war immer Traurigkeit.
Ich war auch darüber enttäuscht, dass ich ihr höchstwahrscheinlich das Gefühl vermittelt hatte, nicht gut genug zu sein – und das, obwohl ich tief in mir spürte, dass sie genauso war, wie sie sein sollte. Ich hielt mich für eine schlechte Mutter, weil ich ein schmerzhaftes Muster wiederholt hatte, das ich nur allzu gut aus meiner eigenen Kindheit kannte. Ich hatte sie abgewiesen. Der Schmerz, von dem sie sicher etwas bemerkt hatte, war meiner. Das war unerträglich.
Zum Glück wurde mir bewusst, dass ich sie wegen meines emotionalen Gepäcks abgewiesen hatte. Deswegen übte ich mich fortan darin, die Aufmerksamkeit auf mich selbst zu lenken, wenn ich verärgert war, und meine Tochter mit offenen Armen zu empfangen.
Die Aufmerksamkeit auf meine eigenen Schwachpunkte zu lenken wurde zu einem entscheidenden Wendepunkt in unserer Beziehung. Anstatt meinen Schmerz auf meine Tochter zu projizieren, blickte ich auf mich.
Ich konnte Ida nicht die echte und offene Liebe geben, die sie verdiente, weil ich noch damit kämpfte, mich selbst bedingungslos zu lieben. Ich musste Kontakt zu meinem eigenen, inneren Kind aufnehmen und versuchen, mich um dieses Kind zu kümmern.