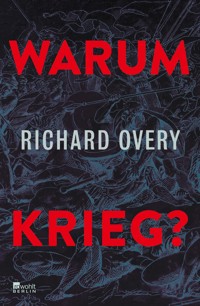
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Warum führen Menschen Krieg? Die Antworten auf diese Frage sind so vielfältig wie die Formen kriegerischer Konflikte selbst. Gehört Krieg zur menschlichen Natur, ist er Ausdruck eines aggressiven menschlichen Triebs? Wie hängt Krieg mit dem Wettbewerb um ökonomische Vorteile zusammen, wie verhält er sich zur Frage staatlicher Sicherheit? Was hat Krieg mit Religion und Ideologie zu tun, was mit dem Streben nach Macht oder mit den Veränderungen des Klimas? Auf fesselnde Weise erkundet Richard Overy die Jahrtausende, von den Anfängen der Menschheit bis heute. Er rekonstruiert längst vergangene Konflikte zwischen Jägern und Sammlern, blickt zurück auf das Römische Imperium und seinen unersättlichen Hunger nach Ressourcen, führt uns mit Alexander dem Großen, Napoleon und Hitler die Auswirkungen politischen Machtwillens vor Augen und zeigt etwa anhand der aktuellen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, wie sich verschiedene Ursachen für Krieg überlagern und gegenseitig befeuern. Warum Krieg? Einer der bedeutendsten Historiker unserer Tage geht einer der wichtigsten Fragen überhaupt nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Ähnliche
Richard Overy
Warum Krieg?
Über dieses Buch
Warum führen Menschen Krieg? Die Antworten auf diese Frage sind so vielfältig wie die Formen kriegerischer Konflikte selbst. Gehört Krieg zur menschlichen Natur, ist er Ausdruck eines aggressiven menschlichen Triebs? Wie hängt Krieg mit dem Wettbewerb um ökonomische Vorteile zusammen, wie verhält er sich zur Frage staatlicher Sicherheit? Was hat Krieg mit Religion und Ideologie zu tun, was mit dem Streben nach Macht oder mit den Veränderungen des Klimas?
Auf fesselnde Weise erkundet Richard Overy die Jahrtausende, von den Anfängen der Menschheit bis heute. Er rekonstruiert längst vergangene Konflikte zwischen Jägern und Sammlern, blickt zurück auf das Römische Imperium und seinen unersättlichen Hunger nach Ressourcen, führt uns mit Alexander dem Großen, Napoleon und Hitler die Auswirkungen politischen Machtwillens vor Augen und zeigt etwa anhand der aktuellen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, wie sich verschiedene Ursachen für Krieg überlagern und gegenseitig befeuern. Warum Krieg? Einer der bedeutendsten Historiker unserer Tage geht einer der wichtigsten Fragen überhaupt nach.
Vita
Richard Overy, geboren 1947 in London, lehrt Geschichte an der University of Exeter. Mehrere seiner Bücher, darunter «Russlands Krieg» und «Die Diktatoren», gelten als Standardwerke. «Weltenbrand» (2023), Overys große Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wurde zum «New York Times»-Bestseller; das Buch stand auf der Shortlist des Gilder Lehrman Prize und wurde mit der Duke of Wellington Medal for Military History ausgezeichnet. Joachim Käppner schrieb in der «Süddeutschen Zeitung»: «Eine meisterliche, monumentale … Erzählung über den schrecklichsten Krieg der Geschichte.» Und der «Economist» meinte: «Ein herausragendes Buch, das die tiefe Gelehrsamkeit und das reife Urteil eines exzeptionellen Historikers spiegelt.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2024 by Richard Overy
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «Why War?» bei Pelican Books, London.
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Die Schlacht bei Potidaea (Ausschnitt). Kupferstich von Wilhelm Müller (um 1810) nach einer Zeichnung von Asmus Jakob Carstens aus dem Jahr 1788. Berlin, Sammlung Archiv für Kunst und Geschichte (akg-images)
ISBN 978-3-644-02134-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
PrologWarum Krieg?
Dieses Buch ist aus mehreren Gründen eine Unverschämtheit. Erstens bin ich als Historiker nur Experte für die Kriege, die in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts – also fast am Ende einer sehr langen Menschheitsgeschichte der Gewalt – auf der ganzen Welt geführt wurden. Demnach fallen die zigtausend Jahre dieser Geschichte, die hier auch behandelt werden, eindeutig nicht in mein Spezialgebiet. Zweitens liegen die schriftlichen Erklärungsversuche für diese lange Geschichte kriegerischer Gewalt größtenteils in der Domäne naturwissenschaftlich geprägter Disziplinen wie der Anthropologie, Ethnologie, Ökologie, Psychologie, Humanbiologie und Archäologie. Historiker sind bemerkenswerterweise kaum beteiligt, wenn es um Antworten auf die große Frage geht, warum Menschen Kriege führen. Teilweise ist diese Zurückhaltung verständlich, denn Historiker können nicht auf eine naturwissenschaftliche Ausbildung bauen, wie sie evident wird, wenn Nichthistoriker sich zu diesem Thema äußern. Werden in der Literatur, die sich der Erklärung von Kriegen widmet, die Disziplinen der Beitragenden aufgelistet, so fehlt die Geschichtswissenschaft meistens ganz – was seltsam berührt angesichts der Tatsache, dass die Darstellung und Erklärung der Kriege vergangener Zeiten eine einzigartig historische Aufgabe ist.
Meine Rechtfertigung für dieses Buch, wenn sie denn erforderlich ist, lautet, dass ich mich seit Jahrzehnten mit dem größten und tödlichsten Konflikt der Weltgeschichte beschäftige. Die meisten, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Mühlen dieses langen, blutigen Weltkrieges gerieten, hätten zweifellos Frieden bevorzugt, und doch wurde dieser Krieg ohne jegliche Zurückhaltung vorrangig von Staaten geführt, die sich einer hoch entwickelten Zivilisation zugehörig fühlten. Die Frage, wie die Menschheit diesen grausamen Endpunkt der Moderne erreichte, wirft also viel tiefergehende Fragen auf: nämlich, warum sich Menschen überhaupt jemals aktiv für Krieg entschieden haben, nicht nur jene «zivilisierten» Staaten in der Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern bereits alle Staaten und Gesellschaften, die sich historisch zurückverfolgen lassen, und darüber hinaus auch schon in prähistorischer Zeit. Diesen Fragenkomplex habe ich mit großem Wissensdrang untersucht – nur dass ich am Ende der Geschichte begonnen habe und nicht bei den Anfängen in grauer Vorzeit.
Eine weitere Rechtfertigung ist die genuin historische Natur der Debatte über das Andauern kriegerischer Handlungen in der gesamten Menschheitsgeschichte. Der Diskurs über den Krieg hat inzwischen seine eigene Geschichte, von Darwin und Freud bis hin zu Pinker und Keeley. Es ist durchaus sinnvoll, zu untersuchen, wie die Vorstellungen von Krieg und seinen Ursachen in den letzten hundert Jahren durch jeweils eigene Kontexte beeinflusst und geformt wurden, bevor man darangeht, den heutigen Diskussionsstand zu präsentieren. Das ist eine Aufgabe, die Historikern zufällt.
Das vorliegende Buch richtet sich an ein breites Publikum, das mehr darüber erfahren möchte, welche Antworten die moderne Forschung auf die Frage «Warum Krieg?» bereithält. Ich habe versucht, auf allzu komplexe technische Fragen zu verzichten sowie spezielles Fachvokabular nur dort zu verwenden, wo es unvermeidlich ist. Dieses Buch soll eine Einführung in teils höchst umstrittene Argumentationen und Annahmen zum Thema vergangener wie gegenwärtiger Kriegführung darstellen. Die Frage nach den Ursprüngen des Krieges wird teilweise selbst zu einem regelrechten akademischen Schlachtfeld. Es ist inzwischen zu einer schwierigen Aufgabe geworden, dem Minenfeld dieser Auseinandersetzungen halbwegs zu entgehen. Eine Parteinahme lässt sich dabei kaum vermeiden, und ich behaupte auch nicht, in jedem Fall neutral zu sein, wenn eine Entscheidung für die eine oder andere Seite sinnvoller erscheint.
Die hier aufgeworfene Frage – «Warum Krieg?» – gehört zu den grundlegenden für die Gegenwart und Zukunft des Menschen. Es überrascht also nicht, dass zwei der intellektuellen Schwergewichte des 20. Jahrhunderts, der Physiker Albert Einstein und der Psychologe Sigmund Freud, in ihrer Korrespondenz im Jahr 1932 nach einer Antwort suchten. Einstein war Ende 1931 vom Internationalen Institut für geistige Zusammenarbeit des Völkerbunds angeregt worden, sich einen Briefpartner zu einem Thema seiner Wahl zu suchen. Einstein, bereits als Redner für Antikriegsorganisationen aktiv, entschied sich für eine Einladung an Sigmund Freud. In ihrer Korrespondenz sollte die Frage beantwortet werden: «Gibt es eine Möglichkeit, die Menschheit von der Bedrohung des Krieges zu befreien?» Freud, nahm Einstein an, verstehe sich besser als er auf die «Tiefen des menschlichen Wollens und Fühlens».[1] Das Ergebnis war ein kurzes Pamphlet, das unter dem Titel Warum Krieg? auf Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch veröffentlicht wurde. Einstein war von Freuds Antwort enttäuscht, denn dieser beharrte darauf, Gewaltanwendung sei ein Merkmal des gesamten Tierreichs, die Menschheit eingeschlossen; er könne deshalb keinen wirksamen Weg erkennen, wie der menschliche Kampf- und Zerstörungstrieb zu bremsen sei. Dieser Trieb sei, so Freud, vom «Todestrieb» abzuleiten und als psychologischer Impuls in jedem Lebewesen angelegt.[2]
Freuds morbide Schlussfolgerung ist seither oft untersucht und erörtert worden – als Versuch, die biologischen, psychologischen, kulturellen und ökologischen Mechanismen zu verstehen, die Krieg zu einem unvermeidlichen Bestandteil der menschlichen Existenz machen. Zu den Ergebnissen solcher Versuche zählen mindestens fünf Bücher mit dem Titel «Warum Krieg?» und viele weitere, die sich den Ursachen des Krieges widmen.[3] Trotzdem bleibt die Antwort auch nach fast einem Jahrhundert wissenschaftlicher wie historischer Diskussionen umstritten, bruchstückhaft und frustrierend vage. Tatsächlich könnte man die Frage angesichts der menschlichen Neigung zur organisierten, «koalitionären» Kriegführung, die über weite Strecken der Vergangenheit des Menschen festzustellen ist, auch genau andersherum stellen: «Warum nicht?» Die Menschen haben nun mal bewiesen, dass sie eine kriegerische Spezies sind. Der Psychologe John Bowlby konstatierte 1939 in einer Untersuchung über den Kampf- und Tötungstrieb: «Keine Gruppe von Tieren könnte bei ihren Angriffen aggressiver oder rücksichtsloser sein als erwachsene Mitglieder der menschlichen Rasse.»[4] Natürlich führen die Menschen nicht immer und überall Krieg, sonst wäre der Homo sapiens vielleicht schon ausgestorben. Krieg ist ein Bestandteil der menschlichen Evolution. Er gehört laut Azar Gat zum menschlichen Werkzeugkasten für das Überleben, ist aber nur eines dieser Werkzeuge.[5] Krieg und Frieden werden oft als die einzigen Optionen dargestellt, dabei sind sie stets in einem komplexeren Zusammenhang von Überlebensstrategien zu sehen. Wer den Krieg verstehen will, muss auch erklären können, warum Friedenszeiten zu Ende gehen. Die einzige Konstante ist, dass immer wieder auf kollektive, tödliche Gewalt zwischen Gruppen von Menschen zurückgegriffen wurde – sei es aus Not, Angst, Ehrgeiz oder aufgrund von Vorurteilen, sogar unter Berufung auf das Übernatürliche. So entstand und entsteht Krieg, von den frühesten Anzeichen gewalttätiger Auseinandersetzungen bis zu den Kriegen und Bürgerkriegen des 21. Jahrhunderts.
In diesem Buch soll untersucht werden, wie das Phänomen Krieg seit dem ergebnislosen Austausch zwischen Einstein und Freud in den wichtigsten wissenschaftlichen Disziplinen erklärt wird. Auf dem Prüfstand steht vor allem die Plausibilität dieser Erklärungen. Unter vielen verschiedenen Ansätzen kann man zwei grundlegende unterscheiden: Die wichtigsten Humanwissenschaften – Biologie, Psychologie, Anthropologie und Ökologie – widmen sich mit ihren je eigenen Methoden der Erklärung des Krieges als evolutionäre Anpassung, als kulturell bestimmte Handlungsweise oder als Ergebnis von Umweltzwängen. In dieser deterministischen Sicht werden Menschen zum Objekt natürlicher oder kultureller Kräfte, die erklären können, warum es in der evolutionären Vergangenheit zu Kriegen gekommen ist.[6] Diese Erklärungsweisen für Krieg sind Gegenstand der ersten Hälfte des vorliegenden Buchs, und sie werden – anders als bei den meisten Forschungsbeiträgen in diesem Bereich – auch auf moderne Kriege angewandt, nicht nur auf Kriege aus vergangenen Jahrtausenden.
Der zweite grundlegende Ansatz – in der zweiten Buchhälfte – betrifft die Geschichts-, Sozial- und Politikwissenschaften. Diese verfolgen nichtdeterministische Erklärungsansätze und Theorien, die auf menschlichen Erkenntnissen basieren. Hier gelten Menschen als Schöpfer von Kulturen, die den Krieg stützen und Menschen zu bewussten Akteuren machen, die Ziele verfolgen, die je nach Ort und Zeit eine große Variationsbreite aufweisen können. Solche «proaktiven» Erklärungsmuster lassen sich nach vier Kategorien von Beweggründen für einen Krieg unterteilen: Ressourcen, Glaube, Macht und Sicherheit. Erklärungen, die auf einem solchen Kausalnexus beruhen, passen besser zur Kriegführung in modernen Zeiten, als Fähigkeiten entwickelt worden waren, Krieg auch zwischen Großmächten zu führen. Doch Glaubensauseinandersetzungen, Machtstreben, Sicherheitsbedürfnisse und der Kampf um Ressourcen waren schon in weit früheren Konflikten als Antriebskräfte erkennbar, sogar in vorstaatlichen Gemeinschaften, wo auch alle vier Ursachen zusammengenommen zu Kriegen führen konnten. All diese Ansätze sind durchaus miteinander vereinbar, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden. Doch sind sie gut geeignet, die vielen Erklärungsstränge zu ordnen und auseinanderzuhalten, die zur Erklärung von Krieg und Kriegführung herangezogen wurden.
Zunächst muss klar definiert werden, was hier unter Krieg und Kriegführung verstanden wird. In großen Teilen der Literatur werden diese Begriffe austauschbar verwendet. Ein «Krieg» jedoch ist ein spezielles Ereignis, selbst wenn Anfang und Ende nicht immer klar zu benennen sind, während «Kriegführung» die vielen Arten bezeichnet, wie Konflikte von Gesellschaften und Kulturen geplant, organisiert und ausgefochten werden. In diesem Kontext ist Krieg eine anthropologische Größe. Gleichwohl ist heftig umstritten, was Krieg oder Kriegführung im Kern ausmacht, und im Lauf der letzten fünf Jahrzehnte ist es darüber zu langen, kontroversen Debatten gekommen. Auf der einen Seite wurde die These vertreten, Krieg sei ein Produkt aus relativ neuer Zeit, nachdem sich Staaten herausgebildet hätten, die in der Lage waren, substanzielle Streitkräfte zu mobilisieren, für den Krieg zu bezahlen und den Nachschub zu organisieren. Auf der anderen Seite standen jene, deren These lautet, jegliche tödliche Gewaltanwendung zwischen verschiedenen Gruppen sei schon seit prähistorischen oder vorstaatlichen Zeiten eine Form von Kriegführung, ganz gleich, wie kurz oder sporadisch solche Gewaltausbrüche gewesen seien. Der Gedanke, Krieg könne nur von zivilisierten Staaten geführt werden, ist paradox, obwohl Freud in Das Unbehagen in der Kultur (1930), kurz vor dem Briefwechsel mit Einstein erschienen, die Meinung vertrat, je zivilisierter die Menschen würden, desto wahrscheinlicher würde der katastrophale Abstieg in primitive Gewaltausübung (was durch den Weltkrieg, der bald darauf folgte, als naheliegender Schluss bestätigt wurde).
Unbestreitbar spricht die historische Beweislage dafür, dass Kriege immer umfassender und tödlicher wurden, je stärker sich Staaten konsolidierten, bürokratisierten und sozial segmentierten, was teilweise dazu führte, dass Kriege effektiver geführt werden konnten. Diese offenkundige Tatsache hat es Anthropologen und Archäologen in weiten Teilen des letzten Jahrhunderts ermöglicht, sich stärker auf friedensorientierte Erzählungen zu konzentrieren, in denen archaische Völker (in ferner Vergangenheit oder an abgelegenen Orten in der Gegenwart) nur selten oder gar nicht zu tödlicher Gewalt griffen oder ihre Auseinandersetzungen ritualisiert austrugen, meistens ohne tödlichen Ausgang.[7] Der Anthropologe Bronisław Malinowski lobte 1940 den «urtümlichen Pazifismus» des primitiven Menschen, während er die in seinen Augen unsinnige, nihilistische Gewaltanwendung der Moderne anprangerte.[8] Viele Anthropologen, die heute publizieren, ignorieren zwar nicht die Belege für gewaltsame Auseinandersetzungen schon vor Beginn der Staatenbildung des Menschen, doch betrachten sie diese Vorfälle lieber als lokale Fehden, gruppeninternen Totschlag oder als gelegentliche Überfälle, die weder endemisch noch besonders tödlich gewesen seien. Nach dieser Lesart haben sich die Menschen im Lauf der Zeit zu erfolgreich kooperierenden Wesen entwickelt, für die Krieg nur eine gelegentliche Verirrung gewesen sei, die Jahrtausende recht friedlicher Koexistenz kurzzeitig unterbrochen habe.[9]
Diese Sicht des Krieges ist kaum noch haltbar angesichts einer Fülle neuer archäologischer und ethnografischer Belege. Erwiesenermaßen gab es bereits tödliche Gewalt zwischen verschiedenen Gruppen, bevor es zu den ersten großen sesshaften Gemeinschaften oder zur Herausbildung der ersten Staaten kam. In der immer umfangreicheren Forschung jener Autoren, die sich mit unserer frühen Vergangenheit als Menschen beschäftigen, besteht weitgehende Einigkeit, dass es geografisch breit gestreute und einen langen Zeitraum abdeckende Belege für kriegerische Handlungen gibt, wobei Krieg als tödlicher, in Bündnissen ausgetragener Konflikt zwischen unterschiedlichen Gruppen von Menschen definiert wird. Manche Belege beziehen sich sogar auf das weit zurückliegende Pleistozän, also die Zeit, bevor der Homo sapiens sich auf der ganzen Welt ausbreitete.[10]
Man kann es bei diesem Argument allerdings auch übertreiben. Der Anthropologe Keith Otterbein, einer der frühesten und hartnäckigsten Vertreter der These, dass der Mensch schon in frühester Vergangenheit Kriege geführt habe, ist ein Beispiel hierfür. Er feierte die Entdeckung von rund 800000 Jahre alten fossilen homininen Knochen in einer Höhle im spanischen Burgos, die elf Kannibalismus-Opfern zugeordnet werden können, als «den ältesten bekannten Beleg für Krieg».[11] Solche hoffnungsvollen Spekulationen lassen sich weder in der einen noch in der anderen Richtung beweisen. Dennoch gibt es überwältigendes Belegmaterial aus neuerer Zeit, welches dafürspricht, dass die Existenz eines Staates keine Voraussetzung für kriegerische Gewalt war und ist. Jungsteinzeitliche Knochenreste in Europa weisen Pfeilspitzen auf, die in Wirbelsäulen eingedrungen sind, sowie eingeschlagene Schädel, enthauptete Skelette und amputierte Gliedmaßen – alles klare Anzeichen kriegerischer Gewalt.[12]
Die Archäologin Patricia Lambert verweist auf über Jahrzehnte gesammelte Ausgrabungsergebnisse und Knochenanalysen aus Nordamerika, die zweifelsfrei belegen, dass es in jeder größeren Region des Kontinents kriegerische Gewalt gab. Die berühmteste Ausgrabungsstätte liegt in Crow Creek in South Dakota; es handelt sich um ein Massengrab mit 415 identifizierbaren Skeletten aus der Mitte des 14. nachchristlichen Jahrhunderts. 89 Prozent der Opfer waren skalpiert worden, und 41 Prozent einer Stichprobe von 101 Schädeln weisen Verletzungen durch Steinäxte auf.[13] Aus der Spätphase der europäischen Linearbandkeramischen Kultur vor rund siebentausend Jahren wurden Orte, an denen es zu Massakern kam, in Talheim bei Heilbronn und in Asparn/Schletz in der Nähe von Wien durch Ausgrabungen verifiziert. Dabei wurden an letzterer Fundstelle 66 Individuen hauptsächlich durch Axthiebe getötet und dann in einen Festungsgraben geworfen – und so weiter.[14] Die Produktion potenzieller Waffen seit der Frühzeit der menschlichen Evolution; die Ikonografie des Kampfes in der Höhlenmalerei, wo Bewaffnete im Gefecht zu sehen sind; die fast universellen knochenarchäologischen Belege von zerschmetterten Schädeln und durchbohrten Knochen – all dies macht es sehr schwer, weiterhin die These vom «urtümlichen Pazifismus» zu vertreten.
Im Folgenden wird der Begriff «Kriegführung» im weiteren Sinne von kollektiver, absichtlicher, tödlicher Gewalt zwischen Gruppen gebraucht, egal, ob es sich um Überfälle, Hinterhalte oder Scharmützel handelt, um rituelle Gewalt oder um die in historischer Zeit üblicheren offenen Feldschlachten. Daraus folgt, dass ein Großteil der Erörterungen in diesem Buch, speziell in den ersten Kapiteln über die Humanwissenschaften und den Krieg, eine Vergangenheit behandelt, die sich weit über die Epoche der ersten organisierten Staaten hinaus in die Frühzeit erstreckt, die einen Zeitraum von zwanzig- bis dreißigtausend Jahren umfasst – und die manchmal auch noch viel weiter zurückgeht, vor allem, wo es um Theorien der physischen und psychologischen Evolution des Menschen geht. Die archäologischen Belege für frühe Gewalt können in Verbindung mit ethnografischem Material genutzt werden, das aus dem Umfeld moderner Gemeinschaften von Jägern und Sammlern stammt. Auch hier mussten die Anthropologen eingestehen, dass tödliche Gewalt in solchen Gesellschaften viel stärker verankert ist, als viele argumentativ für möglich gehalten haben – egal, ob es sich um Aborigine-Gemeinschaften in Australien, um Stammesjäger in Neuguinea oder um indigene Stämme im hohen Norden Amerikas und Kanadas handelt.[15]
Selbst die Argumentation, dass protostaatliche Gemeinschaften Gewalt nur dann einsetzten, wenn eine bestimmte Anzahl von Gefangenen für rituelle Menschenopfer gebraucht wurde, ist unhaltbar, wie am Beispiel der Maya- und Aztekenreiche gezeigt werden konnte (ganz abgesehen davon, dass Menschen gefangen zu nehmen, um sie rituell zu opfern, auch nicht gerade ein friedlicher Akt ist). Zeitgenössische Dokumente belegen, dass Armeen der Azteken ganze Bevölkerungen massakrierten. In der Stadt Cuetlaztlan töteten Soldaten «Alte, Frauen, junge Männer, Knaben, Mädchen, Säuglinge in der Wiege».[16] Die Maya-Kultur war durchdrungen von Krieg und einer Kriegerelite; eine Maya-Chronik listet zwischen 512 und 808 n. Chr. 107 kriegerische Ereignisse an 28 Schauplätzen auf.[17] Keine dieser Revisionen über die Verbreitung von Krieg in allen Kulturen bedeutet allerdings, dass das Muster oder die Motive für Krieg immer gleich sind. Sie sind es keineswegs. Verschiedene Kulturen üben Gewalt auf ganz unterschiedliche, manchmal einzigartige Weise aus. Kriegführung in der Frühzeit ist selbstverständlich nicht dasselbe wie Kriegführung zwischen modernen Großmächten, aber die Größenordnung ist letztlich relativ, und die direkten Ursachen und Ziele können manchmal verblüffend ähnlich sein. Am Ende kommt immer etwas heraus, das klar als Krieg erkennbar ist, egal, ob es sich um «aufkommende Kriegführung» (emergent warfare) handelt, wie der Anthropologe Nam Kim das Phänomen in den frühesten menschlichen Gemeinschaften treffend bezeichnete, oder um eine institutionalisierte Kriegführung zwischen modernen Nationalstaaten.[18] Über den gesamten Zeitraum der menschlichen Evolution hinweg gab es kollektive, tödliche Gewalt zwischen unterschiedlichen Gruppen, und für dieses Phänomen muss eine Erklärung gefunden werden.
Ein paar Vorbehalte sollte man berücksichtigen, wenn man ein ganzes Buch der Frage widmet, wie sich die Ursachen von Kriegen erklären lassen. So wird zum Beispiel nicht den Gründen für individuelle Aggression nachgegangen. Zu diesem Thema gibt eine umfassende Spezialliteratur in der Neurologie, Psychiatrie und Psychologie. Unsere Kenntnis der Funktionsweise des Gehirns und des Zentralnervensystems ist mittlerweile so hoch entwickelt, dass die Pathologie aggressiver Verhaltensweisen bei Individuen, die solche an den Tag legen, rein wissenschaftlich erklärt werden kann, auch dann, wenn sich ein solches Verhalten nicht abstellen lässt.[19] Ein Großteil der Forschungsbemühungen seit den 1930er Jahren konzentriert sich auf aggressive Delinquenz bei Erwachsenen und Kindern. Doch lässt sich diese Art von Gewalt nicht ohne Weiteres mit jener vergleichen, die im Krieg zur Anwendung kommt. Individuelle Aggression ist bedeutsam, wenn es um kollektive oder koalitionäre Gewalt geht – etwa bei der Tötung eines isolierten Schimpansen durch eine marodierende Gruppe benachbarter Artgenossen. Hier könnten frühe hominine Gewalttaten angeknüpft haben. Für eine Gruppe von Menschen, die bereit ist, andere Menschen zu töten, spielt individuelle Aggression eine Rolle, vor allem im früheren Entwicklungsstadium kriegerischer Auseinandersetzungen, in dem von Angesicht zu Angesicht gekämpft wurde. In modernen Armeen, in denen viele Individuen eigentlich persönlich nicht aggressiv sind, erzwingt erst der unmittelbare tödliche Kampf auf dem Schlachtfeld das Hervortreten der eigenen Aggression – als Reaktion darauf, dass das eigene Leben bedroht ist. In solchen Situationen ist die kollektive, nicht die individuelle Aggression der sicherere Weg, wenn man erforschen will, wie sich Krieg und Kriegführung entwickelt haben. Wenn Stammesgemeinschaften einen «Feind» überfielen, agierten sie als Gruppe, für gewöhnlich mit kollektiven Zielen und allzu oft mit einem Übermaß an Aggression.
Im vorliegenden Buch wird außerdem die Frage ausgeklammert, ob die Menschheit im Verlauf der letzten Jahrtausende weniger gewalttätig geworden ist. Steven Pinkers 2011 veröffentlichte bahnbrechende Studie The Better Angels of Our Nature (Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit) hat weithin Diskussionen darüber entfacht, ob Gewalt in ihren vielen Erscheinungsformen, einschließlich der kriegerischen Gewalt, wirklich zurückgegangen ist.[20] Die Tatsache, dass zwischen den Großmächten seit 1945 kein Krieg mehr geführt wurde (obwohl es jede Menge blutiger Stellvertreterkriege gab), hat zu der These verleitet, dass der zwischenstaatliche Krieg selbst vielleicht inzwischen obsolet geworden sei – selbst wenn Bürgerkriege und transnationale Terrorkriege durchaus so lebendig sind wie eh und je. Eine solche These lässt außer Acht, dass die Gefahr eines Atomkrieges nicht endgültig gebannt ist, selbst wenn die Chance, dass es zu einem solchen Krieg kommt, verschwindend gering erscheinen mag. Die moderne «realistische» Sicht der Internationalen Beziehungen rechnet weiterhin mit der Option eines Krieges, denn sonst wären nukleare wie konventionelle Abrüstung längst auf der ganzen Welt Realität.[21]
Nichts von alldem hat für unsere eigentliche Frage «Warum Krieg?» echte Relevanz. Denn ganz gleich, ob statistisch weniger gewaltsam als früher oder nicht, in den letzten einhundert Jahren gab es Kriege von außergewöhnlichen Ausmaßen, die insgesamt überaus blutig und tödlich verliefen – die beiden Weltkriege, der Russische Bürgerkrieg, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Iran-Irak-Krieg, und so weiter. Sollte sich die Zahl der Kriege zwischen Staaten tatsächlich verringert haben, dann gibt es dafür jetzt viele andere Formen moderner kriegerischer Auseinandersetzungen: Bürgerkriege, Aufstandsbekämpfung, Terrorkampagnen, Stellvertreterkriege und sogar «Hybridkriege», bei denen sich reguläre und irreguläre Formen des Krieges überlappen.
Tatsächlich gab es im 20. Jahrhundert kein einziges Jahr, in dem nicht irgendwo auf der Welt ein Krieg oder Bürgerkrieg geführt wurde. Mittlerweile gibt es im 21. Jahrhundert auch schon den ersten Großkrieg zwischen Staaten, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. In der Rückschau auf die jahrtausendelange Geschichte des modernen Menschen könnte ein Beobachter von einem anderen Planeten zu Recht den Schluss ziehen, dass Krieg alles andere als obsolet geworden ist. Man denke nur an die kriegerischen Höhepunkte der letzten einhundert Jahre und an die Existenz von Waffen, die in der Lage sind, die gesamte Menschheit auszulöschen. Die Frage, warum es zu Kriegen kommt, ist unabhängig vom Ausmaß und von der Intensität menschlicher Gewalt, und man sollte diese beiden Fragestellungen darum auseinanderhalten.
Abschließend ist anzumerken, dass es sich hier nicht um eine Geschichtsdarstellung von antiken oder modernen Kriegen handelt. Es geht auch nicht vorrangig um die Frage, wie und mit welchen Folgen sie geführt wurden. Natürlich spielen Faktoren wie der soziokulturelle Rahmen, die Art der Kriegführung, die verfügbare Waffentechnologie und die Kriegsfolgen immer eine Rolle bei Erklärungen dafür, warum sich im Lauf der Geschichte Kriege ereignet haben. Doch jeder einzelne Krieg hat seine eigene historische Erklärung und ist in seinen jeweiligen Kontext einzuordnen.
Krieg wird im Folgenden rein exemplarisch betrachtet, nicht als Teil einer formellen Erzählung über die beunruhigende Anzahl von Kriegen zwischen Menschen. Hauptanliegen soll sein, anhand dieser langen Gewaltgeschichte die prinzipiellen Erklärungsansätze zum Krieg zu veranschaulichen, die vorgelegt wurden, seit Einstein Freud bat, er möge ihm «die repräsentativste und unheilvollste, weil zügelloseste Form des Konfliktes unter menschlichen Gemeinschaften» enträtseln.[22]
Erster Teil
1.Der gefährlichste Teil unseres Erbes – Biologie
«Die Natur hält ihren menschlichen Obstgarten durch Ausschneiden gesund – ihr Schneidehaken ist der Krieg.»
Sir Arthur Keith, 1931[23]
«Wissenschaftlich nicht haltbar ist die Annahme, Krieg oder anderes gewalttätiges Verhalten sei beim Menschen genetisch vorprogrammiert. […] Biologisch gesehen ist die Menschheit nicht zum Krieg verdammt.»
Erklärung von Sevilla: «Gewalt ist kein Naturgesetz», 1986[24]
Seit der britische Biologe Charles Darwin (1809–1882), der Begründer der Evolutionstheorie, die Ansicht vertrat, dass in der Natur alle Arten in einen «Kampf ums Dasein» verstrickt seien, ist der Zusammenhang von Biologie und Krieg eine der umstrittensten Fragen geblieben, wenn erklärt werden soll, warum Menschen Kriege führen. Der neodarwinistische Anatom Arthur Keith behauptete Mitte des 20. Jahrhunderts, Krieg sei unter biologischen Gesichtspunkten nützlich, weil die menschlichen Gemeinschaften auf diese Weise die Schwachen ausmerzen und die Starken fördern könnten. Dies sei, nahm er an, ein Gesetz der Natur. Bei einer Konferenz im Jahr 1986 in der spanischen Stadt Sevilla wies dagegen eine internationale Gruppe von zwanzig prominenten Vertretern eines weiten Spektrums der Humanwissenschaften alle wissenschaftlichen Bemühungen, den Krieg als etwas biologisch Determiniertes zu etablieren, prinzipiell zurück. Für sie stellte diese Sicht eine gefährliche Verzerrung dar. Im November 1989 übernahm die UNESCO die Erklärung von Sevilla, um ihr einen offiziellen Status zu verschaffen, und im Jahr 2002 wurde die Erklärung erneut publiziert und weit verbreitet. Doch brachte auch diese Initiative sozialdarwinistische Theorien nicht zum Schweigen. Zwar würde heute kein Wissenschaftler mehr Keiths krude Metaphorik verwenden, doch die Biologie ist in der einen oder anderen Form ein zentraler Bezugspunkt in Diskussionen über Krieg geblieben.
Die Biologie, genauer: die Evolutionsbiologie, kann mit Fug und Recht beanspruchen, die erste Naturwissenschaft gewesen zu sein, die sich mit der Frage beschäftigte, warum Menschen Kriege führen. Darwin selbst lag diese Fragestellung eigentlich fern; sein Argument, dass alle Spezies einem Kampf ums Dasein unterworfen seien, gehörte für ihn vor allem ins Reich der Naturgeschichte. Es sollte erklären, wie Pflanzen und Tiere sich im Sinne der Evolution anpassten – an den Druck der Umwelt oder an den Konkurrenzkampf innerhalb der eigenen Art beziehungsweise unter den verschiedenen Spezies.[25] «Kampf» war in diesem Kontext nur eine Metapher, kein Synonym für «Krieg». Auf die Möglichkeit menschlicher Konflikte zur Zeit der Vorfahren kam er deutlicher erst im Jahr 1871 in The Descent of Man (Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl) zu sprechen; aber auch hier war dies nur ein Nebenaspekt, denn vorrangig ging es Darwin darum, zu erklären, wie sich die menschliche Spezies entwickelt hatte, speziell durch geschlechtliche Selektion.
Zu diesem Zeitpunkt war Darwin mit dem Gedanken vom «Überleben des Stärkeren» (survival of the fittest) bereits vertraut, den der Sozialwissenschaftler Herbert Spencer 1851 als Erster vorgetragen hatte. Die wenigen Bemerkungen Darwins in Die Abstammung des Menschen über die Art und Weise, wie einige frühzeitliche Stämme überlebten, andere dagegen ausgelöscht wurden, deuten darauf hin, dass für ihn Angepasstheit (fitness) zumindest eine, wenn auch nicht die einzige Erklärungsmöglichkeit war. «Das Aussterben», erklärte er, «ist hauptsächlich eine Folge der Konkurrenz eines Stammes mit dem anderen […]. Und wenn einer von zwei aneinanderstoßenden Stämmen weniger zahlreich und weniger machtvoll als der andere wird, so wird der Kampf sehr bald durch Krieg, Blutvergießen, Kannibalismus, Sklaverei und Absorption beendet.» Eine zahlenmäßige Reduktion oder ein Rückgang der Fruchtbarkeit würden die biologischen Aussichten für das Überleben unterminieren, schloss Darwin, aber ob ein Stamm schließlich ganz verschwinde, sei damit allein nicht gesagt. «Eine Abnahme der Zahl wird früher oder später zum Aussterben führen. Das Ende wird dann in den meisten Fällen durch das Eindringen erobernder Stämme mit Sicherheit herbeigeführt.»[26]
Darwin selbst sagte zur Frage, ob Krieg eine bedeutende Rolle im Verlauf der menschlichen Evolution gespielt habe, kaum mehr als das hier Zitierte. Das rechtfertigt keine großen Schlussfolgerungen. Doch der Gedanke, dass die am besten Angepassten überleben, während die weniger Angepassten zugrunde gehen, wurde von mehreren Generationen von «Darwinisten» weit über Darwins Originalwortlaute und Argumente hinaus vergröbert und verzerrt. Die Darwinisten, nicht Darwin selbst, behaupteten, Krieg habe einen evolutionären Nutzen. Bei europäischen und amerikanischen Autoren stützte die These vom Überleben des Stärkeren das Argument, Krieg und Imperialismus reflektierten in der modernen Welt die rassische Überlegenheit des Westens gegenüber der Unzivilisiertheit der Völker, die von den westlichen Eroberern unterjocht wurden. Krieg war laut Arthur Keith ein Naturphänomen zur Sicherstellung, dass die biologisch Besten überlebten und zahlenmäßig stärker würden. Das Konzept der Rassenkonkurrenz als einer evolutionären Tatsache wurde in Deutschland mit der größten Begeisterung aufgenommen. Dort definierte der Arzt und Biologe Alfred Ploetz (1860–1940), Gründer der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene, die «Vitalrasse» als eine Rasse, die in puncto Kraft und Stärke, Intelligenz und körperlicher Gesundheit eine kollektive Angepasstheit geerbt habe. Die rassisch Unangepassten seien von der Natur zum Aussterben bestimmt, und Krieg sei eines der Mittel, um sicherzustellen, dass die Vitalrassen überlebten.[27]
Der deutsche General Friedrich von Bernhardi trug alle diesbezüglichen Argumente zusammen und veröffentlichte sie 1912 in seinem Bestseller Deutschland und der nächste Krieg. Das Buch erschien auch auf Englisch – zwei Jahre bevor der Erste Weltkrieg ausbrach. Darin behauptete von Bernhardi: «Krieg ist in erster Linie eine biologische Notwendigkeit, ein Regulator im Leben der Menschheit.» Im «Gesamthaushalt der Natur» setze sich zu Recht das Stärkere durch, «das Schwache unterliegt».[28] Der Gedanke einer Vitalrasse beeinflusste später im Dritten Reich nachhaltig die Entwicklung der Rassenpolitik. Die angeblich genetisch Minderwertigen und «Lebensunwerten» wurden sterilisiert oder getötet, um zu verhindern, dass die «arische» Rasse in dieser, wie Hitler sagte, «Welt des ewigen Ringens» entwertet und geschwächt würde.[29]
Der Erste Weltkrieg trug zur Zementierung der Vorstellung bei, dass der «Kampf ums Dasein» weiterhin eine Realität des menschlichen Lebens sei. Der Gedanke, dass der Mensch einen kämpferischen Instinkt in sich trage, der der Menschheit auf evolutionärem Weg eingeprägt worden sei, ließ sich mit der Realität moderner Konflikte bestens vereinbaren. Der Arzt Harry Campbell, der 1918, gegen Ende des Krieges, das Buch The Biological Aspects of Warfare veröffentlichte, nannte den Menschen einen «Erz-Schlächter», der instinktiv gewalttätig werde.[30] Arthur Keith nutzte seine Untersuchungen fossiler menschlicher Knochenreste vor 1914, um das Argument zu untermauern, dass sich die Menschheit «in einer Reihe von Zickzack-Bewegungen» entwickelt habe, wobei jeweils die höher entwickelten Arten die weniger entwickelten ausgelöscht hätten, um die Menschheit insgesamt auf dem Weg der Evolution voranzubringen, bis hin zum gegenwärtigen Weltkonflikt. Konkurrenz und Feindschaft seien als menschliche Komplexe immer wirksam gewesen, vom Urmenschen bis zur modernen Zeit.
Im Vorwort zu einem 1937 erschienenen Buch von Alfred Machin über den Darwinismus lobte Keith den Autor dafür, verstanden zu haben, dass die «‹natürliche Selektion› in der Welt von heute noch genauso mächtig und wirksam ist wie zu der Zeit, als der Mensch noch ein unbedeutender Dschungelbewohner war». Der moderne Krieg, argumentierte Keith gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, sei letztlich «nur der wilde Kampf aus alten Stammeszeiten, aber mit den Ausrüstungen der Wissenschaft und der Zivilisation».[31] Für Keith war der Krieg das logische Instrument der Selektion: Der «Plan der Natur» sei so eingerichtet, dass durch notwendige Gewalt eine höhere Form der Menschheit herbeigeführt werde.[32]
Es gab in der Wissenschaft zwar starken Widerstand gegen die Idee, dass der Kampfinstinkt dem Menschen angeboren sei und Krieg einer evolutionären Zielsetzung diene, doch war die Ansicht, der Mensch sei der oberste Vertreter der Gewaltanwendung und habe sich durch Jagen, Kämpfen und Töten im Stammbaum der Evolution ganz nach oben gearbeitet, auch in den 1950er und 1960er Jahren noch weitverbreitet. Die These vom «Killeraffen» wurde durch den Schriftsteller und Amateur-Evolutionsbiologen Robert Ardrey bekannt, während der Archäologe Raymond Dart der Überzeugung war, seine fossilen Knochenfunde vom Australopithecus würden eindeutig Spuren bewusster Gewaltanwendung aufweisen – eine Ansicht, die heute nicht mehr haltbar ist, da eine forensische Untersuchung bestätigt hat, dass die Schäden an den Knochen erst nach dem Tod auftraten und nicht die Todesursache waren.
Die Ablehnung der These, dass Krieg dem Menschen genetisch inhärent sei, gab es schon lange vor der Erklärung von Sevilla. Bereits Darwins Schriften hatten den Schwerpunkt nicht auf Konflikte zwischen den Vorfahren des modernen Menschen gelegt, sondern auf Geselligkeit und Kooperation als Grundlage menschlichen Zusammenlebens; Letztere waren für Darwin die Schlüsselelemente der Evolution. Den Gedanken, dass der Mensch einen Kampfinstinkt in sich trage, wies er zurück und hoffte, dass die modernen Menschen den Krieg hinter sich gelassen hätten. Es hat sich in der Tat als leichter herausgestellt, aus der Darwin-Lektüre eine «Friedensbiologie» zu entwickeln als eine Theorie der Selektion durch Krieg.[33] Die Entwicklung der wissenschaftlichen Genetik nach 1900 legte die Schwierigkeiten der These offen, dass es eine erbliche Veranlagung für Konfliktverhalten gebe. Das Argument schließlich, der Krieg sei nützlich, weil er das Überleben der biologisch Bestangepassten sicherstelle, wirkte nach dem Ersten Weltkrieg geradezu lächerlich, denn der negative biologische Einfluss des Krieges lag auf der Hand: Er hatte Millionen junge, fitte Männer das Leben gekostet, während die nicht so Tauglichen daheim geblieben waren. Die akademische Evolutionsbiologie konzentrierte sich nach dem Krieg also auf die nichtmenschliche Natur und auf die Vorhersage von Speziesvarianten. Die Vorstellung von Krieg als evolutionärem Selektionsmechanismus für menschliche Bevölkerungen blieb bestehen, doch eher als Glaube denn als wissenschaftlich belegbare Tatsache.
Der krude Darwinismus, den Keith und andere mit ihrer These vertraten, dass der Krieg auf evolutionäre Konkurrenz zurückgehe und somit ein natürliches, biologisches Phänomen sei, stieß nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig auf breite Ablehnung – wie auch andere biologische Erklärungen der menschlichen Natur nur noch marginale Bedeutung hatten. Die «Erklärung zum Wesen der Rasse und der Rassenunterschiede» (Statement on the Nature of Race and Race Differences) der UNESCO aus dem Jahr 1951 wies den Gedanken zurück, dass es biologisch erklärbare, angeborene Unterschiede zwischen Gruppen von Menschen gebe. Der einzige legitime Weg, die Entwicklung der Menschheit zu verstehen, seien die Untersuchung von Umwelteinflüssen und die Methoden der Kulturanthropologie.[34]
Eine Frage blieb bei den wissenschaftlichen Diskussionen, die zur UNESCO-Erklärung führten, allerdings unbeantwortet: Wie lässt sich kollektive Aggression verstehen? Forschungen zu dieser Frage gehen schon auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Beim Versuch zu zeigen, wie sich der frühe Mensch wahrscheinlich verhielt, war Keith als einer der Ersten der Ansicht, dass ein genaueres Verständnis kollektiver Aggression unter den höheren Primaten auch wichtige Erkenntnisse über das kollektive Aggressionsverhalten von Menschen liefern könne. Keith übernahm vom Zoologen Neville Sharp, der die höheren Primaten in Westafrika wissenschaftlich beobachtet hatte, detaillierte Belege über das Verhalten von Schimpansen und Gorillas. Sharp war zu dem Schluss gekommen, dass Schimpansen zu gewalttätigem, ja sadistischem Verhalten in der Lage seien, während Gorillas vor allem dann äußerst aggressiv wurden, wenn sie ihr Territorium gegen das Eindringen von Menschen verteidigen wollten. Forschungen zu Brüllaffen und Gibbons brachten Keith zu der Überzeugung, Territorialverhalten und Gewaltanwendung der Primaten könnten als «Anfangsstadium eines echten Krieges» gelten.[35]
Ähnliche Schlüsse hatte auch schon der junge Anatom Solly Zuckerman aus wissenschaftlichen Beobachtungen in den frühen 1930er Jahren gezogen, nämlich von Mantelpavianen im Londoner Zoo. Im Beobachtungszeitraum starben acht Männchen und dreißig Weibchen bei Kämpfen unter den Pavianen, und alle Weibchen aufgrund von männlichem Konkurrenzverhalten. Zwei britische Psychologen, John Bowlby und Edward Durbin, nutzten Zuckermans Forschungsergebnisse für ihre These, die naturalistische Verhaltensanalogie zwischen Menschenaffen und Menschen sei tragfähig genug für die Schlussfolgerung, Krieg werde beim Menschen durch den «gefährlichsten Teil unseres animalischen Erbes» verursacht. Paviane kämpften um Besitz, gegen fremde Eindringlinge sowie aus Frustration – genau wie der moderne Mensch. Die phylogenetischen Wurzeln der Gewalt könnten ein Primaten und Menschen gemeinsames Muster gewaltsamen Verhaltens erklären, das durch «transformierte Aggression», so die Bezeichnung der Autoren, aktiviert werde. Auf diese Weise lasse sich auch Krieg zwischen modernen Nationen erklären.[36]
Als Bowlby und Durbin ihr Buch veröffentlichten, hatte Konrad Lorenz, ein österreichischer Zoologe, mit seinen Untersuchungen zum Instinktverhalten von Graugänsen bereits einen neuen Zweig der Biologie auf den Weg gebracht, der sich dem Verstehen tierischen Verhaltens widmete und fachsprachlich als Ethologie bezeichnet wird. Lorenz hatte zwar kein großes Interesse daran, das Phänomen Krieg zu erklären, doch seine Tierstudien weiteten sich zu Untersuchungen über die Naturgeschichte der Aggression aus. Wie Bowlby und Durbin konnte auch Lorenz dem Gedanken nicht widerstehen, dass die Aggression beim Menschen sowie das Gewalt- und Angriffsverhalten von Ratten und Tauben, dem er seine Untersuchungen gewidmet hatte, gemeinsame Wurzeln haben könnten. In seinem 1963 erstmals veröffentlichten Buch Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression, das eine große Breitenwirkung erzielte, argumentierte Lorenz, Krieg und andere «dumme und menschheits-schädliche» Aktivitäten ließen sich nicht allein durch Vernunft und kulturelle Traditionen erklären, sondern es handle sich auch um «phylogenetisch entstandene[s] instinktive[s] Verhalten», das tief in der evolutionären Vergangenheit wurzele.[37]
Die Ethologie bot einen potenziell neuen biologischen Ansatz für das Verständnis menschlicher Kriegführung, auch wenn diese neue Forschungsdisziplin sich wie die Evolutionsbiologie in erster Linie dem Verständnis tierischer Verhaltensweisen widmete. Auch wenn Das sogenannte Böse manchmal als Gründungstext für ein ethologisch begründetes Verständnis menschlicher Gewalt gilt, widmen sich die Analysen von Lorenz fast gänzlich der Erklärung aggressiven Tierverhaltens sowie den Hemmungsmechanismen, die dessen ungezügelten Einsatz gegen Mitglieder derselben Art verhindern. Seine gelegentlichen Kommentare zur menschlichen Kriegführung waren so peripher und oberflächlich wie die entsprechenden Bemerkungen Darwins. Lorenz vermutete, für frühmenschliche Gemeinschaften sei der «Gegendruck der feindlichen Nachbarhorden zum wichtigsten Selektionsfaktor für die nächsten Schritte der menschlichen Evolution» geworden. Die Menschen, so seine These, ähnelten bei der Verteidigung der artverwandten Gruppe mit ihrer «instinktiven Zielstrebigkeit» den Schimpansen – ein Verhalten, das «hohen Überlebenswert» für jeden entwickelten Stamm der Menschheit gehabt habe und noch in der modernen Welt evident sei.[38] Doch außer seinem Bedauern über die schiere Irrationalität des Krieges hatte Lorenz kaum etwas zum Verständnis seiner Ursprünge beizutragen. Er teilte die Ansicht, dass Krieg von Grund auf artgefährdend sei, doch er war auch ein überzeugter Unterstützer von Hitlers eugenischer Politik – der Ausmerzung «entarteter» Elemente der deutschen Bevölkerung –, um das biologische Überleben der arischen Rasse sicherzustellen, und vertrat diese Ansichten auch noch lange nach 1945.[39]
In den 1960er Jahren konzentrierten sich Ethologen vor allem darauf, Tierverhalten zu erklären. Doch diverse Hinweise darauf, dass menschliches Verhalten dem von Tieren entspreche, vor allem dem der höheren Primaten, hielten die in den 1930er Jahren begonnene Suche nach einem Verbindungsglied zwischen tierischer und menschlicher Aggression weiterhin in Gang. Es blieb jedoch ein schwieriges Unterfangen, Verbindungen zwischen tierischem Verhalten in freier Wildbahn und der Welt der Menschen überzeugend aufzuzeigen. Zwei ethologische Pioniere, die passenderweise Lionel Tiger und Robin Fox hießen, argumentierten, dass im Gehirn der modernen Menschen noch urtümliche Züge in Form von «Codes und Botschaften» enthalten seien, die schwer zu lesen, aber gleichwohl vermutlich noch wirksam seien.[40] Das war bestenfalls eine dürftige Schlussfolgerung. In der Praxis widmeten Ethologen und Zoologen fast ihre gesamte Forschung dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen tierischem Verhalten und der jeweiligen ökologischen Nische, in der die betreffenden Tiere lebten, näherzukommen. Die vielen unterschiedlichen Manifestationen von Aggression zu verstehen, war nur ein kleiner Bestandteil solcher Untersuchungen. Es überwog die Untersuchung eines weiten Spektrums von Verhaltensweisen, die mit Gewalt kaum etwas zu tun hatten.
Die systematische wissenschaftliche Untersuchung von Tieren in freier Wildbahn statt unter Laborbedingungen verbreitete sich erst in den 1950er Jahren. Zum Thema Aggression wurden in der ethologischen Literatur bestimmte Tierarten regelmäßig herangezogen, die sich innerartlich gewalttätig verhielten und somit potenzielle Analogien zu menschlichen Gesellschaften und zum «Krieg» boten. Dazu zählten Feigenwespen, bei denen sich die Drohnen bis zum Tode bekämpfen, um Zugang zu den Königinnen zu erlangen, oder Honigtopfameisen, die Feldschlachten gegeneinander führen und die Unterlegenen versklaven. Niko Tinbergen, ein Kollege von Lorenz und ebenfalls Pionier der Ethologie, bevorzugte für seine Untersuchungen Stichlinge, bei denen die Männchen Rivalen bekämpfen, um Zugang zu den Weibchen zu erhalten, eine funktionale Anpassung, die das Überleben der Spezies sichert – ähnlich wie die Anpassungen, die Menschen seiner Meinung nach in der evolutionären Vergangenheit ihrer Spezies vorgenommen hatten.[41] Neben diesen wurden noch viele andere Beispiele gefunden, die belegen, dass es in der Natur ein viel weiteres Spektrum innerartlicher Aggression gibt, als bisher angenommen; jedoch stand jeglicher Analogieschluss zur Welt des Menschen bestenfalls auf tönernen Füßen.
Um ihre Sache überzeugender darstellen zu können, zogen manche Biologen und Zoologen nun Beispiele aus dem Reich der sozialen Tierarten heran, um zu zeigen, wie sich bestimmte Sozialverhaltensweisen evolutionär entwickelt hatten: Gruppenaggression, Gruppenaltruismus oder gegenseitige Fürsorge in der Gruppe. Die Untersuchung von Gruppenselektion mit dem Ziel der Vererbung evolutionär erfolgreicher Merkmale erhielt nun als eigene Disziplin die Bezeichnung Soziobiologie, auch wenn sie viele Berührungspunkte mit der Ethologie hatte, da die meisten Soziobiologen nichtmenschliche Organismen untersuchten. Führender Theoretiker der Soziobiologie war der Harvard-Entomologe Edward Wilson, ein Spezialist für das Sozialverhalten von Ameisen und anderen Insekten. Auch in diesem Fall gab es jedoch die große Versuchung, das Sozialverhalten des Menschen ebenfalls aus dieser evolutionären Perspektive zu betrachten.
1975 veröffentlichte Wilson ein hoch umstrittenes Buch mit dem Titel Sociobiology: The New Synthesis; in Wahrheit war die neue Disziplin jedoch weit von einer solchen Synthese, einem Konsens entfernt. Denn erneut beschäftigte sich das Buch fast ausschließlich mit der Frage, wie sich das Sozialverhalten, vorrangig im Reich der Insekten, evolutionär entwickelt habe. Angehängt war ein Schlusskapitel über den Menschen, doch Wilsons These, die Menschen hätten Merkmale geerbt, die durch evolutionäre Anpassung entstanden seien, darunter auch das Aggressionsverhalten, stieß auf den entschlossenen Widerstand von Sozialwissenschaftlern und Anthropologen, die darin vor allem eine Form des biologischen Determinismus sahen. Soziale Handlungsweisen des Menschen, hieß es, würden von Kultur und Umwelt bestimmt.[42] Drei Jahre später veröffentlichte Wilson mit On Human Nature (Biologie als Schicksal. Die soziobiologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens) ein Buch, worin er seine soziobiologische Argumentation um ein ganzes Spektrum menschlicher Verhaltensweisen erweiterte, darunter auch Aggression. Provokant beschrieb Wilson das Aggressionsverhalten des Menschen als angeboren, auch wenn dessen praktische Ausübung von der Umwelt und von sozial Erlerntem geprägt sei.[43]
Die von Wilson provozierte Debatte über das ewige Ringen in der Natur zwischen Veranlagung und Umwelt (nature and nurture) hatte einen weitgehend politischen Kern. Wilsons Kollegen aus der Biologie und viele Nichtbiologen sahen in Wilsons Thesen einen genetischen Determinismus und eine Art Freibrief für rassische Diskriminierung und eugenische Politik, wie sie die Nazis im Dritten Reich verfolgt hatten. Um gegen solches Gedankengut zu mobilisieren, wurde unter der Ägide der linksorientierten Bewegung «Science for the People» («Wissenschaft für das Volk») eine Studiengruppe zu Soziobiologie gegründet. Wilson wurde eine Zeitlang zur Hassfigur des amerikanischen progressiven Meinungsspektrums. Bei einer akademischen Tagung im Jahr 1978 wurde er auf dem Podium von Mitgliedern des «Committee Against Racism» angegriffen, die einen Krug mit kaltem Wasser über seinem Kopf leerten – ein Zwischenfall, der Schlagzeilen produzierte.[44]
Trotzdem erhielt Wilson für On Human Nature den Pulitzer-Preis – ein Beleg dafür, dass das soziobiologische Projekt, für das Wilson stand, trotz aller Schmähungen nicht erledigt war. Denn eines der Schlüsselelemente in Darwins eigenen Schriften war gerade der Versuch, die Evolution soziobiologisch zu verstehen. Die moderne Verhaltensgenetik hat Wilson und seine Thesen beträchtlich entlastet, indem sie zeigen konnte, dass einige Eigenschaften in der Tat in hohem Maß erblich sind – darunter auch das Aggressionsverhalten. Wichtig war, dass die Soziobiologie (die schon bald in Verhaltensökologie umbenannt wurde, um das Konfliktpotenzial dieser neuen Disziplin etwas zu lindern) sich auf das Gruppenverhalten konzentrierte statt auf die individuelle, persönliche Aggression.[45] Krieg, wie auch immer man ihn definiert, wird von koalitionären Gruppen ausgetragen, nicht von Individuen, die auf eigene Faust handeln, und das ist bei Insekten nicht anders als beim Menschen. Über lange evolutionäre Zeitstrecken war Krieg, so kann man sagen, für den Menschen eine Möglichkeit, sich an ein Verhalten anzupassen, welches das Überlebenspotenzial maximal erhöhte.
Wie den frühen Ethologen fiel es auch den Soziobiologen schwer, das koalitionäre Aggressionsverhalten des Menschen anders zu erklären denn als überkommenes Element einer evolutionären Vergangenheit, die nicht genau zu rekonstruieren war. Seit den 1970er Jahren verfolgte man darum einen anderen Ansatz: Wie schon Keith in den 1930er Jahren bevorzugten die Ethologen nun Primatenstudien, wenn sie menschliches Aggressionsverhalten erklären wollten. Menschenaffen lebten wie die Urmenschen in losen Gruppen und sicherten ihre Existenz durch Nahrungssuche. Für alle Vergleiche mit Menschen kamen am ehesten die höheren Primaten in Betracht: Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Bonobos, auch Zwergschimpansen genannt (die erst in den 1920er Jahren als eigene Spezies identifiziert wurden). Diese Arten haben denselben Säugetierstammbaum wie die homininen Frühmenschen und weisen eine DNA-Übereinstimmung von 98 Prozent gegenüber dem Menschen auf.
Die konventionelle zoologische Annahme zu ihrem Verhalten hatte gelautet, dass Primaten kaum aggressiv seien und in losen, nicht klar definierten Gruppen zusammenlebten. Doch beide Annahmen erwiesen sich bei Langzeitbeobachtungen von Schimpansen in den zentralafrikanischen Wäldern als falsch. Solche Untersuchungen wurden von den 1960ern bis in die 1990er Jahre von der britischen Ethologin Jane Goodall und einem kleinen Forschungsteam durchgeführt. Die Schimpansen lebten in definierten, wenngleich flexiblen Gruppen zusammen und zeigten unter bestimmten Bedingungen extrem aggressives Verhalten. Goodalls Schlussfolgerungen wurden anfangs von Wissenschaftlern zurückgewiesen, die nicht akzeptieren wollten, dass Schimpansen eine ganze Reihe Emotionen, Gesten und Geschlechtsidentitäten mit den Menschen gemein hatten. Das ging so weit, dass man Goodall in einem Fall verbieten wollte, mit Bezug auf die einzelnen Mitglieder ihrer Schimpansengruppe von «er» oder «sie» zu sprechen; angebracht sei allein das sächliche Pronomen «es».[46]
Jahrelange Beobachtungen im Gombe-Nationalpark in Tansania bestätigten hingegen eindeutig, dass Schimpansen soziale Wesen waren und in Familiengruppen lebten, die von den älteren Männchen dominiert wurden. Sie hatten klar definierte Territorien, die sie gegen Eindringlinge verteidigten. Gelegentlich drangen jedoch Gruppen von Männchen und vereinzelte Weibchen in das Gebiet rivalisierender Gruppen ein, mit dem Ziel, ein einzelnes Tier aufzuspüren, es in einen Hinterhalt zu locken, mit Stöcken und Steinen auf das Opfer einzuschlagen und unter wilden Beißattacken zu töten. Als sich Goodalls Gruppe teilte, wurde die schwächere Gruppe von der stärkeren so lange überfallen, bis sie ausgelöscht war. Das Territorium der Opfer wurde von den Siegern übernommen, jedoch nur, bis noch stärkere Nachbarn auftauchten und die Sieger selbst zu Opfern wurden – ein geradezu lehrbuchmäßiges Beispiel für natürliche Selektion.[47]
Goodall war und ist die wichtigste Einzelquelle dafür, dass das Verhalten der Schimpansen durchaus analog sein könnte zum Verhalten frühmenschlicher Sammler. Goodall war allerdings nicht die Erste, die diese These vertrat. Es gab weitere Untersuchungen von Schimpansengruppen in Ost- und Westafrika: in Budongo und Kibale in Uganda, in Mahale in Tansania und in Taï in der Elfenbeinküste. Dort kam es seltener zu gewaltsamen Ausschreitungen als in Gombe. Im Wald von Kibale begann in den späten 1980er Jahren der britische Zoologe Richard Wrangham, der in Gombe mit Jane Goodall zusammengearbeitet hatte, mit der Beobachtung einer Schimpansengruppe, die letztlich eine ähnliche Ausrottung durch stärkere Nachbarn erfuhr wie die Schimpansen in Gombe. Es gab fünf Tote; wie sie zu Tode kamen, blieb meistens unbeobachtet. Die Gesamtzahl der Schimpansen, die in den frühen Jahrzehnten der Feldforschung durch Artgenossen getötet wurden, betrug lediglich zehn – sicher eine zu dürftige Grundlage für größere Theorien über die Gewalttätigkeit von Primaten.[48]
Gleichwohl wurde Wrangham zum führenden Vertreter der Theorie, dass es Gemeinsamkeiten gebe zwischen dem Verhalten von Schimpansen in freier Wildbahn und dem Verhalten, das die frühen menschlichen Jäger und Sammler an den Tag gelegt haben müssen, einschließlich gelegentlicher koalitionärer Gewalttaten. Schimpansen leben in Gruppen, deren Zusammensetzung sich jedoch verändern kann, wenn adoleszente Weibchen sich in andere Gruppen begeben oder große Gruppen in kleinere zerfallen. Schimpansen zeigen ein starkes Gruppengefühl, sie sind gesellig und verfügen über Mechanismen, um Gewalt innerhalb der eigenen Gruppe zu hemmen. Sie sind territoriale Tiere, wobei Grenzen nicht ausdrücklich markiert sind; aber die Bewohner auf beiden Seiten verstehen, dass die Grenze respektiert werden muss. Begegnen sich zwei Gruppen männlicher Schimpansen, die ungefähr gleich stark sind, werden lautstarke Rituale durchgeführt: Es wird gekreischt, gestikuliert, an Bäume gehämmert. Es kommt auch zu kurzen Angriffen mit sofortigem Rückzug, aber nicht zur offenen Schlacht. Harte Gewalt wird dagegen angewendet, wenn Eindringlinge im eigenen Territorium gestellt werden oder ein Überfallkommando in benachbartes Territorium vordringt – jedoch nur bei klarer Überzahl (meistens ist das Verhältnis bei Überfällen fünf oder sechs gegen einen). Am Ende kommt es gegenüber dem Opfer zur tödlichen Gewalt, während die Angreifer selbst keine oder nur geringfügige Wunden davontragen.[49]
All diese Merkmale lassen sich auch bei der anthropologischen Beobachtung moderner Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften feststellen. Auch sie bewohnen veränderliche Territorien ohne genau festgelegte Grenzen, in kleinen Verwandtschaftsgruppen, deren Populationen ebenfalls veränderlich sein können, wobei der Wandel meist durch den Austausch von Mitgliedern zustande kommt. Gruppenbindungen in Form von Zusammenarbeit und Geselligkeit sind erkennbar; diese hemmen das Ausmaß der Gewalt. Kommt es zu Gewalt zwischen Gruppen, sind rituelle Konfrontationen möglich, die zwar lautstark sind, aber kaum Schaden anrichten. Wie bei den Schimpansen ist der Überfall die häufigste Form von Gewaltanwendung. Außerdem trifft jeder Fremde, der in das Territorium einer Gruppe eindringt, auf kollektive Feindschaft. Überfälle werden von Männergruppen verübt und verlaufen in aller Regel asymmetrisch: gegen eine benachbarte Jagdgruppe oder ein kleines Lager von Sammlern. Das Risiko für die beteiligten Angreifer bleibt gering. In solchen Situationen kann es auch zu vernichtender, rasender Gewalt kommen.[50]
Es gibt oft zitierte Beispiele für mögliche Vergleiche zwischen Primaten und Menschen. Die Gewalt zwischen Clans auf den Andamanen-Inseln im Indischen Ozean ist ein solches Beispiel. Hier verüben benachbarte Gemeinschaften Überraschungsangriffe oder Hinterhalte, versuchen zu töten, ohne selbst Schaden zu nehmen, und ziehen sich anschließend wieder in ihr Heimatterritorium zurück. Weit im Norden Amerikas unternahmen arktische Stämme bis in die jüngste Vergangenheit Vernichtungsfeldzüge gegen Nachbardörfer und töteten dabei unterschiedslos Männer, Frauen und Kinder – eine Praxis, die Jahrtausende zurückreicht, wie archäologische Funde belegen.[51] Untersuchungen bei den Yanomami im oberen Amazonasbecken durch den Anthropologen Napoleon Chagnon werden oft gerade deshalb als Beispiel herangezogen, weil die Dörfer, die weitgehend aus Verwandtschaftsgruppen bestehen und für Spaltungen anfällig sind, wenn die Bewohnerzahl zu groß wird, regelmäßig mit Nachbarn kämpfen. Es handelt sich dabei um ritualisierte Konfrontationen zweier Kämpfer mit Äxten und Keulen, aber auch um Überfälle, wobei – wie bei den Schimpansen – eine kleine Gruppe von Männern versucht, einzelne Feinde zu töten oder eine Frau aus dem Dorf der Feinde zu entführen, ehe man sich ins eigene Dorf zurückzieht. Die Yanomami sind Gärtner, keine Sammler. Trotzdem wird behauptet, sie zeigten ein Verhalten, das auf den ersten Blick der Überfallstrategie der Schimpansen ähnele.[52]
Die unvermittelte Übertragung von Beobachtungen des Verhaltens von Schimpansen in freier Natur auf das Verhalten von Menschen hat offensichtlich ihre Grenzen. Zum einen weiß man wenig über vergangenes Verhalten der Schimpansen und über die Evolution ihres Verhaltens, sodass uns nur die Annahme bleibt, dass ihrem Verhalten ein Anpassungsdruck zugrunde liegt, über den man allerdings nur Vermutungen anstellen kann. Zum anderen ist auch nur wenig über das weite Spektrum der Jäger und Sammler in den vergangenen zwei Millionen Jahren bekannt. Eines aber ist sicher: Sie unterschieden sich stark von heutigen Jägern und Sammlern. Um zeigen zu können, dass kollektive Aggression bei Schimpansen und Menschen eine ebensolche Anpassungsfunktion hat wie Sozialität und Kooperation, müsste es irgendeine phylogenetische Wurzel für solches Verhalten geben, die bis auf den «letzten gemeinsamen Ahnen» von Schimpansen und Homininen zurückzuverfolgen ist, der, wie man annimmt, vor rund sechs Millionen Jahren lebte.
In neueren Forschungen zu den phylogenetischen Wurzeln innerartlicher Gewalt bei Säugetieren, also der Gewalt gegen Artgenossen, wurden Belege von 1024 Säugetierarten untersucht. Es kam heraus, dass tödliche Gewalt am ehesten bei sozialen und territorialen Tieren vorkam, am häufigsten bei Primaten. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass auch Menschen eine Neigung zur Gewalt geerbt haben, was ihre Position im phylogenetischen Stammbaum nahelegt. Das Niveau tödlicher Gewalt stieg mit dem Auftauchen sesshafter Gemeinschaften, von Stämmen, Häuptlingstümern und Staaten immer weiter an – was zeigt, wie sich das phylogenetische Erbe durch Veränderungen der sozialen und politischen Organisation wandeln kann.
Gewalttätiges Verhalten war jedoch, so die These, schon bei den frühesten Vorfahren des Menschen verbreitet, auf einem Niveau, das im Verhalten der Klade, zu der auch der Mensch gehört, regelmäßig anzutreffen war. In diesem Zweig der Säugetiere kam Gewalt sechsmal häufiger vor als in anderen.[53] Es wurde sogar die Ansicht vertreten, sowohl die Sozialität als auch das Gewaltverhalten gehe auf die frühen Ahnen der Primaten, der Affen wie der Menschen, zurück, speziell auf den Afropithecus, der vor rund 18 Millionen Jahren lebte. Träfe dies zu, ergäbe sich in der Tat eine phylogenetische Wurzel von außerordentlicher Tiefe.[54]
Jedoch ist auch diese Argumentation problematisch. Schimpansen greifen in freier Wildbahn – trotz der Beobachtungen von Goodall und anderen – nur selten zu tödlicher Gewalt. Aggressives Verhalten scheint in dieser Spezies nicht allgemeingültig zu sein; es gibt Gemeinschaften, die aggressiver sind als andere. Zwergschimpansen, dem Menschen ebenso nahe verwandt wie den Schimpansen, neigen innerhalb der eigenen Gemeinschaft wie auch im Verhältnis zu anderen Gruppen fast gar nicht zu aggressivem Verhalten. Die Rolle der Männchen ist dort gegenüber den Weibchen viel stärker untergeordnet als offenkundig bei den Menschen. Begrenzte Gewalt mag bei allen Primaten in Urzeiten phylogenetisch fest verwurzelt gewesen sein, doch seit rund zwei Millionen Jahren haben sich die Menschen deutlich anders entwickelt als andere Primaten. Das hat nicht zuletzt mit der Herausbildung eines wesentlich größeren und komplexeren Gehirns zu tun, woraus die Entwicklung einzigartiger kognitiver Fähigkeiten resultierte, wie etwa Sprache, Bewältigung früher Technologien und ein weites Spektrum von Kulturen.[55]
Die frühen Vormenschen hatten eine Gehirnmasse von rund 400 Kubikzentimetern, bei den frühen Homininen waren es 600 Kubikzentimeter und beim Homo sapiens sind es 1370 Kubikzentimeter. Die Großhirnrinde mag sich so entwickelt haben, dass sich dadurch die menschliche Überlebensfähigkeit vergrößerte und der Mensch bewusst «räuberische Gewalt» gegen nichtmenschliche Raubtiere einsetzen konnte, wie auch im Konkurrenzkampf mit anderen Menschen. Wer über ein größeres Gehirn verfügte, war wohl auch in der Lage, weniger gut angepasste Homininen in Randgebiete abzudrängen, wo deren Überlebenschancen massiv sanken.[56] Ob und in welchem Ausmaß diese herausgebildeten physiologischen Veränderungen koalitionäre Gewalt möglich oder gar wahrscheinlich machten, muss offenbleiben. Man kann darüber nur spekulieren. Wahrscheinlich handelte es sich um keine genaue Replik des Gewaltverhaltens bei Schimpansen und anderen Primaten. Genau das, was die menschliche Evolution von der Evolution enger Verwandter unter den Primaten unterscheidet, macht die These von der Kontinuität zwischen Schimpansen- und Menschenverhalten (einschließlich des Gewaltverhaltens) weitgehend unhaltbar. Schimpansen können auch nach Jahrmillionen der Evolution nur Stöcke und Steine benutzen, um Futter zu suchen oder in seltenen Fällen einen Nachbarn zu Tode zu prügeln. Die Menschen haben sich im selben Zeitraum so weiterentwickelt, dass ihr Waffenarsenal von Stöcken und Steinen bis zur Atombombe reicht.
Für die Möglichkeit, dass Gewaltanwendung gegen andere Menschengruppen positive Folgen für die menschliche Evolution hatte, kann man überzeugender argumentieren, wenn man zum klassischen Darwinismus zurückkehrt. Mit dem heutigen Wissen über die menschliche Evolution und Genetik – welches Darwin ja noch nicht zur Verfügung stand – hat die moderne Evolutionswissenschaft die These entwickelt, die Anpassung des Menschen sei im Überlebenskampf angesichts eines signifikanten ökologischen und umweltbedingten Drucks erfolgt. Eine dieser möglichen Anpassungen sei die Selektion für koalitionäre Gewalt gewesen – zur Verteidigung oder zum Angriff gegen andere Menschen. Wenn man die These so formuliert, müsste man in dieser Anpassung keinen Freibrief mehr für die Auslöschung der ganzen Spezies sehen, sondern man könnte in koalitionärer Gewalt eine Verbesserung der Überlebenschancen für bestimmte Menschengruppen sehen, die ihre eigene Verwandtschaft auf diese Weise beschützten und durch Beseitigung der Konkurrenz ihren Genpool verbreiteten.
Der Schlüsselbegriff wäre dann wie bei Darwin die Angepasstheit oder fitness. Beim Menschen ist dieser Ansatz etwas kompliziert, weil die meisten Homininen, von denen wir heute wissen, ausgestorben sind. Ihre Überlebenstauglichkeit war offenkundig relativ. Die Untersuchung des evolutionären Überlebens der Menschen muss sich daher notgedrungen auf die Fähigkeit des Homo sapiens konzentrieren, sich auf unterschiedliche Weise so gut anzupassen, dass er bislang sein Aussterben verhindern konnte. Inwieweit sich unsere homininen Vorfahren, solange sie existierten, an den Umweltdruck des Klimas, der Ressourcenkonkurrenz und des ökologischen Flusses anpassten, können wir nur vermuten – selbst bei Vorfahren, die Hunderttausende von Jahren überdauerten.
Wenn Gewaltanwendung zwischen Menschengruppen eine Möglichkeit war, sich an diesen vielfältigen Druck anzupassen, dann könnte man genauso gut die These vertreten, dass dieses Gewaltverhalten für kleinere, verwundbare Bevölkerungsgruppen von Nahrungssammlern eine Fehlanpassung war, da die demografischen Verluste diese Gruppen nämlich an einen für das Überleben kritischen Punkt führten. Das Rätselhafte am Menschen ist ja, dass das absichtliche Töten von Artgenossen so verbreitet war (und ist) – was für die Evolutionstheorie insofern eine große Herausforderung darstellt, als die Optimierung des Reproduktionserfolges bei allen Arten als wirksamste Triebfeder der Entwicklung gilt. Da bildet auch der Mensch keine Ausnahme. Sollte es also irgendeinen Bezug zwischen menschlichem Gewaltverhalten gegen andere Gruppen und einem evolutionären Überlebensvorteil geben, dann müsste gezeigt werden, dass die Selektion für gewaltsame Konflikte wirklich etwas zum Fortpflanzungserfolg des Menschen beitragen konnte.
Eine Möglichkeit, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, ist der Begriff der genetischen «Gesamtfitness» (inclusive fitness). Er wurde von dem jungen britischen Biologen William Hamilton geprägt, der 1964 zwei Aufsätze zur genetischen Evolution des Sozialverhaltens veröffentlichte. Hamilton hat deshalb mehr noch als Wilson Anspruch auf den Titel, Begründer der Soziobiologie gewesen zu sein (was Wilson selbst durchaus zugestand). Hamiltons Schlussfolgerungen spielen in der gegenwärtigen Diskussion zur Evolution des Menschen eine große Rolle, obgleich seine Beispiele aus dem Bereich der Ameisen, Bienen und Schmetterlinge kommen, nicht aus dem des modernen Menschen.[57] Ganz einfach formuliert bedeutet «Gesamtfitness», dass alle Artgenossen, die genetisch verwandt sind, selbst wenn es sich nur um entfernte Verwandtschaft handelt, zur genetischen Reproduktion der gesamten Verwandtschaftsgruppe beitragen.
Hamilton betonte die Rolle der individuellen Selektion bei der Maximierung der genetischen Anpassung für den Einzelnen und seine Verwandtschaft stärker als die der Gruppenselektion, obwohl individuelle Organismen auch in Gruppen zusammenarbeiten können. Wenn man dies auf die menschliche Evolution anwendet, dann könnte die «Gesamtfitness» sowohl die individuellen Anstrengungen erklären, das Überleben und den Fortpflanzungserfolg zu garantieren, als auch die hierfür erforderliche Gegenseitigkeit. In urzeitlichen menschlichen Gemeinschaften kooperierten Individuen, die eine Verwandtschaftsgruppe bildeten, auf der Grundlage von Gegenseitigkeit, um sich in ihrer jeweiligen Umwelt den maximalen Fortpflanzungserfolg zu sichern. Soziale Kooperation bei Bedrohungen für die Verwandtschaftsgruppe erhöhte die Vorteile für die betroffenen Individuen und verankerte die Gesamtfitness als evolutionären Plan für das Überleben.[58]
Die Individuen akzeptierten die Sozialität, weil diese ihre Überlebensvorteile stärkte: durch Zugriff auf gemeinsame Ressourcen, Schutz vor Räubern und Konkurrenten, besonders für weibliche Mitglieder der Gemeinschaft, und die Möglichkeit, den Nachwuchs langfristig zu ernähren. In Gruppen zu leben, um die Überlebenschancen zu vergrößern, war seit Beginn der menschlichen Erblinie mit großer Sicherheit typisch für menschliche Sammler (aber auch für viele andere Tiere), als Reaktion auf physische Bedrohungen und den Umweltdruck der Natur. Warum das allerdings zwingend zu stärkerer Konkurrenz und Konflikten zwischen individuellen Verwandtschaftsgruppen geführt haben soll, erfordert eine noch genauere Erklärung.
Wahrscheinlich war eine der Folgen des Zusammenlebens in Gruppen die Herausbildung einer Unterscheidung zwischen dem Verwandtschaftsnetzwerk und den anderen, die nicht dazugehörten. Ähnlich wie bei den Schimpansen müssen die prähistorischen Menschen auf Grundlage einer Unterscheidung zwischen «wir» und «nicht wir» auf andere reagiert haben. Manche Biologen gehen in ihren Erklärungsversuchen sogar so weit zu behaupten, dass die einen Menschengruppen die anderen wie fremdartige Lebewesen betrachtet und feindselig behandelt hätten – im Zuge eines Vorgangs der sogenannten «Pseudospeziation», einer künstlichen Artenabgrenzung. Diese Ab- und Ausgrenzung habe feindliches Konkurrenz- und Konfliktverhalten ermöglicht.[59] Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Wettbewerb um konzentrierte oder knappe Nahrungsressourcen ein Verhalten ermutigte, das als «Konkurrenzausschluss» bezeichnet wird: Eine Verwandtschaftsgruppe eliminiert oder reduziert eine benachbarte Gruppe, weil diese in der von ihr beanspruchten ökologischen Nische auf Nahrungssuche war.[60]
Wo Konkurrenz um Ressourcen oder Partner herrschte, konnte ein gewaltsamer Gruppenkonflikt Vorteile bei der evolutionären Anpassung mit sich bringen, sowohl für die beteiligten Individuen als auch für die Gruppe als Ganzes, zu der sie gehörten. In Gesellschaften, die mit ziemlicher Sicherheit auf Polygynie basierten, in denen also Männer jeweils mehrere Frauen begatteten, brachte ein Konflikt zwischen Gruppen auch noch die Möglichkeit mit sich, weitere Partnerinnen zu gewinnen und männliche Rivalen auszuschalten. Das Ziel solcher Aktionen war es, die genetische Gesamtfitness der eigenen Gruppe zu vergrößern, indem die Gene der Gruppe so weit wie möglich verbreitet wurden. Gleichzeitig wurde so die Gesamtfitness der konkurrierenden Gruppe verringert, was dann wiederum die Möglichkeiten der eigenen Fortpflanzung vergrößerte.[61]
In der Evolutionstheorie gilt, dass gewaltsame Konflikte nur dort vorkommen sollten, wo die Gewinne die Kosten (in Form von Toten oder Verletzten) deutlich übersteigen. Eine größere oder effizientere Gruppe würde also Außenseiter nur dann angreifen, wenn die Machtbalance sie begünstigt. Nur dann würde sich die Aussicht auf Gesamtfitness erhöhen – durch Verfügbarkeit von mehr Ressourcen und/oder Paarungspartnern. Eine evolutionäre Neigung zur Gewalt widerspricht nicht der Tatsache, dass auch menschliche Jäger und Sammler eine soziale Kooperation zwischen Gruppen pflegen und sogar Partner tauschen konnten. Dergleichen geschieht auch heute noch zwischen Stammesgesellschaften. Die Menschen scheinen flexibel reagiert zu haben, wenn es um die Wahl der Mittel zur Anpassung an die Überlebenserfordernisse ging. Über längere evolutionäre Zeiträume blieben sie flexibel in ihren Reaktionen auf die Herausforderungen, denen sie sich gegenübersahen. Gewalt und Kooperation sind hier keine Gegensätze, sondern zwei Elemente im evolutionären Werkzeugkasten, den die Homininen über Hunderttausende von Jahren hin entwickelten, um sich Überlebens- und Fortpflanzungsvorteile zu verschaffen.[62]





























