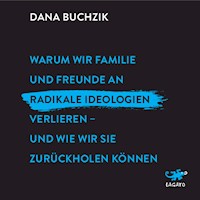
Warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren – und wie wir sie zurückholen können Hörbuch
Dana Buchzik
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lagato Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Querdenken-Demos, gewaltbereite Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker - immer mehr Menschen driften auf der Suche nach Halt und Orientierung aus der Mitte der Gesellschaft und finden beides in Chat-Gruppen, Internetforen und auf fragwürdigen Webseiten. Und immer häufiger wissen Freunde und Angehörige sich im Umgang mit Betroffenen nicht mehr zu helfen, fehlen Strategien, um miteinander im Kontakt und Gespräch zu bleiben. Wie können wir diesen Entwicklungen begegnen? Dana Buchzik wirft einen Blick auf die Psychologie, die hinter dem Abdriften in Parallelgesellschaften steht. Denn wenn wir verstehen, welche Mechanismen bei Radikalisierungsprozessen greifen, können wir ihnen aktiv entgegenwirken. Sie entwickelt konkrete Handlungsstrategien, wie jeder Einzelne den Kontakt zu Betroffenen aufrechterhalten und konfliktärmer gestalten kann und was darüber hinaus in der Bildungsarbeit, in Politik und Sozialwesen wichtig wird, wenn wir auch in Krisenzeiten als Gesellschaft bestehen wollen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dana Buchzik
Warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren – und wie wir sie zurückholen können
Über dieses Buch
Wir brauchen dieses Buch, um zu verstehen, was gerade passiert!
Querdenken-Demos, gewaltbereite Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker: Immer mehr Menschen driften auf der Suche nach Halt und Orientierung in radikale Ideen- und Vorstellungswelten ab, finden Antworten in Chat-Gruppen, Internetforen und auf fragwürdigen Webseiten. Immer häufiger wissen Angehörige und Freunde sich im Umgang mit Betroffenen nicht mehr zu helfen, fehlen Strategien, um im Kontakt und Gespräch zu bleiben. Wie können wir diesen Entwicklungen begegnen? Dana Buchzik erklärt die Psychologie hinter dieser Entfremdung, und sie zeigt Strategien auf, wie jeder Einzelne den Kontakt zu Betroffenen aufrechterhalten und konfliktärmer gestalten kann. Nur wenn wir verstehen, welche Mechanismen bei Radikalisierungsprozessen greifen, können wir ihnen auch aktiv entgegenwirken.
«Dana Buchzik hat das perfekte Buch für all jene geschrieben, die Radikalisierung verstehen wollen und für die es keine Option ist, geliebte Menschen aufzugeben.» Jagoda Marinić
«Dana Buchzik schreibt aus eigener Erfahrung, vor allem aber auf Augenhöhe für all diejenigen, die eine Welt voller Radikalisierungen und Verschwörungserzählungen verstehen und dagegen persönliche oder gesellschaftliche Strategien entwickeln wollen.» Johnny Haeusler
Vita
Dana Buchzik, geboren 1983, arbeitete als Kulturjournalistin u. a. für die Süddeutsche Zeitung, FAZ und ZEIT und war danach Redaktionsleiterin der deutschen «No Hate Speech»-Kampagne, eines Projekts des Europarats. Sie gibt Workshops zum Umgang mit Hass und Verschwörungserzählungen, lehrt an der Freien Universität Berlin zum Thema und berät ehrenamtlich Menschen, die in ihrem direkten Umfeld mit Radikalisierung konfrontiert sind.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Karin Schneider
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
ISBN 978-3-644-01137-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Wenn Aufgeben keine Option ist
April 2020: der erste Lockdown. Die Straßen waren wie leer gefegt, die Geschäfte geschlossen – und mein Postfach quoll über. Es waren vor allem junge Erwachsene, die mir schrieben und um Hilfe baten: Angehörige und Freunde, Nachbarn und Kollegen, die sie für besonnen und reflektiert gehalten hatten, teilten plötzlich in den sozialen Medien krude Verschwörungserzählungen und boykottierten alle Maßnahmen zur Pandemieeindämmung. Meine ehrenamtliche Kommunikationsberatung für Menschen, die im direkten Umfeld Radikalisierung erleben, war erst im Januar gestartet; das Thema Radikalisierung aber begleitet mich bereits ein Leben lang. Ich wurde in eine Sekte hineingeboren und habe mich schon als Kind zum ersten Mal gefragt, wie und warum Radikalisierung funktioniert, auch wenn ich das Wort damals natürlich noch nicht kannte. Ich wollte verstehen, was den Zauber radikaler Ideologien ausmacht und wie er gebrochen werden kann. Je älter ich wurde, desto schmerzhafter stellte sich mir die Frage, warum sich weder Politik noch Mehrheitsgesellschaft dafür interessierten, was tagtäglich in radikalen Parallelgesellschaften passiert. Warum es so oft nicht Ermittlern oder Jugendämtern, sondern Journalisten zu verdanken war, wenn Scharlatanerie, Finanzbetrug oder Kindesmissbrauch aufgedeckt wurden. Warum es zum Thema Sekten vor allem kitschige Autobiografien zu lesen gab und keine Sachbücher, die erklärten, wie Manipulation funktioniert und wie man sich gegen sie wappnen kann. Um es mit den Worten der Sektenexpertin Ursula Caberta zu sagen: «Wir schützen die Menschen heute besser vor Gammelfleisch als vor denen, die es auf ihre Psyche abgesehen haben.»[1]
Im Frühjahr 2020 war ich seit knapp acht Jahren Journalistin. Ich hatte die Redaktion der «No Hate Speech»-Kampagne geleitet, der deutschen Sektion eines Europaratprojekts, und hielt Seminare zum Umgang mit Online-Hass und Verschwörungserzählungen. Ich hatte Tausende Seiten wissenschaftlicher Literatur über Radikalisierung verschlungen – und mich damit abgefunden, dass das Thema für die Gesellschaft nicht wirklich relevant war. Die Nachrichten aber, die mich erreichten, weckten Hoffnung in mir. Plötzlich stellten auch andere die Fragen, die mich seit so langer Zeit begleiteten: Welche kommunikativen Techniken helfen uns dabei, radikale Menschen wirklich zu erreichen? Wie können wir sie dabei unterstützen, aus einer radikalen Gruppe auszubrechen? Wie können wir im besten Fall von vornherein verhindern, dass sie in Parallelgesellschaften abdriften und nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Kindern, ihren Angehörigen, ihren Freunden schaden?
Viele der Menschen, die mich kontaktierten, wussten entweder nichts von den Beratungsangeboten, die es im deutschsprachigen Raum gibt, oder hatten ihr Glück versucht, waren aber mit hohlen Phrasen abgespeist worden. Manche hatten in Zeitungsartikeln oder Social-Media-Beiträgen gelesen, dass sie «Gegenrede» betreiben müssten; ihre Erfahrung zeigte aber, dass Gegenrede alles nur schlimmer machte. Andere hatten in Buchläden und Bibliotheken nach praxisorientierten Hilfestellungen gesucht, aber nur historische Rückblicke oder kulturpessimistische Gesellschaftsanalysen gefunden, die Radikalisierung als Überforderungssymptom in einer globalisierten Welt relativierten.
Ich wollte nicht mehr darauf warten, dass jemand ein Buch veröffentlicht, das eine Brücke zwischen Erkenntnissen der internationalen Radikalisierungsforschung und konkreten, anwendbaren Strategien für den Alltag schlägt. Also habe ich über die Manipulationsstrategien radikaler Missionare geschrieben, über toxische Gruppendynamiken und die Illusion radikaler Heldenreisen. Über die Psychologie hinter dem Abdriften in Parallelgesellschaften und die gesellschaftlichen Nährböden für Radikalisierung. Darüber, wie wir den Kontakt zu radikalen Personen im direkten Umfeld aufrechterhalten und konfliktärmer gestalten können. Und was in Politik und Sozialwesen wichtig wird, wenn wir auch in Krisenzeiten bestehen wollen – als Familie, als Freundeskreis, als Kollegium und als Gesellschaft. Schön, dass Sie da sind. Packen wir’s an.
IRadikal sind immer die anderen
In jedem anderen Jahr wäre der Begriff «Radikalisierung» für Terrorismus reserviert geblieben. In jedem anderen Jahr hätten die meisten Menschen nur herzlich gelacht, wenn sich ein ehemaliger Berufspokerspieler bei seinem Engagement für «die Wahrheit» in der Tradition Martin Luthers verortet oder wenn Zehntausende fest davon überzeugt sind, dass Bill Gates, Mobilfunkmasten oder außerirdische Vampire für eine globale Pandemie verantwortlich sind. Über eine 22-jährige Studentin, die von ihrem Erlebnis, eine Versammlung anzumelden, so beflügelt ist, dass sie sich kurzerhand mit Sophie Scholl vergleicht, oder über ein elfjähriges Mädchen, das ernsthaft verkündet, es habe sich wie Anne Frank gefühlt, als es seinen Geburtstag leise feiern musste, hätten sie nur den Kopf geschüttelt. Es ist verlockend einfach, solche Menschen zu verspotten und sie für ungebildet, dumm oder gar psychisch krank zu erklären. Es ist ein großer Luxus, sich von einem gesamtgesellschaftlichen Problem nicht gemeint zu fühlen und sich einzureden, dass man selbst oder das eigene Umfeld «so einen Blödsinn» niemals glauben würde.
Das Jahr 2020 hat vielen von uns diesen Luxus genommen. Es waren nicht mehr «die anderen», sondern unsere Onkel und Cousinen, Mütter und Söhne, Nachbarinnen und gute Freunde, die unter dem Motto «Querdenken» auf die Straße gingen. Die neben polizeibekannten Rechtsextremen und unter wehenden Reichskriegsflaggen marschierten. Die Wissenschaft und Politik ausnahmslos als korrupt aburteilten. Die Straflager oder gleich den Tod für Virologen, Journalisten und Regierungsmitglieder forderten. Das monatelange kollektive Staunen darüber, dass «ganz normale» Menschen mit ihren Kindern unter wehenden Reichskriegsflaggen herliefen und es irgendwie nie mitbekamen, wenn nicht nur Friedensgebete, sondern auch Holocaust-Leugnung und Mordfantasien gegen Politiker aus den Lautsprechern schallten, sprach Bände. Überraschung: Auch gut situierte Bürger können menschenfeindliche Ideologien hegen! Auch Demokratieverächterinnen haben Kinder! Auch Menschen, die Gewalt predigen, halten sich für Botschafter der Liebe!
In den ersten Pandemiemonaten rätselten Politik und Medien über den wundersamen Kitt, der so «plötzlich» diese «unerwarteten» Allianzen möglich machte, statt auch nur einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen: Schon im 19. Jahrhundert instrumentalisierten Rechte erfolgreich die breite Front, die sich gegen Bismarcks Pocken-Impfpflicht gebildet hatte. Die Angst davor, sich gezielt mit Kuhpocken infizieren zu lassen, wurde durch wilde Verschwörungsmythen und antisemitische Stereotype befeuert: Geimpfte Menschen würden sich in Kühe verwandeln,[1] hieß es, und das «Einimpfen von Krankheiten» sei eine jüdische Erfindung. Später hetzten die Nationalsozialisten gegen die angeblich «verjudete Schulmedizin».[2] Die rechtsextremistische Überzeugung, dass in einer «naturgegebenen» Ordnung nicht jedes Leben gleich viel wert sei und bei feindlichen Angriffen – ob von Menschen oder Viren – immer «die Weißen» als Sieger hervorgehen würden, war in Teilen der Esoterikszene durchaus anschlussfähig: Denken wir etwa an Helena Petrovna Blavatsky, die Ende des 19. Jahrhunderts eine esoterische Geheimlehre rund um «Wurzelrassen» entwickelte, deren höchste Stufe angeblich die «germanische Rasse» darstellte.[3] Zu den Abspaltungen der von Blavatsky mitgegründeten Theosophischen Gesellschaft gehört auch die Anthroposophie, ins Leben gerufen von Impfgegner Rudolf Steiner, der unter anderem der Überzeugung war, dass das Judentum «keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens» habe und seine Erhaltung «ein Fehler der Weltgeschichte» gewesen sei.[4] Steiner sah die Demokratie als Werk dunkler Mächte, gesteuert von den «Finanzleuten» beziehungsweise dem «Großkapitalismus»[5]: ein klassischer antisemitischer Verschwörungsmythos. Politiker waren in seinen Augen ebenso wie Journalisten chronische Lügner[6] – Überzeugungen, die auch heutige Impfgegner pflegen. Auch in der jüngeren Vergangenheit, im Jahr 2019, haben Impfgegner gemeinsam mit Rechtsextremisten, Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen demonstriert – vereint in der Empörung über die Impfpflicht gegen Masern.[7]
Repräsentative wissenschaftliche Erkenntnisse über Querdenker sind bislang Mangelware. Es liegen nur erste kleinere Studien sowie Erkenntnisse des Verfassungsschutzes vor: Analysen der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, Analysen öffentlicher Äußerungen in einschlägigen Telegram-Kanälen sowie Befragungen von Maßnahmenkritikern und Querdenkern. Die bisherige Datenlage liefert einen ersten Aufschluss über ihren Hintergrund, gerade die Befragungen müssen allerdings mit Vorsicht betrachtet werden: Jede radikale Bewegung hat ein Interesse daran, sich so positiv wie möglich darzustellen. Es wäre daher möglich, dass sich vor allem Personen mit hohem Bildungsgrad und einer Zugehörigkeit zu oberen sozialen Schichten an den Befragungen beteiligt haben oder dass bewusst beschönigt oder auch gelogen wurde. Gerade wenn evidenzbasierte Wissenschaft angezweifelt oder gar als Feindbild konstruiert wird, ist die Hemmschwelle vermutlich sehr niedrig, Vertretern ebendieser Wissenschaft die Unwahrheit zu sagen. Während die COSMO-Studie zur Impfbereitschaft der Menschen in Deutschland[8] zeigt, dass Ungeimpfte eher einen niedrigeren Bildungsgrad haben und häufiger arbeitslos sind, zeichnen die Befragungen von Querdenken-Demonstranten ein anderes Bild: Sowohl der Anteil an Akademikern (34 Prozent im Vergleich zu 18,5 Prozent in der deutschen Gesamtbevölkerung) als auch der Anteil an Angehörigen der Mittelschicht (über 66 Prozent im Vergleich zu 47,5 Prozent in der Gesamtbevölkerung)[9] scheint überdurchschnittlich hoch zu sein. Ein Spektrum des Bürgertums, in dem radikale Ideen nicht unbedingt erwartet werden. Ob diese Zahlen nun die Realität abbilden oder nicht: Wer viele Privilegien hat, läuft tatsächlich eher Gefahr, sich zu radikalisieren.[10] Er bringt nicht nur zeitliche und finanzielle Ressourcen mit, um sich ausgiebig seiner Idee des «Widerstands» zu widmen, täglich stundenlang im Netz zu diskutieren und alle paar Wochen quer durch die Republik zur nächsten Querdenken-Demonstration zu reisen, sondern er ist auch daran gewöhnt, von Politik und Gesellschaft gesehen und gehört zu werden. Im Zweifelsfall ist er davon überzeugt – oder lässt sich gern überzeugen –, dass seine persönlichen Bedürfnisse wichtiger seien als die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens und dass er das Zeug dazu habe, die Welt für immer zu verändern.
2020 ist offensichtlich geworden, dass Radikalisierung kein Problem ist, das nur «Außenseiter» oder «Abgehängte» betrifft – und dass sie in den meisten Fällen lange vor der Pandemie begonnen hat. Das spiegelten auch die Anfragen wider, die mich im ersten Frühjahr der Pandemie erreichten: Die Künstlerin, deren Expartner vom Antifaschisten zum Reichsbürger geworden war. Die Schülerin, deren Mutter ihr von klein auf so viele Schauermärchen über «Schulmediziner» erzählt hatte, dass sie panische Angst vor Ärzten entwickelt hatte und selbst vor Routineuntersuchungen nicht mehr schlafen konnte, weil ein Teil von ihr tatsächlich glaubte, bei dem Termin sterben zu müssen. Der Student, dessen Mutter ihn zu verstoßen drohte, weil er nicht an QAnon-Verschwörungsmythen glauben wollte. Die junge Medizinerin, deren Familie sie als Handlangerin der Pharmaindustrie beschimpfte. Der Literaturwissenschaftler, der von seinem kleinen Neffen förmlich angefleht wurde, ihm Lesen beizubringen: Die Mutter hatte ihn in eine private Schule geschickt, wo Basteln und Waldspaziergänge wichtiger waren. Später steckte sie mehrere Besucher ihrer «maskenfreien» Yogakurse mit Covid-19 an, verbrachte ihre Quarantäne damit, die WhatsApp-Gruppe der Familie mit Querdenker-Parolen zu fluten, und deklarierte schließlich ihr Long Covid als psychosomatischen Stress aufgrund der vielen «Schlafschafe» in ihrer Umgebung. In allen Fällen, die ich in meiner Beratung erlebt habe, gab es schon Jahre vor der Pandemie erste Warnzeichen. Das direkte Umfeld aber hatte diese Signale als harmlose Exzentrik oder als Ausdruck einer schwierigen Phase abgetan, als etwas, das sich irgendwann von selbst erledigen würde. Dass ihre Verwandten oder Freunde radikal sein könnten, hätten sie nie für möglich gehalten – nicht zuletzt, weil der Begriff «Radikalisierung» immer wieder von Politik und Medien verzerrt wird.
Politische Definitionen werden der Realität nicht gerecht
Für Regierungen gilt Radikalisierung gemeinhin erst als problematisch, wenn organisierte Gruppen Straftaten begehen und die Schlagzeilen füllen. Die internationale Radikalisierungsforschung erlebte Sternstunden der Förderung vor allem dann, wenn Attentate verübt worden waren: nach den Flugzeugentführungen in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren, nach dem 11. September 2001 und nach dem Ausruf des Kalifats durch den selbsternannten Islamischen Staat (IS) im Jahr 2014. Forschung zu Verschwörungsmythen, Impfgegnerschaft, Wissenschaftsfeindlichkeit, Sekten und Scharlatanen hingegen geriet viel zu oft ins Hintertreffen. Ein Fokus auf Akteure, die unsere staatliche Ordnung gewaltsam zerstören wollen, ist richtig und wichtig. Eine alleinige Fixierung auf diese Akteure aber verstellt den Blick darauf, dass das Phänomen Radikalisierung auch Menschen einschließt, die niemals Gewalt ausüben würden.
Im eigentlichen Wortsinn nämlich bedeutet «radikal» nichts Schlechtes. Der Begriff ist vom lateinischen «radix» für «Wurzel» abgeleitet: Wer radikal ist, will an Problemen nicht oberflächlich herumdoktern, sondern sie nachhaltig lösen, sie «mit der Wurzel» aus dem Boden reißen. Auch der Einsatz gegen Sklaverei oder für ein Frauenwahlrecht war radikal und – zu seiner Zeit – extrem: Die Ziele standen im Konflikt mit der Norm setzenden Mehrheit. Die Mehrheitsmeinung ist aber, wie die Geschichte zeigt, nicht in Stein gemeißelt. Denken wir etwa an die Themen Klima und Umwelt: 2020 wünschten sich 63 Prozent der Deutschen, dass die Covid-19-Konjunkturmaßnahmen auch dem Klimaschutz zugutekämen;[1] 74,5 Prozent zeigten sich dazu bereit, ihr Verhalten zugunsten des Klima- und Umweltschutzes zu verändern.[2] Einige konservative und rechtspopulistische Politiker aber beharren nach wie vor darauf, dass Klimaschutz ein Nischenthema sei. Sie unterstellen der Aktivistin Greta Thunberg und Fridays for Future eine «Ideologie», die mit Demokratie nichts zu tun hätte, sondern «extremistisch» sei. So versuchen sie nicht nur, eine wissenschaftlich fundierte Argumentation als eines von vielen möglichen Wertesystemen abzutun, sondern verzerren Klimaschutz auch als potenziell gewaltbereite Abkehr vom gesellschaftlichen Konsens.
Der Verfassungsschutz sieht Extremismus als ein Verhalten an, das «auf eine Beeinträchtigung oder Beseitigung des staatlichen Grundgefüges» hinauslaufe.[3] Unterschieden wird hier zwischen der im Rahmen der Meinungsfreiheit rechtlich zulässigen radikalen Meinung und einem die Grenze des Zulässigen überschreitenden extremistischen Verhalten: Wenn also jemand öffentlich kundtut, dass er die Demokratie für ein gescheitertes oder gefährliches System hält, gilt er als «radikal». Solange er aber nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreitet und die Gesetze ebendieser Demokratie befolgt, bleiben solche Bekundungen folgenlos: «Das Grundgesetz kennt nur die Pflicht zur Gesetzestreue, nicht aber eine Werteloyalität»,[4] heißt es auf der Website des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Erst wenn eine Person mit radikalen Überzeugungen das Gesetz bricht und die Demokratie aktiv gefährdet, gilt sie als extremistisch.
In diesem Spannungsfeld von «unproblematischen», weil gesetzeskonformen, radikalen Überzeugungen, und gefährlichem, weil demokratiefeindlichem, Extremismus fallen einige Akteure und Gruppierungen durch das Raster: selbsternannte Wunderheiler etwa, die schwere Krankheiten mit nicht evidenzbasierten Methoden behandeln, werden vor Gericht immer wieder freigesprochen, obwohl Menschen, die bei ihnen Hilfe gesucht haben, gestorben sind. Wer Misstrauen in die «Schulmedizin» schürt, um Menschen teure «Heil»methoden zu verkaufen, kann sich immer auf den freien Willen seiner Opfer berufen und gilt im Zweifelsfall als gesetzestreu. Das macht solche Akteure aber nicht weniger gefährlich. Auch Fälle rassistischer und rechter Gewalt, die von Vertretern der Sicherheitsbehörden ausgeht, scheinen in einer Lesart von Extremismus, die nur auf «eine Beeinträchtigung oder Beseitigung des staatlichen Grundgefüges» abzielt, nicht konsequent mitgedacht zu sein, auch wenn sie eindeutig strafbar sind.
Für den Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge ist Extremismus «ein völlig inhaltsleerer Kampfbegriff», der letztlich «als Diffamierungsinstrument gegenüber der politischen Linken fungiert».[5] Auch sein Kollege Claus Leggewie betont, dass sich der deutsche Verfassungsschutz in den ersten Jahren nach seiner Einrichtung im Jahr 1950 vor allem auf linke Strömungen und Parteien konzentriert habe; selbst Vertreter der Grünen galten anfangs als potenzielle Extremisten.[6] Auf dem rechten Auge hingegen scheint der Verfassungsschutz bisweilen an Sehschwäche zu leiden: Bis zur Selbstenttarnung der rechtsextremen Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) etwa wurde behauptet, dass es in Deutschland keine rechten terroristischen Organisationsstrukturen gebe, und für den Fall, dass es doch welche gäbe, würde es sich um eine «braune RAF» handeln.[7] Klar: Rechte Gewalt hat in Deutschland keine Tradition, sie kann also nur von den Linken kopiert sein.
Auch die Querdenken-Bewegung wurde vom Verfassungsschutz trotz der regen Beteiligung von Rechtsextremen und Reichsbürgern an ihren Demonstrationen, trotz wehender Reichskriegsflaggen, Hitler-Gruß und antisemitischer Verschwörungsparolen[8] als noch nie dagewesene Spielart der Radikalisierung präsentiert, als Extremismus «sui generis». Sicher: Was neu ist, hätte niemand kommen sehen können. Was neu ist, könnte eine kurzlebige Erscheinung sein, eine radikale Mode, die sich nach einer Saison wieder erledigt hat. Er habe die Hoffnung, «dass diese Bewegung mit ihren Verschwörungstheorien nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder in den Hintergrund verschwindet»,[9] äußerte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang in einem Interview im Dezember 2020, also wenige Monate, nachdem eine Reichsbürgerin in Berlin Hunderte Menschen erfolgreich dazu aufgerufen hatte, die Treppe des Bundestags zu stürmen, und nur wenige Wochen nach der Explosion eines Sprengsatzes vor der Berliner Leibniz-Gemeinschaft und einem Brandanschlag auf das Robert Koch-Institut. Erst Ende April des folgenden Jahres war man im Bundesamt so weit, eine Beobachtung der Querdenker-Szene auszurufen.
Wie Medien und Deradikalisierungs«experten» das Bild von Radikalisierung verzerren
Nicht nur in der Politik, sondern auch in der journalistischen Berichterstattung sind ausgewogene Wortmeldungen zu Radikalisierung Mangelware. Die mediale Debatte nimmt nur selten Menschen in den Blick, die am Anfang eines Radikalisierungsprozesses stehen. Stattdessen werden Extremfälle präsentiert, die sich in folgende drei Typen einteilen lassen: der Teufel in Menschengestalt (Charles Manson oder Beate Zschäpe), der Abgehängte (die Attentäter von Halle und Hanau) oder der Peinliche (Michael Wendler oder Tom Cruise). Es werden Geschichten erzählt, die entweder schockieren oder zu Spott und Hohn einladen. Diese Art der Berichterstattung befriedigt Sensationslust, erfüllt für das Publikum aber auch andere Funktionen. Erstens: Freispruch von jeder Verantwortung. Wie sollte die Leserin strukturelle Probleme wie Armut oder Bildungsungleichheit lösen? Was könnte der Fernsehzuschauer psychischen Erkrankungen seiner Mitmenschen entgegensetzen? Und überhaupt, was gehen ihn die Spleens peinlicher Promis an? Zweitens: Angstabwehr. Wer radikal ist, kann nicht der gesellschaftlichen Mitte angehören, sondern muss ein fehlgeleitetes Individuum sein, das schnellstmöglich zu identifizieren und sozial auszuschließen ist – Problem gelöst! Wir selbst würden uns von radikalen Missionaren natürlich niemals täuschen lassen …
Solange Medien Radikalität vor allem als Phänomen einzelner «Abweichler» präsentieren, bleibt das eigentliche Problem unbeachtet: die Tatsache, dass sich Radikale und selbst extremistische Gewalttäter eben nicht von uns unterscheiden. Ein Beispiel: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden ranghohe Nationalsozialisten von einem Psychologen der Alliierten befragt. In seinem Gutachten war von «gewalttätigen, machthungrigen Persönlichkeiten» die Rede, «die vom Tod besessen waren und denen jedes echte menschliche Gefühl» fehlte.[1] Jahre später wurden die Resultate seines Gutachtens mit den Testergebnissen amerikanischer Bürger verglichen, und es stellte sich heraus, dass die nationalsozialistischen Täter weder psychisch kränker noch instabiler gewesen waren als der US-amerikanische Durchschnittsbürger. Der Psychologe der Alliierten ging vermutlich einem Phänomen namens Attributionsfehler auf den Leim, erklärt der Kriminologe Andrew Silke: «Wenn Menschen extrem und gewalttätig handeln, neigen wir dazu, anzunehmen, dass ihre Persönlichkeit ähnlich extrem und abweichend sein muss. Und dann tendieren wir dazu, sämtliche verfügbaren Hinweise an unsere Annahmen anzupassen.»[2]
Die internationale Radikalisierungsforschung belegt seit Jahren, dass Terroristen – genau wie die ranghohen Täter im Nationalsozialismus – weder ungebildet noch psychisch auffällig sind, weder ärmer als der gesellschaftliche Durchschnitt noch sozial randständig. Viele von ihnen sind vor ihren Gewalttaten beruflich etabliert und anerkannt gewesen.[3] «Terrorismus ist das Ergebnis eines schrittweisen Radikalisierungsprozesses, der ganz ‹normalen› Menschen passieren kann»,[4] hält ein Forschungsteam um den Psychologen und Politikwissenschaftler Bertjan Doosje fest: Es gibt kein typisches psychologisches Profil des Terroristen oder des Radikalen.
Trotzdem bedienen immer wieder Journalisten und sogar Deradikalisierungs«experten» das Klischee, dass mit der Psyche radikaler Menschen etwas nicht stimmen könne. Radikale als labil und krank abzutun, befeuert die sinnlose Stigmatisierung psychisch Erkrankter und unterstützt das in den allermeisten Fällen sachlich falsche Narrativ eines Außenseiters und «Abweichlers», der in seiner Isolation auf wirre Gedanken kommt und aus dem buchstäblichen Nichts einen Anschlag verübt.
Wenn terroristische Netzwerke über Jahre ungestört wachsen und sich professionalisieren können, liegt der Vorwurf politischen und polizeilichen Versagens nahe. Wenn es sich aber um ein vollkommen neues Phänomen handelt, für das noch keine Früherkennungssysteme existieren, oder wenn ein im Alltag unauffälliger Einzeltäter nicht rechtzeitig identifiziert werden konnte, hat außer dem Täter natürlich niemand etwas falsch gemacht, schon gar nicht die Politik.
Der «Einzeltäter»: Ein bequemer Mythos
Der westliche Blick auf die Welt rückt traditionell gern Einzelfiguren in den Vordergrund. Wenn aber beispielsweise die Überwindung der Sklaverei ausschließlich Abraham Lincoln oder der Zweite Weltkrieg nur Adolf Hitler zugeschrieben wird, kommt, wie die Psychologen Clark McCauley und Sophia Moskalenko in ihrem Buch Friction erklären, die Komplexität historischer (und gegenwärtiger) Tatsachen zu kurz.[1] Ganz gleich, ob wir jemanden als Helden oder als Teufel in Menschengestalt präsentieren: die Erzählstrategie ist dieselbe – und auch ihr Effekt. Wer Einzelpersonen aus der Gesellschaft heraushebt, spricht ebendiese von jeder Pflicht zum Handeln, jeder Verantwortung und jeder Schuld frei. Obwohl Einzeltäter derart selten sind, dass sie laut Extremismusforscher Bart Schuurman eher «Anomalien» darstellen,[2] wurde Attentätern in den vergangenen Jahren immer wieder bescheinigt, sich ohne Netzwerkanbindung radikalisiert zu haben; in der medialen Debatte ließ sich förmlich die Uhr danach stellen, wann der nächste «Zeuge» zitiert wurde, der den jeweiligen Täter als Eigenbrötler beschrieb – «Die Rollläden waren immer unten!», «Die Nachbarn hat er nie gegrüßt!» –, der sich in aller Einsamkeit im Netz die Informationen zusammensuchte, die er für sein teuflisches Werk brauchte: «Wer hätte das ahnen können?»
Haben wir es mit einem Einzeltäter statt mit einem professionellen Netzwerk zu tun, können wir nach Attentaten leichter darauf vertrauen, dass die Politik schnell Hilfe auf den Weg bringen wird. Hilfe bedeutet hier meist ausgeweitete Befugnisse für den Verfassungsschutz, Fördergelder für zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Radikalisierung und Fördergelder für die Wissenschaft, konkret: für Grundlagenforschung. Grundlagenforschung hat für die Politik viele Vorteile: Zum einen suggeriert sie, dass es sich tatsächlich um ein vollkommen neues Phänomen, eine vollkommen neue Art der Radikalisierung handle. Zum anderen ist sie billig. In vielen Fällen besteht sie einfach aus Hypothesen, die nie empirisch überprüft oder gar bestätigt wurden, oder aus Datenanalysen, in die sich nach Belieben rückwirkend «Anzeichen» und «Anfälligkeiten» für Radikalisierung hineindeuten lassen. Die Suche nach einem vermeintlichen psychologischen Profil für Radikale treibt bisweilen seltsame Blüten: Der «gefährlichste Indikator für das Potenzial von Einzelkämpferterrorismus ist die Kombination aus radikaler Ansicht sowie Mitteln und Gelegenheit für radikales Handeln», schreiben etwa Clark McCauley und Sophia Moskalenko.[3] Ja, was denn sonst? Aber es wird noch besser. Zu den bahnbrechenden Erkenntnissen über Einzeltäter gehört auch Folgendes: Über 50 Prozent waren innerhalb der letzten fünf Jahre vor Planung oder Durchführung ihres terroristischen Akts umgezogen! Fünfzig Prozent hatten einen Job! Fünfzig Prozent waren Single![4] Solche wertvollen Ergebnisse erleichtern die Früherkennung sicher enorm.
Tatsächlich werden über 95 Prozent aller terroristischen Anschläge weltweit von Gruppen geplant und ausgeführt.[5] Auch der Weg der übrigen Täter ist in den meisten Fällen kein einsamer.[6] Ihre Ideologie wird nicht nur durch die Propaganda extremistischer Gruppen inspiriert und verstärkt,[7] sondern oft auch durch regelmäßigen Kontakt in entsprechende Szenen.[8] Viele der angeblich «einsamen Wölfe» versuchen, eigene Gruppen zu gründen[9] oder sich bestehenden anzuschließen;[10] viele finden während der Vorbereitung ihrer Attentate Hilfe, etwa, wenn es darum geht, Waffen zu besorgen oder Schießen zu lernen,[11] und die wenigsten von ihnen machen aus ihrer Ideologie ein Geheimnis. Eine Studie zu terroristischen Einzeltätern ergab, dass bei rund zwei Dritteln Angehörige, Freunde oder Bekannte von der radikalen Einstellung des Täters wussten; in 64 Prozent der Fälle hatte er ihnen gegenüber sogar seine Pläne angekündigt.[12]
Der Begriff «einsamer Wolf» trifft auf eine andere Weise zu als intendiert: Er stammt von den US-amerikanischen Neonazis Tom Metzger und Alex Curtis. Deren «lone wolf activism» bezeichnete allerdings keine einsamen Taten. Metzger und Curtis warben vielmehr für den konspirativen Zusammenschluss von Rechtsextremen in kleinsten Gruppen oder Zellen, um während der Planung von Attentaten unter dem Radar der Sicherheitsbehörden zu bleiben. Trotzdem gab es – wie im Wolfsrudel – klare Kommandoketten und eine Anbindung zu den extremistischen Anführern.[13]
Heilige oder Hure?
Die öffentliche Debatte fixiert sich in doppelter Hinsicht auf Einzeltäter – gemeint sind nämlich fast immer Männer. Wenn radikalisierte Frauen doch einmal vorkommen, gelten sie entweder als Opfer, das von Männern manipuliert wurde, oder als Personifikation des Bösen. Beate Zschäpe beispielsweise wurde in den Medien entweder als naives Hausfrauchen und Gespielin von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos oder als der Teufel höchstselbst präsentiert. Mal befassten sich gefühlige Artikel mit ihrer schweren Kindheit oder dem Tod ihrer Großmutter, mal wurde sie offen dämonisiert. Frisur und Kleidung waren in der Gerichtsberichterstattung immer wieder Thema: Trug Zschäpe legere Kleidung, wurde das als Respektlosigkeit und Provokation kritisiert; trug sie einen nüchternen Hosenanzug, wurde gespottet, sie habe sich schick gemacht.
Wir kennen das aus schlechten Filmen: Frauen sind entweder Heilige oder teuflische Hure; individuelle Eigenschaften oder gar eine eigene Agenda haben sie nicht. Zu den prominentesten und mächtigsten Mitgliedern der RAF etwa zählten einige Frauen: Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Brigitte Mohnhaupt. Was deutsche Medien dazu zu sagen hatten: Frauen seien eben unfähig, vernünftig zu handeln. Die Frauenbewegung sei schuld, weil sich Frauen nun «mit der maskulinen Rolle identifizierten». Oder – mein persönliches Highlight – die weiblichen RAF-Mitglieder seien eigentlich nur ihrem «Boss» Andreas Baader sexuell hörig![1] Dass gebildete Frauen aus gutem Hause aus freien Stücken der Gesellschaft den gewaltsamen Kampf angesagt haben könnten, war undenkbar.
Radikale Frauen werden jedoch nicht nur von der Außenwelt objektifiziert, sondern in vielen Fällen auch von ihren Mitstreitern. Während die linksterroristischen und säkularen Gruppierungen der 1960er und 70er Jahre, etwa die RAF oder die baskische ETA, kein Problem damit hatten, Frauen nicht nur in ihre Reihen aufzunehmen, sondern sie auch in die oberen Ränge aufsteigen zu lassen, sah (und sieht) das bei religiös oder stark patriarchal geprägten Gruppen anders aus: Hier gibt es meistens nur einen Lebensentwurf für Frauen, nämlich eine zurückgezogene Existenz, erfüllt von Mutter- und Haushaltspflichten. Je länger aber der «heilige» Kampf dauert und je größer die Gier nach Macht und internationaler Aufmerksamkeit wird, desto kompromissbereiter zeigen sich die männlichen Führungsriegen.[2] Der IS beispielsweise setzt Frauen als Missionarinnen und Spendensammlerinnen ein, als Lehrerinnen und Ärztinnen, als Hackerinnen, Organisatorinnen und Waffenbeschafferinnen.[3] Aber es gibt auch Selbstmordattentäterinnen. Manchmal gehören sie islamistischen Gruppen an, die nur lose an Al-Qaida angeschlossen sind und im Alltag die Freiheit haben, pragmatischere, weniger ideologisch geprägte Entscheidungen zu treffen. Manchmal gelten sie als Ausgestoßene, deren Leben ohnehin nichts wert sei: In Staaten wie Irak, Tschetschenien oder Sri Lanka werden verwitwete oder missbrauchte Mädchen und Frauen als Selbstmordattentäterinnen rekrutiert, indem man ihnen weismacht, dass ein Terroranschlag ihre angeblich verlorene Ehre retten würde, oder indem man sie auf eine Reise mit scheinbarer Schmuggelware schickt, die tatsächlich eine ferngesteuerte Bombe ist.[4] Selbstmordattentäterinnen haben für Terrorgruppen viele Vorteile: Sie werden nicht nur seltener kontrolliert oder überwacht und können deswegen im Durchschnitt viermal so viele Menschen in den Tod reißen wie männliche Täter, sondern ihnen wird auch achtmal so viel mediale Aufmerksamkeit zuteil.[5] Umschmeichelnde Missionierung und professionelle Propaganda rund um Heirat und Mutterdasein als heilige (und einzige) Lebenserfolge bleiben für Mädchen und Frauen aus behüteten Verhältnissen reserviert.[6]
Auch Rechtsextremisten, Verschwörungsgläubige und fundamentalistische Christen haben die Glorifizierung der Mutterrolle als Erfolgsrezept erkannt. Evangelikale Gruppen lassen junge, attraktive Frauen auf YouTube und Instagram für ihren Glauben (und für Spenden) werben. Rechte Propagandistinnen unterwandern die Mütter-Community auf Instagram und verschweigen dabei ihre Zugehörigkeit zur Identitären Bewegung oder anderen einschlägigen Gruppierungen. Eine Aussteigerin berichtete im Interview mit dem Recherchezentrum Correctiv, dass die Identitäre Bewegung Workshops zu «rechten» Frisuren und Kleidungsstilen anbiete, damit man einander gut erkennen könne.[7] Die Propagandistinnen kapern Hashtags wie #Heimatliebe oder #MutzurWahrheit und verbreiten als besorgte Bürgermütter Verschwörungsmythen: Schwere Krankheiten gelten wahlweise als Erfindung der bösen Pharmaindustrie oder als Beweis mütterlichen Versagens; eine Stärkung der Kinderrechte im Grundgesetz wird zur drohenden Selbstermächtigung der Jugendämter deklariert, die angeblich nur darauf warten, Kinder grundlos aus ihren Familien reißen zu können. Auch QAnon-Anhängerinnen adressieren bei Instagram gezielt die Mütter-Community und arbeiten dabei mit einer Mischung aus Panikmache und verheißungsvollen Andeutungen: «Der Grund, warum wir ‹erwacht› sind, ist, dass ich Mutter wurde und wir eine Dokumentation angeschaut haben, die uns nie mehr losgelassen hat», wird etwa eine Influencerin vom Online-Magazin Slate zitiert.[8] Eine wirklich gute Mutter, so wird insinuiert, ist eine, die sich auf ganz bestimmten Kanälen informiert. Konkrete Details gibt’s natürlich nur per Privatnachricht oder auf einschlägigen Telegram-Kanälen, wo ohne Angst vor Moderation gehetzt werden kann.[9]
Radikalisierung: Die Ent-Pluralisierung der Welt
Die internationale Forschung konnte sich bis heute nicht darüber einig werden, was genau «radikal» eigentlich bedeutet und wie lange ein Radikalisierungsprozess dauert. Die meisten Theorien stellen Radikalisierung als Einbahnstraße dar, die, einmal eingeschlagen, über kurz oder lang zu einer staatsfeindlichen Haltung und zu Gewalt führen wird. Das könnte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass beim Fokus auf Gewalt und Terrorismus die meisten staatlichen Fördergelder zu erwarten sind. Immerhin wird seit etwa zehn Jahren immer öfter zwischen gewalttätiger und nicht gewalttätiger Radikalisierung unterschieden.[1] Ersteres meint beispielsweise Attentate von Islamisten gegen «Ungläubige» oder von Neonazis gegen Politiker und Journalisten, also die Ausübung von Gewalt gegen jene, die als Feinde definiert werden. Gruppen und Akteure aber, die sich nicht gegen Außenstehende wenden, sondern «nur» ihre eigenen Mitglieder ausbeuten und missbrauchen, sei es finanziell, emotional oder sexuell, werden hier meist nicht mitgedacht.
Auf der Suche nach der für mich treffendsten Definition für gefährliche Radikalisierungsprozesse bin ich beim Religions- und Politikwissenschaftler Daniel Köhler fündig geworden. Er bezeichnet Radikalisierung als «Ent-Pluralisierung»: Die individuelle Persönlichkeit wird «überschrieben»; eigene Interessen, Werte und Ziele werden durch eine einzige, alles umfassende Ideologie ersetzt.[2] Auch die Welt verliert – in den Augen der radikalen Person – ihre Vielfalt: Jedes politische oder gesellschaftliche Thema, jeder berufliche oder private Konflikt schrumpft zusammen auf den imaginären Kampf zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen «Erwachten» und «Schlafschafen». Diese Beobachtung schildern auch die Menschen, die ich berate: Es scheint, als würde ihr Gegenüber einfach verschwinden. Als würde aus einem geliebten Menschen, den sie in- und auswendig zu kennen glaubten, plötzlich ein Fremder werden. Ein Fremder, dem nichts mehr von dem wichtig zu sein scheint, was zuvor sein Leben ausgemacht hat. Ein Fremder, der anders handelt, anders klingt, anders aussieht als die vertraute Person. Eine solche Erfahrung schockiert, löst Traurigkeit aus, vielleicht auch Wut. Sie überfordert uns, und diesem Gefühl möchten wir so schnell wie möglich entfliehen. Deswegen nehmen wir uns nicht die Zeit, einen Schritt zurückzutreten und die Situation mit mehr Ruhe zu betrachten, sondern wir handeln impulsiv, nach Bauchgefühl. Unser Bauchgefühl aber erinnert uns im Wesentlichen nur daran, wie wir in – scheinbar – vergleichbaren Situationen gehandelt haben. Wenn wir diskussionsfreudige Menschen sind, werden wir Fakten zusammentragen, an den Verstand unseres Gegenübers appellieren und uns kurz darauf in einem hochemotionalen Konflikt wiederfinden. Wenn wir eher introvertiert oder unsicher sind, werden wir uns einem Klärungsgespräch mit der radikalen Person nicht gewachsen fühlen und den Kontakt reduzieren oder sogar abbrechen. Beide Strategien führen zum gleichen Ergebnis: Eine jahre- oder gar jahrzehntelang gewachsene Beziehung wird nachhaltig geschädigt oder zerstört. Die radikale Person stürzt sich noch tiefer in die radikale Ideologie, weil sie nichts mehr in der alten Welt zu halten scheint, während Freunde und Verwandte verletzt zurückbleiben und – meist vergeblich – nach Worten für das Geschehene suchen.
Die meisten Menschen, die sich an mich wenden, wissen nicht, welche Stellen für ihr Anliegen überhaupt zuständig wären. Manche haben sich, weil die radikalen Personen in ihrem Umfeld minderjährige Kinder haben, ans Jugendamt gewendet und wurden mit der Antwort abgespeist, dass sie ja vor Gericht ziehen könnten. Manche haben bei Sektenberatungsstellen angerufen und wurden darüber informiert, dass ihre Vermutung, ihr Gegenüber radikalisiere sich, wahrscheinlich richtig sei. Manche haben «Beratungsstelle Radikalisierung» gegoogelt und sind beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelandet, das eine «Erstanlaufstelle» anbietet, allerdings, das legen sowohl die Website als auch der Standort im entsprechenden Bundesamt nahe, nur für islamistische Radikalisierung von Geflüchteten. Auch eine Übersichtsseite der Bundeszentrale für politische Bildung lässt sich vergleichsweise schnell über Google finden; die aufgelisteten Hilfsangebote beziehen sich aber ebenfalls nur auf islamistische Radikalisierung. Ansonsten im Angebot: Hier und da ein paar gestelzte Infobroschüren und Websites, die Ausstiegsberatung für alle anbieten, die sich «ein extremistisches Umfeld» aufgebaut und «fremdenfeindliche Äußerungen» getätigt hätten, jetzt aber an einer «Distanz zu extremistischen Haltungen» oder einer «Überwindung der Weltanschauung» arbeiten wollten. Welche radikale Person, ausstiegswillig oder nicht, würde ernsthaft in solchen Begriffen über sich selbst nachdenken? Natürlich gibt es auch Beratungsangebote für Angehörige; gern mit dem Hinweis versehen, dass radikalisierte Menschen mit der «Komplexität» der «globalisierten und vernetzten Welt» überfordert seien und «einfache Antworten auf schwierige Fragen» suchten – mit anderen Worten: Es wird nahegelegt, dass Radikale denkfaul oder dumm wären. Solange selbst offizielle Stellen und «Experten» nur alte Vorurteile reproduzieren und die Politik keine langfristige Finanzierung für wissenschaftlich fundiert arbeitende Beratungsstellen, seriöse Überblicksarbeiten über die radikale Szene Deutschlands oder Forschung zu wirksamen Deradikalisierungsstrategien ermöglicht, wird Radikalisierung ein unlösbares Problem bleiben.[3]
IIRadikalisierung verstehen
Geschichten über Auserwählte begleiten uns seit Jahrtausenden. Ob religiöse Schriften, altgriechische Sagen, germanische Heldendichtung, Blockbuster wie «Star Wars» oder Superheldencomics: Die Geschichte ist immer die gleiche. Eine vom Schicksal auserwählte Person rettet ihr Vaterland – oder gleich die ganze Welt. In den meisten Fällen handelt es sich um einen männlichen Helden, dem das eigene Wohlergehen und die eigene körperliche Unversehrtheit gleichgültig sind und der sich allein Treue und Ehre verpflichtet fühlt: Werte, die scheinbar so allgemeingültig und erhaben sind, dass kein Blutbad sie beflecken kann. Egal, wie viele Tode der Held zu verantworten hat: Mörder sind immer die anderen.
Die Selbstlosigkeit und überzeitliche Moral, die Märchen und Mythen glorifizieren, hat einen hohen Preis: Ein Held ist jemand, der die schmutzige Arbeit erledigt, damit alle anderen in Frieden und Wohlstand leben können. Überzeitlichen Ruhm erkauft er sich nicht nur durch den Tod anderer, sondern auch durch das eigene frühzeitige Ableben.
«Wer bereit war, sein Leben eher zu opfern als seine Kameraden zu verrathen, wie es gar mancher Wilde gethan hat, der wird oft keine Nachkommen hinterlassen, welche seine edle Natur erben könnten», konstatierte schon Charles Darwin nüchtern in seinem Hauptwerk Die Abstammung des Menschen. Evolutionär betrachtet, ergibt Heldentum nur wenig Sinn. Aber ein Held steht über den Dingen, auch über der Evolution: «Wir spüren, dass im Heldentum das höchste Geheimnis des Lebens





























