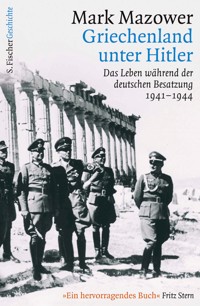23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das Familienmemoir eines großen Historikers und feinfühligen Schriftstellers mit dem Blick für die menschlichen Details.« Orhan Pamuk, Literaturnobelpreisträger
Als sein Vater stirbt und er herausfinden soll, wie seine Großeltern bestattet wurden, tut Mark Mazower, was ein Historiker am besten kann: Er macht sich an die Archivarbeit. Schnell wird ihm klar, wie wenig er über seine Familie weiß. Und so beginnt Mazower, die bewegten Biografien seiner Vorfahren zu erforschen. Etwa die seines Großvaters Max, der als Mitglied des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes in Vilnius revolutionäre Schriften verbreitete, bevor er vor den Wirren des russischen Bürgerkriegs nach Großbritannien floh – der vier Sprachen beherrschte und später doch kein Wort über seine Vergangenheit verlor. Oder die von Max’ unehelichem Sohn, André, dem schwarzen Schaf der Familie, der mehrmals seine Nationalität wechselte, sich zeitweise im faschistischen Spanien niederließ und eine verschwörungstheoretische Abhandlung über die angeblichen Machenschaften eines jüdischen Geheimbundes verfasste.
Mit großer Einfühlsamkeit zeichnet Mazower die Lebenswege seiner Angehörigen nach, die kreuz und quer über die historische Landkarte unseres Kontinents verlaufen: von der Sowjetunion während des Großen Terrors über das besetzte Paris bis in die neue Heimat im Norden Londons. Mit Was du nicht erzählt hast gelingt ihm etwas Außergewöhnliches: ein berührendes Familienmemoir, das zugleich die wechselhafte Geschichte eines ganzen Jahrhunderts erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mark Mazower
WAS DU NICHT ERZÄHLT HAST
Meine Familie im 20. Jahrhundert
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff
Suhrkamp
Für Selma und Jed und für ihre Cousins und Cousinen Nina und Clara, Rachel, Cleo und Nicholas, Max, Seth und Elliot
Inhalt
Einleitung. Auf dem West Hill
Kapitel 1. Der Bundist
Kapitel 2. 1905
Kapitel 3. Die Yost Typewriter Company
Kapitel 4. Grenzübertritt 1919
Kapitel 5. Briten und Bolschewiki
Kapitel 6. Wood End
Kapitel 7. Das Nachleben
Kapitel 8. Zachar
Kapitel 9. Das wachsende Schweigen
Kapitel 10. André
Kapitel 11. Die Krylenko-Verbindung
Kapitel 12. Frouma
Kapitel 13. Highgate
Kapitel 14. Das schützende Wort
Kapitel 15. Ira
Kapitel 16. Kindheit
Kapitel 17. Der Krieg
Kapitel 18. Oxford und was dazwischen kam
Schluss. Der Schuppen
Danksagung
Anmerkungen
Stammbäume
Familie Mazower
Familie Toumarkine
Bildnachweise
Hamstead Heath und Highgate, 1930.
1 South Hill Gardens Nr. 19
2 Oakeshott Avenue Nr. 20
3 University College School
4 Marie Curie Hospiz
Einleitung
Auf dem West Hill
Eigentlich hatte ich geglaubt, meinen Vater recht gut zu kennen. Doch an seinem Sterbetag wurde mir allmählich klar, dass ich von vielen Aspekten seines Lebens keine Ahnung hatte. Als wir aus dem Hospiz nach Hause kamen, fragte jemand, wie seine Eltern bestattet worden seien. Da keiner von uns es genau wusste, tat ich das, was meine Historikerausbildung und mein Instinkt mir nahelegten: Ich ging ins Archiv. Oben im Schrank standen seine Kartons mit Familienunterlagen, und einer war mit der Aufschrift versehen: Tagebücher 1941-1996. Ich stieg auf einen Stuhl, holte ihn herunter und setzte mich auf das Bett meiner Eltern. Diesen Karton öffnete ich zum ersten Mal, da war ich mir ziemlich sicher.
Ich hatte meinem Vater immer nahegestanden. Als meine Brüder und ich heranwuchsen, hatte seine Präsenz für uns etwas äußerst Beruhigendes gehabt. Ich erinnere mich, dass wir einmal durch die Cotswolds fuhren, nur er und ich. Es war ein Frühlingstag, damals muss ich wohl zwölf oder dreizehn Jahre alt gewesen sein. Wir schauten uns Häuser an, weil er und meine Mutter vorhatten, sich ein Wochenendhaus zu kaufen. Die Straßenkarte lag ausgebreitet auf meinem Schoß, und ich war stolz, dass er sich auf meine Angaben zur Fahrtroute verließ. Er fuhr, ich schaute aus dem Fenster auf die vorüberhuschenden Felder und fühlte mich wohl in unserem einträchtigen Schweigen und gegenseitigen Vertrauen.
Ein einträchtiges Schweigen ist keineswegs undurchdringlich. Mein Vater war nicht sonderlich gesprächig und scheute vor persönlichen Äußerungen zurück wie ein nervöses Pferd. Heikle Fragen entlockten ihm zuweilen ein leises Lächeln, bevor er antwortete. Doch wir konnten ihn alles fragen, und er erzählte uns von seiner Kindheit und seinen Eltern. Einige Jahre vor seinem Tod beschlossen er und ich, diese Geschichten aufzuzeichnen – er war mittlerweile Großvater und die Zeit verging –, also setzten wir uns in sein Zimmer im Dachgeschoss, und ich schaltete das Aufnahmegerät ein. Unsere Gespräche zogen sich über mehrere Nachmittage hin. Ich kann mich nicht erinnern, dass es etwas gegeben hätte, über das er keine Auskunft geben wollte. Die Barrieren bestanden eher in mir: Ich hatte Hemmungen, manche Dinge anzusprechen, und bei anderen kam ich gar nicht erst auf die Idee, ihn danach zu fragen.
In dem Karton lagen zwei alte Adressbücher und viele Letts-Taschenkalender, die über ein halbes Jahrhundert reichten und chronologisch geordnet waren. Darin hatte er meist Termine eingetragen, und so fand ich bald die Informationen, die wir suchten. Es gab keine intimen Geständnisse oder Gefühlsergüsse – was nicht überraschend war –, die Eintragungen, in denen mein Vater eine Stimmung oder Gefühlsregung aufgezeichnet hatte, ließen sich an zehn Fingern abzählen. Auf ihre Art waren diese alles andere als introspektiven Aufzeichnungen jedoch durchaus sprechend, und so fügte sich beim Lesen nach und nach ein Bild von den täglichen Bewegungen und Sozialkontakten zusammen, die sein Leben geprägt hatten.
Aufgewachsen war er in Highgate im Londoner Norden, und wie die Taschenkalender belegten, blieb er diesem Vorort zeitlebens eng verbunden. Als er Anfang Januar 1942 in seinem Schülerkalender vermerkte, er habe sich »im Waterlow Park von Daddy verabschiedet«, war er gerade mal sechzehn Jahre alt. Er musste in seine nach Somerset evakuierte Schule zurückkehren, während sein rasch alternder Vater sich auf den Weg durch die zerbombte Stadt zu seinem Kriegsdienst bei der Postzensurstelle machte. Zehn Jahre später lagen sein Studium in Oxford und der Militärdienst bereits hinter ihm, und in dem Jahr, in dem sein Vater starb, kamen seine Vettern aus Paris zu Besuch, und er »ging mit den Kindern auf der Heath spazieren«, also im Park Hampstead Heath. Mit »Kindern« waren nicht etwa meine Brüder und ich gemeint, denn uns gab es noch gar nicht. Im Kalender von 1954 ist am 11. April ein »Spaziergang auf der Heide mit Miriam« verzeichnet; damals kannten er und meine Mutter sich seit knapp einem Monat. Es dauerte nicht lange, bis auch wir kamen und sie mit uns auf den Wiesen oberhalb der Weiher spielten und zwischen den Rhododendren hinter Kenwood House, dem ehemaligen Herrensitz der Familie Mansfield, spazieren gingen.
Als meine Mutter und mein Vater Eltern wurden, fingen sie an, uns zu filmen, und sobald wir etwas älter waren, holten sie an Winterwochenenden nachmittags als besondere Vergünstigung den Projektor heraus, zogen die Vorhänge zu und zeigten uns Aufnahmen von uns als Kleinkindern: Daves erste torkelnde Schritte über den Sand in Devon auf die Kamera zu; Ben im Kinderwagen in unserem Garten; Jony auf dem Klettergerüst. Eine ihrer ersten Filmaufnahmen stammte aus dem Sommer 1958. Es ist ein sonniger Tag, und meine Mutter muss wohl die Kamera halten, die sich meine Eltern von einem Freund geborgt haben. Sie machen ein Picknick in der Hampstead Heath und haben wie üblich die karierte Decke auf dem Boden ausgebreitet, da das Gras selbst im Juli und August häufig leicht feucht ist. Dad liegt auf dem Rücken und hält mich über seinen Kopf: Er ist voller Leben und wirkt stark und glücklich, wie ich ihn eigentlich während meiner gesamten Kindheit in Erinnerung habe. Doch als ich den Film anhalte, fällt mir auf dem Standbild etwas im Hintergrund auf: Hinter ihm, jenseits des Weihers und der Baumreihe ragt der Kirchturm von St. Michael auf dem West Hill in Highgate auf. Mit seltsamer Präzision markiert er genau die Stelle, an der ich ein halbes Jahrhundert später täglich auf ein Taxi warten sollte, um ihn in den letzten Monaten seines Lebens im Krankenhaus zu besuchen.
Im Sommer 2009 hatte ein Forschungsjahr mich wieder nach London geführt. Kurz nach meiner Ankunft hatte sich der Gesundheitszustand meines Vaters verschlechtert. Da ich kein Auto hatte, ging ich immer zu Fuß auf den West Hill in Highgate und wartete dort auf ein Taxi. Es war ein ungewöhnlich milder Herbst – soweit ich mich erinnere, gab es kaum Regentage –, und der Spaziergang erlaubte es mir meine Gedanken vom Bild meines Vaters in seinem Krankenhausbett weg zu den Themen schweifen zu lassen, über die er gerne sprach: den Krieg, seine Kindheit, Geschichte, Russland.
Etwa fünfzig Meter von der Stelle entfernt, an der ich auf das Taxi wartete, stand ein Wegweiser an einer Abzweigung: Ein Pfeil wies nach »Highgate Village«, der andere nach »Norden«. Während die Autos auf ihrem Weg in die Stadt oder hinaus vorbeirasten, ließ irgendetwas an diesem Schild – vielleicht die schlichte Wahl, die es anbot, oder der altmodische Schrifttyp der Jahrhundertmitte – mich über die Orte nachdenken, die mein Vater als Zuhause empfunden hatte. Mir fiel auf, dass er seine mehr als achtzig Lebensjahre, abgesehen von seinem Militärdienst, seinem Studium und seinen Geschäftsreisen, an einer Reihe von Orten rund um Hampstead Heath verbracht hatte, also rund um jenen weitläufigen Park, der sich unterhalb von meinem Standort ausbreitete. Anders als seine aus Russland vertriebenen, von ihren Familien getrennten Eltern, die viel durchlitten hatten, bis sie sich in London niederließen, erlebte er im Laufe seines Lebens ein Gebiet als Zuhause, das sich weitgehend auf einen Tagesmarsch rund um meinen Standort auf dem West Hill beschränkte. Nun endete es nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem es begonnen hatte, und ich fragte mich, ob die Zufriedenheit, die ich mit ihm verknüpfte – ein Akzeptieren des Lebens, eigentlich eine gewisse Art von Glück, wenn es nicht anmaßend ist, es so zu nennen –, irgendwie mit seiner dauerhaften Bindung an diese Umgebung zusammenhing, was immer seine Eltern nicht nur nach England, sondern gerade in diesen Teil Londons geführt und veranlasst haben mochte, ihn zu ihrem und seinem Zuhause zu machen.
Seit ich einige Jahre zuvor nach New York gezogen war, hatte ich akutes Heimweh nach meiner Heimatstadt verspürt. Als ich dort aufwuchs, war vieles noch ganz ähnlich wie zur Zeit meines Vaters: Die Lyons Teahouses waren zwar verschwunden, und es entstanden die ersten Sainsbury’s-Supermärkte. Doch die viktorianischen Klassenzimmer in der Schule, die schäbigen Toiletten am anderen Ende des Spielplatzes, die behaglichen Stadtbibliotheken und der von Standesdenken getragene Ethos Englands hatten sich mehr oder weniger gehalten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts verschwand das alles sehr rasch. London veränderte sich zusehends, getrieben vom massiven Kapitalzustrom. Als mein Vater im Krankenhaus lag, dachte ich über Heimweh und das nach, was ihm vorausgeht. Wie kommt es, dass wir die Orte, an denen wir leben, irgendwann als unsere empfinden? Was hatte es für den schweigsamen Vater meines Vaters, Max, bedeutet, dass er seinen Geburtsort nie wiedergesehen hatte? Wie war Dads liebevolle, intuitive Mutter Frouma damit zurechtgekommen, dass sie dreißig Jahre von ihrer Familie in Moskau getrennt war? Welche seelischen Kämpfe, welchen mühevollen Verzicht hatte es erfordert, ihrem Sohn in Highgate ein Zuhause zu bieten, in dem er aufwachsen konnte? Diese Fragen erlangten nach meiner Rückkehr nach Manhattan für mich neue Bedeutung. Je mehr ich darüber nachdachte, umso stärker schien mir dieser doppelte Verlust – der Tod meines Vaters und das Verschwinden Londons, wie ich es als Kind gekannt hatte – untrennbar miteinander verwoben zu sein.
Dahinter stand noch ein dritter, weiter zurückliegender Verlust. Die Eltern meines Vaters hatte ich nie richtig kennengelernt, da Max schon vor meiner Geburt gestorben war und Frouma, als ich sechs Jahre alt war. Doch nach allem, was wir gehört hatten, war Dads Schweigsamkeit nichts im Vergleich zu der seines Vaters. Wie sonst hätte sich erklären lassen, dass Max seiner Frau Frouma offenbar nie den Namen seiner Mutter gesagt hatte, obwohl die Eheleute sich so nahegestanden hatten? Anders als bei meinem Vater verbargen sich hinter Max’ Schweigen echte Geheimnisse. Bevor er Frouma kennenlernte, hatte er sich im zaristischen Russland als revolutionärer Sozialist engagiert, Aktivitäten, über die er später nie mehr sprach, nachdem er sein Leben im Untergrund hinter sich gelassen hatte. Viele seiner engsten Genossen starben eines gewaltsamen Todes, erschossen von den Bolschewiken oder den Nazis. Sein Entschluss, nach England zu kommen, Frouma zu heiraten und mit ihr eine Familie zu gründen, war eine Vorbedingung unserer Existenz. In Frouma hatte er eine Frau gefunden, der die Pflege von Familienbanden eine Möglichkeit bot, die schmerzhafte Geschichte zu ertragen. Doch Max musste für die Familiengründung seinen Aktivismus aufgeben: Ein Heim zu schaffen und politische Desillusionierung waren untrennbar verbunden.
Vielleicht erklärt dieser Umstand, dass mein Bild von ihm von der melancholischen Aura enttäuschter Hoffnungen durchdrungen war. Im Mut und Engagement seiner Jugend sah ich etwas Exemplarisches für unser zynischeres Zeitalter mit seinen Demagogen, seinem obszönen Reichtum und seiner zunehmenden Nabelschau. Heutzutage sind anscheinend viele zu ernüchtert und von ihrem Misstrauen gegenüber selbst den praktischsten Gesellschaftsutopien zu gelähmt, um für etwas zu kämpfen, was über die Vervollkommnung ihrer eigenen Seelen hinausreicht. Max hatte hart für andere gekämpft – getrieben von einem äußerst altmodischen Gerechtigkeitsstreben, das sich aus dem eigenen Erleben von Armut und Ausbeutung speiste. Instinktiv war er gegen Stammesdenken jeglicher Art, vor allem ethnisches und religiöses, eine Opposition, die ebenso stark aus dem Bauch wie aus dem Verstand kam. Die Bewegung, für die er vor über hundert Jahren gekämpft hatte, hatte verloren und war in Vergessenheit geraten, doch das spielte kaum eine Rolle. Von den Verlierern der Geschichte können wir mehr lernen als von den Gewinnern. Kein Sieg währt ewig – was zählt, ist das, was man aus Niederlagen macht.
Als ich wieder in Highgate war, musste ich an das Antiquariat Fisher and Sperr auf der Hauptstraße, gleich neben dem Hilltop Beauty Salon, denken. Ich weiß nicht, warum es mir in den Sinn kam – vielleicht weil nichts besiegte Ideen besser bewahrt als ein alter Buchladen, der die Möglichkeit ihrer Entdeckung und Wiederauferstehung birgt. Vielleicht fiel mir deshalb wieder ein, wie bestürzt ich war, als einige Monate nach dem Tod meines Vaters ein staubiger grüner Vorhang hinter dem vertrauten Erkerfenster von John Sperrs Tod zeugte. So lange hatte diese Buchhandlung schon existiert, dass ich einfach angenommen hatte, es würde sie ewig geben. Mr Fisher war zwar schon vor Jahren verschwunden, aber John Sperr hatte bis zum Ende an der Theke gestanden. Er war mittlerweile extrem schwerhörig geworden und hatte Kunden angebrüllt, doch hatte man erst einmal sein Vertrauen gewonnen, hatte er den Schlüssel hervorgeholt, widerstrebend das höhlenartige Hinterzimmer mit all seinen Schätzen aufgeschlossen und das Licht eingeschaltet. Der Raum war immer eiskalt und bis unter die Decke vollgestopft mit Büchern, die allmählich verstaubten und nur selten angerührt wurden. Eines Nachmittags entdeckte ich dort eine kleine, ledergebundene Ausgabe der Anthologia Lyrica Graeca, deren Deckblatt in einer akkuraten, winzigen Schuljungenhandschrift mit der Signatur »V. E. Rieu« und dem Datum »Nov. 10th 1902« versehen war. Ich kaufte das Buch, weil ich von Rieu gehört hatte, der später die erste Homer-Übersetzung im Taschenbuchformat besorgte und Penguin Classics gründete, jenen Verlag, der das Bildungsgut der Welt verbreitete. Er hatte ganz in der Nähe gelebt, war dort gestorben und hatte seine Bibliothek hinterlassen, die in alle Winde zerstreut, von einem Antiquar wieder zusammengestellt wurde und so ein Nachleben fand.
Rieu war nicht der einzige Ortsansässige, der Ideen und Bücher zu schätzen wusste: Highgates Höhenlage war anscheinend wie geschaffen, zum Denken anzuregen wie ein urbaner Berggipfel: »Ist man erst einmal oben angekommen und hat den mühevollen Anstieg hinter sich gebracht, hat man das Gefühl, einen Hafen erreicht zu haben«, vermerkte Ernest Aves, ein scharfsichtiger Beobachter der viktorianischen Londoner Straßen, nachdem er an einem milden Dezembertag 1898 in das Dorf hinaufgegangen war. »Hier sollten Philosophen oder Quäker leben.«1 Das taten sie denn auch, zusammen mit Dichtern, Romanciers, konservativen Romantikern, Anarchisten und Revolutionären. Auf dem dortigen Friedhof liegt der berühmteste Kommunist der Geschichte begraben. Viele waren Emigranten wie Karl Marx. Andere wie Rieu waren die Kinder ausländischer Eltern. Es war geradeso, als locke der Blick auf die Stadt von den Hügeln im Norden Londons die Kontemplativen und Idealisten an und verleihe ihren Reizen eine besondere Bedeutung für alle, die politische Unruhen erlebt und Zuflucht gesucht hatten, ohne sich von der Welt abwenden zu wollen.
»Meist waren es Schritte, raschelndes Laub«, um es mit den Worten des englischen Dichters und Viktoriana-Barden John Betjeman zu sagen, der seine Kindheit auf dem West Hill in Highgate verbrachte. Als mein Vater dort aufwuchs, zogen noch Pferde den Milchwagen über die Langbourne Avenue, und über die North Road wurden Schafe getrieben. Seinen Eltern gefiel das gemächliche Tempo des Viertels, und nachdem sie sich im Holly Lodge Estate, einer Zwischenkriegssiedlung mit Fachwerkhäusern und breiten Straßen an der Flanke des West Hill, niedergelassen hatten, weigerten sie sich, sich noch einmal entwurzeln zu lassen. Als familiäre Umstände sie zwangen, ihr erstes Haus zu verkaufen und in ein kleineres zu ziehen, holte der Möbelwagen ihr Mobiliar ab und stand nur fünf Minuten später vor ihrem neuen Zuhause: Es befand sich gleich um die Ecke. Und nach dem Tod von Dads Vater zog seine Mutter in eine Wohnung, die keinen halben Kilometer entfernt lag. An einem Ort bleiben zu dürfen und selbst entscheiden zu können, wann man umzieht, ist ein Privileg, das die Eltern meines Vaters dank der Umwälzungen, Ängste und Entbehrungen ihres früheren Lebens zu würdigen wussten.
In diesem Umfeld wuchs mein Vater auf, und er kannte es in- und auswendig. Es gab ihm, glaube ich, ein Selbstvertrauen, wie es vielleicht nur aus dem Wissen erwächst, woher man kommt, dass man dort glücklich war und die Nähe dazu bewahrt hat. In seinen letzten Lebenswochen brachte ich ihm die Memoiren eines Mannes ins Krankenhaus, der in den ärmlichen Seitenstraßen von Highgate New Town unterhalb des Friedhofs aufgewachsen war. Als ich meinen Vater nach einem Straßennamen fragte, den der Autor erwähnt hatte, erkannte er ihn auf Anhieb, weil er dort Plakate für die Labour Party geklebt hatte, bevor sie in jenem magischen Sommer 1945 ihren historischen Wahlsieg errang. Als sein Gesundheitszustand sich verschlechterte und er auf einer lauten Station mit Blick auf die abschüssigen Straßen zu den West-Heath-Weihern lag, beunruhigte ihn kaum etwas stärker als die Möglichkeit, er könne vorübergehend den Weg von zu Hause zum Krankenhaus vergessen. Ein Stadtplan half seinem Orientierungssinn wieder auf die Sprünge.
Hampstead Heath, Mitte der dreißiger Jahre.
Diese Fähigkeit, sich zu orientieren und zu wissen, wo er sich gerade befand, war ihm schon immer wichtig gewesen. Zu den ersten Fotos, die er als Junge in den frühen dreißiger Jahren geschossen hat, zählen Aufnahmen in der Parklandschaft von Hampstead Heath – ein Beleg für den Reiz und die Faszination, die für ihn von diesem Ort ausgingen. Nach den kahlen Bäumen und der Kleidung der unscharf erfassten Personen jenseits des Weihers zu urteilen, sind die Fotos vermutlich an einem Frühlingstag entstanden. Nicht die Menschen haben den Blick des Kindes gefesselt, sondern die Hänge, die Skyline und die Hecken. Darin ist bereits eine aufkeimende Verbundenheit zu erkennen, die er als eine von vielen Gaben an uns weitergegeben hat.
Seine Verbundenheit und auch die seiner Eltern. Für sie hatte sie allerdings einen Preis – den alle Flüchtlinge zu zahlen haben –, denn England zu ihrer Heimat zu machen hatte bedeutet, andere Orte aufzugeben, mit denen ganz eigene, frühere Erinnerungen verknüpft waren. Über den einen oder anderen wussten wir ein bisschen Bescheid, da wir als Kinder hin und wieder gehört hatten, wie unser Vater in fließendem Russisch mit Verwandten in Moskau und Leningrad telefonierte. Andere Orte waren nie mehr als Namen – Smolensk, Wilna, Grodno, Riga –, die gelegentlich in Anekdoten vorkamen. Ich wusste nicht genau, wo sie lagen oder wer dort gewohnt hatte. Das alles schien so weit weg.
Max, um 1926.
Kapitel 1
Der Bundist
Als mein Vater geboren wurde, ging es seinem Vater wirtschaftlich gut. Max war mehrfach als Firmendirektor tätig und leitete damals die Engineering and Mercantile Company Ltd., die in Sheffield hergestellte Werkzeugmaschinen nach Osteuropa exportierte. Auf dem Foto vermitteln der dreiteilige Anzug, das zugeknöpfte Jackett, die Manschetten und die leger gehaltene Zigarette einen Eindruck von Ehrbarkeit und Gelassenheit eines Mannes, der mit Bilanzen, Handelspositionen und Kapital umzugehen versteht.
Seine unterschwellig vorsichtige Miene deutet jedoch auf einen Menschen hin, der auf der Hut ist, und der leicht seitlich gerichtete Blick lässt vermuten, dass sein sorgfältiges Erscheinungsbild ebenso viel verbirgt, wie es offenbart. Ein führender Anarchist namens Rudolf Rocker schrieb einmal in seinen Erinnerungen an die politischen Exilanten, die er um die Jahrhundertwende in London gekannt hatte, sie seien schweigsame Männer gewesen, die nicht viel geredet hätten, und das galt auch für Max: Seine Frau, Frouma, nannte ihn zhivotik – »Bäuchlein«, weil Worte dort blieben und nur selten den Weg in seinen Mund fanden. Mit Sprachen hatte er keinerlei Schwierigkeiten – vier sprach er fließend. Sein Englisch war perfekt und ohne jeden Akzent. Doch Max hatte gelernt, in keiner Sprache mehr zu sagen als nötig.
Er gehörte derselben Generation an wie Lenin, der Menschewiki-Führer Julius Martow und der spätere sowjetische Außenminister Maxim Litwinow. Ihre Wege müssen sich nahezu mit Sicherheit gekreuzt haben, denn als er vor dem Ersten Weltkrieg für ein russisches Transportunternehmen in Wilna arbeitete, war er gleichzeitig an der Leitung einer sozialistischen Untergrundbewegung beteiligt. Ihr vollständiger Name lautete Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Polyn un Rusland (Allgemeiner jüdischer Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland). »Der Bund«, wie er kurz genannt wurde, ist heutzutage nahezu völlig in Vergessenheit geraten: Seine Sprache, Jiddisch, wird kaum noch gesprochen, und die Bevölkerung, die ihn unterstützte – die jüdische Arbeiterschaft im Ansiedlungsrayon, also jenem Gebiet im Westen des Russischen Reiches, in dem Juden sich niederlassen und arbeiten durften –, wurde während des Zweiten Weltkrieges großenteils ausgelöscht. Zu seiner Zeit spielte er jedoch eine entscheidende Rolle in der Entstehung einer linken Parteipolitik im Zarenreich. Max, der ein Doppelleben als Buchhalter eines Kaufmanns und revolutionärer Agitator führte, lernte bereits früh den Wert von Vorsicht, Schweigsamkeit und Misstrauen als überlebenswichtig schätzen. Diese Haltung vergaß er nie – ebenso wenig wie die loyalen Bindungen, mit denen er aufgewachsen war. Bis zum Lebensende blieb er nicht nur ein Linker: Er war ein Bundist.
Ein Bundist sein: Das alles begann vielleicht mit einem Gefühl – einer Empörung über die anhaltende Kluft zwischen Arm und Reich:
Im Salzmeer der menschlichen Tränen
Öffnet sich ein schrecklicher Abgrund,
er kann kaum noch tiefer, noch finsterer werden,
Ihn zeichnet ein blutiger Strom …2
Auf der einen Seite standen die notleidenden Arbeiter, die Armen, die Sklaven, auf der anderen die Herrscher, die Barone, die Ausbeuterklasse. Die Hymne des Bundes, eine Art proletarischer »Marseillaise« für eine zukünftige Revolution, war ein Aufruf, sich im Zorn zu erheben, sich auf die Seite der Gerechtigkeit zu schlagen und unter der roten Flagge des Sozialismus zu kämpfen. »Brider un shvester«, begann sie – »Brüder und Schwestern in Arbeit und Kampf«. Der Wunsch, die tausendjährige Ungerechtigkeit der Welt zu bekämpfen, ging mit einem tiefen Gefühl kameradschaftlicher Solidarität einher. Von Anfang an schuf der Bund eine bemerkenswert warmherzige Verbundenheit unter seinen Kämpfern, eine beispiellose Treue zueinander und zum gesamten Bund, als ob er mehr als eine bloße Partei oder Organisation wäre, etwas Lebendiges und Geliebtes. Das jiddische Wort dafür lautet mischpochedikayt, Familienzusammenhalt. Vielleicht lag es an dieser Verbundenheit, die er schuf, dass er sich in einer Welt weitaus skrupelloserer Feinde so lange halten konnte und noch lange danach in den Herzen der Menschen präsent blieb.
Selbstverständlich war der Bund nicht einfach eine Gefühlssache – sonst hätte er einem Realisten wie Max nicht gefallen –, sondern auch ein ernsthaftes Vehikel für Ideen zur politischen Veränderung. Der revolutionäre Sozialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts bot ein argumentatives Milieu, das sich vor allem mit unterschiedlichen Lehrmeinungen auseinandersetzte, eine Welt, in der Parteien sich spalteten und fusionierten und Flügel sich in einer endlosen Debatte darüber bildeten und reformierten, welche Lehren sich aus der Vergangenheit für die Zukunft der Menschheit ziehen ließen. Unter dem Dach der russischen Sozialdemokratie stritten sich Menschewiki mit Bolschewiki und beide mit dem Bund. Sie alle trafen sich unter dem gestrengen Blick von Karl Marx, von dessen Schriften sie inspiriert wurden. Während die Bolschewiki Lenin mit seinem Konzept einer straff geführten, zentralistischen Partei huldigten, besaß der Bund keinen Lenin und wollte keinen einzelnen Anführer. Menschewiki und Bolschewiki beanspruchten jeweils, für alle Einwohner des Russischen Reiches zu sprechen; dagegen sahen sich die Bundisten in erster Linie als Stimme der russischen Juden. Nach ihrer Ansicht galt es, nationale, kulturelle und sprachliche Unterschiede anzuerkennen, nicht zu ignorieren. Sie waren jedoch keine Nationalisten und weit davon entfernt, sich nur um eine jüdische Zukunft zu kümmern, daher hielten sie die zionistische Idee, im Nahen Osten eine nationale Heimstatt für die Juden zu schaffen, für eine gefährliche Spinnerei. Bundist zu sein hieß, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, sich gemeinsam mit anderen am Kampf der sozialistischen Bewegung für eine bessere Zukunft zu beteiligen und in diesem Rahmen auf den Sturz der autokratischen Herrschaft in Russland hinzuarbeiten. Zumindest verfolgten sie diesen Traum zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Max dort aktiv war und der Bund die größte und effektivste revolutionäre Kraft im Zarenreich darstellte. Doch in den zwanziger Jahren war der Bund nur noch ein Schatten seiner selbst, sein Kernland war auseinandergerissen, der Bolschewismus hatte in Russland triumphiert, und sein Traum gehörte der Vergangenheit an.
Max war über fünfzig Jahre alt, als mein Vater geboren wurde, somit war das verborgene Buch seines Vorlebens bereits dick. Die wenigen Anekdoten, die er seinem Sohn erzählte, warfen ebenso viele Fragen auf, wie sie beantworteten. Er war ein Rätsel, wie mein Vater wesentlich später sagte, ein reservierter, verschlossener Mensch. Einem Schulfreund meines Vaters erschien er als geheimnisumwitterte Gestalt, die still im Obergeschoss las und zu einem abendlichen Drink herunterkam. Es war leicht, sich Spionagegeschichten, Exilantenverschwörungen und Geheimkontakte zu Regierungsvertretern auszumalen. Schweigen lädt zu Spekulationen ein, und Max schwieg zu vielem.
Frouma wusste auch nicht viel mehr über ihren Mann, weil sie ihn erst zu Beginn der zwanziger Jahre kennengelernt hatte, nachdem er seine Aktivistenzeit hinter sich gelassen hatte. Obwohl die beiden eine liebevolle Beziehung verband, sprach Max kaum über seine Vergangenheit. Nach seinem Tod im Jahr 1952 bekam Frouma einen auf Jiddisch verfassten Brief von einem New Yorker Verlag, dem Ferlag Unzer Tsayt, einem Außenposten des politischen Lebens osteuropäischer Juden auf der Upper East Side. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dieser Verlag eines der wichtigsten Organe des einst so einflussreichen Bundes und stand unter der Leitung eines früheren Genossen von Max, der einen Nachruf über ihn schreiben wollte. Auf seine Anfrage musste Frouma gestehen, dass sie so gut wie nichts über das Leben ihres Mannes vor ihrem Kennenlernen wusste. »Als ehemaliges Mitglied des Bundes, der zu der Zeit, als er dort aktiv war, eine illegale Organisation war, sprach mein Mann selbst in seinem späteren Leben nicht gern über seinen Anteil daran.« Nicht nur im Hinblick auf seine politischen Aktivitäten waren Max’ Lippen versiegelt. Wie sie weiter erklärte, waren seine Eltern beide bereits gestorben, als sie ihn heiratete. Selbst den Namen seiner Mutter kannte sie nicht. Keinen seiner Verwandten hatte sie je getroffen, und soweit sie wusste, waren seine engsten Freunde tot. Max habe nicht einmal sein genaues Geburtsdatum mit Sicherheit gekannt, sagte sie. So konnte sie dem ehemaligen Gefährten lediglich ein Foto von ihm schicken, das mit der Unterschrift erschien: »Mordecai Mazower. Ein führender Parteifunktionär in Wilna, Łódź und anderen Städten in der Zarenzeit.«
In der Zarenzeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Wilna eine der größten Städte des Russischen Reiches, an der Schnittstelle der Bahnlinien nach Europa und an die Ostsee gelegen und damit ein wichtiger Knotenpunkt des zaristischen Verkehrsnetzes. Dort entdeckten Zöllner am 12. April 1901 einen jungen Mann, der unter der Last eines verdächtig wirkenden Sacks aus dem Bahnhof wankte. Als er ihn in eine Mietdroschke laden wollte, forderten sie ihn auf, den Sack zu öffnen. Wie sich herausstellte, enthielt er Bündel illegaler jiddischer Zeitungen und Flugblätter. Eine Durchsuchung förderte zudem einen Zettel mit Anweisungen auf Russisch zutage: »Ecke Ignatiewskaja-Gasse und Blagoweschtschenskaja-Straße, gegenüber der polnischen Kirche, wo die Praxis des Zahnarztes Katz ist, frag im dritten Stock nach Mazower und dann nach Max – wenn er nicht zu Hause ist, geh in das Büro der Nadeschda Co. auf der Bolschaja-Straße und frag da nach ihm.«
Sehr schnell erkannte die Polizei in Wilna den aufrührerischen Charakter der Schriften. Die Zeitung Die Arbeiterstimme war den Behörden zufolge »in ihrem Inhalt offen staatsfeindlich«. Ihre Autoren argumentierten, das bestehende kapitalistische System müsse durch ein sozialistisches ersetzt werden, und propagierten den Kampf der Arbeiter gegen die russische Regierung, die sie als »brutalste der zivilisierten Welt« bezeichneten. Herausgegeben wurde die Zeitung vom Bund. Außerdem enthielt der Sack Flugblätter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands mit einem Aufruf zu Demonstrationen am 1. Mai – einem nur wenige Wochen entfernten Datum, dem die Polizei mit besonderer Sorge entgegensah – und der Parole: »Nieder mit der barbarischen asiatischen Autokratie [d. h. dem Zarenregime], dem Feind der Demokratie und des Sozialismus.«
Als man dem jungen Mann vorwarf, er gehöre zu »einem Geheimbund, der sich Allgemeiner jüdischer Arbeiterbund in Polen und Russland« nenne, behauptete er, diese Organisation nicht zu kennen; er habe die Bündel lediglich aus Gefälligkeit gegenüber jemandem mitgenommen, dem er auf der Straße begegnet sei. Die Wohnung in der Ignatiewskaja-Gasse gehörte einer Witwe: Sara Mazower wohnte dort mit ihren drei Söhnen, von denen einer Mordkhel (Max) hieß. Dort fand man nichts Belastendes, ebenso wenig in den Büros des Transportunternehmens Nadeschda, wo er arbeitete. Max – in den Polizeiakten als Buchhalter bezeichnet – wies den Vorwurf zurück, dem Bund anzugehören und illegale revolutionäre Schriften zu verbreiten. Er erklärte, er habe keine Ahnung, wer seine Adresse aufgeschrieben habe oder warum, und sein Chef bescheinigte ihm einen guten Charakter. Davon unbeeindruckt, beschuldigte der Staatsanwalt von Wilna ihn und drei weitere Männer der Mitgliedschaft in einer »kriminellen Geheimorganisation«, die zur Arbeiterbewegung gehöre und staatsfeindliches Material verbreite. Die Polizei nahm ihn fest, da sein Name und der des Unternehmens, bei dem er arbeitete, auch in anderen Ermittlungen aufgetaucht waren. Zudem wusste sie, dass man verdächtige Personen die Wohnung seiner Mutter hatte betreten sehen. Da sie keine weiteren Beweise finden konnten, entließen sie ihn schließlich gegen Kaution aus der Haft und stellten ihn unter Beobachtung, aber er konnte sein Doppelleben wiederaufnehmen.3
»Es gibt Dinge, die schwer zu vergessen sind«, sagt der Held in Ethel Voynichs Erzählung Die Stechfliege, die Max sehr mochte.4 Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, was er wohl hatte vergessen wollen, was im Einzelnen tief in seinen frühesten Erinnerungen vergraben gewesen sein mochte, bevor er als junger Mann sein Doppelleben aufnahm. Wer W. G. Sebalds merkwürdig traumhafte Meditationen Die Ausgewanderten gelesen hat, erinnert sich vermutlich an die geheimnisumwitterte Gestalt am Anfang des Buches:5 Dr. Henry Selwyn, ein älterer englischer Arzt, der in einem Dorf bei Norwich seinen abgeschiedenen, von Melancholie umgebenen Garten pflegt, wurde, wie sich herausstellt, im ausgehenden 19. Jahrhundert als Hersch Seweryn, Sohn einer russisch-jüdischen Familie, irgendwo in der Nähe von Grodno, eine Tagesreise von Wilna entfernt, geboren. Max lebte in England nie auf dem Land in verfallender Pracht, doch auf seine Weise legte er einen ebenso weiten Weg zurück wie Sebalds erfundene Figur und fand wie diese in England eine Zufluchtsstätte für seine Version eines bürgerlichen Daseins. Der wahre Grund, dass er mich an Selwyn erinnert, ist vielleicht aber ein anderer: nämlich die merkwürdige Parallele, dass sein Ausgangspunkt – ein Ort und ein Milieu, über das er nie sprach – ebenfalls Grodno war.
Als Max geboren wurde, war Grodno eine Stadt mit etwa 35 000 Einwohnern im Ansiedlungsrayon. Im ausgehenden 19. Jahrhundert lebten fünfundneunzig Prozent der jüdischen Einwohner des Russischen Reiches in diesem Gebiet. Das war nahezu die Hälfte der weltweiten jüdischen Bevölkerung. Grodnos jüdische Gemeinde bestand seit dem 14. Jahrhundert, und die Mazowers waren bereits seit mehreren Generationen dort ansässig. Ursprünglich hieß Max Mordkhel (Mordechai) nach seinem Großvater, der 1792 geboren wurde und wohl ein Jahr alt war, als das Parlament der alten polnischen Republik in Grodno zum letzten Mal zusammentrat.
Westrussland um 1900.
Nach der Teilung Polens war die Stadt unter russische Herrschaft gekommen und hatte als abgelegener Außenposten an der Nordwestgrenze des Reiches stagniert, bis sie im ausgehenden 19. Jahrhundert einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Mittlerweile hatte sich der Ansiedlungsrayon zu einer demografischen Zeitbombe entwickelt, da die jüdische Bevölkerung des Reiches von 1820 bis 1880 von 1,6 Millionen auf vier Millionen angewachsen war und in zunehmend beengten, ärmlichen Verhältnissen leben musste. In den Städten trat ihre Not am deutlichsten zutage. Die meisten Einwohner Grodnos waren Juden – Mitte der 1880er Jahre etwa 27 000 –, und viele von ihnen lebten in dem seuchengeplagten Elendsviertel jenseits der Memel (Neman), beengt mit bis zu fünfzehn Personen in schmutzigen, abgesackten Hütten ohne Licht, mit bröckelnden Mauern, deren Risse mit Papier geflickt waren. Im Sommer spielten die Kinder halbnackt und barfuß in den stinkenden Gassen voller Pfützen. In den Dörfern war die Lage nicht besser: Dort teilten sich zwei bis drei bettelarme Familien unhygienische Hütten und lebten von ein paar Zwiebeln, einem Hering und etwas Brot pro Tag.6
Es gab eine kleine wohlhabendere Schicht, meist in Verbindung mit der Tabakfabrik, die den größten Teil der Arbeitsplätze in der Stadt stellte. Max sprach nie über seine Kindheit und Jugend, aber einem seiner Vettern ging es als Buchhalter der Fabrik gut genug, dass er sich eine Wohnung außerhalb des jüdischen Viertels leisten konnte. Außerdem beschäftigte er einen Privatlehrer für seine Kinder, damit diese ordentlich Russisch lernten, und besaß ein kleines Holzhaus einige Kilometer außerhalb der Stadt, wo die Familie den Sommer verbrachte und Walderdbeeren und Pilze sammelte. Dieser Vetter half Max später, als er auf der Flucht war, und in den zwanziger Jahren in London mit Unterkünften und Geld. Max revanchierte sich, indem er einen der Söhne seines Vetters unterstützte.
Max’ Eltern waren vermutlich weder reich noch hungerten sie. Mein Vater meinte, Max’ Vater Iosif (Yosl/Osip) habe einen kleinen Betrieb besessen. Semyon, einer von Max’ Brüdern, schrieb einmal, ihr Vater sei ein »schlecht bezahlter Büroangestellter« gewesen. Fest steht, dass er bereits in zweiter Ehe verheiratet war, als Max geboren wurde. Für große Sprünge dürfte es kaum gereicht haben, denn Iosif hatte bereits mehrere Kinder von seiner ersten Frau und dann kamen in rascher Folge drei Jungen hinzu. Max war der erste von ihnen. Laut Frouma wusste Max lediglich, dass er 1874 am »fünften Tag von Chanukka« geboren wurde, zumindest glaubte sie das. Doch selbst das ist ungewiss, denn da Max keine Geburtsurkunde hatte, wurde ihm 1909 eine notariell beglaubigte Bescheinigung von zwei älteren Einwohnern Grodnos ausgestellt, die bezeugten: »Wie uns wohlbekannt und gut in Erinnerung ist, wurde dem rechtmäßig verheirateten Bürger der Stadt Grodno, Yosl Mordkhelovitch Masower und seiner Frau Merka-Sara Jankelevna im Oktober des Jahres 1873 ein Sohn geboren, der den Namen ›Mordkhel‹ erhielt.«
Obwohl seine Schwiegereltern Max wesentlich später in Paris als Dr. Mazower oder schlicht le docteur kannten, verdankte sich dieser Titel eher seiner gepflegten Kleidung, seiner Ausdrucksweise und seiner reservierten Art als einem Diplom oder Doktorgrad: Er studierte nie an der Université de Liège oder der technischen Universität Riga wie manche seiner emigrierten Freunde in London. Tatsächlich hatte er nie eine höhere Schulbildung genossen. Er besaß jedoch eine schnelle Auffassungsgabe und erkannte ohne Weiteres, wie begrenzt die Zukunftsperspektiven in Grodno waren, da schon in den 1880er Jahren viele aus der Provinz auswanderten. Dann passierte die Katastrophe, die vielleicht ein verkappter Segen war: Als Max vierzehn Jahre alt war, starb sein Vater. Der Verlust des Ernährers konnte eine Familie in Armut stürzen, und um ihre Finanzen war es schlecht bestellt. Max und seine Brüder verließen Grodno mit ihrer Mutter umgehend; offenbar hielt sie nichts an diesem Ort.
Einige ihrer Verwandten wanderten über den Atlantik aus, doch die vier zogen lediglich nach Wilna, das um ein Mehrfaches größer war als Grodno, und mieteten dort eine kleine Wohnung. Max musste die Familie ernähren, und sobald er eine Stelle im Büro eines wohlhabenden jüdischen Transportunternehmers namens Lazar Rapoport erhielt, stabilisierte sich ihre Lage. Sein Bruder Zachar fand dort ebenfalls eine Anstellung, während Semyon, der jüngste, eine Lehrstelle als Setzer in einer Druckerei fand. Sie alle traten dem Bund bei und bekamen dadurch Ärger mit der Polizei. Zachar wurde später Zahnarzt und schaffte damit den Aufstieg in die unteren Ränge der Akademikerschicht. Semyon entkam der Welt der Handarbeit nie, litt zeitlebens unter Gesundheitsproblemen und konnte mit fünfzig Jahren nicht mehr arbeiten, weil seine Sehkraft nachließ. Max war anscheinend der Geschäftstüchtigste und brachte es am weitesten. Er begann als Büroangestellter, stieg schon bald zum Vertrauten und persönlichen Assistenten seines Arbeitgebers auf und leitete zur Zeit seiner Verhaftung das Büro, wenn Rapoport nicht im Haus war. Der fähige, diskrete und energische junge Mann besaß ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl und einen trockenen Humor. In einem Zeugnis, das Rapoport ihm 1902 ausstellte, bescheinigte er Max, er habe ihn im Laufe von zehn Jahren als »höchst rechtschaffenen, kultivierten und fleißigen Menschen und tadellosen Angestellten« zu schätzen gelernt – ein Vorbild bürgerlicher Tugendhaftigkeit.
Mittlerweile hatte Max sich dank Wilna auch zu einem überzeugten Revolutionär entwickelt. In der Reihe der Städte, die in dieser Familiengeschichte eine Rolle spielen – London, Paris, Moskau –, war Wilna die erste und vielleicht wichtigste. Grodno war im Grunde eine jüdische Stadt mit niedrigen Holzhäusern und einer großen Fabrik. Dagegen war Wilna ein Mikrokosmos des Russischen Reiches. Die heutige Hauptstadt Litauens war damals ein florierendes, polyglottes Handelszentrum, das mehr und mehr zur Brutstätte politischer Rivalitäten wurde, als sich die jeweiligen Kämpfe um den polnischen Nationalismus, um die Wiederbelebung jiddischer Kultur und um den russischen Sozialismus verschärften. Die zaristischen Behörden fühlten sich von allen Seiten von Feinden umzingelt; nach Angaben der Polizei wimmelte es in der Stadt von Revolutionären, und nach ihrer Einschätzung gehörten die »entschlossensten und engagiertesten« zum in Wilna gegründeten Bund.
Die eleganten neuen Boulevards und Plätze im Stadtzentrum konnten die Behörden mehr oder weniger im Auge behalten, weitaus prekärer war ihre Kontrolle über die Seitengassen, in denen Prostitution und Bettelei grassierten und das Abwasser offen durch die Gosse floss. Nicht weniger als vierzig Prozent der Einwohner Wilnas waren jüdisch, darunter viele Arbeiter in den Textilfabriken und Ausbeuterbetrieben, Packer, Pförtner, Hausierer und Bürstenmacher, und aus der Begegnung dieser arbeitenden Männer und Frauen mit den gebildeteren jüdischen Studenten der Stadt war der Bund hervorgegangen. In den frühen 1890er Jahren, nicht lange nach Max’ Umzug in die Stadt, gründeten jugendliche jüdische Sozialisten Diskussionszirkel, um sich in politischer Theorie fortzubilden – vermutlich gehörte Max diesen Gruppen an. Schon bald gingen sie zu der praktischeren Aufgabe über, die jiddischsprachigen Arbeiter der Stadt gewerkschaftlich zu organisieren. Im Oktober 1897 trafen sich Vertreter mehrerer jüdischer Arbeiterorganisationen aus den Hauptorten der Region im Dachgeschoss eines bescheidenen Hauses am Stadtrand von Wilna und gründeten den Bund, die erste marxistische Massenpartei der russischen Geschichte. Diese Aktivisten wollten eine Basisorganisation der Arbeiter schaffen und besaßen die dafür notwendigen Beziehungen, die Geduld und das Können. Im Laufe der folgenden zehn Jahre bauten sie den Bund zur größten und mächtigsten Arbeiterbewegung des Russischen Reiches aus.
Wilna war ein Einfallstor für die Sprachen und die Kultur Europas, ein Ort, an dem man sich im Maison Schmidt auf der Rue Grande fotografieren lassen konnte und doch im Russischen Reich war. Durch die Eisenbahnanbindung war die Stadt ein Zentrum für Auswanderungsagenten, die ihr Geld damit verdienten, Bauern bei der Emigration zu helfen. Die Eisenbahn brachte Bücher, Flugschriften und Zeitungen aus West- und Mitteleuropa und Studenten, die aus Berlin und Zürich zurückkehrten. Es war ein Umfeld, in dem moderne Ideen zirkulierten und geschätzt wurden. Mordkhel aus Grodno änderte seinen Namen, so dass er russischer und europäischer klang. Offenbar entschied er sich zunächst für Markus – »Markus Osipovich Mazower« nannte Rapoport ihn in seinen Zeugnissen – und später für Max, wie er für den Rest seines Lebens hieß. In Wilna passte Max sich in Kleidung und Manieren der bürgerlichen Kultur im Zarenreich an, die er in Cafés, Fabriken, Buchhandlungen und Mietshäusern im Wiener Stil kennenlernte. Von da an kleidete er sich adrett, trug Krawatte, Weste und meist ein bis oben zugeknöpftes Jackett. Mit seinem ordentlich gestutzten Schnäuzer und Kinnbart hat er auf frühen Fotografien beinahe etwas Dandyhaftes in jener Mittelschicht-Uniform, die auf dem gesamten Kontinent als eine Art Pass fungierte. Es ist sicher kein Zufall, dass die ersten Fotos von ihm erst nach seinem Umzug nach Wilna entstanden, da die Fotografie als solche eine Art von Bestätigung der guten gesellschaftlichen Stellung ermöglichte. Das Stadtleben machte ihn jedoch auch zu einem Mitglied der Intelligenzija, wie die gebildeten Schichten im Russischen genannt werden, sowie zu einem konspirativen Revolutionär. Denn nicht nur in der marxistischen Theorie setzte die Revolution das Aufkommen bürgerlicher Werte voraus, sondern auch im tatsächlichen Leben. Führende Bundisten strebten ein respektables Erscheinungsbild an; viele Mitglieder seines Zentralkomitees hatten eine Vorliebe für Pferderennen, die damals als Symbol bürgerlichen Lebensstils galten. Die Arbeit in einem Handelsunternehmen vermittelte Max die Fertigkeiten und die Sprache für seine revolutionäre Arbeit und verschaffte ihm nicht zuletzt das nötige logistische Netzwerk. Seine Russischkenntnisse – etwas, worüber nicht einmal fünf Prozent der Juden im Ansiedlungsrayon verfügten – eröffneten ihm den Zugang zur klassischen marxistischen Theorie und zu einer bestimmten Weltsicht.
Dass Max sich der Ironie dieser Situation durchaus bewusst war, wissen wir durch eine Anekdote, die einer seiner Genossen, ein gewisser Sholem Levine, später erzählte. Er war ein junger Bundist und kam im Winter 1899 nach Wilna, um eine illegale Druckerei einzurichten. Als ihm das Geld ausging und er sich die Miete nicht länger leisten konnte, kam seine Freundin auf eine Idee: Sie sollten ihrer Familie sagen, sie würden heiraten, und dann die Mitgift verwenden, die ihr reicher Bruder ihr versprochen hatte. Wie Levine in seinen Erinnerungen schildert, wurde Max als Mitglied des Zentralkomitees in Wilna gebeten, den Plan zu genehmigen. Das tat er mit dem trockenen Kommentar: »Es ist ein Segen [mitzvah], von einem Bourgeois Geld zu nehmen, um eine illegale Druckerei einzurichten.« Es ist die einzige Äußerung von ihm, die uns aus diesen ersten Jahren überliefert ist, und sie ist zugleich pragmatisch, witzig und gebieterisch. Nur zwei Jahre nach Gründung des Bundes gehörte Max mit fünfundzwanzig Jahren bereits dem Führungsgremium an, das die Organisation an ihrem wichtigsten Standort leitete.7
Max um 1905.
Da die Nadeschda-Handelsgesellschaft, für die er arbeitete, ihren Sitz in St. Petersburg hatte und Warentransporte in das gesamte Russische Reich tätigte, bot sie ihm die perfekte Tarnung. Die Bundisten aus Wilna waren in der ganzen Partei für ihre strengen Sicherheitsmaßnahmen bekannt und konnten dank ihrer Vorsicht und Disziplin das Eindringen von Polizeispitzeln in Grenzen halten. Daher waren sie den Behörden gewöhnlich einen Schritt voraus, was in anderen Städten nicht der Fall war. Bei seiner Verhaftung 1901 war Max schon seit mindestens fünf Jahren für den Druck und die Verbreitung illegaler jiddischer Schriften in einem Gebiet von Warschau über Białystok bis Witebsk verantwortlich und betreute die Veröffentlichung der illegalen Zeitschrift Der Klassenkampf, eines Organs des Komitees in Wilna. Es gab noch weitere Aufgaben: mit Vordrucken, die aus städtischen Ämtern gestohlen waren, Pässe fälschen; Waffen kaufen; im Ausland Druckerpressen erwerben und deutsche Handwerker einschleusen, die bei ihrer Bedienung helfen konnten. Wilna war ein revolutionärer Knotenpunkt für Nordwestrussland, und Max befand sich in dessen Zentrum. Max, den die Agenten der zaristischen Geheimpolizei Ochrana, die ihn beschatteten, »den Gutaussehenden« nannten, um ihn von seinem Bruder Zachar zu unterscheiden, war ein perfekter Organisator, der sich im Hintergrund hielt, nie das Podium suchte, aber genau wusste, was zu tun war, wenn eine neue Druckerpresse gebraucht wurde, ein Aktivist in eine oder aus einer Gefahrenzone geschmuggelt werden musste oder es Arbeiter zum Streik zu bewegen galt.8
Außer der eleganten Kleidung und den Ansichten eines Mitglieds der Intelligenzija legte sich Max noch einen Decknamen zu, ein fester Bestandteil der Kultur aller Untergrundparteien jener Zeit. Allein im Bund finden sich alle erdenklichen Pseudonyme: Verbreitet waren Hinweise auf die Haarfarbe: der »Rote«, der »Schwarze«, »Max der Weiße«. Einer, der gern und viel aß, hieß »Soße«; Namen wie »der Philosoph«, »der Verrückte« oder »der Kämpfer« erklärten sich von selbst. Häufig wählten Mitglieder eine Version ihres Vornamens, was vermuten lässt, dass sie weniger von Sicherheitserwägungen als von dem Wunsch motiviert waren, zum Kreis derer zu gehören, die sich duzten.9 Bei Max war es eindeutig eine Sicherheitsvorkehrung, doch welchen Namen er benutzte, ist alles andere als leicht herauszufinden: Selbst seine Frau Frouma irrte sich in dieser Hinsicht nach seinem Tod. Das Hauptproblem ist, dass die Korrespondenten des Bundes es in Briefen, Parteiunterlagen und Zeitungsartikeln vermieden, die Klarnamen zu erwähnen. Daher ist oft nur schwer zuzuordnen, wer sich hinter einem Decknamen verbirgt. In einem wesentlich späteren Werk benannte Jacob Hertz, ein Chronist der Bewegung, Max als Autor mehrerer Artikel, die unter dem Pseudonym »Daniel« erschienen waren, was eine kürzlich in den Moskauer Archiven entdeckte Akte bestätigte. Ein Agent der Ochrana verfolgte 1904 die Spur von Briefen, die ein Bundist in Wilna namens »Wolf« an einen gewissen »Daniel« in Warschau geschickt hatte. Wolf war Teil eines Netzwerks in Wilna, zu dem Max’ Bruder Zachar gehörte, und Daniel war offenbar ein erfahrener Funktionär des Bundes, da er strenge Sicherheitsvorkehrungen traf. Er sorgte dafür, dass die Briefe nicht unmittelbar an ihn gesandt, sondern in einem Kurzwarenhandel in Warschau hinterlegt wurden. Dort holte er sie nicht etwa persönlich ab, sondern ließ sie von einer dritten Partei, einer jungen Krankenschwester und Verwandten des Ladeninhabers, holen, die sie vermutlich an ihn weiterleitete. Ein Großteil der Briefe war abgefangen worden und schien Lieferungen geheimer Flugblätter in die polnische Hauptstadt zu betreffen, obwohl das schwer zu beurteilen war: Die Ochrana konnte den Code, mit dem der Inhalt der Briefe verschlüsselt war, nicht knacken. Wie der Agent seinen Vorgesetzten in Moskau berichtete, hatten er und seine Kollegen jedoch herausfinden können, wer Daniel war: der älteste der Mazower-Brüder, Max.10
Diesen Namen hatte Max nicht zufällig gewählt: Vielmehr war er ein Hinweis auf seine Wurzeln in Grodno und vielleicht auch auf seine Hoffnungen. Ursprünglich verwies der Name auf den Propheten des Alten Testaments, dem offenbart wurde, was die Zukunft bereithielte, sobald die damaligen Könige besiegt wären. Dieses Pseudonym hatte sich ein Vertreter der vorhergehenden Generation zugelegt: Aaron Lieberman, den manche den Vater des russischen Sozialismus nannten. Er stammte wie Max aus der Region Grodno und hatte sich seine Bildung einige Jahre früher in den Studierzirkeln angeeignet. Wie Max war er vorrangig an der Verbreitung des Sozialismus in der jüdischen Arbeiterklasse interessiert und lehnte den Nationalismus ebenfalls ab in der Überzeugung, dass »Juden ein fester Bestandteil der Menschheit sind und nur durch die Befreiung der Menschheit befreit werden können«. Lieberman war 1876 vor Verfolgung aus dem Zarenreich geflüchtet und hatte im Londoner East End die erste Vereinigung jüdischer Sozialisten gegründet, bevor er in die Vereinigten Staaten emigriert und dort 1880 gestorben war – ein noch junger Intellektueller und Aktivist, dessen ehrendes Andenken nicht nur Max, sondern viele andere bewahrten.
Liebermans Generation hatte nicht viel für das Jiddische übrig, jene bodenständige Mischung aus Mittelhochdeutsch, Hebräisch und Slawisch, die von den meisten Juden im Ansiedlungsrayon gesprochen wurde. Nach ihrer Ansicht war Russisch die Sprache der Bildung und der von ihnen angestrebten sozialistischen Kultur. Lieberman schrieb häufig in einem recht komplexen Hebräisch, hatte jedoch im Gegensatz zu anderen die Verwendung des Jiddischen gefördert, und das mag für Max und sein Umfeld das Wichtigste gewesen sein, da die Wiederbelebung des »Jargons« im Zentrum ihrer Politik stand. Dafür gab es ausgesprochen praktische Gründe: Für eine erfolgreiche Agitation war es notwendig, die Massen anzusprechen, und da mehr als fünfundneunzig Prozent der jüdischen Arbeiter im Ansiedlungsrayon kein Russisch verstanden – wer wie Max Russisch sprechen konnte, hob sich bereits ab –, war es unerlässlich, sie in einer ihnen geläufigen Sprache zu adressieren. Da Jiddisch damals nur eine gesprochene Sprache, keine Schriftsprache war, betätigten sich die frühen Bundisten als Übersetzer, Dichter und Dramatiker.
In Wilna gründeten sie ein »Jiddisch-Komitee«, das sich heimlich in den Wohnungen respektabler Apotheker und Ärzte traf, die mit ihnen sympathisierten. Diese Gruppe suchte nach Materialien, die »sozialistische Einstellungen« fördern und Widerstandsgeist wecken würden. Zuweilen schrieben die Mitglieder selbst Geschichten oder sie suchten aus dem Russischen oder anderen Sprachen Kurzgeschichten, Romane und klassische Schriften der marxistischen politischen Ökonomie aus. Viele dieser Werke waren mit Vorsicht zu behandeln, da sie die Zensur nicht passiert hätten. Max gehörte diesem Komitee an und war vor allem für Druck und Verbreitung der Schriften zuständig. Nahezu mit Sicherheit hatte er in Grodno Jiddisch gesprochen, bevor er Russisch lernte, allerdings weiß ich nicht, ob er die Sprache seiner Kindheit je wieder sprach, nachdem er seine Arbeit für den Bund beendet hatte – als gebildeter Mann bevorzugte er immer Russisch. Damals übersetzte er neben seinen Verwaltungsaufgaben Kurzgeschichten, schrieb Rezensionen zu jiddischen Theaterstücken und war mit mehreren Schriftstellern befreundet. Vor allem auf ein Buch muss er viel Zeit verwendet haben, da er es vollständig übersetzte: ein radikaler englischer Roman der Jahrhundertwende mit dem Titel Die Stechfliege.11
Der Roman stammt von der englisch-irischen Schriftstellerin Ethel Voynich, die Mitherausgeberin der antizaristischen Londoner Zeitschrift Free Russia war und sich aktiv in radikalen Zirkeln engagierte. Die Tochter des Logikers George Boole sprach Russisch und war mit einem Exil-Polen verheiratet, der zu einem erfolgreichen Antiquar wurde (bis heute ist er Wissenschaftlern als Entdecker des mysteriösen und noch immer nicht entschlüsselten Voynich-Manuskripts in Erinnerung). Doch Ethel Voynich war ebenso bemerkenswert wie diese beiden Männer und erlangte durch ihre Novellen eine Zeit lang Bekanntheit. Die Stechfliege spielt in der Zeit des Risorgimento in Italien und handelt von einem geflüchteten freiheitsliebenden Helden, der flammende Traktate und Satiren verfasst. Der Roman orientierte sich an dem berühmten italienischen Republikaner Giuseppe Mazzini, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts aktiv war, und stellte eine offenkundige Allegorie für den Freiheitskampf in Russland dar. In England war er erfolgreich – genug, um Joseph Conrad zu ärgern, der sich damals bereits mit den Themen beschäftigte, aus denen später seine bemerkenswerte Studie zum Terrorismus Der Geheimagent hervorgehen sollte – und fand auch bei den Linken in anderen Ländern großen Anklang. Er zirkulierte nicht nur in einer russischen Übersetzung weithin unter Sozialisten, sondern erfreute sich auch nach 1917 enormer Popularität und wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem sensationellen kommunistischen Bestseller, von dem allein in der UdSSR schätzungsweise mehr als vier Millionen Exemplare verkauft wurden.
Einen ebenso dramatischen, wenngleich indirekteren Erfolg hatte er im kapitalistischen Westen. Sidney Reilly, der berühmte britische »Spion der Spione«, nahm sich angeblich Voynichs Helden zum Vorbild, wenngleich bei Reilly Wirklichkeit und Fantasie schwer zu unterscheiden sind. Er behauptete, er habe eine Affäre mit der Autorin gehabt, was vermutlich wie die meisten seiner Behauptungen nicht den Tatsachen entsprach. Gesichert wissen wir über ihn nur, dass sein richtiger Name Rosenblum lautete, dass er jüdisch war, um dieselbe Zeit wie Max in Russland geboren wurde, für den britischen Secret Intelligence Service arbeitete, nach 1917 die Bolschewiki zu stürzen versuchte und 1925 von der sowjetischen Geheimpolizei (OGPU) erschossen wurde.12 Viele Jahre später verwendete Ian Fleming Reilly, der ihn faszinierte, als Vorlage für James Bond und machte damit Die Stechfliege zu einer überraschenden Inspirationsquelle für den berühmtesten Agenten des Kalten Krieges.
Max und Reilly waren offenkundig beide von diesem Roman fasziniert. Doch trotz der Aura des Geheimnisvollen, die Max in seinem späteren Leben umgab, war er ein völlig anderer Typ als der schillernde Geheimagent. Reilly war ein Schürzenjäger, ein Abenteurer, der offenbar nicht einmal vor Mord zurückschreckte, hemmungslos log, das Luxusleben liebte und kaum klare politische Prinzipien besaß. Was Max an Voynichs Roman gefiel, war, glaube ich, etwas, das Reilly zweitrangig gefunden hätte: die Idealisierung des selbstlosen, leidvollen Lebens der Revolutionäre. In dem ernsthaften Bestreben, sich und andere weiterzubilden, schrieb Max eine lange historische Einleitung zu der jiddischen Übersetzung – ein Text in einem trockenen Stil, wie wir ihn von einigen anderen seiner Schriften kennen, während Voynichs Roman alles andere als trocken war. Suchte er dieses Buch gerade deshalb aus, weil es die Leidenschaft und den Pathos des von ihm gewählten einsamen Weges zum Ausdruck brachte, wie er es nicht konnte?
Als die jiddische Übersetzung von Die Stechfliege 1907 in Wilna erschien, war Max bereits mehr als ein Mal durch Festnahme, Inhaftierung und Flucht auf die Probe gestellt worden. Seit Mitte der 1890er Jahre hatte die Ochrana ein Auge auf ihn, und 1901 war es zu dem bereits erwähnten Zwischenfall gekommen. Angesichts des zunehmenden Einflusses des Bundes war es lediglich eine Frage der Zeit, wann man ihn erneut festnehmen würde. Im Februar 1902 wurde er verhaftet und diesmal zu drei Jahren Verbannung unter Polizeiaufsicht in dem entlegenen Dorf Ujarskoje bei Kansk verurteilt, einen Ort, der etwa fünftausend Kilometer östlich von Wilna an der Transsibirischen Eisenbahnlinie lag.
Die Härten dieser Erfahrung, über die Max nie sprach, sind ansatzweise aus den Memoiren der jüdischen Sozialistin Marie Sukloff aus dem Ansiedlungsrayon zu erahnen, die nicht weit von Kansk entfernt in der Verbannung landete. Darin schildert sie eine anstrengende, unberechenbare mehrtägige Fahrt in überfüllten, eiskalten Gefangenenwaggons, lediglich unterbrochen von Zwischenaufenthalten in schmutzigen, typhusverseuchten Gefängnissen an der Strecke, zu denen sie in der Regel vom Zug aus unter Bewachung zu Fuß über eis- und schneebedeckte Straßen laufen mussten. In Kansk wurden politische Gefangene selbst in den Wintermonaten in unbeheizten Baracken untergebracht und von dort zu Fuß durch die verschneiten sibirischen Wälder in die abgelegenen Bauerndörfer geschickt, die ihr Bestimmungsort waren. Bücher waren selten, Zerstreuung bot hauptsächlich Alkohol, und die ungebildeten Dörfler begegneten den »vornehmen« Fremden in ihrer Mitte mit Argwohn und Respekt. Max hielt es nur wenige Monate in den Wäldern am Jenissei aus. Am 13. Juli 1902 flüchtete er. Die Polizei gab einen Fahndungsaufruf heraus nach »Mazover, Mordkhel Ioselev, Bürger der Stadt Grodno«. Beamte sollten nach einem 1,65 Meter großen Mann mit »dunkelblondem Haar« und braunen Augen Ausschau halten. Doch die Suche war vergebens: In ihrer Ausgabe vom November 1902 berichtete Voynichs Zeitschrift Free Russia, dass sich unter den fünf Bundisten, die kurz zuvor aus Sibirien in »freiere Länder« geflüchtet seien, ein gewisser »M. Mazover« befand.13 Max ging nach Deutschland und schloss sich in Berlin einer bundistischen Studentengruppe an. Außer Trotzkis Schwester waren in der Stadt auch viele spätere Prominente – wie auch Gegner – des bolschewikischen Staates.
Es bestand immer die Gefahr, dass zaristische Spione den Bund unterwanderten. Tatsächlich hätte eine Verhaftungswelle die Bewegung in den ersten Monaten ihres Bestehens beinahe im Keim erstickt, und obwohl sie sich bald von diesem Schlag erholte, hatte er bleibende Nachwirkungen. Die Organisation in Wilna ergriff Vorkehrungen, sich gegen Infiltration zu schützen, und schreckte auch nicht vor einer Bestrafung enttarnter Informanten zurück. Nachdem die Bundisten 1902 den Gouverneur von Wilna zu ermorden versucht hatten, ging die Polizei rigoros gegen sie vor. Doch die russischen Behörden waren keineswegs ihr einziger Gegner. Gläubige Mitglieder der jüdischen Gemeinde hielten die Bundisten für gottlose Materialisten und Terroristen und missbilligten besonders, dass unter den Aktivisten junge Frauen waren. Der Bund redete seinerseits der proletarischen Revolution das Wort und prangerte regelmäßig die Feigheit wohlhabender Juden an, die meinten, ihr Geld könne ihnen Sicherheit erkaufen. Kader des Bundes waren berüchtigt, weil sie Synagogen stürmten und sozialistische Reden schwangen, daher beschimpften Rabbiner die Organisation in ihren Predigten. Die Bewegung bekämpfte zudem kriminelle jüdische Banden aus der Prostitutions- und Glücksspielunterwelt, die in den Städten des Ansiedlungsrayons florierten, weil sie enge Beziehungen zu Polizei und Arbeitgebern pflegten, von denen sie als Streikbrecher eingesetzt wurden.
Die für die Zukunft wichtigsten Gegner kamen jedoch aus der Linken. Anfangs hatten die Leistungen des Bundes Lenin zwar imponiert, in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts begann er ihn jedoch als Bedrohung zu sehen und wandte sich gegen die Vorstellung, russisch-jüdische Arbeiter bräuchten eine eigene Bewegung. Das führte zu einem tiefgreifenden Bruch zwischen Lenin und dem Bund, der nie wieder gekittet werden sollte. Der nachdrückliche Anspruch des Bundes, er vertrete das jiddischsprachige jüdische Proletariat des Russischen Reiches, lief Lenins Vision einer einzigen, von ihm kontrollierten, russischsprachigen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei mit straff zentralistischer Organisation zuwider. Dahinter stand die weiter reichende Frage, wie man die zahlreichen ethnischen Gruppen des Zarenreiches in den Schoß der revolutionären Bewegung bringen sollte, zumal viele von ihnen kein Russisch sprachen. In Anbetracht der Stärke des Bundes vertiefte Lenin sich in dessen Argumente, las seine Publikationen und begann – anfangs respektvoll, später mit wachsender Ungeduld – seine Einwände vorzubringen.
Dabei ging es nicht nur um theoretische Argumente, sondern auch um eine persönliche Auseinandersetzung, ausgetragen aus nächster Nähe, denn damals lebten sowohl Lenin als auch mehrere führende Exil-Bundisten in Bern, wo sie reichlich Gelegenheit hatten, ihren Gegner zu treffen und kennenzulernen. »Äußerlich machte er keinen guten Eindruck«, erinnerte sich der Theoretiker des Bundes, Vladimir Medem. »Nach allem, was ich gehört hatte, stellte ich mir einen baumlangen Revolutionär vor […], eine große Nummer. Was ich vor mir sah, war jedoch ein kleiner lebhafter Mensch […] mit flachsblondem Bärtchen, Glatze und winzigen braunen Augen. Ein schlaues Gesicht, aber kein intelligentes. Er erinnerte mich damals – und der Vergleich kam mir auf Anhieb in den Sinn – an einen ausgefuchsten russischen Getreidehändler.« Lenin war kein starker, imposanter Redner, doch zwei Dinge fielen Medem unwillkürlich auf: sein eiserner Wille und sein Misstrauen gegenüber Menschen.14
Max geriet in die zunehmenden Streitigkeiten, als er kurz nach seiner Flucht die Einladung erhielt, an einem der wichtigsten Treffen des Bundes teilzunehmen: einer geschlossenen Sitzung der Parteiführung, die im Frühjahr 1903 in Genf stattfand. Lenin hatte gerade in einem Artikel unter der Überschrift »Braucht das jüdische Proletariat eine ›selbständige politische Partei‹?« einen weiteren unmittelbaren Angriff auf den Bund veröffentlicht und darin seine Frage erwartungsgemäß abschlägig beantwortet. Die Sitzung des Bundes wurde einberufen, um darauf eine Antwort zu formulieren. Da nur zehn Personen teilnahmen, darunter mehrere Gründer des Bundes, zeugt Max’ Anwesenheit von seiner angesehenen Stellung innerhalb der Organisation. Da war der kettenrauchende Arkadi Kremer, der »Vater des Bundes«, ein Theoretiker der revolutionären Agitation, dessen Schrift zu diesem Thema erheblichen Einfluss auf Lenin hatte; John Mill, hinter dessen englisch klingendem Namen sich eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Bundes und der Gründer seines einflussreichen Auslandskomitees verbarg; sowie Evgenia Gurvitz, eine von mehreren Frauen in wichtigen Positionen. Max vertrat das Komitee von Wilna gemeinsam mit seinem Genossen Julius Lenski, der zusammen mit ihm aus Sibirien geflüchtet war. (Später schloss sich Lenski den Bolschewiki an und stieg laut einer internen Quelle in eine Führungsposition in der Tscheka, dem Vorläufer des KGB, auf.)
Die Teilnehmer an der Genfer Sitzung bekräftigten, dass jüdische Arbeiter ihre eigene politische Bewegung brauchten, und kündigten entschiedenen Widerstand gegen jegliche Bestrebungen an, den Bund in der größeren Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands aufgehen zu lassen. Damit spitzte sich die Lage zu. Noch im selben Jahr kam es auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands zur berüchtigten Spaltung in Menschewiki und Bolschewiki. Weniger bekannt ist, dass die Bundisten Lenin und seinen Anhängern damals diktatorische Tendenzen vorwarfen und sich völlig zurückzogen. Sie forderten ihre Anerkennung als alleinige Vertreter russisch-jüdischer Arbeiter in der Partei und verlangten, die Partei solle sich hinter die Idee einer kulturellen Autonomie verschiedener nationaler Gruppen im Russischen Reich stellen. Einige Jahre später willigte die Partei in die zweite Bedingung ein und nahm den Bund wieder auf, nachdem dieser die erste Forderung stillschweigend fallengelassen hatte. Im Laufe der Zeit schlossen sich die Bundisten zunehmend dem Flügel der Menschewiki an, aus diesem Grund finden sich unter ehemaligen Menschewiki viele, die anfangs dem Bund angehörten. Max unterhielt über die Jahre hinweg enge Freundschaften zu Menschewiki und ihren Familien. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass seine Kenntnisse des Bolschewismus – und sein Misstrauen gegenüber dessen autoritärem Führer – auf diese Zeit lange vor der Revolution zurückgingen, als Lenin den Bund als eine der größten Gefahren für die Einheit der Partei betrachtete.