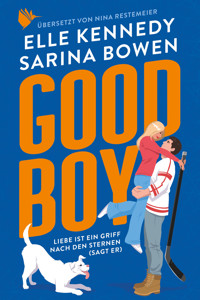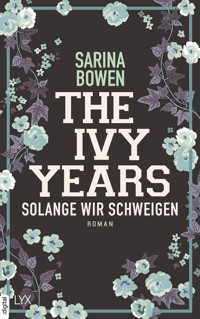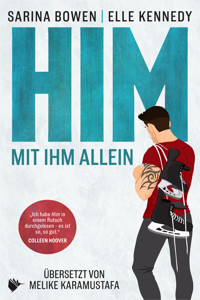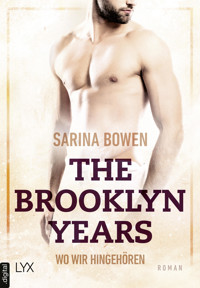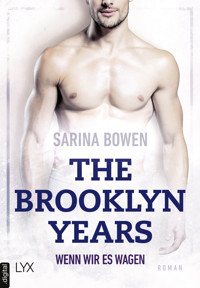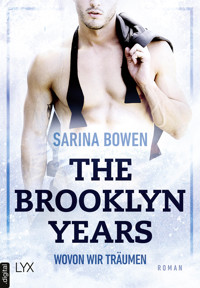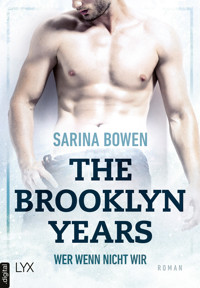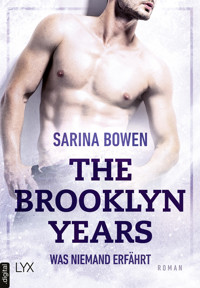9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Burlington University
- Sprache: Deutsch
Egal, was auch passiert, mein Herz wird dich nie vergessen
Als Daphne Shipley den attraktiven Rickie bei einer Mitfahrgelegenheit vom College nach Hause kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu ihm hin gezogen - bis er sie bei ihrem ersten Date versetzt. In Burlington treffen sich die beiden zufällig wieder - aber Rickie kann sich nicht mehr an sie erinnern! Zwar ist die Anziehung zwischen ihnen größer denn je, doch Daphne hat Angst, ihr Herz zu riskieren. So leicht gibt Rickie jedoch nicht auf, aber je mehr Zeit er mit Daphne verbringt, desto stärker kommt die Erinnerung an etwas zurück, das ihre Liebe zerstören könnte, bevor sie überhaupt angefangen hat ...
"Eine Geschichte, die unwiderstehlich ist -spannend, emotional, tiefgründig und sexy." SHELLY von BOOKGASMS BOOK BLOG
Band 2 der BURLINGTON-UNIVERSITY-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Die Autorin
Die Romane von Sarina Bowen bei LYX
Impressum
SARINA BOWEN
Was ich dir bedeute
BURLINGTON UNIVERSITY
Roman
Ins Deutsche übertragen von Wanda Martin
Zu diesem Buch
Als Daphne Shipley den attraktiven Rickie bei einer Mitfahrgelegenheit vom College nach Hause kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu ihm hingezogen. Die beiden verabreden sich auf ein Date, doch dann taucht Rickie nicht auf, und Daphne hört nie wieder etwas von ihm – bis ihr Bruder ihn ihr zwei Jahre später als seinen neuen Mitbewohner vorstellt. Aber Rickie kann sich nicht mehr an sie erinnern! Dennoch ist die starke Anziehung zwischen ihnen gleich wieder da. Doch Daphne hat Angst, ihr Herz zu riskieren. Zu tief ist die Enttäuschung darüber, dass er sie damals versetzt hat, und auch die Trennung von ihrem Ex-Freund hat schlimme Narben auf ihrer Seele hinterlassen. So leicht gibt Rickie jedoch nicht auf, denn es gibt einen guten Grund, warum er sich nicht erinnern kann: Bei einem schweren Unfall kurz nach ihrem Kennenlernen wurde ein halbes Jahr seines Lebens aus seinem Gedächtnis gelöscht. Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto stärker kommt die Erinnerung an jene Nacht zurück, in der er sich mit Daphne treffen wollte. Doch diese Erinnerung könnte ihre Liebe zerstören, bevor sie überhaupt angefangen hat …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
1
Rickie
Die Mittagszeit auf der Shipley-Farm ist vorbei, und jetzt stehen wir wieder draußen in der heißen Sommersonne. Ich arbeite schon seit ein paar Wochen auf der Farm, deshalb kenne ich die Abläufe. Frühmorgens helfe ich zuerst meinem Freund Dylan dabei, die Kühe und Ziegen zu melken. Dann frühstücken wir, bevor wir den restlichen Vormittag lang schuften.
Meine Beine und mein Rücken sind schon müde davon, Löcher für Zaunpfosten auszuheben. Im Grunde meines Herzens bin ich ein Stadtkind, deshalb waren die letzten paar Wochen für mich eine Herausforderung.
»Du hast das doch schon mal gemacht, oder?« Dylan gibt mir einen Drahtkorb mit Holzgriff. »Leg die Eier da rein.«
»Na klar.« Dabei habe ich noch nie Eier eingesammelt. Immerhin hört es sich einfacher an, als Fünfundzwanzig-Kilo-Säcke Futter zu schleppen.
Er gibt mir außerdem noch einen Milchkanister aus Plastik, der oben abgeschnitten ist und ein geflochtenes Seil durch den Henkel gefädelt hat. »Der ist fürs Blaubeerpflücken. Du hängst ihn dir um den Hals, sodass du beide Hände zum Pflücken frei hast.«
»Mega. Ich bin nämlich echt geschickt mit den Händen.« Ich hebe den Blick zu Dylans Zwillingsschwester Daphne. Und klar doch, ich stelle fest, dass sie mich mit neugierigen braunen Augen ansieht, in die sofort ein harter Ausdruck tritt, als ich sie beim Glotzen erwische. Mal wieder.
Mit Daphne zu flirten, ist das Zweitbeste an der Arbeit auf der Farm. Das Allerbeste ist das Essen. Ehrlich, ich würde die Reihenfolge dieser Vorteile ja mit Vergnügen tauschen, nur hat mich das Flirten nicht dahin gebracht, wo ich hinwill. Noch nicht.
Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Daphne weiß, was sie will. Ich habe keine Ahnung, warum sie so scheu ist, aber ich lasse ihr Zeit und Raum, ihre Zurückhaltung zu überwinden. Trotzdem bleibt sie bisher weiter auf Distanz und wirft mir jedes Mal heimliche Blicke zu, wenn sie denkt, dass ich es nicht merke.
Spoileralarm: Ich merke es immer.
»Okay, Kinder«, sagt Dylan mit einem leisen Lachen. »Ich werde rechtzeitig wieder da sein, um die Hühner reinzutreiben und um das zweite Mal zu melken. Sei nachsichtig mit ihm, Daph«, bittet er seine Schwester.
»Wieso?«, fragt sie. »Jeder hat seinen Teil der Aufgaben zu erledigen. Sogar der Neue.«
»Ja, ich weiß. Aber das hab ich nicht gemeint.« Er zwinkert. »Sei nett.«
»Hey, das passt schon«, versichere ich. »Ich mag deine Schwester.«
Sie presst die Lippen zusammen.
Dylan lächelt. Dann winkt er uns zum Abschied und läuft mit großen Sätzen zu seinem Pick-up, in dem seine Freundin schon wartet, um mit ihm in die Stadt zu fahren und Besorgungen zu machen.
Sobald er weg ist, drehe ich mich zu Daphne um. »Das passt gut. Denn wir müssen mal reden.« Seit meiner Ankunft hier ist dies so ziemlich das erste Mal, dass wir unter uns sind. Daphne beobachtet mich immer mit sehnsüchtigem Blick. Aber sie redet nicht mit mir. Wenn ich einen Raum betrete, geht sie hinaus.
Sie hat Angst, sich mir gegenüber zu öffnen. Ich muss bloß herausfinden, warum.
»Wir sind nicht zum Reden hier«, sagt sie. »Die Beeren pflücken sich nicht von allein.«
»Na gut, sollen wir dann zuerst Beeren pflücken? Oder die Eier einsammeln?«
»Arbeitsteilung: Ich übernehme die Beeren.« Sie nimmt mir einfach den Milchkanister weg. »Du holst die Eier.«
»Aber …« Diese Aufteilung passt mir gar nicht. »Wieso denn nicht zusammen? Wir könnten währenddessen eine nette kleine Unterhaltung darüber führen, warum du mir ständig aus dem Weg gehst. Außerdem mögen die Hühner mich nicht. Schick mich da nicht allein rein.«
Sie bleibt ruckartig stehen. »Wart mal, hast du etwa Angst vor den Hühnern?« In ihre braunen Augen tritt ein Leuchten, so als hätte ich ihr gerade ein wertvolles Geschenk gemacht.
»Überhaupt nicht. Hab ich das etwa behauptet?« Ich habe nicht wirklich Angst vor Hühnern. Wir essen ein paarmal die Woche Huhn, ich bin mir also ziemlich sicher, wer hier vor wem Angst haben sollte.
Die Augen von denen sind ein bisschen gruselig – die Art, wie sie einen erst von einer Seite ihres spitzen Kopfs her ansehen, bevor sie zur anderen wechseln.
Aber egal. Daphne hängt sich den Kanister für die Beeren schon um ihren schlanken Hals. Daphne Shipley besteht aus nichts als langen Gliedern und goldbrauner Sommerhaut. Sie hat weich aussehendes braunes Haar und ausdrucksstarke braune Augen, deren Ausdruck in schwindelerregendem Tempo von böse zu fröhlich wechseln kann.
Und ich bin unheimlich verknallt in sie.
»Hol die Eier. Lass bloß keins liegen«, ruft sie über ihre Schulter hinweg. »Heute müssten es dreizehn oder vierzehn Stück sein.« Mehr hat sie nicht zu sagen, ehe sie in dem Blaubeerhain aus ungefähr einem Dutzend Büschen in drei Reihen verschwindet.
Die Büsche sind zwar nicht so groß wie ich, aber als sich Daphne vorbeugt, verschwindet sie darin und lässt mich mit dem Drahtkorb, allzu vielen Fragen und meiner sexuellen Frustration allein auf dem Rasen stehen.
Bloß ein weiterer Tag in meinem verkorksten Leben. Ich bin irgendwie schon dran gewöhnt.
Ich drehe mich zum Hühnergehege um und überlege mir eine Strategie. Je schneller ich fertig bin, desto schneller kann ich mit Daphne Beeren pflücken.
Zwei, drei Hennen beobachten mich schon misstrauisch. Wenigstens brauche ich nicht mit dem Elektrozaun zu hantieren, den hat Dylan schon abgebaut. Die Hennen laufen also in ihrem Auslauf umher, scharren im Gras nach Würmern und warten darauf, mir mit ihren scharfen Schnäbeln und den krallenbesetzten roten Füßen die Kehle aufzuschlitzen.
»Okay, Ladys«, sage ich, während ich mich sachte auf den Auslauf zu bewege. »Keine Panik, das ist ein Überfall!«
Ich höre ein Schnauben aus dem Blaubeerhain. Vielleicht ist Daphne kein Fan von Pulp Fiction. Aber ein guter Spruch ist eben ein guter Spruch – auch wenn die Hühner sich jede Mühe geben, mich zu ignorieren. Der Stall hat solche kleinen, nach außen aufgehenden Türchen, hinter denen die Legenester zum Vorschein kommen. Das ist ein ziemlich gutes System, und hinter der ersten, die ich aufklappe, liegt ein Ei einfach so zum Wegnehmen.
Es ist noch warm. Ich lege es vorsichtig in den Drahtkorb und öffne dann die nächste Klappe.
Dahinter starrt mich eine Henne mit rotem Auge böse an.
»Hoch mit deinem Federpopo, Mädchen. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.«
Als sie sich nicht rührt, stoße ich einen Seufzer aus. Dann schiebe ich sie leicht beiseite und entdecke die beiden Eier, auf denen sie hockt.
»Ich leide hier viel mehr als du«, versichere ich ihr. Dann klaue ich ihr erst ein Ei, dann das andere. Und sie lässt mich machen.
Drei geschafft, bleiben noch zehn oder elf.
Als ich die nächste Klappe öffne, spüre ich einen Blick im Rücken. Aber noch drehe ich mich nicht um. Daphne beobachtet mich. Wahrscheinlich denkt sie, ich kriege es nicht hin. Ich wurde zwar in Vermont geboren, bin aber ein Soldatenkind. Als Kind habe ich an verschiedenen Orten der Welt gelebt. Und meine Vorstellung von einem tollen Tag an der frischen Luft ist es, mit einem Getränk in einem deutschen Biergarten zu sitzen oder in einem australischen Café Flat Whites zu trinken und Gedichte zu lesen.
Allerdings lässt sich nicht abstreiten, dass mir das Landleben gut zu Gesicht steht. Es sind erst ein paar Wochen vergangen, und ich bin schon so braun und muskulös wie seit Jahren nicht mehr. Und das gefällt Daphne viel mehr, als sie zugeben will.
Na schön. Wenn sie mich schon beobachtet, werde ich ihr was zu gucken bieten. Ich stelle den Drahtkorb im Gras ab und ziehe mein T-Shirt aus. Dann mache ich eine Vierteldrehung mit dem Oberkörper und spanne beim Öffnen der nächsten Klappe die Muskeln. Ich sammele ein weiteres Ei ein und schiele dann schnell nach rechts, um sie möglichst beim Glotzen zu erwischen.
Bingo. Zwischen den Zweigen eines Blaubeerbuschs sehe ich etwas Silbernes blitzen.
»Shipley?«, rufe ich. »Brauchst du irgendwas? Was machst du denn da mit deinem Handy?«
»Auf die Uhr gucken! Ich kriege in einer Stunde einen Anruf. Morgen fängt mein neuer Job in Burlington an.«
Aha. Ich hatte auch vor, morgen nach Burlington zu fahren. So ein Zufall.
»Wenn du mit den Eiern fertig bist, kannst du hier drüben Unkraut jäten«, wechselt sie das Thema. »Hier sieht’s übel aus.«
»Ja, Ma’am. Das können wir doch aber zusammen machen, oder?«
»Auf gar keinen Fall«, sagt sie entschieden.
Mist. Ich widme mich wieder den Eiern.
Eine Stunde später brennt die Sonne auf mich herab, während ich noch einen Löwenzahn aus der Erde ziehe. Von der gebückten Haltung tut mir der Rücken weh, aber meine Knie werden durch das grüne Kissen geschont, auf dem ich knie. Es nennt sich Das Gartenkissen. Als Ruth Shipley – Dylans und Daphnes Mom – es mir vor einer Viertelstunde gegeben hat, sagte ihr Lächeln: Hier, du armer müder Kerl. Nicht dass du mir noch auf meinem Grundstück stirbst.
Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, liegt aber nicht komplett bei null. Außerdem bin ich gerade echt übelst durstig. Mir tut alles weh von den Arbeiten auf der Weide heute Vormittag, als ich ein Zaunpfostenloch nach dem anderen ausgehoben habe, um mit Dylan und seinem älteren Bruder Griffin mitzuhalten. Ich war zu stolz dazu, langsam zu machen. Und jetzt braucht mein armer müder Körper ein Nickerchen hier auf dem Rasenstreifen.
Ich hätte auch gern ein kaltes Bier und eine Zigarette. Aber ich habe Mrs Shipley versprochen, mit dem Rauchen aufzuhören, somit kann ich mir so dicht am Farmhaus keine anstecken. Außerdem bin ich ein sturer Esel. Ich werde diesen verdammten Hain vom Unkraut befreien, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Den Sommer hier zu verbringen war schließlich meine Idee. Dylan Shipley ist mein Freund und während der Vorlesungszeit auch mein Mitbewohner. Ich wusste, dass die Shipleys immer Helfer suchen, also habe ich Dylan einen Deal vorgeschlagen: Wenn sie mich den Sommer über bei sich wohnen lassen, kann ich mein Haus in Burlington in der Zeit vermieten und Dylans Miete fürs nächste Jahr dann fast auf null senken.
»Verdammt noch mal, ja«, hat er gesagt. »Wir würden uns freuen, wenn du zu uns kommst – vorausgesetzt, du weißt, worauf du dich da einlässt. Es gibt jede Menge zu tun.«
Ich habe mich nie für eine Lusche gehalten. Ich bin den El Capitan hochgeklettert. Ich bin durch den thailändischen Dschungel gewandert. Wobei das schon eine Weile her ist. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Unfall, der seinen Tribut von meinem Körper und auch meinem Leben gefordert hat.
Trotzdem – bis jetzt war mir nicht klar, was für ein Weichei ich geworden bin. Außerdem dauert es länger, als ich gedacht hatte, mich an die viele Arbeit auf der Farm zu gewöhnen.
Ich stoße den Unkrautstecher in die Erde und drehe ihn. Doch als ich am Unkraut ziehe, reißt es prompt in meiner Hand ab.
»Fuck.«
Das Zeug weiß, dass ich nicht hierfür geschaffen bin. Es merkt, dass ich einer von der Sorte bin, der denkt, Kraut ist zum Rauchen da. Jedenfalls nicht zum Jäten, verdammt noch mal.
Einige lange Minuten des Grabens und Fluchens später gelingt es mir endlich, die verdammte Wurzel aus ihrem Loch zu ziehen. Ich schleudere sie auf den versprengten Haufen, den ich schon erschaffen habe. Dann werfe ich das Werkzeug hin und lasse mich wie der müde Mann, der ich nun mal bin, ins Gras sinken.
Der Himmel über mir ist so blau, dass es fast schon wehtut hinaufzusehen. Die gelbe Sonne brennt auf meinen nackten Oberkörper nieder. Drei Wochen auf dieser Hügelkuppe in Vermont haben meiner Haut unter den Tattoos schon einen goldbraunen Schimmer verliehen. Mein Rücken pocht und meine Glieder liegen schmerzend im Gras.
Und jetzt krabbelt etwas über meinen Knöchel. Ich bin zu müde, um nachzugucken, was es ist. Wer hätte gedacht, dass es so anstrengend ist, gesund zu leben?
Langsam richte ich mich wieder auf und schnippe eine Spinne von meinem Fuß. Durch die Blaubeerbüsche hindurch habe ich einen indirekten Blick auf Daphne. Sie spült mit dem Schlauch einige Holzfässer ab, in denen die Shipleys ihren Cider reifen lassen. Nach dem Beerenpflücken ist sie schnell rübergeflitzt, um wieder Abstand zu mir zu gewinnen.
Sie ist eine harte Nuss. Aber ich bin ein geduldiger Mann. Der muss ich auch sein. Die letzten beiden Jahre haben mich auf jede erdenkliche Weise auf die Probe gestellt. Daphne hält mich für großspurig, und früher hätte sie damit richtiggelegen. Aber heute kommt mein großspuriges Gehabe eher aus dem Gedächtnis meines Körpers als durch Selbstvertrauen. Es ist heftig, mit zweiundzwanzig nur noch die Hülle seines früheren Selbst zu sein.
Wenn ich allerdings mit Daphne flirte, ist das nicht gespielt. Ich finde sie sehr interessant, und zwar nicht nur, weil sie wahnsinnig schön ist. Was mich richtig anmacht, ist ihr Charakter. Sie hat eine schroffe Effizienz an sich, die ich sexy finde – so eine nüchterne Art. Für deinen Quatsch hat sie keine Zeit und für Dummköpfe nichts übrig.
Sie ist nicht sonderlich warmherzig oder nett. Das stört mich nicht, ich bin es nämlich auch nicht. Sie ist die wütende Shipley. Und mir gefällt das.
Ich möchte zu gern wissen, wieso sie mir aus dem Weg geht. Wir sind uns schon ein paarmal begegnet, bevor ich hierherkam, und es kann gut sein, dass ich sie mal verärgert habe und mich nicht daran erinnere.
Ich hoffe definitiv, dass es nicht so ist. Ich wünschte, sie würde mir gegenüber zugänglicher werden, sonst wird der Sommer lang. Zum einen teilen wir uns das Bad. Ich bin im Obergeschoss des Farmhauses untergebracht, wo auch sie und ihre Mutter ihre Zimmer haben.
Derweil wohnt Dylan schön mit seiner Freundin in der Schlafbaracke, einem separaten Gebäude. Sie brauchen ihre Privatsphäre, schätze ich, denn die zwei haben öfter Sex, als Kriegsheimkehrer ihn haben. Letzte Woche habe ich die beiden erwischt, wie sie es mitten auf der Wiese auf einer Decke getrieben haben. Allein um außer Hörweite des Gestöhnes zu kommen, musste ich einen Riesenumweg gehen.
Drüben richtet Daphne sich wieder auf. Ihr Tanktop ist ein klein wenig nass gespritzt vom Wasserschlauch, und ich ertappe mich dabei, dass ich zu überlegen anfange, wie sie wohl pitschnass aussehen würde.
Ich mache neuerdings eine komische Phase durch. One-Night-Stands standen zuletzt nicht besonders weit oben auf meiner Liste. Aber verdammt, Daphne Shipley hat den Staub von meiner Libido gewischt. Irgendwas an diesen langen Gliedern macht mich an. Ihr dichtes braunes Haar will sich immer aus dem lockeren Dutt an ihrem Oberkopf lösen. Ich würde gern die Klemme wegziehen, damit ihr die Haare über die nackten Schultern fallen.
Inmitten dieses gemeinen, aber unterhaltsamen Gedankens höre ich ein leises Rascheln aus der anderen Richtung. Das Geräusch ist so weit weg, dass ich nicht feststellen kann, ob es von einem Menschen kommt oder von einem der gruseläugigen Hühner.
Jedenfalls richte ich mich auf. Es wäre peinlich, während der Arbeit beim Rumliegen erwischt zu werden. Also mache ich mich wieder ans Werk und ziehe weiter Unkraut aus dem Boden, als jemand beim Hühnerstall um die Ecke biegt. Ich schaue hoch und will grüßen. Aber es ist gar keiner von den Shipleys.
Es ist ein Schwarzbär. Ein echter Bär … ein ausgewachsener verdammter Bär, und er hält einen weißen Eimer im Maul.
Jetzt begreife ich den Ausdruck starr vor Angst. Ich brauche einige dumpfe Herzschläge lang, um zu reagieren, weil ich vor lauter Unentschlossenheit paralysiert bin. Soll ich aufstehen und wegrennen? Schreien? Mich tot stellen? Das Ungeheuer ist bloß wenige Schritte entfernt. Ich kann die Schnurrhaare an seiner Schnauze erkennen.
Er macht noch einen Schritt nach vorn, und das bringt mich dazu, mich in Bewegung zu setzen. Ich stehe auf, mein Schrei bleibt mir jedoch im Hals stecken. Ich schnappe mir den im Gras liegenden Unkrautstecher – er ist meine einzige Waffe. Doch als ich einen Schritt nach hinten mache, stolpere ich über das gottverdammte Gartenkissen und falle auf den Hintern.
Der Bär beobachtet mich dabei, wie ich auf dem Boden herumkrabbele wie eine verletzte Kakerlake. Mit einem erstickten Laut springe ich wieder hoch und drehe mich so weit ich es mich traue weg, um Daphne zu warnen.
»BÄR!«, schreie ich mit einer für einen erwachsenen Mann viel zu hohen Stimme.
Aber es genügt. Sie dreht den Kopf in meine Richtung. Der Bär lässt sofort den Eimer fallen, der daraufhin mit einem lauten Knall zu Boden fällt. Selbst wenn er mich jetzt gleich zum Mittagessen verspeist, kann wenigstens Daphne fliehen. Ich sehe, wie sie auf den Traktorschuppen zurennt. Zumindest kann sich einer von uns in Sicherheit bringen.
Das Gartenwerkzeug umklammernd, gehe ich einen Schritt zurück. »Verpiss dich, Bär. Geh wieder in den Hundert-Morgen-Wald oder wohin auch immer.«
Er nimmt den Henkel wieder ins Maul und zieht den Eimer ein paar Meter von mir weg. Daraufhin schleiche ich rückwärts und überlege, ob es sicher ist loszurennen.
Doch dann höre ich hinter mir ein Geräusch. Und ich gehe auf volles Risiko, indem ich einen Blick über die Schulter wage.
Daphne kommt aus dem Traktorschuppen gestürmt. Und in den Händen hat sie … ist das etwa eine Schusswaffe? Ehe ich auch nur blinzeln kann, hebt sie die Waffe und schießt in die Luft, wobei sie den Rückstoß gekonnt abfedert.
Mein Kopf fährt herum, als der Bär den Eimer mit einem lauten Knall fallen lässt und dann mit seinem dicken Hintern von mir wegtrottet. Er läuft immer weiter, überquert die Wiese und verschwindet schließlich zwischen den ersten Bäumen.
»Verdammt noch mal!«, rufe ich aus und drehe mich dabei zu Daphne um, die beobachtet, wie er wegläuft. Sie hält die Waffe vorsichtig, aber gelassen, die Mündung zum Boden gerichtet, steht mit einer voll toughen Haltung in ihren winzigen Shorts da. »Hast du das gesehen? Das war ein verdammter Bär.« Ich bin immer noch geschockt.
Sie reagiert mit einem Schulterzucken. Einem Schulterzucken! »Die mögen Sonnenblumenkerne. Diese Pissnelken. Ich hoffe, er hat den Eimer nicht kaputt gemacht.« Sie geht an mir vorbei, um den Eimer aufzuheben, und schüttelt ihn. Der Deckel ist immer noch fest angeschraubt, und ich kann die Sonnenblumenkerne darin klappern hören.
Dann geht sie wieder an mir vorbei, um die Waffe wegzuschließen. Als ich zusehe, wie sie mit ihren braun gebrannten langen Beinen an mir vorbeimarschiert, macht mich das an und schüchtert mich gleichzeitig ein wenig ein.
Ich stehe auf resolute Frauen. Auf diese hier ganz besonders. Und so langsam fange ich an zu glauben, dass dieser Sommer richtig spaßig werden könnte.
2
Daphne
Beim Abendessen erzählt Rickie die Bärengeschichte einem hingerissenen Publikum.
Während er die Geschichte spinnt, schmiere ich Butter auf mein Maisbrot und verdrehe die Augen. Ein Bär auf unserem Grundstück ist keine große Sache. Bloß ein ganz normaler Dienstag.
»Und der Bär ist riesig, ich sehe also förmlich mein ganzes Leben vor meinem inneren Auge vorbeiziehen.« Rickie gestikuliert wild. Bei der Bewegung spannt sein Designer-T-Shirt über seinen sehnigen Brustmuskeln. Seine Tattoos gucken unter dem V-Ausschnitt hervor.
Ich hasse mich ein bisschen dafür, dass ich ständig diese Tattoos anstarre. Bevor Rickie mit seiner scharfzüngigen Art und diesen durchdringenden graublauen Augen in meinem Leben aufgetaucht ist, fand ich Tattoos nie attraktiv.
Er ist nicht mal mein Typ. Das sage ich mir selbst andauernd. Aber er ertappt mich ständig beim Glotzen. Heute hätte er mich beinahe dabei erwischt, wie ich ein Foto von ihm machte. Zum Glück hat er nicht geschnallt, was ich da mit meinem Handy anstellte.
Zu meiner Verteidigung: Das Foto war nicht für mich, sondern für meine Freundin Violet Trevi. Sie fragt mich die ganze Zeit über den mysteriösen Rickie aus – den Typen, der mich in meinem ersten Studienjahr versetzt hat. Schon damals musste sie sich anhören, wie ich darüber geschimpft habe.
Zu meiner weiteren Verteidigung: Das Geglotze passiert nicht bloß aus sexuellem Interesse, sondern auch aus Neugier. Ich hatte mich immer gefragt, was wohl aus Rickie geworden ist. Vor fast drei Jahren ist er mit einem großen Auftritt in meinem Leben erschienen. Und dann verschwand er genauso schnell wieder daraus.
Und heute – das ist das wirklich Verrückte daran – scheint er sich gar nicht daran zu erinnern, wie wir uns kennengelernt haben und was er alles Unverschämtes zu mir gesagt hat. Wahrscheinlich tut er nur so. Vielleicht hat er nicht damit gerechnet, mich jemals wiederzusehen, und will jetzt nicht zugeben, dass er mich versetzt hat. Oder aber ich bin schlichtweg so leicht zu vergessen.
Autsch.
Rickie kann man dagegen nicht so leicht ignorieren. Er ist anziehend. Meine Leute sind ganz gefesselt von seiner blöden Bärengeschichte, obwohl sie schon Dutzende Male selbst welche gesehen haben.
»Wisst ihr, ich hatte nicht vor zu sterben, ehe ich den Inka Trail gewandert bin. Als er also auf mich zugeschlichen kam, hat mich das ziemlich deprimiert …«
Meine Familie lacht los, als wären sie zahlende Gäste in einem Comedy-Club.
»Und ich winke Daphne zu nach dem Motto: Reeeeeeette dich!«
Noch mehr schallendes Gelächter.
Mir reicht’s jetzt. »Kann mir jemand mal das Apfelgelee geben?«, frage ich.
Aber keiner reagiert, weil sie alle immer noch Rickie lauschen.
»Daphne rennt in den Traktorschuppen, zumindest weiß ich also zu meiner Freude, dass einer von uns lange genug leben wird, um den Kuchen zu essen, den Ruth gerade gebacken hat.« Erneut ausgelassenes Gelächter. Als wäre Rickie das Beste, was ihnen je passiert ist. »Und dann taucht Daphne wieder auf – wie ein Racheengel in abgeschnittenen Jeans – und feuert einen Schuss in die Luft. Da wird der Bär lammfromm. Er lässt den Eimer fallen und watschelt mit seinem fetten Hintern Richtung Wald. Das Lustigste, was ich je gesehen habe.«
Alle am Tisch haben einen Ausdruck reinster Freude im Gesicht, vom Jüngsten – meinem einjährigen Neffen Gus, der bei meinem Bruder auf dem Schoß sitzt – bis hin zu Grandpa, der sich mit seiner Serviette über die Augen wischt.
Ich bin genervt. Aber ich verstehe es. Rickie ist sowohl unterhaltsam als auch anziehend. Er hat das gewisse Etwas, das die Menschen für ihn einnimmt.
Habe ich alles schon durch. Auf seinen Charme falle ich nicht noch mal rein.
»Das Apfelgelee?«, wiederhole ich.
Nur Rickie scheint die Bitte mitzubekommen. Er greift nach dem Glas und reicht es auf meiner Seite des Tischs weiter. Und Mist, ich kann nicht anders, als das Spiel seiner Unterarmmuskeln zu bemerken.
Es ist schlicht unfair, wie wahnsinnig attraktiv manche Menschen sind. Er hat das Aussehen eines europäischen Models zwischen zwei Shows. Die einen Tick zu langen Haare. Die betörende Schönheit seines Körpers. Die teuren Klamotten. Die Farmarbeit scheint ihm auch gut zu bekommen. Sein Teint sieht besser aus als bei seiner Ankunft vor ein paar Wochen.
Nicht dass ich darauf geachtet hätte.
»Also, wegen morgen«, sagt mein Bruder Griffin und wechselt damit endlich das Thema. Sein Blick wandert von Rickie zu mir. »Kannst du früh um zehn losfahren? Ich belade bis dahin schon mal den Wagen.«
Ich will gerade antworten, als Rickie mir zuvorkommt. »Kein Problem.«
Der Blick meines Bruders huscht zurück zu unserem Sommergast. »Es ist ungefähr eine Stunde Fahrt bis rein nach Burlington. Hinter der Weinhandlung verläuft eine Gasse, in der es manchmal eng werden kann.«
»Hey, wart mal«, werfe ich ein. »Ich werde den Cider in der Stadt ausliefern. Wir hatten eine Abmachung.« Griffin hat mir die Restaurant-Lieferungen zugeteilt, damit ich für ein paar Stunden im Sozialwissenschaftlichen Institut an der Burlington University arbeiten kann, zu der ich im Herbst wechseln werde.
»Oh, ihr fahrt beide«, sagt mein Bruder.
»Wieso?«, frage ich. »Ich schaffe das allein.«
»Ich habe eine Sommervorlesung belegt, die jeden Mittwoch stattfindet«, sagt Rickie.
»Eine Vorlesung? Kannst du dich da nicht einfach über Zoom dazuschalten?«
Rickie zuckt mit den Schultern. »Ist besser, wenn man persönlich teilnimmt. Außerdem kann ich dir somit bei der Auslieferung helfen.«
»Das ist nett von dir«, sagt mein Zwillingsbruder Dylan, ohne die Augen von seiner Freundin Chastity zu lassen. Unter dem Tisch halten sie wahrscheinlich Händchen. Oder befummeln sich vielleicht. Die zwei sind wie wandelnde Hormone. Es überrascht mich, dass Dylan überhaupt imstande ist, der Unterhaltung zu folgen.
»Kein Ding«, sagt Rickie schulterzuckend. »Ich habe eh noch was in Burlington zu erledigen. Außerdem kann ich mal nach meinem Haus sehen, ein bisschen shoppen gehen, so was eben.«
Ich beiße von meinem Maisbrot ab, damit ich nicht etwas Fieses sage. Glücklich bin ich allerdings nicht über diese Entwicklung. Überhaupt nicht.
Erstens sollte der Mittwoch in Burlington ein Tag sein, an dem ich mal rauskomme. Wenn man eine große Familie hat, ist man selten für sich.
Und jetzt soll ich auf der Hin- und Rückfahrt jeweils eine Stunde mit Rickie und seinem Flirtblick verbringen?
Gott, er ist zwar hübsch anzusehen, aber ich will nicht noch mehr Zeit mit ihm verbringen. Es ist schon schlimm genug, sich den ganzen Sommer über ein Bad mit ihm teilen zu müssen. Und es ist schon anstrengend, ihm hier in meinem eigenen Zuhause aus dem Weg zu gehen.
Worüber zum Geier sollen wir uns im Auto unterhalten?
Ich schätze, ich werde es rausfinden. Als ich am nächsten Morgen um zehn mit meinem Rucksack aus dem Haus komme, ist Dylans Pick-up bereits mit Schnapskisten beladen und Rickie sitzt hinterm Steuer.
»Hier ist die Lieferliste«, sagt Griffin und gibt mir ein zusammengefaltetes Blatt Papier. »Sollte easy werden. Hab einen schönen Tag.«
»Danke«, brumme ich, während ich zur Beifahrertür gehe. Schätze, ich werde doch nicht das Hörbuch hören, das ich mir für die Mittwochsfahrten vorgenommen hatte.
Ich steige auf den Sitz neben Rickie und schließe die Tür. Mist, er riecht gut. Nach irgendeinem würzigen, exotischen Eau de Cologne. Wundervoll. Eine Stunde allein mit einem Mann, der mich mal versetzt hat und anschließend vergessen hat, dass ich existiere. Genau danach sehnt sich eine Frau doch.
»Wenn du jetzt fährst«, sage ich zur Begrüßung, »dann fahre ich auf dem Rückweg.«
»Nee«, sagt er und legt den ersten Gang ein. »Das mach ich schon. Beide Strecken.«
Mein Blutdruck schnellt in die Höhe. »Das war keine Bitte. Frauen können Auto fahren, Rick.«
»Ich bin sicher, du fährst super, Kleines. Allerdings habe ich Dylan versprochen, dass ich dich und den Alk sicher nach Burlington transportiere, also mach ich das.« Er stellt das Radio an und lenkt den Pick-up unsere lange Einfahrt hinunter. »Also, was hast du heute in Burlington vor?«, fragt er, ohne zu checken, dass ich im Stillen gerade seinen Mord plane.
»Arbeiten. Ein Job. Einmal die Woche.« Meine Antwort ist etwa so freundlich wie Schüsse. Die meisten Leute wollen sowieso nichts über Gesundheitsforschung hören. Das ist nerdig.
Während wir weiterrollen, ist es im Fahrerhaus so still, dass ich jedes einzelne Kieselsteinchen, das die Reifen aufwirbeln, klacken hören kann. Ich weiß, dass ich jetzt eigentlich an der Reihe bin, höfliche Fragen zu stellen, aber ich bringe es einfach nicht über mich. Ich habe ganz genau einen Sommer Zeit, um sämtliche Verstrickungen in meinem Leben zu lösen. Darum ist es nicht besonders gut bestellt. Und vor lauter Stress hab ich die Fähigkeit eingebüßt, Small Talk zu machen.
»Hey, kannst du mal anhalten, damit ich nach der Post gucken kann?«, frage ich, als Rickie am Ende der Einfahrt abbremst, um auf die Straße abzubiegen.
»Sicher doch, Schöne.« Während er den Wagen anhält, versuche ich, nicht die Augen zu verdrehen. Wahrscheinlich nennt er mich bloß so, weil er meinen richtigen Namen vergessen hat.
Ich steige aus und öffne unseren Briefkasten. Es liegt ein Katalog des Milchbauernverbandes für meinen Zwillingsbruder darin, den ich also drinlasse. Dylan hat zwei Interessen: Ziegenhaltung und seiner Freundin an die Wäsche gehen. Allerdings nicht beides gleichzeitig.
Schnell gehe ich einen Stapel Briefumschläge durch und halte nach meinem Namen Ausschau. Ich warte auf Nachricht, ob ich ein Stipendium bekomme, mit dem ich das nächste Studienjahr finanzieren kann. Es war nicht gerade hilfreich, dass ich mich urplötzlich entschieden habe, vom Harkness College an die Burlington University zu wechseln, und mich in allerletzter Minute um finanzielle Unterstützung bewarb.
So was passiert, wenn man sich das Leben vermasselt.
Im Briefkasten liegt zwar ein Umschlag mit meinem Namen, doch der hat das falsche Format und kommt von der falschen Uni. Als ich also wieder zu Rickie in den Pick-up steige, starre ich auf einen großen quadratischen Umschlag von der Fakultät für Gesundheitswesen in Harkness. Was wollen die denn jetzt? Trotz meiner Abmeldung von der Uni scheine ich wohl immer noch in deren Adressverteiler zu stehen.
Während Rickie die Landstraße entlang in Richtung Highway fährt, tippe ich mir mit dem Brief aufs Knie. Schließlich gewinnt meine Neugier, und ich schlitze den Umschlag mit dem Daumen auf. Darin finde ich eine auf teures Papier gedruckte Einladung zu einer Feier im September. Betreten Sie mit uns die Zukunft, steht da, und ich werde eingeladen zur Einweihung des neuen Anbaus des Gesundheitswesen-Gebäudes, in dem ich das letzte Jahr geforscht habe.
Unten auf der edlen cremefarbenen Karte steht eine kleine Liste der Sponsoren, denen bei dem Empfang gedankt werden wird. Genau in der Mitte prangt der Name, den ich hassen und fürchten gelernt habe: Senator Mitchell Halsey. Die Halseys sind in Connecticut eine große Nummer. Eine riesengroße.
Und ich bin die Idiotin, die glänzende Augen bekam, als der Sohn des Senators anfing, mich mit seinen blauen Augen anzublitzen. Das vergangene Jahr war wie ein in Zeitlupe ablaufendes Katastrophenszenario. Es fing mit diesen blauen Augen an und endete mit der Erkenntnis, dass ich Harkness verlassen muss, wenn ich überhaupt je einen Abschluss machen will.
Reardon Halsey war genau wie ich Studierender im höheren Semester mit einem Job in einem Forschungsprojekt im Gesundheitswesen. Ich dachte, wir hätten so vieles gemeinsam. Ich glaubte ihm, als er mir sagte, wir seien dazu bestimmt, ein Paar zu werden.
Er hat mich belogen. Genau genommen hat er eine Menge Menschen belogen. Doch ich bin die Einzige, die es gemerkt hat. Und als ich ihn zur Rede stellen wollte, holte er nicht mal erst groß Luft, bevor er meine gesamte akademische Zukunft bedrohte.
Ganz unten hat Dekanin Rebecca Reynolds, meine bisherige wissenschaftliche Betreuerin, handschriftlich etwas ergänzt.
Daphne, wir vermissen Sie jetzt schon! Meine Tür wird Ihnen immer offen stehen.
– RR
Tja, das schmerzt. Bis vor einigen Wochen war ich in einem anspruchsvollen Programm am Harkness College. Ich war auf dem Weg, innerhalb von nur fünf Jahren sowohl meinen Bachelor als auch meinen Master in Gesundheitswesen zu machen. Ich hätte es auch geschafft. Hätte ich nur nicht dem falschen Mann vertraut.
Selbst jetzt bin ich nicht wirklich in Sicherheit. Reardon Halsey könnte mit einem einzigen Anruf mein Leben sprengen. Aus dem Grund schlafe ich nicht mehr gut.
Ich bin versucht, die Einladung direkt aus dem Fenster zu werfen. Aber eine Shipley wirft keinen Müll in die Natur. Also öffne ich Dylans Handschuhfach, stopfe die Einladung hinein und klappe es wieder zu.
»Nicht der Brief, auf den du gewartet hast?«, fragt Rickie fröhlich.
»Nope«, grummele ich.
»Schade. Ich wüsste da vielleicht was, um dich nachher ein bisschen aufzumuntern.« Als ich aufstöhne, lacht er. »Ich meinte Eis. Sollen wir auf dem Rückweg anhalten, um uns ein Eis zu holen?«
»Klar doch, Kumpel«, murmele ich.
»Super.« Kurz herrscht Stille. »Oder wir essen zusammen zu Abend.«
»Wir essen jeden Tag zusammen zu Abend«, stelle ich klar.
»Das habe ich nicht gemeint. Du wirkst wie eine Frau, die mal einen lustigen Ausgehabend vertragen könnte. Und dafür bin ich genau der Richtige.«
Jede Wette. Ich zweifele nicht im Geringsten daran, dass Rickie weiß, woher das Play in Playboy kommt. Ich hatte das schon. Er hat mich schon einmal eingeladen, um mich dann zu ghosten.
Männern, die mit mir flirten, traue ich nicht. Und werde ich auch nie wieder trauen.
»Hör zu, ich fühle mich ja geschmeichelt, aber wir wissen doch beide, dass du echt nicht mein Typ bist«, lüge ich. »Und ich bin nicht deiner.«
»Tatsächlich? Was ist denn dein Typ? Lass mich raten – du stehst auf anständig und ehrgeizig.«
Das stimmt so halb. Oder zumindest stimmte es früher. Der erste Mann, in den ich mich je verliebt habe, war anständig. Und der zweite wirkte anständig und war definitiv ehrgeizig. Aber im Moment bin ich einfach nur verwirrt. »Ich weiß es ehrlich gesagt schlicht nicht mehr. Aber ich werde bestimmt nicht deine Vergnügungsnummer, weil sich’s so schön praktisch anbietet, okay? Das läuft nicht.«
Er lacht doch tatsächlich. »Du glaubst, du wüsstest, wie ich ticke. Ich bin ein voll unanständiger Typ, hm?«
Ja. »Das habe ich nicht gesagt.«
»Schon okay, Daphne. Es gab Zeiten, da hättest du damit richtiggelegen. Ich hatte definitiv eine unanständige Phase. Aber dann bin ich erwachsen geworden.«
»Gut zu wissen«, murmele ich. Ich hatte nie eine unanständige Phase, aber dafür eine naive – was mit Sicherheit schlimmer ist.
»Lass mich ehrlich sein«, sagt er, als wäre hier eine Unterhaltung im Gange. »Du verwirrst mich. Dein Mund sagt, du hast kein Interesse. Deine umherwandernden Blicke sagen jedoch das Gegenteil.«
»Hey! Das stimmt nicht«, lüge ich. Ich fühle mich definitiv zu Rickie hingezogen und bin alles andere als bereit, das zuzugeben.
»Und was sollte das gestern mit dem Handy? Hast du ein Foto von mir gemacht?«
»Nein!«, jaule ich. »Wieso sollte ich?«
»Für den Sperrbildschirm?«, schlägt er vor. »Ich bin eine schöne Deko.«
»Halt die Klappe. Ich habe ein Selfie gemacht.«
Seinem Schnauben nach glaubt er mir nicht. Kann ich bitte einfach sofort tot umfallen? Bis zur ersten Schnaps-Auslieferung dauert es immer noch mindestens eine Dreiviertelstunde. Das wird die längste Fahrt nach Burlington überhaupt.
Mein Handy brummt, als eine Reihe von Nachrichten eingeht, also hole ich es heraus, um nachzusehen. Sie stammen alle von Violet.
Halllooooo! Wie läuft’s mit dem Hottie?
Hat er einen guten Musikgeschmack?
Hast du ihn gefragt, warum er dich damals bei eurem Date versetzt hat?
Kriege ich noch ein Foto? Auf dem hier erkennt man sein Gesicht nicht so gut.
Ich antworte mit der Geschwindigkeit von jemandem, der sich schuldig fühlt. Keine Fotos mehr. Basta. Ich höre nie wieder auf dich. Er hat es mitgekriegt, und jetzt werde ich mir das ewig anhören können.
Ach, keine Sorge! Ich werde diese Anekdote eines Tages auf eurer Hochzeit zum Besten geben.
Ich stöhne. Du bist eine hoffnungslose Romantikerin. Mit Betonung auf hoffnungslos.
Sie antwortet mit einem Herz-Emoji. Ich habe Violet echt gern, aber ihren Optimismus verstehe ich nicht. Sie hat nicht mehr Glück mit Männern als ich.
Ich stecke das Handy ein und starre wieder aus dem Fenster. Rickie fasst das jedoch als Zeichen auf, dass ich bereit bin, mich zu unterhalten. »Pass auf, wir müssen einiges klären. Ich hab da ein paar Fragen.«
Während ich die Landschaft vorüberziehen sehe, frage ich mich, ob ich wohl den Sprung aus einem fahrenden Auto überleben würde.
»Ich frage mich, wieso dich meine Gegenwart so nervös macht. Mir ist klar, dass wir uns schon mal begegnet sind …«
Ich erstarre innerlich, und mir stockt der Atem.
»… aber wo und wie genau, ist mir schleierhaft. Also hier eine wilde Vermutung: Haben wir uns schon mal nackt gesehen? Liegt da das Problem?«
Ehe ich mich versehe, entweicht mir ein Keuchen. »Nein! Auf keinen Fall.« Es sei denn, der eine Morgen letzte Woche zählt, als ich einen flüchtigen Blick darauf erhaschte, wie er sich unter die Dusche stellte. Dieser Mann hat einen Hintern wie ein Kunstwerk …
»Na, ein Glück.« Er lacht in sich hinein. »Wär eine Schande, wenn ich das vergessen hätte.«
Ich stoße leise ein empörtes Zischen aus. »Im Ernst?«, kiekse ich. »Das muss ja eine verdammt unanständige Phase gewesen sein, wenn du glaubst, dass du so was vergessen haben könntest.«
»Oh, du wärst überrascht, was ein Kerl so alles vergessen kann.« Der Motor des Pick-ups röhrt, als er beschleunigt, um einen Holzlaster zu überholen. »Hör zu, mir ist sehr wohl klar, dass ich mich gerade wie ein Arschloch anhöre. Aber könntest du mir bitte einfach verraten, wo wir uns schon mal begegnet sind? Hilf mir auf die Sprünge.«
Unwillkürlich drehe ich den Kopf und starre ihn für einen langen Moment bloß an. Meint er das überhaupt ernst? Ich hatte angenommen, er wüsste ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben, wolle aber einfach nicht darüber reden. Aber jetzt soll ich ihm auf die Sprünge helfen?
»Ja, ich mein’s ernst«, sagt er, als hätte er meine Gedanken mitgehört. »Mein Gedächtnis ist scheiße.«
»Mein Gott, das kann man wohl sagen. Vielleicht solltest du das Kiffen sein lassen.«
»Das hör ich oft.«
Das hier ist die merkwürdigste Unterhaltung, die ich je geführt habe. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er mich nicht nur verarscht. Er und ich haben sechs Stunden miteinander verbracht. Komplett angezogen. Aber trotzdem. »In meinem ersten Studienjahr sind wir einmal als Fahrgemeinschaft übers Wochenende von Connecticut nach Vermont und zurück gefahren. Du hattest das Auto. Ich habe fürs Benzin bezahlt.«
»Oh«, sagt er und wirft mir einen kurzen Blick zu. »Von Harkness aus.«
»Ja, natürlich.«
»Stimmt«, sagt er, die Augen auf die Straße gerichtet. »Ergibt Sinn.«
Ich mache mich auf weitere Fragen gefasst. Wahrscheinlich fällt ihm jetzt alles wieder ein. Unser seltsam vertrautes Gespräch. Die komische Art, wie es geendet hat.
Doch die Fragen kommen nicht. Stattdessen dreht er das Radio lauter.
3
Vor fast drei Jahren
Es ist ein nieseliger Herbsttag in Harkness, Connecticut. In dieser Stadt am Wasser regnet es oft.
Daphne, eine Erstsemesterin, wartet unter einem wunderschönen Bogengang am Rand des Campus. Sie hat jahrelang davon geträumt, auf diese Uni zu gehen – seit ihr ehrgeiziges kleines Herz das Harkness College in einem Studienratgeber entdeckt hat, den sie in der Stadtbibliothek von Tuxbury ausgeliehen hatte.
Und hier ist sie nun, vor sechs Wochen hat ihr erstes Semester begonnen. Ihr ehrfürchtiges Staunen hat nicht nachgelassen, wenngleich sie sich hier nicht so ganz wohlfühlt. Es ist noch nicht ihr Zuhause.
Das irritiert sie sehr. Um ehrlich zu sein, hatte sie geglaubt, in dem Moment, wenn sie nach Harkness führe und ihr Zimmer im Wohnheim bezöge, würde ihr Leben erst so richtig anfangen. So wie es sein sollte.
Stattdessen wurde sie mit einer Mitbewohnerin zusammengesteckt, die doch tatsächlich einen Pelzmantel fürs College eingepackt hat. Wer macht denn so was?
Daphne sieht auf ihrem Handy nach der Uhrzeit. Sie hat es dermaßen eilig, übers Wochenende nach Hause zu kommen, dass sie zu früh hier steht. Sie hat Heimweh. Das ist ein bisschen peinlich. Also redet sie sich ein, dass die Überpünktlichkeit einfach nur höflich ist. Sie hat jenen Freund einer Freundin, der bereit war, sie heute Morgen nach Vermont mitzunehmen, noch nie getroffen.
Wenigstens ist er pünktlich. Um Punkt acht Uhr hält ein kastiger alter Volvo am Straßenrand an. Nach nur einem flüchtigen Blick zu dem Mann hinterm Lenkrad flitzt Daphne durch den kalten Regen und öffnet die Beifahrertür. Mit einer einzigen hastigen Bewegung rutscht sie auf den Sitz und stellt ihre kleine Reisetasche zwischen ihre Füße.
Dann dreht sie sich zur Seite, um einen genaueren Blick auf ihren Begleiter zu werfen. Und – heiliger Strohsack! – er ist ein Traum. Er hat ganz kurz rasierte Haare. So ein Bürstenhaarschnitt steht nicht jedem, diesem Kerl aber schon. Seine modelmäßig schönen Gesichtszüge kommen so richtig gut zur Geltung.
Und – wow – aus überraschten graublauen Augen checkt er sie von oben bis unten ab. »Hallo, du. Ich hoffe mal inständig, du bist Daphne Shipley und keine Autoräuberin.«
»Die bin ich«, sagt sie etwas atemlos. Gut aussehende Männer machen sie immer leicht nervös. »Und du bist Richard Ralls?«
»Das ist mein Vater. Ich bin Rickie.«
»Gibt’s erwachsene Männer, die sich Rickie nennen?« Sie wollte frech klingen, aber es kommt ein bisschen zickig heraus. So ist das bei ihr. Daphne hat nie den Dreh rausgekriegt, wie das mit dem Flirten geht.
»Wer sagt, dass ich ein erwachsener Mann bin?« Daraufhin lächelt er, wodurch er nur noch umwerfender wird, und ihr Bauch macht einen komischen Hüpfer.
»Wie ich merke, hast du es eilig, nach Vermont zu kommen«, sagt er. »Vielleicht solltest du aber nicht so schnell zu einem Fremden ins Auto springen? Du hast nicht mal überprüft, ob ich es bin. Ich hatte schon meinen Ausweis bereitgelegt, siehst du?« Er hält einen Ausweis von der US Tactical Services Academy hoch.
Auf dem Ausweisfoto sieht er sogar noch besser aus, wenn das überhaupt möglich ist. Denn er trägt eine Paradeuniform.
Daphne ist allerdings keine, die sich vor anderen gern ihre Gefühle anmerken lässt. Und sie ist bestimmt keine, die sich von einem Mann sagen lässt, dass sie etwas Dummes getan habe. »Mal überlegen«, sagt sie. »Dein Vermonter Nummernschild und dieser Haarschnitt machen es echt unwahrscheinlich, dass ich ins falsche Auto eingestiegen bin.«
Wieder so ein blendendes Lächeln. »Schätze, da hast du recht, Daphne. Und du bist die Freundin von Carla?«
»Sozusagen.« Freundin wäre zu viel gesagt. Carla war auf der Highschool eine Klassenkameradin von Daphne – eins von den selbstbewussten Mädchen, im Vergleich zu denen sich Daphne immer nerdig und seltsam vorgekommen ist. »Die Colebury Highschool ist so klein, dass jeder jeden kennt.«
Carla hatte vergangenen Sommer mal erwähnt, dass sie einen Collegetypen kenne, der auch oft zwischen Connecticut und ihrem Teil von Vermont pendele. Also hatte sich Daphne Rickies E-Mail-Adresse aufgeschrieben, denn sie denkt praktisch.
»Carla war für ungefähr zehn Minuten mit meinem Zwillingsbruder zusammen«, sagt sie. »Wie alle.«
Als Rickie leise lacht, hüpft der Laut in Daphnes Brust umher. »Ich glaube, deinen Zwillingsbruder würde ich mögen.«
Wie alle. Sie holt einen Zwanzigdollarschein heraus und steckt ihn in den Becherhalter. »Die sind fürs Benzin. Danke für die Mitfahrgelegenheit.«
»Ist mir ein Vergnügen.« Er legt den ersten Gang ein, und sie beginnen ihre dreistündige Heimfahrt. Aus dem Radio wummert irgendeine leise Musik, und im Wagen ist es warm und trocken, während sie die verregnete Straße entlangrollen.
Das College verschwindet hinter ihnen, und Daphne ist froh, es hinter sich zu lassen.
»Also, wie gefällt dir Harkness?«, fragt Rickie. »Und was studierst du dort?«
»Ich mache einen Bachelor in Biologie und einen Master in Gesundheitswesen, in einem Schnellspur-Programm.«
»Ah, ehrgeizig. Lustig, dass du nicht auf meine erste Frage geantwortet hast. Wie gefällt’s dir?«
»Ich bin erst sechs Wochen dort.«
»Doch so gut?« Er lacht in sich hinein.
Sie kennt ihn nicht gut genug, um ihm die ganze Wahrheit zu erzählen. Dass das Harkness College einschüchternd ist. Dass sie sich immer für intelligent gehalten hat, sich jetzt aber fragt, ob sie mithalten kann. Und ganz bestimmt erzählt sie ihm nicht, dass sie sich unter den ganzen geschniegelten reichen Kindern, die auf Privatschulen überall im ganzen Land waren, wie ein Landei vorkommt.
»Es soll versnobt sein«, sagt Rickie und bietet ihr damit einen Einstieg.
»Na ja, in der ersten Woche hat mich jemand gefragt, woher ich komme, und als ich Vermont sagte, meinte derjenige: ›Ach, da übersommert immer ein Kumpel von mir.‹«
»Ja, übersommern als Begriff. Ein passender Look gehört auch dazu. Ziemlich Tribute-von-Panem-mäßig.«
Daphne lächelt über die Anspielung, obwohl sie den ersten Teil gehasst und die Reihe nicht mal zu Ende gelesen hat. »Okay, und was ist mit dir? Gefällt’s dir an der Tactical Services Academy? Und was studierst du?«
»Philosophie und Psychologie – zwei Hauptfächer.«
»Wie mir auffällt, hast du meine erste Frage nicht beantwortet.«
»Du bist eine Blitzmerkerin. Aber das Ding mit der USTSA ist, dass es einem dort gar nicht gefallen soll. Man soll sie überstehen. Das ist auch sehr Tribute-von-Panem-mäßig, aber eher wie in den späteren Büchern.«
»Und du hast dir das freiwillig ausgesucht?«
Er lacht trocken. »So ziemlich. Sie ist kostenlos, weißt du? Mir hat also das Preisschild gefallen. Außerdem bin ich das Arschgekrieche und den Tonfall beim Militär gewöhnt. Mein Vater war bis zu seiner Pensionierung Colonel in der Air Force.«
»Ach, auf dem Militärstützpunkt außerhalb von Burlington?«
»Früher. Ich wurde in Vermont geboren, bin aber nicht dort aufgewachsen.«
»Wo bist du denn aufgewachsen?«
»Überall. Japan. Deutschland.«
»Wo bist du zur Highschool gegangen?«
»In Choate. Wo sie auch übersommern sagen.«
»Ah.« Das verunsichert Daphne ein bisschen, denn sie hat ihn eher für einen Gleichgesinnten gehalten – einen Vermonter, der übers Wochenende aufs Land abhaut, wo die Welt noch Sinn ergibt. »Und woher kennst du Carla?«
»Ich war letzten Sommer für ungefähr zehn Minuten mit ihr zusammen.«
Das hätte Daphne echt kommen sehen müssen. Die Carlas und Dylans und Rickies dieser Welt fühlen sich naturgemäß zueinander hingezogen. Sie wissen alle, wie man lockerlässt und Spaß hat. Daphne hat den Bogen nie so recht rausgekriegt. Sie hat gedacht, wenn sie erst unter ihresgleichen ist – den Nerds dieser Welt –, würde es leichter werden, Freunde zu finden.
Vielleicht dauert es mehr als sechs Wochen.
»Große Pläne fürs Wochenende?«, fragt Rickie, als sie auf den Highway 91 auffahren.
»Nicht wirklich. Auf unserer Farm ist gerade Hauptsaison. Wahrscheinlich werde ich das ganze Wochenende lang mit einer Ponykutsche herumfahren, damit die Familien, die zum Apfelpflücken kommen, nicht so weit zu laufen brauchen, um ihre Lieblingssorte zu finden.«
»Könnte doch lustig werden?«
»Klar – wenn man auf quengelnde Kinder und Pferdemist steht. Die Ponykutsche ist bei uns die unbeliebteste Aufgabe, aber sie kommt bei den Besuchern an.«
»Was ist denn dann die beste Aufgabe?«
»Die Cider-Verkostung. Oder Kassieren. Ich kann gut mit Zahlen umgehen. Wechselgeld rausgeben macht mir nichts aus.«
Er schweigt einen Augenblick. »Und welchen Grund hast du noch?«
»Wofür?«
»An einem x-beliebigen Novemberwochenende nach Hause zu fahren.«
»Veteran’s Day – wegen des Feiertags haben wir Montag frei. Das ist alles.«
»Okay, klar. Aber wenn ein Mädchen an einem verregneten Samstagmorgen Make-up trägt, heißt das meistens, dass es da einen Typen gibt.«
Daphne steigt Hitze ins Gesicht. »Wow, sechs Wochen Psychologieseminare, und du packst alle direkt schon auf die Couch, was?«
»Sag mir, dass ich falschliege.« Er lehnt sich gegen die Kopfstütze und grinst.
»Sorry, Sigmund. Es gibt keinen Kerl.«
»Was? Unmöglich. Warte – dann ein Mädchen? Sorry, ich hätte aufgeschlossener sein sollen.«
Daphne lacht. »Nö. Vielleicht schmink ich mich einfach nur gern.« Tut sie nicht. Aber das weiß Rickie nicht.
»Nee. Es muss jemanden geben. Nach sechs Wochen im ersten Semester …« Er überlegt kurz. »Du fährst nach Hause, weil du einen Typen nicht verlieren oder ihn dir schnappen willst. Eins von beidem muss es sein.«
Daphne schaut hinaus auf den nassen Highway, als ihr Herz höherschlägt. Der Kerl auf dem Fahrersitz ist echt nicht ihr Typ. Er hat so ein Bad-Boy-Funkeln in den Augen, dem sie normalerweise aus dem Weg gehen würde. Aber seine schnelle Auffassungsgabe macht unheimlich viel Spaß. Es ist lustig, sich Wortgefechte mit ihm zu liefern. »Hör zu, ich glaube, deiner Analyse fehlt es an Feinsinn.«
»Sag mir, womit ich falschliege«, bleibt er beharrlich.
»Es gibt da einen Typen …«
Er johlt.
»Hey! Ich war noch nicht fertig. Es gibt einen Typen, der auf unserer Farm arbeitet. Und ich dachte meine ganze Highschool-Zeit, ich wäre verliebt in ihn.«
»Ein älterer Mann«, sagt Rickie zwinkernd.
»Genau. Er hat mich nie mehr als eines Blickes gewürdigt. Aber ich konnte meine Schwärmerei nicht besonders gut verbergen. Vor ein paar Wochen habe ich rausgefunden, dass er mit jemandem zusammen ist. Und da habe ich, äh, schlecht reagiert.«
»Autsch.« Er besitzt den Anstand zusammenzuzucken.
»Ja. War nicht gerade eine Sternstunde von mir. Es kommt sogar noch schlimmer, in meinem Wutanfall war ich auch noch schrecklich zu meiner Schwester. Sie redet wahrscheinlich nie wieder mit mir.« Aus gutem Grund. Daphne schämt sich zutiefst für das, was sie gesagt und getan hat. Wenn sie die Zeit zurückdrehen und den Schaden ungeschehen machen könnte, würde sie das tun.
»Dann ist das Make-up also wie eine Rüstung«, sagt er. »Du musst dich dem Mist stellen, den du angerichtet hast, und möchtest dabei selbstbewusst wirken.«
»So ungefähr.«
»Ich verstehe. Bei der nächsten Abfahrt mache ich einen Tankstopp. Ich werde mir was zu trinken holen, möchtest du auch was? Limo? Üblen Tankstellenkaffee?«
»Nein, danke.«
Ein paar Minuten später biegt er auf die Tankstelle ein. Daphne ist sich seiner Unterarmmuskeln überaus bewusst, als er die Handbremse anzieht. Unter dem Ärmel seines Uniformhemds guckt der Rand eines Tattoos hervor.
Ich mag gar keine Tattoos, sagt Daphne zu sich selbst, auch wenn das jetzt weniger wahr ist als noch vor einer Stunde.
Rickie hängt den Tankstutzen ein und geht dann in den Shop. Sein Gang ist großspurig, und in der Uniformhose sieht sein Hintern muskulös aus.
Daphne reißt den Blick von seinem Po los, sinkt wieder zurück in den Sitz und wartet. Doch jetzt zweifelt sie an ihrer Entscheidung, heute Morgen Make-up aufzulegen. Ist es wirklich so offensichtlich? Wenn es Rickie aufgefallen ist, dann wird ihre Familie es vielleicht auch bemerken.
Sie beugt sich vor, um ihre Reisetasche aufzumachen, nimmt ihre Kulturtasche heraus und stellt sie auf ihren Schoß. Darin befindet sich eine Packung Reinigungstücher. Sie benutzt eins davon, um an ihrer Wimperntusche herumzutupfen.
»Hey«, sagt Rickie einige Minuten später und stellt einen Pappbecher in den Becherhalter. »Mach das nicht. Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe.«
»Es ist nicht nett, neue Freunde gleich zu psychoanalysieren«, grummelt sie, während die Wimperntusche abgeht.
»Ich fand, das sah heiß aus«, sagt er. »Dabei hätte ich es belassen sollen.«
»Ist egal«, erwidert sie. »Es passt sowieso nicht zu mir.«
»Du sagst das, als wäre Make-up was Schlechtes.« Rickie greift in ihre Kulturtasche und nimmt ihren Kajalstift heraus.
»Was machst du da?«
Er zieht die Kappe ab. Dann langt er zum Rückspiegel und kippt ihn in Richtung seines Gesichts. »Es ist nichts verkehrt daran, alle im Ungewissen zu lassen.«
Mit offenem Mund schaut Daphne zu, wie Rickie anfängt, sich überraschend geschickt das rechte Auge zu umranden.
»Gib ihnen nicht solche Macht«, sagt er und wechselt zu seinem linken Auge. »Wenn du jemand bist, der heute Make-up trägt, dann ist es eben so.« Er schiebt die Kappe auf den Stift, bringt den Spiegel wieder in seine vorherige Position und dreht sich, um Daphne anzusehen.
Ihr Herz gerät ins Stottern, als sie geradewegs in diese heftigen graublauen Strahleaugen schaut, die von einem Hauch schwarzen Kajals betont und optisch vergrößert werden. Er sieht jetzt doppelt so gefährlich aus wie vorher. »Du bist anders, als ich erwartet habe«, stammelt sie.
»Gut«, flüstert er. Dann gibt er ihr den Kajal und steigt aus, um den Tankdeckel wieder zuzumachen.
Einen Augenblick später sind sie wieder auf dem Highway. Daphne hatte damit gerechnet, dass er sich den Kajal abwischen würde. Aber er schert sich nicht darum. Während sie die 91 entlangfahren, schiebt er doch tatsächlich eine Kassette in das Radio im Armaturenbrett und singt dann Joan Jetts I Hate Myself for Loving You mit.
Der Song scheint eigentlich ganz passend, also stimmt Daphne mit ein.
4
Rickie
Der erste Laden auf unserer Liste ist ein Steakrestaurant außerhalb von Burlington. Und als ich hinter dem Gebäude halte, weigert sich Daphne, mich die Kiste mit dem Alkohol hineintragen zu lassen. Sie besteht darauf, es selbst zu machen.
Sie hat heute vielleicht eine Laune. Ich glaube, sie hatte erwartet, den Tag allein zu verbringen. Außerdem traut sie mir nicht. Sie kann nicht fassen, dass ich mich nicht an unser erstes Zusammentreffen erinnere.
Geht mir genauso, Mädchen, denke ich, während ich zusehe, wie sie durch die Hintertür des Restaurants verschwindet. Seit meiner Zeit in Connecticut ist mein Leben eine einzige wilde Fahrt. Ich erzähle den Menschen in meinem Leben nie die ganze Geschichte, weil ich es satthabe, der Typ zu sein, der sechs Monate aus seinem Gedächtnis verloren hat.
Ehrlich gesagt ist es leichter, ein primitives Arschloch zu sein als der Freak.
Etwas sagt mir, dass ich gar nicht der eigentliche Grund für Daphnes Missmut bin. Irgendetwas beschäftigt sie, und es hat rein gar nichts mit mir zu tun.
Ich hätte ein paar Ideen, wie ich sie aufmuntern könnte, wenn sie sich nur darauf einlassen würde.
Gerade als ich das denke, taucht Daphne wieder auf. Sie hat ein ernstes Stirnrunzeln aufgesetzt, das nicht zum Nachfragen einlädt. Und weil ich Stimmungen einschätzen kann, halte ich mich an das, was zu erledigen ist. Sobald sie wieder eingestiegen ist, lenke ich den Pick-up ins Stadtzentrum.
Unsere zweite und letzte Lieferung geht an eine Weinbar. Das Vino und Veritas liegt in der Church Street, in der Autos verboten sind. Aber dahinter gibt es eine Gasse, die die Anlieferung erleichtert. Daphne verschwindet durch die Hintertür des Ladens und taucht eine Minute später wieder auf.
»Wieso liefern wir das Zeug eigentlich persönlich aus?«, frage ich, während ich vorsichtig rückwärts aus der Gasse setze. »Griffin hat doch einen Lieferanten für seinen Cider, oder nicht?«
»Der Apfelschnaps ist noch in der Entwicklung«, sagt sie. »Er stellt nicht genug davon her, um auf die Mindestabnahmemenge des Lieferanten zu kommen.«
»Oh. Dein Bruder ist ein witziger Typ. Er ist ein Tüftler, stimmt’s? Experimentiert immer an der Zusammensetzung diverser alkoholischer Getränke herum. Gibt’s was Cooleres als das?«
»Echt cool«, murmelt sie. »Kannst du mich beim Gebäudekomplex für die Sozialwissenschaften absetzen? Ich möchte an meinem ersten Tag nicht zu spät kommen.«
»Sicher doch, Schöne. Kein Problem.«
Ich mache es sogar noch besser. Ein paar Minuten später fahre ich direkt vor der Fakultät für Gesundheitswesen vor. »Ich parke da drüben«, sage ich und zeige auf das Parkhaus eine Ecke weiter. »Wann soll ich wieder hier sein?«
»Ähm, ist siebzehn Uhr zu spät?« Sie schaut nervös zum Gebäude.
»Nein, das passt. Ich hab noch Erledigungen zu machen. Außerdem werde ich im Café ein bisschen Zeit totschlagen.«
»Äh, danke.« Als sie schwer schluckt, wird mir klar, dass selbst Daphne Shipley Bammel vor dem ersten Tag befällt. Wer hätte das gedacht? Sie schultert ihren Rucksack und steigt aus dem Wagen aus.
Ich lasse das Fenster herunter. »Hey, Daphne?«
Mit einem leicht genervten Runzeln auf der Stirn dreht sie sich wieder um. »Was?«
»Du bist der Hammer.«
»Was?« Sie blinzelt.
»Du rockst das. Jetzt geh schon. Komm zeitig. Beeindrucke die Welt des Gesundheitswesens. Das willst du doch, gib’s zu.«
»Danke.« Sie schenkt mir ein so zartes Lächeln, dass man fast ein Elektronenmikroskop bräuchte, um es zu entdecken. Und dann schreitet sie davon, die langen Beine wie Honig im Sonnenschein, und verschwindet durch die Glastür des Gebäudes.
Und ich sitze bloß da wie ein Holzkopf und wünsche mir, ich hätte einen Abschiedskuss bekommen.
Diesen Sommer besuche ich eine Vorlesung in Philosophie der Antike, und die erste Stunde macht richtig Spaß.
Nach meiner Verletzung habe ich zwei Semester verloren. Ich brauchte ein Jahr, um mein Leben neu zu sortieren, mich an der Burlington University einzuschreiben und nach Burlington zu ziehen. Obwohl ich also bereits zweiundzwanzig bin, liegt mein Abschluss noch in weiter Ferne.
Aber Uni gefiel mir schon immer. Und neunzig Minuten lang im Vorlesungssaal einem Professor zuzuhören, der Sophokles erläutert, ist kurzweilig.
Hinterher verbringe ich etwas Zeit in der Buchhandlung, bevor ich wie angekündigt ins Café gehe. Aber nur kurz. Ich habe noch einen Termin in Burlington, den ich Daphne gegenüber nicht erwähnt habe.
Es ist an der Zeit für einen Besuch bei meiner Seelenklempnerin.
Lenore ist eine junge, frisch promovierte klinische Psychologin – ganz genau, was ich in einigen Jahren auch zu sein hoffe. Sitzungen bei ihr sind auf mehr als eine Art nützlich für mich. Lenore hilft mir nicht nur bei meinen Problemen – und davon gibt es so einige –, ich lerne auch von ihr. Sie ist klug und redet mit mir als zukünftigem Kollegen sowie als Patient.
»Mein Gott, Sie sind aber braun geworden!«, kreischt sie, als ich ihr Sprechzimmer betrete. »Und so durchtrainiert, dass ich Sie kaum wiedererkenne.«
»Wollen Sie damit etwa sagen, dass ich vorher blass und geisterhaft wirkte?« Ich lasse mich auf meinen Sessel plumpsen.
»Ach, bitte. Sie sind heute ja überpünktlich, Rickie. Ich glaube, Sie haben mich vermisst.«
»Aber sicher doch. Mir hat schon einen ganzen Monat niemand mehr neugierige Fragen gestellt.«
»Na, dann beheben wir das doch mal. Wie ist es Ihnen ergangen? Erzählen Sie mir alles. Melken Sie Kühe?«
»Hauptsächlich schaufele ich deren Fladen auf. Aber es ist trotzdem schön.« Ich erzähle ihr von der Shipley-Farm und meinem Muskelkater und dem Auftauchen des Bären gestern.
»Etwas sagt mir, dass dieser Bär jedes Mal, wenn Sie diese Geschichte erzählen, noch wilder wird«, sagt sie und spielt dabei mit dem Anhänger ihrer Halskette.
»Nennen Sie mich etwa einen Lügner? Ist das eine gute Arzt-Patienten-Interaktion?«
»Nicht einen Lügner«, sagt sie mit einem Augenrollen. »Einen Ausschmücker.«
»Schön. Na klar. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen, aber Sie glauben, ich schmücke bloß aus. Ich verstehe.«
Sie schenkt mir ein nachsichtiges Lächeln. »Sie wirken zufrieden, Rick. Und das steht Ihnen.«
»Danke«, sage ich leise. Und ich schätze, sie hat recht. Die letzten drei Jahre waren die Hölle. Zufriedenheit ist etwas, von dem ich dachte, ich würde es womöglich nie finden.
»Haben Sie Ihre Eltern besucht?«, fragte Lenore mit einem Mal.
»Nope.« Dabei verspüre ich ein stechendes Schuldgefühl. Sie leben vielleicht vierzig Minuten entfernt von meinem Wohnort. Aber unser Verhältnis zueinander ist so angespannt, dass ein Besuch bei ihnen für mich nicht gerade oberste Priorität hat.
»Hätten Sie den Sommer über auch zu Hause wohnen können?«, fragt sie und hält damit an diesem unangenehmen Thema fest.
»Ich denke schon. Ja. Dann hätte ich mir allerdings einen Sommerjob suchen müssen. Bei den Shipleys ist der Job gleich inbegriffen. Außerdem sind die Shipleys nicht enttäuscht von mir, weil ich an der Academy gescheitert bin und dann einen Vergleich angenommen habe.«
Sie schaltet sich noch nicht ein. Sie wartet ab, wie es ein kluger Therapeut eben macht.
»Ich nehme an, ich sollte sie mal besuchen, damit dieser Mist nicht vor sich hin gärt, oder?«
»Kommt drauf an«, sagt sie ruhig. »Es gibt Eltern, die es gar nicht anders verdient haben, als dass man sie aus seinem Leben verbannt. Es gibt toxische Menschen auf dieser Welt, und denen schuldet man gar nichts. Aber wenn Sie denken, dass Ihnen ein gutes Verhältnis für die Zukunft wichtig ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, einen gemeinsamen Nenner zu finden.«
Nach außen hin bin ich so gelassen wie eh und je. Dabei befinde ich mich erst seit drei Minuten in Lenores Praxis, und sie hat bereits einen wunden Punkt gefunden und draufgedrückt. Früher hatte ich ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Ich bin ihr einziges Kind, und während meiner Kindheit haben wir zusammen die Welt bereist. Wir standen uns nah.
Dann ging ich an die Alma Mater meines Vaters, die US Tactical Services Academy. Ich war nicht sonderlich begeistert davon, sie Middlebury vorzuziehen, wo ich ebenfalls angenommen worden war. Anders als mein Vater bin ich nicht so der Typ fürs Militär. Aber es sprach einiges dafür. Zuerst mal die Kosten. Die Academy ist kostenlos. Ich hätte nach meinem Abschluss keinerlei Schulden gehabt.
Zweitens war mein Vater stolz, als ich angenommen wurde. Mächtig stolz. Das fand ich megacool.
Und schließlich interessierte ich mich auch für eine berufliche Laufbahn beim militärischen Geheimdienst. Obwohl ich in Reih und Glied marschieren sterbenslangweilig fand, gefiel mir der Gedanke, dass ich eines Tages Spion werden könnte.