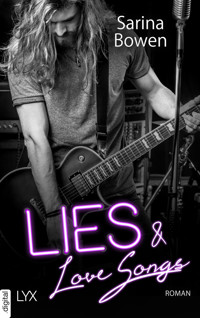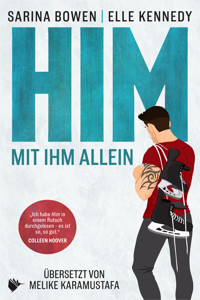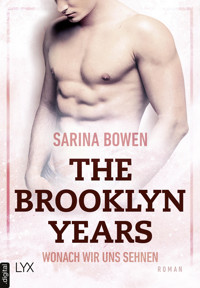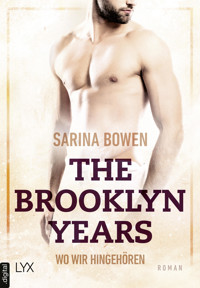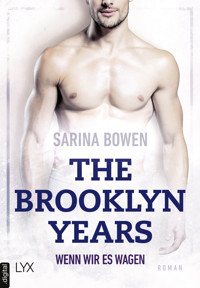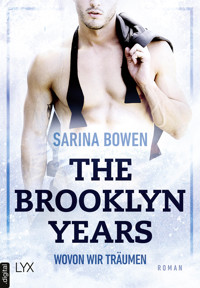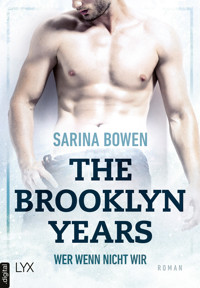9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Burlington U
- Sprache: Deutsch
Das Einzige, was unsere Freundschaft zerstören könnte, sind Gefühle, die wir für uns behalten ...
Für Chastity war es Liebe auf den ersten Blick: Seit Jahren empfindet sie für ihren besten Freund Dylan Shipley mehr, als sie sollte. Dass sie mit ihm am selben College studieren wird, stand außer Frage. Doch dort lernt sie Dylan von einer völlig neuen Seite kennen: als Frauenheld. Nur in ihr scheint er nicht mehr als seine beste Freundin zu sehen. Aber Chastity ist nicht bereit, das Feld kampflos zu räumen - was sie in einer Nacht die Grenzen ihrer Freundschaft überschreiten lässt. Und seitdem ist nichts mehr, wie es war ...
"Sarina Bowens Geschichten zu lesen ist wie nach Hause kommen. Ich lache, weine, fühle und verliebe mich!" APRIL DAWSON
Band 1 der neuen New-Adult-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Sarina Bowen bei LYX
Impressum
SARINA BOWEN
Was wir in uns sehen
BURLINGTON UNIVERSITY
Roman
Ins Deutsche übertragen von Wanda Martin
ZU DIESEM BUCH
Für Chastity war es Liebe auf den ersten Blick: Seit Jahren empfindet sie für ihren besten Freund Dylan Shipley mehr, als sie sollte. Er versteht sie wie kein anderer und weiß genau, was sie alles durchmachen musste – bloß von Chastitys Gefühlen hat er keine Ahnung. Dass sie ihm an die Burlington University folgen und gemeinsam mit ihm studieren wird, steht für sie dennoch außer Frage. Doch am College lernt sie eine Seite an Dylan kennen, die so gar keine Ähnlichkeit mit dem netten Jungen von nebenan hat: Der neue Dylan ist nicht nur der begehrteste Student des Campus, er liebt auch Partys, und die Frauen liegen ihm reihenweise zu Füßen. Nur in Chastity scheint er nach wie vor nicht mehr als seine beste Freundin zu sehen. Aber sie ist nicht bereit, das Feld kampflos zu räumen. In einer leidenschaftlichen Nacht überschreiten die beiden die Grenzen ihrer Freundschaft, als sie Dylan bittet, ihr nicht nur in Algebra Nachhilfe zu geben, sondern auch im Bett. Und danach ist nichts mehr, wie es war …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für Vermont. Bleib so verrückt, wie du bist.
1
Chastity
»Bitte sei vorsichtig, Chastity. Trink nichts, was dir nicht in einer ungeöffneten Flasche gegeben wird – es sei denn, Dylan ist derjenige, der es dir einschenkt.«
»Ich werde aufpassen, Leah«, erwidere ich. Aber gleichzeitig verdrehe ich die Augen vor dem Spiegel, in dem ich mich gerade ein letztes Mal von oben bis unten betrachte, bevor ich zu meiner ersten Collegeparty gehe.
Das Festnetztelefon des Wohnheimapartments hat ein langes Spiralkabel, das sich gerade eben bis ins Bad ziehen lässt. Somit kann ich mir Leahs Bedenken anhören und gleichzeitig mein Aussehen checken.
Mit zusammengekniffenen Augen betrachte ich mein Spiegelbild und schließe den zweiten Knopf meiner Bluse. Dann knöpfe ich ihn jedoch wieder auf. Ich möchte attraktiv wirken, aber mein Oberteil soll nicht schreien: HIER, GUCK MAL, MEINE BRÜSTE.
Es ist ein schmaler Grat.
»Geh nicht in den Keller«, sagt Leah. »Da spielen sich immer die ganzen dummen Geschichten ab.«
»Was denn für dumme Geschichten?«, frage ich, hellhörig geworden. Ich wüsste nicht, dass Dylans Haus in der Spruce Street überhaupt einen richtigen Keller hat. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich trotz Leahs Warnung hinuntergehen. Anscheinend kapiert keiner, was für eine Lust ich auf dumme Geschichten habe. Und schon immer hatte. Es ist nur so, dass sich mir in meinem Leben noch nicht viele Gelegenheiten dazu geboten haben.
»Sei einfach vorsichtig. Vertrau auf dein Bauchgefühl. Es gibt Männer, die machen Mädchen betrunken oder high, nur um an sie ranzukommen.«
»Ich werde sehr vorsichtig sein«, verspreche ich, weil sich dieses Gespräch auf diese Art einfach am schnellsten beenden lässt.
Leah meint es gut. Sie ist bloß acht Jahre älter als ich, sieht sich aber als meine Beschützerin. Vor zwei Jahren – mit neunzehn – bin ich von der Sekte abgehauen, in der wir beide aufgewachsen sind.
Ich schulde ihr viel. Obwohl wir bloß entfernte Cousinen sind, hat sie mich ohne viel zu fragen bei sich aufgenommen. Meine Zukunft und ich liegen Leah am Herzen, was deutlich mehr ist, als ich von meinen richtigen Eltern behaupten kann. Wäre ich auf der Paradise Ranch geblieben, wäre ich inzwischen mit einem fünfzigjährigen Mann verheiratet, der noch vier weitere Frauen hat.
Wenn Leute davon hören, sagen sie manchmal, wir hätten eine »schillernde Vergangenheit«. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Es war überhaupt nicht schillernd, es war echt trostlos. Und deshalb stehe ich jetzt hier in einer weinroten Seidenbluse aus dem Secondhandladen und einer engen Jeans, die mir auf der Ranch eine Tracht Prügel eingebracht hätte.
Leah hat mir vor zwei Jahren meine erste Jeans gekauft. Ich zog sie sofort an und kam mir sehr kühn dabei vor. Dann schaute ich in den Spiegel und dachte: Hure. So haben sie mich nämlich immer genannt.
Manchmal höre ich ihre Stimmen noch in meinem Kopf. Für sie war ich eine Hure. Und das nur, weil ich einen Jungen geküsst hatte.
»Kommst du dieses Wochenende nach Hause?«, fragt Leah. Mit nach Hause meint sie ihre Farm in Tuxbury, die etwa eine Autostunde von der Uni in Burlington entfernt liegt.
»Ich glaube schon.« Ich drehe die Kappe von meiner einzigen Tube Lipgloss und ziehe vor dem Spiegel meine Lippen nach.
»Hast du Dylan von deiner Idee erzählt?«
»Noch nicht.« Und das ist einer der Gründe, warum ich zu der Party bei ihm gehe.
Es ist Mittwoch, und da treffen wir uns eigentlich immer zur Nachhilfe. Aber heute ist er nicht aufgetaucht. Ich besitze kein Handy, wahrscheinlich habe ich deshalb nichts von ihm gehört. Er muss auf dem Festnetz angerufen haben, als ich nicht da war.
Dylan ist ein bisschen unzuverlässig, aber er ist ein guter Freund. Er hat noch nicht einen Mittwochstermin verpasst. Diese eine Stunde in der Woche ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Ich verbringe liebend gern Zeit mit Dylan. Aber Algebra. Uff. Das ist nicht meine Stärke. Ich versuche dabei die ganze Zeit, weder dumm noch liebeskrank rüberzukommen – mit unterschiedlichem Erfolg.
Ersteres gelingt mir vermutlich nicht, aber Dylan hat keine Ahnung, was ich für ihn empfinde, und ich habe vor, es dabei zu belassen.
»Ich hoffe, Dylan gefällt deine Idee«, sagt Leah. »Sie hat großes Potenzial. Freitags- und samstagabends steht euch die Küche zur freien Verfügung. Diese Zeiten bucht nie jemand.« Leah stellt edle Käsekreationen her, was jedoch ein Saisongeschäft ist. Deshalb vermietet sie die Gewerbeküche ihrer Molkerei in den Wintermonaten an andere Unternehmer.
»Wenn Dylan mitmacht, wird er sich für Samstag entscheiden«, sage ich zu ihr. »Die Freitage sind seiner schrecklichen Freundin vorbehalten.«
»Schscht!«, zischelt Leah. »Kann sie dich nicht hören?«
»Nein. Sie ist nicht da.« Der größte Fehler meines Collegelebens – der ganzen vier Wochen hier – war es, Dylan darum zu bitten, dass er mir am Einzugstag hilft, meine Sachen ins Wohnheim zu bringen.
Wenn ich so darüber nachdenke, hatte ich ihn nicht mal darum gebeten. Er hat es von sich aus gemacht. Er fuhr mich in seinem alten Pick-up zur Uni und setzte mich beim Wohnheimbüro ab, damit ich meine Schlüssel holen konnte.
Und ich war ihm unheimlich, unheimlich dankbar. Bis zu dem Moment, als Dylan meinen einzigen Karton ins Wohnheim trug. Ich war so nervös, dass ich das Gefühl hatte, mich gleich übergeben zu müssen, aber Dylan pfiff fröhlich vor sich hin, während er mir voran durch den Flur zu Apartment 302 ging.
»Mach auf«, hat er nett gesagt. »Mal sehen, ob die Wohngötter dir wohlgesinnt waren.«
Waren sie nicht. Ich meine – das Apartment ist in Ordnung. Mein Bett steht nicht im selben Zimmer wie Kaitlyns. Wir teilen uns nur zu zweit das Bad. Ich habe einen Schreibtisch, eine Kommode und ein Fenster. Ich kann mich nicht beschweren.
Ich hatte gehofft, eine Mitbewohnerin zu bekommen, mit der ich mich anfreunde, doch Kaitlyn zeigte mir sofort die kalte Schulter. Sie hat kaum in meine Richtung geschaut.
Dylan hat sie dagegen nicht ignoriert. Man kennt doch diesen Satz: »Ihre Augen fingen an zu leuchten«? Tja, ich habe noch nie gesehen, wie jemanden so offensichtlich und plötzlich die Lust überkommen hat. Sie war wie eine Cartoonfigur mit Herzchen in den Augen.
»Ist das dein Bruder?«, fragte sie.
»So ungefähr«, hat Dylan leise lachend geantwortet. »Wir leben auf benachbarten Farmen.«
»Wie süß«, hat sie geschleimt.
Und während ich dann meine wenigen Habseligkeiten verstaute, hat sie ihn vollgequatscht. Ich erfuhr alles über ihr Leben in Manhattan und ihren Ärger mit dem Barnard College – wo auch immer das sein mag. »Es gab da einen kleinen Flirt mit einem Professor«, sagte sie seufzend. »Der nahm kein gutes Ende. Meine Familie ist entsetzt.« Sie schenkte ihm ein sexy Grinsen. »Hier bin ich nun also, ins Hinterland verbannt, um fertig zu studieren.«
»Willkommen an der Moo U«, sagte Dylan mit einem trägen Lächeln. »Nicht gerade New York City, aber bei uns kann man auch seinen Spaß haben.«
Gleich am nächsten Tag fragte sie mich nach seiner Nummer. »Ich will wissen, ob er mir eine Reinigung empfehlen kann. Er hat gemeint, ich könne ihn alles fragen.«
»Es würde mich wundern, wenn Dylan jemals was zu einer Reinigung gebracht hat«, habe ich erwidert. Aber ich gab ihr trotzdem seine Nummer.
Großer Fehler.
In der darauffolgenden Woche kam sie zweimal nachts überhaupt nicht nach Hause. Zuerst dachte ich, das wäre eine super Entwicklung. Ich fand es toll, das Apartment für mich allein zu haben. Doch dann – ich lief gerade über den Campus und gratulierte mir innerlich dazu, eine Abkürzung zum Mathe-Fachbereich gefunden zu haben – sah ich die beiden. Kaitlyn stand mit Dylan unter einem Baum. Dann hat er sich vorgebeugt und sie geküsst.
Nein … das trifft es nicht ganz. Er hat sie praktisch an Ort und Stelle verschlungen, am helllichten Tag, zwischen den Kursen. Ich bin noch nie im Leben schneller abgehauen.
Drei Wochen später bin ich immer noch nicht darüber hinweg. Mir war bewusst, dass Dylan schon jede Menge Sex hatte. Seine Zwillingsschwester bezeichnet ihn als »die Schlampe der Familie«. Es hängen immer irgendwelche Mädchen aus seinem Highschool-Jahrgang auf der Shipley Farm ab und fahren vorne in seinem Pick-up mit. Ich bin immer eifersüchtig auf diese Mädchen.
Aber Kaitlyn? Allein die Vorstellung von ihr und Dylan macht mich wahnsinnig. Es ist auch ganz egal, ob ich das jetzt im Moment laut ausspreche. Kaitlyn ist mit ziemlicher Sicherheit gerade bei Dylan zu Hause. Sollte sich herausstellen, dass er unsere Nachhilfestunde mit ihr statt mit mir verbracht hat, wäre das ein herber Schlag.
Aber Dylan wird es wiedergutmachen. Er ist wirklich ein guter Freund.
»Berichte mir, wie es gelaufen ist«, sagt Leah. »Ich bringe Maeve jetzt mal lieber ins Bett. Ich kann hören, wie sie Isaac anbettelt, noch eine Geschichte vorzulesen.«
»Gib ihr einen Gutenachtkuss von mir«, sage ich. »Ich rufe dich noch mal wegen des Wochenendes an und gebe dir Bescheid, ob wir die Küche Samstagabend brauchen.«
»Viel Spaß heute Abend, Chass. Sei nur –«
»… vorsichtig. Ich weiß, Leah. Werde ich sein.«
Wir legen auf. Ich werfe noch einen letzten Blick in den Spiegel, nehme dann meinen Rucksack und verlasse das kleine Apartment.
Ich eile die zwei Treppenabsätze hinunter und gehe auf die Ausgangstür des Wohnheims zu. Draußen ist es schon dunkel, und ich kann in der Glastür mein Spiegelbild sehen. Durch den Schulterriemen meines Rucksacks ist die Bluse ein wenig verrutscht und ein klitzekleines Stück meines BHs blitzt darunter hervor.
Als ich ruckartig stehen bleibe, um das zu richten, läuft jemand von hinten in mich hinein.
Wir schreien beide unisono auf.
»Sorry!«, kreische ich und drehe mich herum.
»Nein, das war voll meine Schuld«, stammelt das andere Mädchen. Ihr Name ist Ellie, glaube ich. Wir sind im gleichen Englischkurs. Sie hält mir die Tür auf. »Dein Outfit sieht übrigens gut aus. Hör auf, am Kragen herumzuzupfen.«
»Äh, danke.«
»Hast du ein Date? Ziemlich schick für einen Mittwochabend.« Wir schlagen auf dem Gehweg dieselbe Richtung ein. »Ich gehe in die Bibliothek, so eine Stimmungskanone bin ich.«
»Ach, ich war heute schon vier Stunden dort«, versichere ich ihr. Ich erzähle ihr nicht, dass ich die ganze Zeit nur darauf gewartet habe, dass Dylan Shipley zur Nachhilfe auftaucht. »Ich gehe auf eine Party außerhalb vom Campus.«
»Tatsächlich«, sagt Ellie grinsend. Sie hat den Mund voll mit diesen Zahnspangen-Brackets. Tragen die denn nicht nur Kinder? Es ist zwei Jahre her, dass ich die Sekte verlassen habe, in der ich aufgewachsen bin, doch vieles finde ich immer noch verwirrend. Vierundzwanzig Monate sind keine große Zeitspanne, um die ganze Welt verstehen zu lernen. »Viel Spaß dir. Ich versuche derweil, Aristoteles zu kapieren.«
»Cool.« Was Aristoteles ist, weiß ich auch nicht.
Sie greift nach meiner Hand und zieht sie vom zweiten Knopf meiner Bluse weg, an dem ich herumgefummelt habe. »Nicht dran rumspielen. Dadurch lösen sich die Knöpfe.«
»Stimmt. Aber …« Ich zögere. »Ist es zu viel?« Ich wedele mit einer Hand vor meiner Brust herum.
»Zu viel was? Sexyness? Auf keinen Fall. Wenn ich Brüste hätte, würde ich sie mit Stolz tragen. Wen auch immer du damit beeindrucken willst – derjenige wird es toll finden.« Sie winkt mir und trottet in Richtung Bibliothek davon. »Viel Spaß!«, ruft sie über ihre Schulter.
Immer noch unsicher laufe ich weiter. Jetzt zu Dylan zu gehen, ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich habe keine Ahnung, warum er unseren Nachhilfetermin heute hat platzen lassen. Das passt nicht zu ihm. Andererseits hat er viel um die Ohren. Außerdem bin ich hier diejenige ohne Handy.
Es ist nicht Dylans Schuld, dass ich von vier bis halb acht wie ein Dummie in der Bibliothek gesessen und die Abendessenszeit verpasst habe. Aber wenn es um Dylan geht, war ich schon immer ein bisschen blöde.
Mir knurrte der Magen, als ich es schließlich aufgab, auf ihn zu warten. Auf dem Nachhauseweg blieb ich vor dem Mini-Markt stehen und überlegte, was man sich wohl für zwei Dollar kaufen kann. Eigentlich nur Süßigkeiten. Ich habe nichts gekauft, bin aber Dylans Mitbewohner begegnet, einem echten Original namens Rickie.
»Chastity!«, rief er aus, als er mit einer vollen Einkaufstüte mit diversen Sorten Chips in der einen Hand und einem Beutel Eiswürfeln in der anderen aus dem Laden kam. »Was geht, die Dame? Kommst du nachher vorbei?«
»Wegen …?« Ich bin erst ein Mal in ihrem Haus gewesen. Es liegt ziemlich weit ab vom Schuss, deshalb trifft sich Dylan immer auf dem Campus mit mir.
»Die Party! Hat Dylan dir nicht Bescheid gesagt?«
Hat er nicht. Aber das ließ ich mir nicht anmerken. »Ich habe Dylan heute nicht getroffen«, erklärte ich ihm. »Weißt du zufällig, wo er war?«
»Zu Hause in Tuxbury«, sagte Rickie. »Shit, Chastity. Er meinte, er würde dich anrufen. Die Ziegen sind ausgebüxt und haben was gefressen, was sie nicht sollten.«
»Oh nein!«
»Doch. Er bekam einen Anruf, es wurde herumgeschrien, und dann ist Dylan in den Pick-up gestiegen und nach Hause gefahren. Aber er wird um neun zur Party zurück sein. Komm vorbei. Ich mache heißen Apfelpunsch und Guacamole.«
Mein Magen grummelte, und die Entscheidung schien einfach.
Aber während ich jetzt bergan auf das viktorianische Haus zu stapfe, in dem Dylan mit Rickie und noch einem anderen Kerl namens Keith wohnt, zweifle ich an sämtlichen Lebensentscheidungen von mir. Wahrscheinlich werde ich mich mit Fremden unterhalten müssen, was nicht gerade meine Stärke ist.
Oder alle werden mich einfach ignorieren, was auch öde Aussichten sind.
Außerdem wären da noch die unfertigen Algebra-Hausaufgaben in meinem Rucksack. Wenn ich jetzt da auftauche, wird Dylan sich bloß schuldig fühlen, weil er unseren Termin verpasst hat.
Trotzdem treiben mich zwei Dinge weiter bergan. Zuerst mal die Guacamole. Bevor ich als neunzehnjährige Ausreißerin nach Vermont kam, hatte ich noch nie zuvor eine Avocado gesehen – und damit echt was verpasst. Das zweite ist eine krankhafte Neugierde. In den vier Wochen, seit ich an der Burlington University bin, habe ich den College-Dylan immer nur kurz erlebt. Und ich möchte mehr herausfinden.
Der Dylan, den ich aus Tuxbury kenne, ist der Familien-Dylan. Er melkt Ziegen und Kühe. Er pfeift auf der Obstwiese beim Äpfelpflücken vor sich hin. Er zieht zum Heustapeln sein T-Shirt aus. Er nimmt sich am Esstisch noch einen dritten Nachschlag. Er streitet mit seinen Geschwistern und begleitet seine Mutter in die Kirche.
Und was noch? Er ist mir ein guter Freund.
Der College-Dylan ist jedoch anders. Und zwar – na gut – noch faszinierender. College-Dylan trinkt und kifft und hat (soweit ich es beurteilen kann) jede Menge Sex. Manchmal mit meiner bösen Mitbewohnerin.
Niemals mit mir.
2
Chastity
Seit Einbruch der Dunkelheit sind die Temperaturen drastisch gesunken, deshalb zittere ich, als ich beim Haus ankomme.
Trotzdem bleibe ich ein, zwei Minuten auf dem Weg zur Haustür stehen, um mich zu orientieren. Es ist ein schönes Haus in einer von Bäumen gesäumten Straße. Es hat drei Etagen und mehrere Dachfirste. Dylan sagt, er habe Glück, hier zu wohnen. Rickie verlangt nicht viel Miete. Heute Abend leuchtet das Haus wie ein Halloweenkürbis, hinter sämtlichen Fenstern brennt gelbes Licht.
Obwohl die Fenster geschlossen sind, dringen Stimmen – viele Stimmen – zu mir herüber. Und Musik. Die Geräusche von Leuten, die Spaß haben. Je länger ich so dastehe, desto weniger kann ich mir vorstellen hineinzugehen. Ich werde niemanden kennen außer Rickie und Dylan. Und Kaitlyn, die sowieso nicht mit mir reden wird.
Am Erkerfenster entdecke ich Dylan. Das ist nicht schwer. Seit dem Tag vor zwei Jahren, als ich ihn kennengelernt habe, besitze ich eine Antenne für den Dylan-Shipley-Sender. Seine große Gestalt und seinen dichten, welligen Haarschopf würde ich überall erkennen. Alle Shipleys haben braune Haare, aber Dylans sind von helleren Strähnen durchzogen. So als hätte die Sonne ihn ein kleines bisschen lieber als alle anderen.
Er wendet mir den Rücken zu, sodass ich seine lachenden Augen nicht sehen kann. Aber er gestikuliert beim Reden und schwenkt dabei heftig eine zwischen zwei Finger geklemmte, fast vergessene Bierflasche. Man braucht ihn nur anzusehen, um zu wissen, dass er ein fröhlicher Mensch ist.
Fröhlich und außerdem nett. Und herzlich. Und urkomisch.
Okay, ich schaffe das.
Ich marschiere die Verandastufen hinauf und öffne die große Eichentür, hinter der mich glänzende Holzfußböden erwarten und ein Türbogen, durch den es ins Wohnzimmer geht. Am Fenster steht Dylan in seinem typischen Outfit – abgetragene Jeans und ein enges T-Shirt. Und da Oktober ist, hat er ein Flanellhemd darübergezogen, dessen Ärmel über seinen muskulösen Unterarmen hochgekrempelt sind.
»… diese Ziegen sind verdammte kleine Houdinis. Griff ruft mich mindestens einmal täglich an, um sich zu beschweren. Heute hatten sie allerdings sämtlichen Spinat und Grünkohl meiner Mom gefressen, deshalb hat er mich angeschrien, als ich ans Telefon ging.« Kopfschüttelnd trinkt Dylan einen Schluck aus der Bierflasche in seiner Hand. »Ich bin heimgefahren, damit er sich beruhigt. Als würde das überhaupt was bringen. Und als ich dort ankomme, will er, dass ich den Zaun höher mache, ja? Also gucke ich mich um …«
Ich kenne die besagten zwei Milchziegen. Das sind listige, kleine, wahnsinnig niedliche Tiere. Dylan hat sie sehr gern. Vielleicht sogar noch lieber als seine Kühe.
»… und der Zaun ist total in Ordnung. Also hab ich Mister Grummelig gefragt, ob er vielleicht zuvor einen Futtereimer ins Ziegengehege gestellt hatte. Und er so: ›Was wäre, wenn?‹ Und daraufhin frage ich, ob ein Deckel drauf war. Und er sagt: ›Woher weißt du das?‹« Dylan schüttelt den Kopf, als könne er so viel Dämlichkeit nicht fassen. »Na, weil du mir hier den Allerwertesten aufreißt, obwohl du der Blödmann bist, der diesen kleinen Scheißerchen einen Eimer hingestellt hat, auf den sie klettern und über den Zaun steigen können.«
Alle lachen leicht angetrunken. Es sind vielleicht ein Dutzend Leute im Wohnzimmer. Ein Grüppchen sitzt auf dem Fußboden und reicht einen kleinen Kürbis herum. Jemand hat ihn mit zwei Röhrchen ausgestattet, die auf beiden Seiten herausstehen. Es ist eine Kürbis-Wasserpfeife.
Man nimmt einen Zug und reicht sie weiter. Ich habe das allerdings noch nie gemacht. Bis letzten Monat kannte ich Gras nur aus Filmen. Ich hatte den Geruch in Dylans Pick-up wahrgenommen, ohne zu wissen, um was es sich handelte.
Die Uni bildet eben.
Mein Blick bleibt an der Couch hängen, die ebenfalls besetzt ist. Die, die dort sitzen, hören Dylan allerdings nicht zu, denn sie sind zu beschäftigt damit, miteinander rumzumachen. Das Ganze wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn sie nicht zu dritt wären. Zwei Mädchen und ein Kerl. Mir ist noch nie in den Sinn gekommen, dass sich drei Leute gleichzeitig küssen könnten, aber sie scheinen das ganz prima hinzukriegen.
Ich kann den Blick nicht davon lösen. Es ist ein zugleich schönes und verwirrendes Bild. Der Junge hat die Augen zu. Ich sehe kurz seine Zunge, als ihre Münder neu zusammenfinden. Seine Hand steckt unter dem Oberteil eines der Mädchen. Und dieses Mädchen hat seine Hand auf der Brust des anderen Mädchens. Während ich zuschaue, fährt sie langsam mit dem Daumen über die Brustwarze. Sie zeichnet sich hart unter dem T-Shirt ab.
Okay, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das antörnen würde, aber bitte. Ehrlich gesagt, törnt mich vieles an. Das war schon immer so. Seit ich dreizehn bin, tobt in mir ein Kampf darüber, was ich denken sollte und woran ich tatsächlich denke.
Ich hoffe inständig, dass niemand Gedanken lesen kann.
Musik wummert im Hintergrund, während Dylan seine Geschichte über die Ziegen zu Ende erzählt. Seine Mutter ist sauer, weil sie sich durch ihren Gemüsegarten gefressen haben. »Und ohne ein hübsches Grünkohlbeet kann man sich quasi nicht als Vermonter Farmerin bezeichnen. Was werden die Nachbarn sagen?«
Alle lachen. Mein Blick verweilt bei Kaitlyn, als diese die Wasserpfeife weiterreicht, nachdem sie daran gezogen hat. Meine böse Mitbewohnerin schaut mit Sternchen in den Augen zu Dylan hoch.
Das kann man ihr schlecht vorwerfen, denn ich gucke ihn wahrscheinlich genauso an. Es ist buchstäblich das Einzige, was wir gemeinsam haben.
Kaitlyn steht auf, als Dylan zum Ende seiner Geschichte kommt. Sie nimmt ihm das Bier aus der Hand und trinkt einen kräftigen Schluck. Ich schätze, das ist eine Art, Besitzansprüche auf ihn anzumelden. Es weckt in mir den Wunsch, ihr eine zu klatschen. »Komm, Dyl«, sagt sie in dem Augenblick, als er zu reden aufhört. »Du hast gesagt, ich darf dir etwas vorspielen.«
»Ja, okay. Cool.« Zusammen gehen sie einen Schritt in meine Richtung. Da hebt Dylan den Kopf und bemerkt mich. »Chastity! Hallo!« Er zieht mich in eine Shipley-typische Ganzkörperumarmung – eine von der Sorte, auf die ich nie so ganz vorbereitet bin. »Gott, tut mir leid wegen heute Nachmittag. Rickie meinte, du hast gewartet.«
Autsch. Ich wünschte, Rickie hätte das nicht erwähnt.
»Schon g…gut«, stammele ich, während seine Arme mich umschließen. Kurz drückt seine feste Brust gegen meinen Oberkörper. Das Flanellhemd, das er trägt, kann die Muskeln darunter nicht verhüllen.
Seine Umarmungen bringen mich immer aus der Fassung. Ich zähle bis drei und trete dann einen Schritt zurück, damit ich mich nicht dabei ertappe, wie ich allzu lange unbeholfen seinen Rücken tätschele. Das passiert mir manchmal.
Ich bin jetzt seit zwei Jahren in Vermont, und während ich mir vieles erschlossen habe – zum Beispiel Netflix und Nagellack –, machen diese kleinen Zusammentreffen mich immer noch verlegen. Auf der Ranch hat ein Mann niemals ein Mädchen umarmt, das nicht seine Frau war. Wir haben einander nicht einmal die Hand gegeben.
Heute bin ich eine annehmbare Händeschüttlerin, und es gibt auch einige Menschen, die ich ohne Schwierigkeiten umarmen kann. Dylan gehört allerdings nicht dazu. Ich stehe dermaßen auf ihn, dass ich bei jeder Umarmung wie eine nervöse Versagerin rot anlaufe.
»Ich habe angerufen«, sagt er.
»W…was?«
»Ich habe auf dem Festnetz in eurem Apartment angerufen. Kaitlyn meinte, sie lässt dir einen Zettel da.«
»Hab ich auch«, blafft Kaitlyn. »Auf dem Schreibtisch. Wollten wir nicht nach oben gehen?« Sie zupft leicht an Dylan.
»Moment.« Dylan macht sich von ihr los und legt mir eine seiner großen Hände auf die Schulter. »Komm kurz mit in die Küche. Hast du was gegessen? Mom hat mir Linsensuppe mitgegeben.«
Mir knurrt der Magen, aber Gott sei Dank ist es auf der Party so laut, dass es niemand hören kann. Zusammen mit Dylan drehe ich mich zur Küche um. Ich kann beinahe fühlen, wie Kaitlyns Wut mir entgegenschlägt.
Es ist komisch, aber ich verspüre keinerlei Schuld. Schuldgefühle und ich sind normalerweise ganz dicke Freunde. Aber bei Kaitlyn genieße ich diese kurzen Momente, wenn sie sich ärgert. Wahrscheinlich weil ich weiß, dass es keine Rolle spielt. Sie hat, was ich will, und es besteht null Chance, dass ich es jemals bekomme.
»Sieh an, wer da ist!«, sagt Rickie vom Herd aus, wo er gerade einen Topf mit einer dampfenden Flüssigkeit darin umrührt. Es duftet himmlisch. »Leute, der Apfelpunsch ist fertig. Wer möchte?«
»Ich hätte sehr gern welchen«, sage ich. Das ist der Duft von Vermont – Äpfel und Zimt. Und Marihuana, schätze ich.
»Kaitlyn?«, bietet er an.
»Warum nicht?« Sie schnaubt. »Muss ich doch, oder? Solange ich auf die Moo U gehe, werde ich wohl Cider trinken, eine Beanie Mütze tragen und alle immer nach ihrem bevorzugten Geschlechtspronomen fragen.«
»Du kannst dich glücklich schätzen«, sagt Rickie fröhlich. »Verbrenn dir nur nicht die Zunge. Die brauchst du nachher wahrscheinlich noch.« Mit einer Kelle füllt er Apfelpunsch in eine Reihe Becher auf der Arbeitsplatte. »Hier, Chastity. Hey, schönes Oberteil. Wawawumm! Der herbstliche Ausschnitt gefällt mir.«
Sofort wird mir heiß im Gesicht. Ich schnuppere ausgiebig an dem Apfelpunsch, um meine Verlegenheit zu überspielen. »Duftet toll, danke.«
Dylan wärmt bereits die Suppe in der Mikrowelle auf und nimmt Schüsselchen aus dem Schrank. »Suppe? Rickie? Kait?«
»Zu viele Carbs«, sagt Kaitlyn.
»Apfelpunsch hat auch Kohlenhydrate«, wendet Dylan ein.
»Aber in den kann ich Rum kippen«, sagt sie und nimmt einen Becher.
»Bleibt mehr für mich.« Dylan zuckt mit den Schultern. »Setz dich, Chastity. Uuh, Guacamole.« Er schnappt sich die große Schüssel und stellt sie zusammen mit einer Tüte Chips auf den Tisch.
Dylan und ich setzen uns einander gegenüber an den Tisch. Rickie lehnt die Hüfte gegen die Arbeitsplatte und nippt an seinem Punsch, während Kaitlyn durch die Küche tigert und sichtlich vor Ungeduld kocht, weil Dylan es nicht zu merken scheint.
Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass die zwei ein Paar sind. Nie. Laut seinen Freunden und seinen geschwätzigen Familienangehörigen (man unterschätze nie Grandpa Shipleys Beobachtungsgabe) war Dylan immer ein überzeugter Single. Jedenfalls, bis Kaitlyn ihn sich geschnappt hat.
Dylan ist ein Mensch, der immer das Beste in allen sieht. Während ich es also für offensichtlich halte, dass sie eine Zicke ist, sieht er nur ihr glänzendes Haar. Und ihren glänzenden Lipgloss. Und ihren schlanken kleinen Körper in der teuren Kleidung.
Anders kann ich es mir nicht erklären. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Dabei geht es mich eigentlich gar nichts an.
Ups.
»Chass, können wir Algebra morgen beim Frühstück nachholen?«, fragt er mich jetzt. »Ich habe erst um zehn einen Kurs.«
»Klar. Okay. In der Mensa?« Kaitlyn geht nie frühstücken, ich werde mit ihr also nicht zu tun haben. Es ist schon schwer genug, meine Doofheit vor Dylan zuzugeben. Da brauche ich nicht auch noch ihr Stirnrunzeln.
»Ja, geht klar.« Er hebt seine Suppenschale hoch und trinkt den letzten Rest aus.
»Mach schon«, drängelt Kaitlyn. »Ich warte.«
Ich schaue weg, denn ich weiß, was als Nächstes kommt.
»Komme«, sagt Dylan fröhlich. Er schiebt seinen Stuhl zurück und trägt seine Schale zur Spüle, wo er sie sorgfältig ausspült, bevor er sie in den Geschirrspüler stellt. »Bin gleich wieder da«, sagt er auf dem Weg hinaus zu mir.
Ich tauche meinen Löffel in die Suppe und esse weiter. Es war nett von Dylan, mir etwas zu essen zu geben. Er ist ein guter Freund. Außerdem ist es wohl kaum seine Schuld, dass ich Sachen will, die ich nicht haben kann.
Einen Augenblick später landen zwei Becher vor mir auf dem Tisch, und dann setzt sich Rickie auf Dylans Platz. »Die zwei sind schwer zu ertragen, was?«
Autsch. Entweder bin ich eine furchtbar schlechte Schauspielerin oder Rickie ist wie ich der Meinung, dass sie ein schreckliches Paar abgeben.
»Das mit ihr wird nicht lange halten«, sagt er. »Der Sex ist bestimmt toll, aber er langweilt sich schnell.«
»Ist mir auch schon aufgefallen«, murmele ich, ehe ich mir einen Chip in den Mund schiebe.
Rickie schenkt mir kurz ein breites Lächeln. Ich mag Dylans Mitbewohner, aber er schüchtert mich ein wenig ein. Er spricht Deutsch und Französisch, und er hat einen Ohrring. Seine Klamotten sind ganz anders als die von Dylan. Heute Abend trägt er zerrissene Jeans und schwarze Lederstiefel, die niemals die Arbeit auf einer Farm überstehen würden. Sein Vintagehemd steht fast bis zum Bauchnabel offen und enthüllt kunstvolle Tattoos.
In Gegenwart mancher Menschen wird meine Naivität noch offensichtlicher. Rickie ist einer davon.
Er schiebt mir einen Becher Apfelpunsch zu. »Erzähl mir was über deine Geschichte.«
»Wie meinst du das? Ich bin bloß wegen Algebra hier.«
»Hmmm.« Er öffnet eine Flasche Rum und kippt jeweils einen ordentlichen Schluck in unsere beiden Becher. »Ich meine, deine eigentliche Geschichte. Erzähl mir, wie du hier auf der Moo U gelandet bist.«
»Kennst du den Teil denn nicht schon?« Ich hatte schlicht angenommen, dass Dylan meine ungewöhnliche Geschichte schon erwähnt hat. Wunder dich nicht über diese idiotische Freundin von mir. Sie kann nichts dafür, sie ist in einer Sekte aufgewachsen.
»Ich möchte es von dir hören«, sagt er.
»Tja, es ist dein Mittwochabend. Schätze, wenn du es eben so willst, dann hör dir meinen Bockmist an.«
Als er plötzlich auflacht, sieht er gut fünf Jahre jünger aus. »Ich steh total auf den Bockmist anderer Leute, Chastity. Schieß los.«
Ich ziehe den Punschbecher näher zu mir, während ich überlege, was ich sagen soll. »Mit neunzehn bin ich aus der religiösen Gemeinde im Westen abgehauen, in der ich aufgewachsen bin. Ich konnte mir nur eine Busfahrkarte bis zur Grenze von New York leisten. Und das restliche Stück bin ich dann gelaufen und per Anhalter gefahren.« Gott sei Dank war Sommer, sonst wäre ich erfroren.
»Wie war es dort? In der Gemeinde, meine ich.«
»Ähm …« Was soll ich sagen? Ich spreche nicht oft darüber, weil es seltsam und peinlich ist. »Mal überlegen. Das einzige Kleidungsstück, das ich bis zu meinem Weggang besaß, war das sogenannte Paradieskleid. Stell dir Laura Ingalls von Unsere kleine Farm in pastellfarbenem Polyester vor. Lange Ärmel, langer Rock. Mit hochgeschlossenem Kragen.« Ich lege eine Hand an meine Kehle. »Man durfte keine Haut zeigen, weil das als sündig galt. Zu den Kleidern trugen wir Wanderstiefel vom Schuh-Discounter.«
»Ach du Scheiße«, sagt er und pustet über den Apfelpunsch in seinem Becher. »Modemäßig war es also eine Katastrophe. Aber wie ging es da so zu? Was hast du den ganzen Tag gemacht?«
»Hausarbeit. Gekocht, geputzt und genäht. Nach der dritten Klasse habe ich keine richtige Schule mehr besucht. Man wollte sowieso nicht, dass wir klug werden. Es ging nur um Gehorsam. Sie wollten nicht, dass wir hinaus in die Welt der Sünder gehen und uns fragen, warum wir das, was andere Kinder haben, nicht auch haben können. Da kommt man bloß auf dumme Gedanken. Mit sieben habe ich mal um ein Paar neue Schuhe gebeten, wie sie ein anderes Mädchen in der Schule hatte. Stattdessen habe ich eine Ohrfeige bekommen.«
»Wow.« Rickie betrachtet mich mit unverhohlener Faszination. Er hat einen hypnotisierenden Blick. Seine Augen sind grau, mit einem dunkleren Ring um die Iris. »Sie dachten also, ihr könntet dahinterkommen, dass Polygamie verboten ist?«
»Vielleicht«, sage ich ausweichend. »Aber es hätte nicht viel geändert, wenn wir es gewusst hätten. Deshalb gibt es ja Gehirnwäsche. Wir saßen sonntags sechs Stunden lang in der Kirche. Der Prediger verbrachte viel Zeit damit, uns einzutrichtern, wie besonders wir sind.« Ich verdrehe zwar die Augen, doch meine Lässigkeit ist gespielt. Zwei Jahre sind keine besonders lange Zeit, und ein Teil von mir glaubt immer noch einiges von dem, was mir gelehrt wurde.
Diesen Aspekt kann ich keinem Außenstehenden erklären. Alles, was unser Himmlischer Pastor je erzählt hat, war großer Schwachsinn. Aber manches davon war eben sehr ansprechender Schwachsinn. Ich werde niemals dorthin zurückkehren, und ich vermisse die Ranch überhaupt nicht. Aber es gefiel mir, zu hören, dass ich Teil einer besonderen Mission Gottes sei und in dieser Welt eine einzigartige Bestimmung erfülle.
Man kann sagen, was man will, aber es war leichter, in einer Welt zu leben, deren Regeln ich kannte. Auch wenn ich sie nicht immer befolgt habe.
»Wie kam es, dass du schließlich beschlossen hast, von diesem super, super besonderen Ort abzuhauen?« Rickie blickt mich forschend mit seinen ernsten Augen an.
»Na, das ist erst recht eine Geschichte.« Ich stoße ein unbehagliches Lachen aus. »Mit sechzehn habe ich mir einigen Ärger eingehandelt. Ich war mit einem Jungen auf dem Rücksitz eines Wagens.«
»Du Luder!«, sagt Rickie schnaubend. Er macht zwar nur Spaß, aber ich versteife mich dennoch. Denn der Junge und ich wurden erwischt, und danach haben sie mich noch viel, viel Schlimmeres geschimpft.
»Er wurde rausgeworfen«, sage ich.
»Aus dem Wagen?« Rickie nippt an seinem Punsch.
»Nein, aus der Gemeinde.«
Rickie starrt mich an. »Für immer?«
»Natürlich. Die Söhne dürfen niemals mit den Töchtern allein sein. Das ist verboten. Aber ich, ähm, wollte wissen, was hinter dem ganzen Aufstand steckt. Wenn einem jeden Sonntag von der Sünde gepredigt wird …«
Ich glaube, den Satz kann ich nicht zu Ende bringen. Allein bei der Erinnerung daran, wie ich in dieser Garage saß und Zachariah küsste, bekomme ich heiße Wangen. Seine Hand lag auf meinem nackten Oberschenkel. Ich wollte unbedingt, dass er sie höher schiebt. Und dann? Die Katastrophe.
»Nach mir hat die Sünde auch schon immer geschrien«, sagt Rickie lächelnd. »Was man auch Dummes anstellen kann, ich hab’s getan.«
Ich kann nicht anders, als sein Lächeln zu erwidern. Ich trinke einen großen Schluck von dem dampfenden Apfelpunsch. Durch den Rum ist da ein Brennen, an das ich nicht gewöhnt bin, aber ich mag es irgendwie.
»Und was ist dann mit dir passiert? Nachdem du den Jungen geküsst hattest?«
»Oh.« Ich stelle den Becher ab.
Dieser Teil der Geschichte ist nicht besonders lustig. Nach einigen glückseligen Minuten wurden wir von der schlimmsten Person überhaupt erwischt – nämlich von meinem rachsüchtigen Onkel Jeptha. Es kam gar nicht infrage, dass er es unter den Teppich kehrte. Er berief die Ältesten ein …
»Wir wurden bestraft«, sage ich, und es kommt piepsig heraus.
»Scheiße, Chastity«, sagt Rickie. »Tut mir leid, wenn ich eine schmerzhafte Erinnerung geweckt habe.«
»Ach, schon gut«, sage ich, aber meine gepresste Stimme straft mich Lügen. Ich trinke einen Schluck. »Ich habe Zach drei Jahre lang nicht wiedergesehen. Das Schlimmste war die Ungewissheit, ob er noch am Leben ist.« Nacht für Nacht lag ich im Bett und versuchte mir vorzustellen, was der obdachlose Zach wohl machte. »Über die Außenwelt wusste ich nichts, deshalb stellte ich mir Sachen vor, die ich aus der Bibel kannte – Bettler am Straßenrand, die versuchen, etwas in den Magen zu bekommen.«
Rickies Augen werden rund vor Staunen. »Was hat er denn gemacht?«
»Ach, er ist per Anhalter nach Vermont gefahren. Kennst du die Nachbarn der Shipleys, Leah und Isaac? Er wusste, wohin sie zusammen abgehauen waren, und es war nicht allzu schwer für ihn, sie ausfindig zu machen.« Damals wusste ich das alles jedoch nicht – ich glaubte, er wäre tot. »Zach sagt, rausgeschmissen zu werden, war das Beste, was ihm passieren konnte. Und heute ist er einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne.«
»Aha. Aber was ist mit dir?«, fragt Rickie. »Dich haben sie nicht rausgeworfen?«
Ich schüttele langsam den Kopf. »Ich bekam eine Tracht Prügel. Sie mussten an mir ein Exempel statuieren. Wer sich mit einem Jungen auf die Rückbank eines Autos begibt, wird blutig geschlagen. Mindestens zehn Männer haben sich mit dem Riemen abgewechselt. Ich konnte eine Woche lang nicht sitzen, so wund war mein Hintern.«
Rickie fallen fast die Augen raus. »Du lieber Gott.«
Doch ich bringe es nicht über mich, Rickie vom Allerschlimmsten zu erzählen – dass ich dabei nackt war. Das war die eigentliche Strafe, glaube ich. Die giftige Mischung aus Schmerz und tiefster Demütigung. Es macht mir nichts aus, Rickie zu erzählen, wie schlimm sie meine Haut zugerichtet haben, aber über ihr Gelächter kann ich nicht sprechen. Schlampe, nannten sie mich. Dirne. Hure. Die Stimmen werden mir für immer im Ohr bleiben.
»Die Narben habe ich immer noch«, sage ich aufgesetzt munter.
»Danach bist du also weggelaufen?«
»Nee. Ich hatte noch nicht rausgefunden, dass Abhauen möglich ist. Aber als ich siebzehn wurde, wollte mich keiner zur Frau nehmen, weil ich befleckt war.«
Rickie schnaubt angewidert.
»Es, äh, stimmte gar nicht. Aber das spielte keine Rolle. Und jetzt wird es spannend: Mir wurde klar, dass ich im Grunde eine Aussätzige bleiben würde. Also fragte ich meinen Stiefvater nach einem Job, und er besorgte mir einen wirklich ungewöhnlichen – einen außerhalb der Gemeinde. Ich wurde Kassiererin in einer Drogerie.«
»Na, das nenne ich mal ein Leben.« Rickie grinst.
»War es tatsächlich! Ich kam jeden Tag raus und konnte in der Welt herumspitzeln. Du hast keine Ahnung, wie viel Spaß es mir gemacht hat, Süßigkeiten und Aspirin zu verkaufen. Und Zeitschriften – ich habe hinter dem Tresen Seventeen und Allure gelesen. Das verdiente Geld durfte ich allerdings nicht behalten. Mein Gehalt ging auf das Bankkonto meines Vaters. Ich habe nie Geld gesehen, bis sich schließlich ein Weg fand, welches abzuzwacken.«
»Du bist faszinierend, Chastity.«
»Ach, bitte.«
»Ich mein’s ernst.« Er nimmt meinen leeren Becher. Ich weiß nicht mal, wann ich ihn ausgetrunken habe. Er war ruckzuck leer. »Wie hätte dein Leben ausgesehen, wenn das alles nicht passiert wäre?«
»Sie hätten mich an meinem siebzehnten Geburtstag mit einem alten Mann verheiratet, den die Ältesten für mich ausgewählt haben. Ich hätte eine Fünf-Minuten-Trauung während der Sonntagsmesse bekommen. Und dann wäre ich aus meinem Elternhaus ausgezogen, um mit demjenigen zusammenzuleben.«
»Und dann die Hochzeitsnacht.« Er betrachtet mich über den Rand seines Bechers hinweg. »Ich schätze mal, Verhütung kam auch nicht infrage.«
Ich schüttele den Kopf. »Ich hatte noch nie etwas von Verhütung gehört, bis ich irgendwann anfing, bei der Arbeit in der Drogerie die Angaben auf den Verpackungen zu lesen. Kinder zu gebären war unsere wichtigste Aufgabe. Das wurde mir jeden Sonntag vermittelt.«
Ich verschweige dabei, dass ich mich darauf gefreut hatte. Wenn unser Himmlischer Pastor über die ehelichen Pflichten einer Frau sprach, richtete ich mich immer auf der Kirchenbank auf. Legt euch zu eurem Ehemann und gebt euren Körper Gott hin. Empfangt seine Liebe. Empfangt seinen Samen. Bringt eine neue Generation hervor, die in unserem Tempel beten wird.
Ich konnte es gar nicht erwarten, mich zu meinem Ehemann zu legen und seinen Samen zu empfangen. Mit sechs fragte ich einmal einen gleichaltrigen Jungen, ob er mit mir übt. Er hat es gepetzt, und wir bekamen beide den Hintern versohlt. Als wir fünfzehn waren, wurde jener kleine Junge aus der Gemeinde geworfen. (Gott sei Dank nicht meinetwegen.)
Aber ich erinnere mich immer noch an sein Lächeln. Sein Name war Jacob, und er hatte strahlend blaue Augen. Ich hatte schon immer zu viel für Jungs übrig. Irgendwann lernte ich, es zu verbergen, doch es blieb meine heimliche Scham. Das Kreuz, das ich zu tragen hatte.
So ist es noch immer. Seit dieser Knutscherei mit Zachariah auf dem Rücksitz des Autos hat mich kein Mann mehr berührt. Doch ich wünschte, das würde einer tun.
Vorzugsweise Dylan.
Doch für den Moment habe ich meinen eigenen Bockmist satt. »Du bist dran, Rickie. Wie lautet deine Geschichte?«
Mit einem frechen Grinsen schiebt er mir meinen aufgefüllten Becher Apfelpunsch rüber. »Ich bin ein Soldatenkind. Habe bis zu meinem achtzehnten Geburtstag schon an zehn verschiedenen Orten gelebt.«
»Kannst du deshalb Französisch?«
»Oui. Und was jetzt kommt, wirst du nicht glauben – ich bekam einen Platz an einer Militärakademie. Dort habe ich mein erstes Studienjahr absolviert. Mit kurz geschorenen Haaren und Uniform.«
»Und mit Salutieren?« Ich kann mir Rickie nicht als Soldaten vorstellen. Es geht einfach nicht.
»Mit allem Drum und Dran.« Er lacht böse in sich hinein.
»Wieso hast du abgebrochen?«
»Darüber rede ich nicht.«
»Hey!«, beschwere ich mich. »Ich hab dir auch meine Geschichte erzählt.«
»Hast du das wirklich?« Sein kluger Blick ruht auf mir. »Oder hast du alles Peinliche weggelassen?«
Ach, zum Kuckuck. Das habe ich wohl. Wir betrachten einander über den kleinen Tisch hinweg. Dann lächelt er, und zwar sehr herzlich. Als würden wir einander verstehen. »Mein Professor hat diese Woche im Grunde das Gleiche zu mir gesagt. Hattest du auch den Grundkurs Kreatives Schreiben?«
Rickie schüttelt den Kopf. »Ist das der, wo alle jede Woche einen neuen Aufsatz zum selben Thema schreiben müssen?«
»Genau. Dieses Semester ist Essen das Thema. Also habe ich über das unsichtbare Wunderwerk der Mikroorganismen geschrieben, die Milch in Käse verwandeln. Mein Professor fand es schrecklich. Er meinte, es stecke nicht genug von meiner Persönlichkeit darin.«
»Ich nehme an, man soll für ihn seine Seele zu Papier fließen lassen.« Rickie schnaubt. »Nimm noch etwas Rum.« Er hält die Flasche hoch. Und ich schiebe ihm meinen Becher ein Stückchen näher hin.
3
Dylan
In meinem Zimmer schenke ich mir einen Schluck Scotch ein und lausche, wie Kaitlyn einen neuen Song auf ihrer Akustikgitarre spielt. Ich könnte schwören, dass sie mir den schon letztes Wochenende vorgespielt hat, aber ich will nicht so arschig sein und das anmerken.
Abgesehen davon kann es gut sein, dass die Musik nur ein Vorwand ist, um mich für sich allein zu haben. Kaitlyn ist echt raffiniert.
»Das klingt toll«, sage ich, als sie schließlich ihre Gitarre weglegt. Und das stimmt auch. Von klassischer Gitarre verstehe ich nicht besonders viel, aber offensichtlich hat sie Talent.
»Danke, Stalljunge.«
Das ist ihr Spitzname für mich. Da es sich um eine Anspielung auf den besten Film aller Zeiten handelt – Die Braut des Prinzen –, sollte ich es wohl als Kompliment auffassen. Doch Komplimente von Kaitlyn haben immer auch etwas Negatives. In dem Fall stört es sie tierisch, dass ich tatsächlich ein Stalljunge bin. Es ist Erntezeit, und ich muss jeden Samstagmorgen mit dem ersten Hahnenschrei nach Hause zu meiner Familie fahren, um am Wochenende mit anzupacken.
Bis letztes Jahr war ich Teilzeitstudent und kam nur zu den Kursen nach Burlington. Aber das war ziemlich nervig, und als Rickie mir für einen Appel und ein Ei ein Zimmer in seinem Haus anbot, nutzte ich die Gelegenheit, um Vollzeit ins Studium einzusteigen. Auf die Art bekomme ich mehr finanzielle Hilfen, langfristig gesehen spare ich also Geld.
Mein Bruder hasst diese Lösung allerdings, weil ihm auf der Farm eine Arbeitskraft fehlt.
»Spielst du ein Duett mit mir?«, fragt Kaitlyn.
»Nee«, sage ich, weil ich zu faul bin, meine Geige rauszuholen und sie zu stimmen.
»Dein Pech.« Sie setzt sich auf meinen Schoß und küsst mich. »Ich habe dich heute vermisst. Wir wollten doch zusammen zu Abend essen.«
»Glaub mir«, sage ich und streichle mit einer Hand über ihren Brustkorb. Sie trägt ein Samttop, das geradezu danach schreit, berührt zu werden. »Ich würde viel lieber mit dir zu Abend essen, als nach Hause zu fahren, um mich anschreien zu lassen.« Ich lege ihren schlanken Hals frei, indem ich ihre Haare nach hinten streiche, und küsse die Stelle unterhalb ihres Kinns.
Sie erschauert. Kaitlyn ist immer geil, genauso wie ich. Deswegen habe ich auch meine Keine-Freundin-Regel gebrochen und bin mit ihr zusammen. Der Sex ist fantastisch.
Außerdem hat sie darauf bestanden. Entweder das mit uns wird was Festes oder wir vögeln nicht, hat sie gesagt, als ich sie zum ersten Mal nackt sah. Und dann? Hat sie meinen Schwanz in ihren Mund genommen.
Und so landete ich in einer Beziehung. Es ist nicht die allerromantischste Geschichte. Nicht wie in Die Braut des Prinzen. Aber für uns beide funktioniert es, nehme ich an.
Ich widme mich ihrem Mund für einen richtigen Kuss. Darauf hat sie sowieso nur gewartet. Das Abendessen ist völlig vergessen. Kaitlyn zieht mir das T-Shirt aus der Hose und lässt die Hände an meiner Brust nach oben wandern, während ich ihr meine Zunge zuwende. Sie setzt sich rittlings auf mich, verschränkt hinter mir die Beine und schmiegt sich an mich.
Das ist ziemlich super, bis mein Freund Keith die Treppe hoch ruft: »Dylan! Komm, trink einen Shot mit mir!«
»Ignorier ihn«, flüstert Kaitlyn zwischen zwei Küssen.
Einen Augenblick lang versuche ich das. Aber es ist erst zehn, und im Haus sind lauter Freunde, die ich dieses Wochenende nicht sehen werde, wenn ich zu Hause Äpfel verkaufe.
»Es gibt Jägermeister!«, probiert Keith es, und ich unterbreche lachend das Geknutsche mit Kaitlyn.
Sie stöhnt genervt auf. »Echt jetzt? Du wählst Jägermeister statt deiner Freundin? Abartig.«
»Ich wähle ihn nicht statt meiner Freundin«, sage ich sanft. »Sondern vor ihr.«
»Ich sage nur: Schlappschwanz.«
»Ach bitte.« Ich hebe sie von meinem Schoß und setze sie aufs Bett. »Das war bloß ein Mal.«
Letzte Woche hat Rickie mich einen Abend mit Absinth abgefüllt, und ich bin eingepennt, bevor wir miteinander schlafen konnten. Heute Abend wird Kaitlyn aber nicht unbefriedigt nach Hause gehen.
Das weiß sie auch. Sie ist nur ungeduldig.
Ich stehe auf und rücke meine Jeans zurecht, um meine Erektion zu kaschieren. »Na komm! Nimm deine Gitarre mit, wenn du Lust hast.« Ein Publikum zu haben genießt Kaitlyn fast so sehr wie Sex.
Wir gehen zusammen nach unten. In der Diele stoppt Keith mich und drückt mir zwei Schnapsgläser in die Hand. Ich exe eines und biete das andere Kaitlyn an, die die Nase rümpft.
»Im Kühlschrank steht bestimmt Wein«, schlage ich vor.
Wortlos verschwindet sie, um nachzuschauen.
Keith tauscht die Schnapsgläser gegen die Wasserpfeife, und ich nehme einen langen, tiefen Zug. Ahh. Die Verspannungen in meinen Schultern lösen sich langsam. Endlich.
Die meisten Menschen lieben den Oktober. Dieses Wochenende werden die Landstraßen mit Touristen verstopft sein, die nur hierherfahren, um die wundervolle Farbenpracht zu bestaunen, die dieser Monat zu bieten hat.
Ich dagegen hasse ihn. Die Tage sind kurz, die Nächte dunkel, und unser Familienbetrieb ist zu hundertfünfzig Prozent ausgelastet. Dazu kann ich es keinem recht machen. Mein Bruder ist sauer auf mich, weil ich in Burlington wohne. Meine Freundin ist sauer auf mich, weil ich jedes Wochenende nach Hause nach Tuxbury abhaue.
»Scheißoktober«, sage ich, als Keith mir noch einen Schnaps gibt.
»Ja. Scheißzwischenprüfungen«, stimmt er mir zu.
Es liegt aber nicht nur daran. Im Oktober ist mein Vater gestorben. Das ist sechs Jahre her, aber im Oktober fühle ich mich immer verwundbar. Als würde ich aus jeder Pore meines Körpers bluten. Ich habe ein paar Mittel, um den Schmerz zu betäuben: Alk, selbst angebautes Gras und Sex. Sie sind alle nicht perfekt, aber es sind die besten, die mir zur Verfügung stehen.
»Erzähl, wann bringst du uns neuen Cider mit?«, fragt Keith. »Ich liebe das Zeug.«
Da dreht jemand einen Green-Day-Song voll auf, sodass ich meine Antwort brüllen muss. »Keine Ahnung, Mann. Jägermeister ist billiger.« Ich habe keine Lust darauf, von meinem Bruder dumm angemacht zu werden, weil ich ein paar Flaschen von dem Edelcider mitnehme, den er herstellt. »Aber in zwei Wochen ist das große Lagerfeuer. Griffin schenkt an dem Abend immer jede Menge Cider aus. Du kommst doch, oder?«
»JA!«, brüllt Keith zurück.
Gott, ist das laut! Ich hoffe, die bringen Rickies Boxen nicht zum Platzen. »Wo ist denn unser furchtloser Anführer?«
Keith zuckt mit den Schultern. Er beugt sich ins Wohnzimmer, um sich umzuschauen. »Rickie is’ gleich da drüben!«, schreit er mit einem Fingerzeig. »Auf dem Sitzsack, mit deiner Freundin von zu Hause!«
Oh. Na, hoffentlich passt Rickie gut auf Chastity auf. Ich hätte sie vielleicht nicht in der Küche zurücklassen sollen. Außerdem – ich fass es nicht – hat sie scheinbar heute in der Bibliothek auf mich gewartet, während ich durch halb Vermont gefahren bin.
Ich bin voll das Arschloch.
Als ich das Wohnzimmer betrete, lasse ich den Blick über das Chaos schweifen. Mit der Party ist es in den letzten vierzig Minuten heftig bergab gegangen. Oder bergauf, je nach Blickwinkel. Das Licht ist schummrig, die Musik laut, und alle sehen aus, als hätten sie ordentlich einen sitzen.
Sogar Chastity, stelle ich geschockt fest. Verflucht. Sie trinkt nie. Hastig gehe ich rüber und schaue dann hinunter auf den riesigen Sitzsack, auf dem sie und mein Mitbewohner fläzen. »Chastity!«, brülle ich. »Geht’s dir gut?«
Sie hebt leicht schwankend den Kopf. »Mir geht’s suuuuuuper«, schreit sie. »Wusstet ihr, dass da Leute Sex auf eurer Couch haben?«
Rickie kichert. »Stimmt, oder? Ihr benutzt hoffentlich Kondome!«, ruft er. »Keine Sauerei!«
Ich habe Angst hinzusehen, mache es aber trotzdem. Und, yep. Rickies Freund Igor stößt träge in unsere Freundin Gretchen, die wiederum mit einer mir unbekannten Frau rumknutscht. Wobei, ich kenne jetzt deren nackte Brüste, denn die streichelt sie, während sie sich küssen.
Alles klar. »Zeit, nach Hause zu gehen, Chass«, sage ich und halte ihr eine Hand hin.
»Wieso denn?«, jammert sie. »Es ist echt bequem hier. Obwohl ich eigentlich mal pullern muss.« Sie rülpst.
»Hoch mit dir.« Ich beuge mich noch weiter vor und nehme ihre Hand. »Ab auf die Toilette, und geh dann deinen Rucksack holen. Ich bring dich nach Hause.«
»Meinen Rucksack?«, lallt sie. »Kommt mir bekannt vor.« Sie wankt leicht, als sie suchend den Kopf dreht.
Oh. Ich weiß nicht, ob sie je etwas Stärkeres hatte als den Wein bei unseren donnerstäglichen Abendessen, die abwechselnd zu Hause bei meiner Familie oder bei ihrer stattfinden. »Die Toilette ist da hinten«, sage ich und zeige dabei in Richtung Küche.
»Genau.« Sie trottet davon.
Ich ziehe Rickie hoch. »Was hast du dir dabei gedacht?«, schreie ich über Green Days fetten Schlagzeugbeat hinweg.
»Ich verstehe dich nicht!«
Ich zerre Rickie in Richtung Küche. »Du kannst Chastity keinen Rum geben! Sie trinkt überhaupt keinen Alkohol.«
»Jeder fängt mal damit an«, sagt er schulterzuckend.
»Nicht Chastity«, beharre ich. Zu behaupten, sie wäre behütet aufgewachsen, wäre, als würde man Mussolini leicht aufdringlich nennen. Chastity hat sich erst mit neunzehn das erste Mal die Haare geschnitten. Bis dahin hatte sie noch nie Jeans getragen oder geflucht oder sich geschminkt.
»Es geht ihr gut, Dyl«, sagt Rickie nachdrücklich. »Ich würde deiner Freundin niemals wehtun. Sie hatte vielleicht drei Drinks.«
»Gibt’s ein Problem?«, fragt Kaitlyn mit einem Glas Wein in der einen und einem Tortillachip in der anderen Hand.
»Chastity ist ein bisschen angeschickert, und Dylan will deswegen gleich einen Krankenwagen rufen.« Rickie verdreht die Augen und verlässt die Küche.
»Ich habe gar nichts von einem Krankenwagen gesagt«, brumme ich. »Aber ich muss sicherstellen, dass sie heil nach Hause kommt.« Ich klopfe mir auf die Tasche, in der ich meine Schlüssel habe. »Ich hole mir eine Jacke.«
»Warte, wieso denn?«, jammert Kaitlyn. »Sie ist eine betrunkene Collegestudentin. Davon gibt’s jede Menge in dieser Stadt. Entweder findet sie heim oder sie wacht bei irgendjemand anderem auf dem Fußboden auf. Genau wie alle anderen.«
»Sie ist aber nicht wie alle anderen«, erwidere ich. »Ich meine, alle Ersties betrinken sich. Aber dann gehen sie nach Hause zu ihren Mitbewohnern, die sicherstellen, dass sie es überleben. Und die Mitbewohnerin hier bist du, oder?«
Kaitlyn verzieht das Gesicht. »Meine Zeiten als Erstie-Saufnase hab ich längst hinter mir.«
Genau. Deshalb werde ich mich kümmern.
Ich gehe in den hinteren Flur und schnappe mir meine Jeansjacke. Kaitlyn nippt an ihrem Wein und beobachtet mich. Sie ist schon im dritten Studienjahr. Nach irgendeinem Skandal in New York City hat ihre Familie sie an die Moo U verfrachtet. Deshalb ist sie mit Chastity im Wohnheim gelandet.
Ich bin genauso alt wie Kaitlyn, aber offiziell immer noch im zweiten Jahr, weil ich zuerst nur Teilzeit studiert habe.
Chastity ist eigentlich die Älteste von uns. Mit einundzwanzig ist sie ein Jahr älter als ich. Aber wenn man von einer Sekte abhaut, raubt einem das die Teenagerzeit.
»Du machst viel zu viel Wind um die Sache«, sagt Kaitlyn und zeigt dabei in Richtung Wohnzimmer. »Guck doch, ihr geht’s gut.«
Ich stelle mich so hin, dass ich durch den Türbogen schauen kann. Und da ist Chastity. Schon von der Toilette zurück, tanzt sie auf eine verrückte, exaltierte Art neben Rickie. Alle drei, vier Taktschläge stoßen sie die Hüften gegeneinander und lachen dann.
Und jetzt lächle ich, denn das ist echt unheimlich süß. Chastity lässt sich nicht oft gehen. Morgen wird sie wahrscheinlich einen fiesen Kater haben. Aber jetzt gerade hat sie Spaß.
Als der Song endet, bleiben Rickie und sie schwer atmend stehen. »Wie wär’s mit Gras?«, fragt Rickie mit in die Hüften gestemmten Händen.
»Hab ich noch nie probiert!«, erwidert Chastity.
Das ist mein Stichwort. »Ein andermal«, sage ich eilig. »Hast du deinen Rucksack gefunden?«
»Yep!«, sagt sie.
»Jacke?«, zähle ich auf.
Sie schüttelt übertrieben den Kopf. »Hatte keine an.«
»Können wir nicht deinen Pick-up nehmen?« Kaitlyn taucht hinter mir auf. Sie hat ihre Jacke an, also nehme ich an, dass sie mitkommt.
»Nein, ich kann nicht mehr fahren. Zu viel Alk und Gras.« Ich bin kaum angetrunken, doch ich werde nichts riskieren. Ich habe zwar gern meinen Spaß, bin aber kein Idiot. »Es sind höchstens zehn Minuten zu Fuß.« Ich lege Chastity eine Hand auf die Schulter und dirigiere sie in Richtung Tür.
»Die haben ja immer noch Sex«, keucht sie. »Ist das normal, dass es so lange geht?«
Kaitlyn schnaubt, und Rickie lacht in sich hinein. »Kommt drauf an, wen du fragst.«
Dass ich Chastity nie zu einer von Rickies Partys eingeladen habe, hat seinen Grund. Man weiß nie, was einen da erwartet. Ich mache die Haustür auf und erinnere Chastity, bei der Treppe aufzupassen. »Die ist steil.«
»Die paar Stufen kriege ich schon hin, Dyl«, sagt sie seufzend.
»Es ist kalt«, beschwert sich Kaitlyn.
»Das ist noch gar nichts«, merke ich an. »Wenn der Wind vom See her kommt, ist Burlington einer der kältesten Orte Vermonts.« Ich ziehe meine Jacke aus und nehme Chastity den Rucksack von der Schulter. »Wir tauschen.«
»Wieso?«, fragt sie, als ich ihr die Jacke über die Schultern lege. »Das brauchst du nicht.«
»Ich hab ein Flanellhemd an. Außerdem ist mir warm. Du dagegen trägst bloß …« Ich deute auf ihr hübsches Seidenoberteil. Und dann trete ich mir innerlich leicht dafür in den Hintern, dass ich registriere, wie gut sie heute Abend aussieht. Es ist nicht das erste Mal, dass mein Blick an Chastitys Busen hängen bleibt. Man müsste schon blind sein, um nicht zu bemerken, wie hübsch Chastity ist – und wie gut gebaut.
Trotzdem gehört es sich nicht, eine betrunkene Freundin anzuglotzen. Zum Glück nimmt Chastity meine Jacke an und knöpft sie zu, sodass ihr üppiges Dekolleté außer Sichtweite ist.
Wir gehen die Straße entlang. Es ist eine kühle Herbstnacht. Die Lampen in den vielen alten Häusern tauchen die Zimmer in ein gelbliches Licht. Die Luft riecht nach Laub und Holzrauch, und diesen Geruch verbinde ich mit Traurigkeit.
Denn ich hasse den Oktober.
Als Chastity über einen Riss im Gehweg stolpert, schießt meine Hand nach vorn, um sie aufzufangen. Doch sie fällt gar nicht richtig hin und schüttelt schnell meine Hand ab.
Kaitlyn geht schweigend neben mir und kocht wahrscheinlich innerlich. Gut, dass ich ganz genau weiß, wie ich sie aufmuntern kann. Man muss seine Stärken eben ausspielen.
Ich bin nicht der allerzuverlässigste Typ. Aber mit mir kann man eine gute Zeit haben. Manchmal reicht das.
4
Chastity
Der Spaziergang nach Hause macht mich wieder etwas nüchterner. Einer der lauten Songs von der Party geht mir immer noch durch den Kopf, und alle paar Minuten erwische ich mich dabei, wie ich vor mich hin summe. Ich mag vielleicht nicht wissen, wie man sich beim Rum zurückhält, aber ich hatte eine gute Zeit mit Rickie. Er war heute Abend alberner, als ich es ihm zugetraut hätte.
Und anders als Dylan hat er mich nicht wie ein Kleinkind behandelt. Man muss mich nicht nach Hause führen wie einen Welpen. Das einzig Gute ist, dass Kaitlyn gerade megagenervt ist.
Ungelogen, ich bin sonst ein netter Mensch, aber sie bringt das Schlechteste in mir zum Vorschein.
Als wir beim Wohnheim ankommen, rechne ich damit, dass Dylan und Kaitlyn mir zum Abschied winken und wieder zurück zur Party gehen. Aber so kommt es nicht. Sie gehen mit mir hinein. Ich drücke den Fahrstuhlknopf, weil mir meine Füße nicht ganz gehorchen und ich nicht vorhabe, auch noch irgendwem recht zu geben, indem ich auf der Treppe stürze.
Ich muss mich fest an den letzten Rest meiner Würde klammern. Nicht, dass davon noch sonderlich viel übrig wäre.
Oben angekommen guckt Dylan zu, wie ich mit langsamen Handgriffen die Tür aufschließe. »Wie geht’s deinem Magen?«, fragt er.
»Gut«, sage ich nachdrücklich.
»Schön. Ich geh dir mal Aspirin holen. Wenn du es jetzt gleich nimmst, geht es dir morgen früh vielleicht nicht so schlecht.«
»Gute Idee«, murmele ich. Ich gehe in mein Zimmer, um meinen Flanellpyjama anzuziehen.
Gerade als ich meinen BH ausziehe, kommt Dylan herein. »Wow!« Er dreht sich schnell um. »Hab dir auch ein Glas Wasser geholt«, sagt er, mit Blick in die andere Richtung.
»Danke.« Dylan ist wirklich nett zu mir. Er gibt mir was zu essen. Kümmert sich um mich. Nur nicht auf die Art, wie ich es eigentlich möchte …
»Wenn’s dir zum Frühstück immer noch ganz gut geht, können wir Algebra üben«, sagt er.