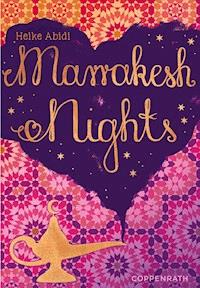Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oetinger Taschenbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was Mädchen wollen – und Jungs denken. Justines Leben wird gleich mehrfach auf den Kopf gestellt: Erst muss sie ihr geliebtes Internat verlassen und auf eine normale Schule gehen, dann trifft sie ein Kugelblitz, woraufhin sie die äußerst sonderbare Fähigkeit entwickelt, die Gedanken anderer zu hören. Allerdings nur, wenn sich diese um Gefühle drehen, und von Jungs stammen. Das sorgt für einige erhellende Erkenntnisse, allerdings auch für ziemliches Gefühlschaos, als Justine sich in Lenny verliebt. Denn dessen Gedanken sind ziemlich verwirrend. Mit Heike Abidis "Was Jungs mit 15 wollen und warum ich das weiß" können Mädchen nun endlich die Gedanken der Jungs lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Denk nicht mal dran!
Ein Kugelblitz fährt durch Justines Körper – und stellt ihr ganzes Leben auf den Kopf. Auf einmal kann sie die Gedanken der Jungs hören, und das ist nicht unbedingt ein Vergnügen. Schlimm genug, dass sie ihr geliebtes Internat verlassen musste, weil ihre Mutter das Schulgeld in ihre neu eröffnete Liebesschule investiert. Plötzlich klingt ihr auch noch das Gedankenchaos ihrer Mitschüler im Ohr. Halten die anderen sie wirklich für eine Streberin? Warum wollen sie sich mit ihr verabreden? Am liebsten hätte sie einfach nur ihre Ruhe! Wäre da nicht der schüchterne Lenny, dessen Gedanken sich in ihrer Nähe förmlich überschlagen. Vielleicht hat das Gedankenhören ja doch seine Vorteile?
Witzig, originell, charmant – das neue Buch von »Tatsächlich 13«- Autorin Heike Abidi
01Eine SMS, eine App und eine neue Adresse
Mürrisch starre ich aus dem Zugfenster. Es sieht aus, als würden Bäume, Getreidefelder, Hügel und Dörfer im Affentempo an uns vorbeirasen. Dabei ist es genau umgekehrt. Wir rasen, und alles andere steht still. Eine optische Täuschung, auf die ich immer wieder reinfalle. Kein Wunder, dass die Menschen früher dachten, die Sonne würde sich um die Erde drehen. Die glaubten einfach, was sie sahen. Man geht eben immer davon aus, selbst der Mittelpunkt des Universums zu sein.
Im Moment ist mein Universum dieser ICE, und ich wünschte, ich könnte mich darauf freuen, bald anzukommen. Doch ehrlich gesagt wäre ich viel lieber geblieben, wo ich herkomme. Im Internat Falkenburg, der weltbesten Schule, in der ich rundum happy war. Bis heute.
Na ja, eigentlich nur bis vor ungefähr drei Wochen, als meine Mutter mir eröffnet hat, dass sie vorhat, unser Leben völlig auf den Kopf zu stellen.
»Du wirst sehen, das wird toll, Justine!«, hat sie geschwärmt.
Toll ist ihr Lieblingswort und lässt in meinem Hinterkopf sämtliche Alarmglocken schrillen. Denn sie benutzt es zielsicher für Dinge, die sich hinterher als absolut schrecklich entpuppen. So wie diese Last-minute-Reise, die uns in eine Baustellenhölle geführt hat (aber ein tolles Schnäppchen war). Oder dieser trostlose Kinoabend, bei dem ich vor Langeweile fast eingeschlafen wäre (ein toller französischer Experimentalfilm). Einmal habe ich es sogar gegoogelt und festgestellt, dass toll ursprünglich so etwas wie unsinnig, schlimm, verwirrt bedeutet hat. Na, wenn das nicht passt!
Nun ja. Mein neues Leben wird also toll werden.
Kann ich bitte mein altes zurückhaben?
Zuerst war das Internat zwar nur eine Notlösung für uns gewesen, weil meine Mutter beruflich so viel reisen musste, aber nachdem mein anfängliches Heimweh verschwunden war, habe ich mich in die Falkenburg verliebt! Seitdem genießen Mama und ich die gemeinsamen Ferien und Wochenenden umso intensiver und verstehen uns so gut wie Schwestern. Ob das in Zukunft auch so sein wird, wenn wir uns wieder täglich sehen?
Wir durchqueren jetzt einen Wald, und kurz bevor mir endgültig schwindelig wird, fährt der Zug in einen Tunnel ein. Statt der verschwommenen Tannen sehe ich im Fenster nun ein Mädchen in Jeansjacke und T-Shirt, das trotz des milden Frühlingswetters eine Beanie-Mütze trägt. Darunter kommt eine braune Mähne zum Vorschein, die weder richtig lockig noch schön glatt ist, sondern irgendwie wild und ungezähmt.
Ich betrachte mein Spiegelbild, als sähe ich es zum ersten Mal. Was ziemlich schwierig ist, schließlich kenne ich mich schon seit über fünfzehn Jahren. Da stelle ich mir lieber vor, ich wäre jemand aus meiner neuen Klasse, in die ich ab Montag gehe. Werden meine neuen Mitschüler mich mögen? Oder arrogant finden? Cool? Langweilig? Witzig? Doof?
Ich versuche, mir einzureden, es wäre mir egal.
Doch das stimmt leider nicht ganz.
Na ja, ehrlich gesagt bin ich sogar ein kleines bisschen aufgeregt. Aber nur, weil ich neue Dinge generell spannend finde. Sogar, wenn ich mich null darauf freue. Und sie vorübergehender Natur sind.
»Ein Jahr geht schnell vorbei, Justine«, hat meine Mutter gesagt. Ich fürchte, da irrt sie sich. Ein Jahr ist eine halbe Ewigkeit!
Wir kommen wieder ins Tageslicht, und mein Spiegelbild weicht dem Blick auf die ersten Vororte. Jetzt sind es höchstens noch zwanzig Minuten bis zum Bahnhof. Mama wird garantiert am Bahnsteig stehen und mich überschwänglich begrüßen. Sie schafft es immer irgendwie, überall im Mittelpunkt zu stehen. Nicht, weil sie das will, sondern weil es einfach passiert. Sie ist eben ein bisschen … anders. Etwas lauter, bunter, fröhlicher, rundlicher und verrückter als andere Mütter. Und meistens finde ich das ja auch gut. Aber wenn sie mich vor allen Leuten knuddelt, bis ich kaum noch Luft kriege, und dabei vor Freude gleichzeitig lacht und weint, wünsche ich mir immer, sie wäre normaler.
»Deine Mum ist die Allercoolste«, hat Tabea, die Kapitänin unseres Hockeyteams, einmal nach einem Besuchstag kommentiert. Da war ich irre stolz auf meine Mutter. Und darauf, dass die Kapitänin des Hockeyteams mich mit diesem Lob sozusagen geadelt hat. Das war noch, bevor ich Stammspielerin wurde und sie meine Zimmergenossin.
Künftig werden andere meinen Platz im Team einnehmen und sich mit Tabea anfreunden, während sie mir vielleicht anfangs noch schreibt, mich dann aber nach und nach vergisst. Ich schlucke. Wäre ja noch schöner, wenn ich hier vor allen Leuten in Tränen ausbrechen würde.
Reiß dich zusammen, Justine Kroeger!
Es reicht schon, wenn sich um mich herum alles verändert – da muss ich es nicht selbst auch noch tun. Und was ich definitiv nicht bin, ist eine Heulsuse. Im Gegenteil: Alle sagen, ich sei sehr vernünftig für mein Alter. Zu vernünftig, findet meine Mutter, was daran liegt, dass sie selbst nicht sonderlich viel von Vernunft hält. Würde sie sonst einen super bezahlten Topmanagerinnenjob bei einem internationalen Konzern kündigen, um sich selbstständig zu machen? Wohl kaum.
Immerhin hat sie Ahnung von Businessplänen, Bilanzen und so, sodass die Hoffnung besteht, aus ihrer Wahnsinnsidee könnte eines Tages sogar ein geschäftlicher Erfolg werden. Laut ihren Berechnungen wird sie in spätestens neun Monaten langsam in die Gewinnzone kommen, und bis dahin leben wir von ihren Ersparnissen.
Nur leider funktioniert diese Kalkulation nur, wenn man das teure Schulgeld abzieht.
»Mein Traum lässt sich realisieren, wenn du mitspielst«, hat Mama mir bei ihrem letzten Besuch eröffnet. »Wärst du bereit, für ein Jahr auf eine normale staatliche Schule zu gehen? Sobald der Laden brummt, kannst du natürlich zurück ins Internat Falkenburg. Na, was sagst du, Justine-Schatz?«
Puh, gute Frage.
Was konnte ich dazu schon sagen?
Was ich dachte, war: Auf keinen Fall! Schau dir die Falkenburg doch an: Kann es irgendwo schöner sein? Allein schon der Park, der See, die Tennisplätze, das Hallenbad … Ich gehöre hierher. In diese Schule, ins Hockeyteam, ins Schulorchester. Nicht zu vergessen der Debattierclub – der, wie du weißt, die perfekte Übung für meine geplante Karriere als Juristin ist. Das alles kannst du mir nicht einfach wegnehmen!
Aber was ich sagte, war: »Deal. Ein Jahr geht klar. Das werde ich schon irgendwie aushalten.«
Ich schaffte es sogar, dabei zu lächeln. Vermutlich war es das grimassenhafteste Gruselgrinsen, das je gelächelt worden ist. Aber es machte meine Mutter überglücklich. Und sie hat es verdient. Schließlich hat sie die letzten fünfzehn Jahre in einem Job geschuftet, den sie hasst, nur um unser Leben zu finanzieren. Jetzt ist sie mal dran.
Verdammt, warum muss ich immer so verständnisvoll sein? Anstatt auch mal einen gepflegten Wutanfall zu kriegen, so wie andere egoistische Teenager.
Tja, jammern hilft nichts. Ich bin nun mal so. Wenn ich meine drei wichtigsten Eigenschaften nennen sollte, würde ich sagen: Ich bin zielstrebig, bewahre immer einen kühlen Kopf und halte mich an Fakten, nicht an Illusionen.
Davon, dass plötzlich ein liebevoller Vater in mein Leben tritt, träume ich zum Beispiel schon lange nicht mehr. Der hat sich nämlich noch vor meiner Geburt aus dem Staub gemacht und wird garantiert nicht wieder auftauchen.
Ist auch nicht nötig. Mama und ich sind nämlich ein super Team. Und ich bin eine gute Teamplayerin. Wir kriegen das schon hin, irgendwie.
Aus dem Lautsprecher ertönt scheppernd die Ansage, dass wir mein Ziel in wenigen Minuten erreichen. Die Stadt, in der ich das nächste Schuljahr verbringen werde. Vermutlich ohne Hockeyteam und Debattierclub. Trotzdem werde ich mich nicht von meinen Zielen abhalten lassen. Eines Tages werde ich Staatsanwältin sein. Trotz Mamas Selbstverwirklichungstrip. Ich werde eben das Beste daraus machen. Aber keiner kann mich dazu zwingen, begeistert zu sein!
So langsam wird es Zeit, meine Siebensachen zusammenzusuchen. Na ja, eigentlich sind es nur fünf Gepäckstücke: mein Koffer, der riesige Rucksack, die Querflötenbox, der Beutel mit dem Hockeyzeug und meine Laptoptasche. Das alles schleppe ich in Richtung Ausstieg und versuche, weder darüber zu stolpern noch irgendetwas davon zu verlieren, während der Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof bremst. Eine echte Herausforderung für meinen Gleichgewichtssinn – ich sollte damit im Zirkus auftreten.
Dann stehen wir, und ich atme auf. Geschafft. Zum Glück wartet Mama ja am Bahnsteig auf mich. Zu zweit wird es ein Kinderspiel sein, die vielen Gepäckstücke zum Auto zu schleppen.
Beim Aussteigen hilft mir ein netter Herr, der offensichtlich Mitleid mit mir hat. Ich danke ihm höflich, obwohl ich es hasse, bemitleidenswert zu wirken.
Dann stehe ich auf dem Bahnsteig. Überall um mich herum spielen sich herzergreifende Begrüßungs- und Verabschiedungsszenen ab. Es herrscht ein Kommen und Gehen, nur ich stehe irgendwie blöd herum.
Wo bleibt denn die coolste aller Mütter?
Undenkbar, dass ich sie übersehe. Man übersieht sie nicht. Da muss irgendwas passiert sein.
Ich krame mein Handy hervor und checke WhatsApp. Nichts. Dann fällt mir ein, dass meine Mutter WhatsApp boykottiert – wegen irgendwelcher seltsamen Datenschutzbedenken. Sie schreibt lieber SMS, wie in der Steinzeit.
Tatsächlich, ich habe eine Nachricht von ihr.
Liebste Justine,
so ein Mist: Das Auto springt nicht an! Ausgerechnet … Ich wollte dich doch unbedingt abholen, aber daraus wird nun leider nichts. Zum Trost gibt es später dein Lieblingsessen. Nimm einfach den Bus – Linie elf, bis Endhaltestelle. Nicht zu verfehlen! Melde dich, wenn du aussteigst, dann hole ich dich ab und helfe dir mit dem Gepäck.
Kuss, Ma
Na, großartig! Das fängt ja gut an. Zwar bleibt mir die peinliche Begrüßungszeremonie am Bahnsteig erspart, aber dafür muss ich mein Gepäck nun allein zur Bushaltestelle schleppen. Puh!
Ich habe ungefähr drei Arme zu wenig. Und nur halb so viele Muskeln, wie nötig wären, um das ganze Zeug zu tragen. Ständig muss ich stehen bleiben, damit ich mich ein bisschen ausruhen und umgreifen kann. Gab es nicht früher mal Gepäckträger am Bahnhof? In den uralten Filmen, die Mama so gerne schaut, ist das jedenfalls so. Da stehen verzagten jungen Frauen sofort eifrige Helfer zur Seite. Aber das wirkliche Leben ist nun mal kein altmodischer Kitschfilm. Niemand hilft mir. Man beachtet mich nicht einmal. Es ist, als ob ich unsichtbar wäre.
Habe ich eben behauptet, dass ich es hasse, bemitleidenswert zu wirken? Ich muss mich korrigieren: Ich hasse es, bemitleidenswert zu sein, und keiner merkt es.
Nach fünf Stunden (oder, wie meine Uhr behauptet, zehn Minuten, aber das kann unmöglich stimmen) erreiche ich die Bushaltestelle. Linie elf. Perfekt. Ich habe es geschafft. Jedenfalls so gut wie. Erst muss ich noch meinen Krempel in den Bus wuchten.
»Warte, ich helfe dir«, sagt jemand.
Kein Gentleman – sondern ein Mädchen in meinem Alter. Sie sieht ziemlich freaky aus, mit irren Klamotten und einer total verrückten Frisur. Hat sie etwa aus bunten Dreadlocks ein Vogelnest auf ihrem Kopf gebaut? Egal, Hauptsache, sie ist nett und reicht mir meine Gepäckstücke.
»Du hast ja ganz schön viel Kram dabei, Wahnsinn, wie hast du es allein bis hierher geschafft? Ich bin ja schon mit einem Rucksack überlastet, schon dreimal habe ich ihn im Bus liegen lassen. Inzwischen ruft das Busunternehmen schon bei uns zu Hause an, wenn sie einen finden. Gehört meistens mir. Ich bin übrigens Giulia.«
Puh, die plappert ja, ohne Luft zu holen! Ich bin viel zu schlapp, um ausführlich zu antworten, und beschränke meine Reaktion auf die Minimalinformation: »Justine. Danke dir!«
Weil ich mit meinem Kram auch den Nebensitz belagere, setzt sie sich in die Reihe vor mir. Besser gesagt: Sie kniet sich auf den Sitz und stützt sich dabei auf die Rückenlehne.
»Wo musst du denn aussteigen?«, fragt Giulia. »Ich fahre nämlich bis zur Endhaltestelle, also kann ich dir auf jeden Fall helfen.«
»Ich auch«, erwidere ich. Dann fällt mir ein, dass ich gar nicht genau weiß, wie man von dort aus zu unserem Haus gelangt. Was, wenn Mama wieder etwas dazwischenkommt? Dann stehe ich dumm da. Schon schräg, dass ich nicht einmal meinen Heimweg kenne. Aber immerhin habe ich die Adresse. Und eine App mit dem Stadtplan.
Während ich mir vorzustellen versuche, wie das Haus wohl aussieht, das Mama für uns gekauft hat (sie findet es natürlich toll – also sollte ich mit dem Schlimmsten rechnen), plaudert Giulia munter weiter. Über das Busfahren, ihre Lieblingsband, einen Jungen, für den sie schwärmt, und die Schuhe, die sie sich heute gekauft hat. Ich höre nur mit halbem Ohr zu und nicke hin und wieder. Nicht, weil ich Giulia nicht mag, im Gegenteil – sie macht einen supernetten Eindruck. Aber im Moment geht mir einfach so viel anderes durch den Kopf.
Dann hält der Bus, und Giulia hilft mir beim Aussteigen mit den Sachen.
»Ich muss da lang«, sagt sie und deutet nach rechts.
»Und ich wohne dort drüben, Hausnummer 42«, antworte ich und zeige nach links. Jedenfalls muss ich laut App in diese Richtung gehen, doch das erzähle ich Giulia nicht. Zu kompliziert.
»Das ist zwar nicht weit, aber mit dem ganzen Zeug wird das eine Quälerei«, findet sie. »Weißt du was? Ich komm einfach mit und nehm ein paar von deinen Sachen.«
Wow, wie cool von ihr! Dann kann ich mir die SMS an meine Mutter sparen. Dankbar überreiche ich Giulia die sperrige Querflötenbox und den Rucksack.
»Ich hab dich hier noch nie gesehen«, nimmt sie das Gespräch wieder auf.
»Wir wohnen auch erst seit Neuestem hier.«
Gerade will ich sie fragen, ob sie auch in die Marie-Curie-Gesamtschule geht, da bleibt sie plötzlich stehen und starrt auf ein windschiefes, violett gestrichenes Häuschen.
Mein Blick fällt auf die Hausnummer. 42. Wie bitte? Das soll mein neues Zuhause sein?
An der Tür hängt ein Schild. LOLASLIEBESSCHULE.
Na, toll! Schlimmer geht’s nicht.
Ich wünschte, ich wäre ganz weit weg. Im Internat. Oder meinetwegen auch auf dem Mars!
Giulia kommentiert zum Glück weder das Haus noch das Schild.
»Man sieht sich«, sagt sie einfach nur. Und ich nicke.
Dann atme ich tief durch und klingele.
02Das Leben ist kein Hollywood-Schinken
»Justine, Liebes, da bist du ja endlich! Lass dich mal drücken! Aber warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dir doch beim Tragen geholfen! Komm rein, schau dich um, ist es nicht sagenhaft toll hier? Ich bin natürlich noch lange nicht fertig mit dem Renovieren, aber der Kursraum ist bereit für die ersten Teilnehmerinnen. Schau, hier rechts ist der Eingang. Das Gepäck bringen wir später rauf in dein Zimmer, leg es erst mal hier im Flur ab. Und lass dich anschauen! Kann es sein, dass du seit unserem letzten Treffen schon wieder gewachsen bist? Oder ich bin geschrumpft von der ungewohnten körperlichen Arbeit … Magst du einen Kakao?«
Ich will schon ablehnen, da wird mir klar, dass ein schöner, heißer Kakao jetzt genau das Richtige wäre. »Gern. Mit viel Sahne!«, sage ich und lasse mich erschöpft aufs Küchensofa sinken – das war schon immer mein Lieblingsplatz, auch in unserer alten Wohnung.
»Eine Küche ohne Sofa ist wie ein Kino ohne Popcorn«, pflegt Mama zu sagen. Dabei ignoriert sie die Tatsache, dass unser Küchensofa vermutlich älter ist als jedes Kino, denn es stammt noch von ihrer Urgroßmutter Justine, der ich nicht nur meinen Namen, sondern auch diese wunderbare Chill-Ecke zu verdanken habe. Früher stand wohl in allen Küchen ein Sofa, aber heutzutage gibt es stattdessen nur noch unbequeme Barhocker. Das erwähnt meine Mutter immer, um zu betonen, dass nicht jeder neumodische Schnickschnack eine Verbesserung darstellt. Was die Sache mit WhatsApp betrifft, finde ich ihre Einstellung hoffnungslos altmodisch, aber das Küchensofa würde ich echt nicht missen wollen.
Ich mache es mir bequem und genieße den Kakao. Lecker! Da ist die anstrengende Schlepperei schon fast vergessen.
Nicht jedoch die Tatsache, dass die tolle Immobilie, von der Mama so begeistert erzählt hat, in Wahrheit eine alte Bruchbude ist und ihr neues Business eine Liebesschule. Grundgütiger! Wie kommt sie bloß auf so eine absurde Idee? Das also hat sie die ganze Zeit gemeint, wenn sie von Erwachsenenbildung gesprochen hat!
Mama lässt sich neben mich aufs Sofa plumpsen und verursacht damit beinahe eine kleine Kakao-Katastrophe. Zum Glück habe ich schon so viel abgetrunken, dass nichts überschwappt.
»Na, wie gefällt dir unser schnuckeliges neues Heim?«, fragt sie freudestrahlend. Dass ich es hier extrem gewöhnungsbedürftig finde, sieht sie mir offenbar nicht an. Liegt bestimmt an meinem Pokerface, das mir als Juristin eines Tages noch sehr nützlich sein wird.
»Sehr … bunt«, kommentiere ich möglichst diplomatisch. Denn das entspricht auf jeden Fall den Tatsachen. Zwar habe ich bisher nur den Eingangsbereich, den Flur und die Küche gesehen, aber schon jetzt fast alle Farben des Regenbogens entdeckt.
»Toll, oder? Ich finde, eine Küche braucht ein frisches Maigrün. Und die Diele wirkt durch das warme Schokobraun wunderbar einladend, während der schmale Gang durch das helle Blau optisch größer wird. In meinem Kursraum dominieren übrigens Fifty Shades of Red. Willst du mal sehen?«
Ich bin nicht besonders scharf darauf, mehr über ihre Liebesschule zu erfahren. Erst einmal muss ich verdauen, dass es so etwas überhaupt gibt. Und das auch noch in unserem Haus! Kaum zu fassen, dass sie dafür ihren Spitzenjob gekündigt hat.
»Was rede ich da«, erspart Mama mir die Antwort, »bestimmt willst du erst einmal die restlichen Zimmer sehen. Komm mit!«
Stolz wie Beyoncé bei den MTV Video Music Awards schreitet sie voran und öffnet mit viel Tamtam – es fehlt nur noch ein Trommelwirbel – die nächste Tür. Sie führt zum Wohnzimmer, das wirklich ganz hübsch sein könnte mit seiner gemütlichen Sitzecke, dem großen Flachbildfernseher und sogar einem Kamin, wenn die Wände nicht brombeerlila gestrichen wären.
Für meinen Geschmack ist das viel zu heftig. Zum Glück werden wir uns hier hauptsächlich abends aufhalten, wenn es halbwegs dunkel ist und die Farbe hoffentlich nicht mehr so auffällt.
Das Badezimmer ist in einem kräftigen Türkis gestrichen, die Gästetoilette knallgelb und Mamas Schlafzimmer puderrosa. Ich stöhne leise auf. Da kriegt man ja Albträume!
Als sie die steile Holztreppe hinaufsteigt, wird mir angst und bange, denn der einzige Raum, der jetzt noch fehlt, ist mein Zimmer. Mir graut davor, zu sehen, wie sie ihn gestaltet (um nicht zu sagen: verunstaltet) hat.
Daher bin ich erleichtert, dass mich ein ziemlich trister, fast leerer Raum erwartet. Auf dem Boden liegt nur eine Matratze, in der Ecke steht eine alte Kleiderstange auf Rollen, wie man sie in Kaufhäusern findet, und vor dem Fenster ist mein alter Kinderschreibtisch mit dazugehörigem Stuhl. Das Einzige, was mir kein bisschen gefällt, ist die Blümchentapete. Aber die lässt sich ja überstreichen.
»Cool«, sage ich und meine es ehrlich.
Mama hält das für einen Witz und lacht sich halb schief. Man könnte fast denken, sie wäre erst fünfzehn, nicht ich. Manchmal ist sie unfassbar albern. Aber sie behauptet, das sei wahnsinnig gesund, mindestens so gesund wie Sport und Vitamine zusammen. Und weil mir meine kichernde Mutter hundertmal lieber ist als eine sportbesessene, kalorienzählende, verkniffene, smoothieverrückte Mutter, warte ich einfach, bis sie sich beruhigt hat. Und das lohnt sich, denn sie verkündet mir anschließend, dass sie mein Zimmer bewusst so gelassen hat, wie es war. »So karg und eintönig muss es natürlich nicht bleiben. Du hast freie Hand, dich hier einzurichten und es dir gemütlich zu machen. Ich werde dir überhaupt nicht reinreden, weder bei der Möbelsuche noch bei der Farbauswahl und den Accessoires. Es sei denn, du willst meinen Rat.«
Na, das ist ja mal ein Lichtblick! Wie gut, dass meine alten Kinderzimmermöbel den Umzug nicht überstanden haben, die waren mir schon lange zu prinzessinnenhaft. Nicht mehr mein Stil. Und eigentlich auch nie gewesen. Damals, als sie angeschafft wurden, war ich noch zu klein, um Einspruch zu erheben.
»Ich sag doch: cool«, wiederhole ich grinsend.
Und das bleibt nicht einmal der einzige Lichtblick: Direkt nebenan befindet sich nämlich noch ein eigenes Bad für mich. Frisch renoviert sogar und ganz in Weiß. Ein Traum! Ansonsten gibt es hier oben bloß noch einen Hauswirtschaftsraum und einen Speicher, auf dem massenhaft Kartons herumstehen.
Wir gehen wieder runter ins Erdgeschoss.
»Jetzt habe ich wohl alles gesehen«, vermute ich.
»Nicht ganz«, erwidert Mama und macht ein geheimnisvolles Gesicht. »Das Highlight habe ich mir bis ganz zum Schluss aufgehoben. Unser verwunschenes, kleines Gärtchen!« Ihr schwärmerischer Ton lässt mich Übles ahnen.
Aber als ich ihr nach draußen folge, bin ich hin und weg. Dieser Garten ist ein mittelgroßes Wunder, denn zum ersten Mal im Leben deckt sich unser Geschmack. Bisher fand ich das, was meiner Mutter gefällt, meistens zu schrill, und sie das, was ich mag, zu langweilig.
»Ist es nicht ein Traum?« Meine Mutter sieht ganz stolz aus.
»Es ist fantastisch«, staune ich und schaue mich um. Dichte Rosenbüsche umrahmen das Grundstück und sorgen dafür, dass es von außen nicht einsehbar ist. Es gibt einen Birnbaum, der in voller Blüte steht und um dessen Stamm eine Lichterkette geschlungen ist, außerdem einen mit Efeu bewachsenen Schuppen, unter dessen Dachüberstand das Brennholz für den Winter lagert, und eine gepflasterte Terrasse, die Platz für zwei Liegestühle, ein Tischchen und einen Sonnenschirm bietet.
»Unser geheimes Paradies«, ruft Mama aus, und diesmal bin ich diejenige, die lachen muss, weil sie mal wieder so übertrieben enthusiastisch ist. Aber eigentlich hat sie recht: Es ist einfach herrlich hier!
»Na, wie gefällt dir unser neues Zuhause?«, fragt meine Mutter und macht damit meine gute Laune zunichte. Aber das will ich mir nicht anmerken lassen. Und na ja, vielleicht – wenn ich mir ganz viel Mühe gebe – könnte ich mit der Zeit lernen, mich hier wohlzufühlen. Meiner Mutter zuliebe. Und weil mir eh nichts anderes übrig bleibt.
»Äääähm«, beginne ich, da klingelt es zum Glück an der Haustür.
»Das ist bestimmt der Lieferservice«, ruft Mama fröhlich und eilt davon.
Ich pflanze mich auf einen der Liegestühle, obwohl es dafür inzwischen schon ein bisschen zu kühl geworden ist, und schließe die Augen.
Andere Mütter würden ihre Töchter mit etwas Selbstgekochtem begrüßen, nicht mit Fast Food vom Lieferservice. Und dafür sorgen, dass das Auto funktioniert, um sie am Bahnhof abholen zu können. Und vor allem gar nicht erst auf die bekloppte Idee kommen, eine Liebesschule zu eröffnen und ihre Tochter zwingen, deswegen ihr geliebtes Internat zu verlassen.
Die meisten meiner ehemaligen Mitschüler wären allerdings auch froh, zu Hause bei ihren Eltern leben zu dürfen. In der Falkenburg sind Tränen und Heimweh an der Tagesordnung gewesen, und so einige meiner Mitschüler hätten bestimmt liebend gern mit mir getauscht.
Schon verrückt. Vielleicht ist nicht nur Mama anders als andere Mütter, sondern ich bin auch anders als andere Töchter? Was ja bedeuten würde, dass wir letztendlich doch ziemlich gut zusammenpassen, auch wenn sie mich ein bisschen zu erwachsen findet und ich sie ein bisschen zu kindisch.
Ich muss an die gepfefferte Rede denken, die ich vorhin während der Bahnfahrt in Gedanken zum Thema »Ungerechtigkeit in der Erziehung« formuliert habe. Damit hätte ich im Debattierclub garantiert jede Menge Applaus geerntet.
Seltsamerweise ist mir überhaupt nicht mehr nach gepfefferten Reden zumute. Meine Wut ist verflogen. Das muss an diesem Garten liegen. Er hat mich wirklich verzaubert. Außerdem bin ich klug genug, zu wissen, dass an der Situation nun mal nichts zu ändern ist. Wenn man keine Chancen auf ein günstiges Urteil hat, zieht man auch nicht vor Gericht. Das ist pure Energieverschwendung.
Apropos Energie: Mein Magen knurrt laut und vernehmlich. Erst jetzt fällt mir auf, was für einen Bärenhunger ich habe.
»Justine, wir können essen«, ruft Mama genau im richtigen Moment.
Ich springe sofort hoch und mache mich auf den Weg in die Küche. Beim ersten Versuch lande ich allerdings im Bad und beim zweiten im Wohnzimmer. Irgendwie habe ich den Grundriss des Hauses noch nicht ganz verinnerlicht.
»Wo steckst du denn? Hast du keinen Hunger?«, fragt Mama, als ich endlich die richtige Tür öffne.
»Doch, und wie!«, sage ich. »Boah, gibt es etwa Sushi?«
Mama lächelt. »Hab ich dir dein Lieblingsessen versprochen, oder hab ich dir dein Lieblingsessen versprochen?«
Stimmt. Hat sie.
»Lass uns anstoßen und unseren Neuanfang feiern!«, jubelt sie, während sie eine Flasche Prosecco köpft.
Ich finde zwar nicht, dass es etwas zu feiern gibt, aber ich freue mich auf die Sushis und will ihr vor allem die Laune nicht verderben. Deshalb proste ich ihr mit meinem Glas Wasser zu.
»Weißt du was? Wir essen im Wohnzimmer«, schlägt Mama vor. »Lass uns einen richtigen Mädelsabend machen – mit leckerem Essen und einem schönen Film.«
Da bin ich sofort dabei!
Schon cool, dass Mama das vorschlägt, was andere Eltern strengstens verbieten.
Weniger cool ist, dass sie unbedingt so einen schmalzigen Film sehen will, nur weil der gerade im Fernsehen läuft. Wie retro. Wer lässt sich heute, im Streaming-Zeitalter, noch vom Fernsehprogramm vorschreiben, was man anschaut? Sogar DVDs sind voll historisch. Und dann ist das auch noch so ein Millenniums-Movie! Also weder modern noch ein richtiger Klassiker. Seltsamerweise behauptet meine Mutter, es sei noch gar nicht lange her, dass sie ihn im Kino gesehen hat. Dabei war ich, als der Film gedreht wurde, noch nicht mal geboren. Ich fürchte, bei Erwachsenen tickt die innere Uhr nicht ganz richtig.
»Okay, ich bin dabei«, gebe ich nach, »wenn ich nächsten Samstag das Programm bestimmen darf.«
»Gute Idee«, findet Mama, die noch nicht ahnt, dass ihr ein Binge-Watching-Wochenende bevorsteht. Anwaltsserien machen mich süchtig, und Suits ganz besonders.
Der Film, den meine Mutter für heute ausgesucht hat, heißt Was Frauen wollen und ist leider nicht halb so spannend, wie sie angekündigt hat, sondern ziemlich dämlich. Es geht um einen Werbefuzzi, der meiner Meinung nach weder besonders gut aussieht (Mama dagegen findet ihn toll) noch sympathisch ist, im Gegenteil: Er hält sich selbst für den Allergrößten und kann es nicht ertragen, dass seine Kollegin befördert wird. So ein Macho! Und ein ungeschickter dazu. Er lässt doch tatsächlich einen Föhn ins Badewasser fallen und bekommt einen Stromschlag. Wie kann man sich nur so dämlich anstellen! Boah – und das soll eine romantische Komödie sein?
»Warte, gleich wird’s richtig witzig«, behauptet Mama.
Aber es wird nur total albern und unrealistisch, denn der Werbefuzzi-Macho kann auf einmal die Gedanken sämtlicher weiblicher Wesen hören und wird daraufhin im wahrsten Sinne des Wortes zum Frauenversteher. Kitschalarm! Wer denkt sich bloß so einen Mist aus? Natürlich klaut er seiner Konkurrentin erst die guten Ideen, um sich dann in sie zu verknallen. Und wenn sie nicht gestorben sind …
Gähn!
Zum Glück sind wenigstens die Sushis lecker.
»Hach, den könnt ich mir immer wieder ansehen«, seufzt Mama zufrieden, während der Abspann läuft. Moment – wischt sie sich da etwa eine Träne aus dem Augenwinkel? Ich tue lieber mal so, als ob ich es nicht gesehen hätte.
»Also, mir reicht vorerst dieses eine Mal«, erkläre ich.
»Vielleicht bist du noch ein bisschen zu jung, um den tieferen Sinn der Story zu verstehen.« Sie tut fast so, als wäre dieser Hollywood-Schinken reinstes Bildungsfernsehen: »Wenn alle Männer wüssten, wie Frauen ticken, wäre das Leben einfach traumhaft.«
Wie soll das funktionieren, wenn ich nicht einmal begreife, wie meine eigene Mutter tickt?
»Was Frauen wollen ist aus guten Gründen mein Lieblingsfilm«, fährt sie fort, »und ich habe mich davon sogar zu meinem Künstlernamen inspirieren lassen.«
Ich stutze: Seit wann hat meine Mutter denn einen Künstlernamen? Als ob sie das nötig hätte bei ihrem klangvollen Vornamen. Ich kenne sonst keine Frau, die Dolores heißt. Dann fällt mir die Aufschrift auf dem Schild an der Haustür ein: Lolas Liebesschule.
»Du hast dich nach der Geliebten dieses Kerls benannt, die er am Ende abserviert?« Na, ob das ein gutes Omen ist?!
»Lola ist eine Kurzform von Dolores, aber das bedeutet Schmerz, und du musst zugeben, dass das wohl kaum zu einer Liebesschule passt. Da ist Lola doch wesentlich angemessener.«
Ich persönlich fände es ja viel angemessener, wenn meine Mutter – ihrem Vornamen entsprechend – Schmerztherapeutin geworden wäre. Das wäre wenigstens nicht so peinlich!
03Lauter neue Gesichter … und ein bekanntes
Im Internat bin ich meistens schon aufgewacht, bevor der Wecker geklingelt hat. Tabea und ich haben uns eine frühmorgendliche Laufrunde angewöhnt, was sich natürlich enorm auf unsere Kondition ausgewirkt hat und damit auch auf unsere Leistungen beim Hockey.
Ein weiterer Vorteil: Wenn man anschließend als Erste in den Waschraum gekommen ist, waren die Duschen alle noch frei, und das Wasser wunderbar heiß!