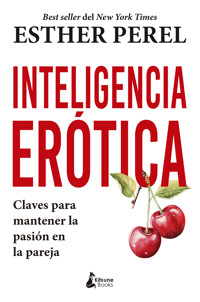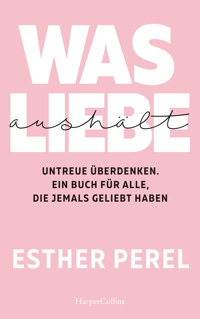8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Können wir begehren, was wir schon haben?« – der Beziehungsklassiker im neuen Gewand
Insgeheim kennen viele Paare das Problem: Mit der Zeit nimmt die Liebe zu, doch das Begehren schwindet; man teilt den Alltag, doch die heißen Nächte werden weniger. Wieso ist es eigentlich so schwer, emotionale Nähe und sexuelles Verlangen unter einen Hut zu bringen?
Die bekannte Beziehungsexpertin und Therapeutin Esther Perel hat mit zahlreichen Paaren gearbeitet und ihre Frustrationen, geheimen Wünsche und Sehnsüchte erforscht. Und ihnen dabei geholfen, ihre widersprüchlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und Abenteuer zu verstehen, um der Erotik in der Beziehung (wieder) eine Chance zu geben.
Mit ihrem Buch »Was Liebe braucht« traf sie damit bei Millionen Menschen einen Nerv. 2006 zum ersten Mal in dem USA unter dem Titel »Mating in Captivity« [wörtlich: »Paarungen in Gefangenschaft«] erschienen, avancierte es zum weltweiten Bestseller und wurde in fast dreißig Sprachen übersetzt. Die deutsche Ausgabe erschien bisher unter dem Titel »Wild Life« und wurde 2020 unter dem Titel »Was Liebe braucht« neu aufgelegt.
DIE NEUAUSGABE DES BEZIEHUNGSKLASSIKERS »WILD LIFE. DIE RÜCKKEHR DER EROTIK IN DER LIEBE – EIN BUCH, DAS LUST AUF MEHR MACHT.
»Esther Perel ist der Guru in Beziehungsfragen – und die erste Person, die ich um Rat fragen würde.« Cara Delevingne
»Jahrhundertlang musstest du dich dafür schämen, zu viel Sex zu haben; jetzt musst du dich dafür schämen keinen zu haben.« Esther Perel
»Wenn Sex in einer Beziehung gut läuft, nimmt er vielleicht fünfzehn Prozent der Energie ein. Wenn Sex ein problematisches Thema ist, sind es fünfundsiebzig.« Esther Perel
»Die meisten von uns werden nachts von genau den Sachen angeturnt, die sie tagsüber verpönen.« Esther Perel
»Sex ist schmutzig, spar ihn dir für die wahre Liebe auf.« Esther Perel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Esther Perel ist Psychotherapeutin, Bestsellerautorin und eine der berühmtesten Paartherapeutinnen der Welt. Sie leitet eine Praxis in New York City, spricht neun Sprachen fließend und ihre TED-Talks zählen über 30 Millionen Zuschauer. Ihr Bücher »Was Liebe braucht« und »Was Liebe aushält « sind internationale Bestseller. Esther Perel ist außerdem Produzentin und Moderatorin der preisgekrönten Podcasts »Where Should We Begin?« und »How’s Work«. Ihre Vorträge sind legendär.www.estherperel.com @EstherPerel @EstherPerelOfficial
HarperCollins®
Dies ist eine Neuausgabe des zuvor im Piper Verlag erschienenen Titels »Wild Life. Die Rückkehr der Erotik in die Liebe«.
Copyright © 2020 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2006, © 2017 by Esther Perel Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Mating in Captivity. Unlocking Erotic Intelligence« bei Harper Paperbacks, an imprint of HarperCollins Publishers, New York.
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959679213
www.harpercollins.de
Werden Sie Fan von HarperCollins Germany auf Facebook!
WIDMUNG
Für meine Eltern Sala Ferlegier und Icek Perel, deren Lebensfreude in mir fortbesteht.
TIERE IN GEFANGENSCHAFT
TIERE IN GEFANGENSCHAFT
Tiere in Gefangenschaft
behalten zwar die wilde Eigenschaft,
doch zeugen nicht, trauern, gehn ein.
Alle Menschen sind in Gefangenschaft,
im Banne langer Verfangenschaft,
und die besten zeugen nicht, sehen’s nicht ein.
Der große Käfig der häuslichen Haft
tötet in einem die Lust, die Kraft
des Begehrens verbiegt und verkrümmt sich, knickt ein.
Getrieben von bitterer Trägheitskraft,
anstoßend wider das, was das Leiden schafft,
rammeln die Jungen und finden’s zum Speien.
Die Lust ist ein Gnadenstand.
Im Käfig ist sie unbekannt.
Zerbrich drum den Käfig und lass dich ein.
D. H. LAWRENCE
EINFÜHRUNG
Moderne Paare, die über Jahre miteinander vertraut sind, berichten häufig von einem Schwinden der sexuellen Lust, wofür sie eine lange Liste vermeintlicher Gründe anführen. In jüngster Zeit nehmen sich fast alle Massenmedien dieses Themas an und weisen warnend darauf hin, dass auffällig viele Paare nur selten Sex haben, selbst dann, wenn die Partner beteuern, einander zu lieben. Sie sind heutzutage an ihrem Arbeitsplatz oder mit der Erziehung ihrer Kinder überlastet und schließlich zu müde für Sex. Und wenn dies nicht zur Abstumpfung ihrer Sinne geführt hat, so sind es die Antidepressiva, die eingenommen werden, um den Stress zu lindern. Für die Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge, die vor rund dreißig Jahren das Zeitalter der sexuellen Befreiung einläuteten, ist dies eine wahrlich ironische Entwicklung. Jetzt, da diese Männer und Frauen sowie die nachfolgenden Generationen so viel Sex haben könnten, wie sie wollen, scheint ihnen das Verlangen danach abhandengekommen zu sein.
Ich will an der Zuverlässigkeit solcher Medienberichte nicht deuteln – wir sind in der Tat allzu großen Belastungen ausgesetzt. Mir scheint allerdings, dass sie nur die Oberfläche eines weit verbreiteten Unbehagens streifen, wenn sie fast ausschließlich die Häufigkeit sexueller Beziehungen thematisieren. Ich glaube, dass sehr viel mehr dahintersteckt.
Psychologen, Sexualtherapeuten und Sozialwissenschaftler beschäftigen sich schon seit Langem mit der scheinbar unlösbaren Frage, wie Sexualität und Häuslichkeit miteinander zu vereinbaren seien. Uns wird eine Unmenge an Ratschlägen und Rezepten zur Anregung unseres sexuellen Appetits gegeben. Nachlassendes Verlangen, so heißt es, sei entweder auf zeitliche Fehlplanung zurückzuführen, die sich durch geeignete organisatorische Maßnahmen korrigieren lasse, oder auf ein Kommunikationsproblem, dem durch eine offene Aussprache über die sexuellen Wünsche des jeweils anderen beizukommen wäre.
Von statistischen Erhebungen über Frequenz und Dauer, darüber, wer zuerst kommt und wie viele Orgasmen erfahren werden, halte ich wenig. Ich möchte stattdessen Fragen stellen, auf die es keine schnellen Antworten gibt. Das vorliegende Buch handelt von Erotik und sexueller Poesie, der Natur erotischen Verlangens und den ihr innewohnenden Dilemmata. Wie fühlt es sich an, wenn man liebt? Wie unterscheidet sich das Gefühl des Verlangens davon? Kann tief empfundene Intimität guten Sex gewährleisten? Wie kommt es, dass der Übergang zur Elternschaft so häufig mit einem erotischen Desaster einhergeht? Warum ist das Verbotene so verlockend? Kann man sich noch wünschen, was man bereits hat?
Uns allen ist ein Grundbedürfnis nach Sicherheit gemein. Es hat uns eine verbindliche Partnerbeziehung eingehen lassen. Nicht minder stark aber spricht in uns das Bedürfnis nach Abenteuer und neuen Reizen. Moderne Romanzen versprechen, dass es möglich sei, beides miteinander in Einklang zu bringen. Davon bin ich allerdings nicht überzeugt. Wir wenden uns heute einer einzigen Person zu in der Hoffnung, sie könne uns das bieten, was früher eine ganze Dorfgemeinschaft vermittelt hat, nämlich ein Gefühl von Zugehörigkeit, Bestimmung und Kontinuität. Gleichzeitig erwarten wir von einer verbindlichen Beziehung, dass sie sowohl romantisch als auch emotional und sexuell erfüllend ist. Kann es noch verwundern, dass so viele Beziehungen unter dieser übergroßen Last zerbrechen? Freudige Erregung und Lust der einen Person gegenüber aufzubringen, die den Wunsch nach Zufriedenheit und Stabilität erfüllen soll, ist schwer, aber nicht unmöglich. Ich möchte Sie einladen, darüber nachzudenken, inwieweit Sie Ihrer Sicherheit Risiken, der Vertrautheit Geheimnisvolles und dem Beständigen Neuerungen zuzumuten bereit sind.
Es wird davon die Rede sein, wie die moderne Vorstellung von Liebe manchmal mit den Kräften der Libido kollidiert. Liebe gedeiht in einer Atmosphäre, die von Nähe, Gegenseitigkeit und Gleichheit gekennzeichnet ist. Wir wollen diejenigen, die wir lieben, von Grund auf kennen und alles Trennende aufheben. Wir kümmern und sorgen uns um sie, fühlen uns für sie verantwortlich. Für manche von uns sind Liebe und Verlangen untrennbar miteinander verbunden. Viele andere aber sehen sich durch emotionale Nähe in ihren erotischen Ausdrucksmöglichkeiten beeinträchtigt. Die sorgenden, beschützenden Impulse der Liebe unterdrücken nicht selten jene Unbefangenheit, die erotische Freuden erst möglich macht.
In meiner langjährigen Praxis als Therapeutin habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, dass viele Paare, die in ihrem Verhältnis auf Sicherheit bedacht sind, Liebe mit Verschmelzung verwechseln, was ein schlechtes Omen für Sex ist. Damit der sprichwörtliche Funke überspringen kann, muss ein gewisser Abstand gegeben sein. Für Erotik ist Distanz unabdingbar. Oder anders formuliert: Erotik entfaltet sich im Freiraum zwischen der eigenen Person und der des anderen. Um mit dem oder der Geliebten zu kommunizieren, müssen wir diese Leerstelle mitsamt ihren Unwägbarkeiten tolerieren.
Zu diesem Paradox gesellt sich ein weiteres: Leidenschaft wird häufig von Gefühlen begleitet, die der Vorstellung von Liebe zu widerstreben scheinen. Es regen sich zum Beispiel Aggressionen, Eifersucht und Missklang. Ich werde die kulturellen Einflüsse aufzeigen, die den domestizierten Sex formen, sprich: nivellieren, zahm und sicher machen und somit viele Paare auf Dauer langweilen. Ich möchte dazu anregen, spannendere, verspieltere, ja vielleicht sogar frivolere Möglichkeiten auszuprobieren und wenigstens im Schlafzimmer von unserem kulturell überformten Sinn für demokratischen Ausgleich abzusehen.
Um diesem Gedanken weiter nachzugehen, werde ich die Leserinnen und Leser auf einen Exkurs in die Sozialgeschichte mitnehmen. Wir werden sehen, dass Paare von heute ironischerweise mehr in ihre Liebe investieren als je zuvor und dass gerade dieses Modell für Liebe und Ehe mitverantwortlich ist für den sprunghaften Anstieg von Scheidungen. Wir müssen uns fragen, ob die traditionellen Strukturen der Ehe ihrem Mandat jemals gerecht werden können, insbesondere wenn »Bis der Tod uns scheidet« einen fast doppelt so großen Zeitraum umspannt wie in vorausgegangenen Jahrhunderten.
Das magische Elixier, das dies ermöglichen soll, heißt Intimität. Wir werden ihr aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Grund zu gehen versuchen. An dieser Stelle sei nur kurz darauf hingewiesen, dass das Klischee, wonach Frauen ganz und gar romantisch gestimmt, die Männer hingegen sexuelle Konquistadoren seien, längst nicht mehr taugt und entsorgt werden sollte. Gleiches gilt für all jene Vorstellungen, die davon ausgehen, dass Frauen typischerweise nach Liebe dürsteten, im Wesentlichen aber treu und häuslich veranlagt seien, während Männer, von Natur aus auf Polygamie gepolt, jegliche Intimität scheuten. Die sozialen und ökonomischen Veränderungen, die die westliche Welt in ihrer jüngeren Geschichte kennzeichnen, haben die traditionellen Geschlechterrollen aufgehoben und besagte Qualitäten sind sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu finden. Stereotype Definitionen mögen durchaus manche Wahrheiten enthalten, sie greifen aber zu kurz, wenn sie auf die Komplexität moderner Beziehungen angewendet werden. Ich werde mich dem Phänomen der Liebe daher mit einer eher androgynen Methode anzunähern versuchen.
In meiner therapeutischen Praxis habe ich die herkömmlichen Prioritäten auf den Kopf gestellt: Vertretern meiner Zunft wurde beigebracht, sich zuerst über den Zustand der Beziehung zu informieren und dann danach zu fragen, wie sich das Geäußerte im Schlafzimmer manifestiert. So gesehen, ist der sexuelle Austausch eine Metapher für die Beziehungen im Allgemeinen. Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass ein günstigeres Sexleben gewissermaßen automatisch folgt, wenn sich die Beziehung verbessert. Nach meinen Erfahrungen ist dies häufig nicht der Fall.
Herkömmlicherweise favorisiert die Therapie das gesprochene Wort und stellt es über die Körpersprache. Sexualität und emotionale Intimität bedienen sich aber verschiedener Ausdrucksmittel. In der Diskussion über Paarbeziehungen und Erotik möchte ich dem Körper den ihm gebührenden Vorrang einräumen. Er lässt von den emotionalen Wahrheiten, um die es geht, sehr viel mehr aufscheinen als Worte, die diese allzu häufig übertönen. Die dynamischen Kräfte, welche vielen Konflikten zwischen Partnern zugrunde liegen, insbesondere wenn es um Macht, Kontrolle, Abhängigkeit und Verwundbarkeit geht, offenbaren sich dann besonders deutlich, wenn sie über den Körper erfahren und erotisiert werden. Sexualität wirft nicht nur ein Schlaglicht auf Konflikte und Verwirrungen, die um Intimität und Lust kreisen, sie kann auch einen geeigneten Ansatz bieten, um diese destruktiven Entzweiungen zu heilen. Geprägt von persönlicher Geschichte und kulturellen Zurechtweisungen, wird der Körper gleichsam zu einem Text, der von uns allen gelesen werden kann.
Apropos lesen: An dieser Stelle bietet sich eine günstige Gelegenheit, zu erläutern, was Sie im vorliegenden Buch erwartet. Der Einfachheit halber werde ich den Begriff »Ehe« ganz allgemein für langfristige, vertraute Beziehungen und nicht nur im Sinne eines rechtlichen Familienstandes verwenden. Außerdem möchte ich mich frei zwischen männlichen und weiblichen Pronomen bewegen, ohne damit Urteile über ein bestimmtes Geschlecht abzugeben.
Ich persönlich bin, wie es schon mein Name verrät, von weiblicher Glaubensrichtung. Was vielleicht weniger ins Auge springt, ist, dass ich ein kultureller Hybrid bin. Ich bin von vielen Einflüssen geprägt und möchte einen möglichst fundierten kulturellen – oder multikulturellen – Blick auf das Thema dieses Buches werfen. In Belgien aufgewachsen, habe ich in Israel studiert und meine Ausbildung in den Vereinigten Staaten abgeschlossen. Weil ich also seit über dreißig Jahren gewissermaßen einen Spagat zwischen unterschiedlichen Kulturen mache, habe ich mir eine Perspektive zu eigen gemacht, die der eines außenstehenden Beobachters entspricht; oder anders ausgedrückt: Mir stehen verschiedene Brillen zur Verfügung, durch die ich mir anschaue, wie wir uns sexuell entwickeln und mit anderen verbinden, wie wir über Liebe sprechen und uns auf körperliche Freuden einlassen.
Ich habe meine persönlichen Erfahrungen in meine Arbeit als Klinikerin, Lehrerin und Beraterin auf dem Gebiet interkultureller Psychologie einfließen lassen. Das Augenmerk auf kulturelle Übergänge gerichtet, beschäftige ich mich vornehmlich mit drei verschiedenen Bevölkerungsgruppen: Flüchtlingsfamilien, ausländischen Familien (zwei Gruppen, die heutzutage zunehmend in den Blickpunkt geraten, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen) und interkulturellen Paaren (die unterschiedlicher ethnischer oder religiöser Herkunft sind). Die von diesen Gruppen vollzogenen kulturellen Übergänge sind weniger auf einen Ortswechsel zurückzuführen als auf das, was innerhalb der eigenen vier Wände stattfindet. Was mich ganz besonders interessiert, ist, wie sich diese Vermischung von Kulturen auf die jeweiligen Geschlechtsbeziehungen und Praktiken der Kindererziehung auswirkt. Ich mache mir Gedanken über die vielen verschiedenen Bedeutungen von Ehe und darüber, wie deren Rolle und Stellenwert innerhalb des größeren Familienverbandes je nach nationalem Kontext variieren. Ist die Ehe Privatsache zweier Individuen oder eine Angelegenheit zwischen zwei Familien? In meiner therapeutischen Arbeit mit Paaren habe ich immer wieder versucht, die kulturellen Nuancen aus den Gesprächen über Verbundenheit, Intimität, Freude, Orgasmus und körperliche Erfahrungen zu destillieren. Die Liebe mag universell sein, aber die Vorstellungen und Ausprägungen davon werden in unterschiedlichen Sprachen definiert – sowohl im wörtlichen als auch übertragenen Sinn. Besonders aufmerksam höre ich zu, wenn über kindliche und pubertäre Sexualität gesprochen wird, denn es sind gerade die Botschaften an Kinder, in denen sich die Wertvorstellungen und Ziele einer Gesellschaft, ihre Anreize und Verbote am deutlichsten manifestieren.
Ich spreche acht Sprachen; manche habe ich zu Hause gelernt, andere in der Schule oder auf Reisen, eine oder zwei aus Neigung. In meinem Beruf kommt mir dies ebenso zugute wie meine interkulturellen Erfahrungen. Meine Patienten sind sowohl hetero- als auch homosexuell (mit Transsexuellen arbeite ich derzeit nicht), verheiratet, verlobt, alleinstehend und wiederverheiratet, jung und alt. In ihrer Gesamtheit decken sie ein breites Spektrum von Kulturen, Ethnien und Gesellschaftsschichten ab. Ihre individuellen Geschichten erzählen von den kulturellen und psychischen Kräften, die unsere Art zu lieben und zu begehren formen.
Eine meiner prägendsten persönlichen Erfahrungen, die auch in dieses Buch einfließt, mag abwegig erscheinen, doch ich möchte sie an dieser Stelle nennen, weil sie die tieferen Beweggründe meiner leidenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Thema erhellt. Meine Eltern haben ein Konzentrationslager der Nazis überlebt. Über mehrere Jahre hatten sie den Tod ständig vor Augen. Meine Mutter und mein Vater waren die einzigen Überlebenden ihrer Familien und entschlossen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, das ihnen nach den erfahrenen Schrecken als ein einzigartiges Geschenk erschien. Ich glaube, meine Eltern waren ziemlich ungewöhnlich. Sie wollten nicht nur überleben, sondern neu auferstehen. Sie hatten einen ausgeprägten Lebenshunger und kultivierten ihre Freude am Leben. Über ihre sexuelle Beziehung weiß ich nur, dass aus ihr zwei Kinder hervorgegangen sind, mein Bruder und ich. Ihr Umgang miteinander aber ließ erkennen, dass sie ein tiefes Verständnis von Erotik besaßen. Wahrscheinlich war ihnen dieser Begriff als solcher fremd, seine Bedeutung aber durchaus vertraut, und zwar nicht in jener engen Definition, die ihm die Moderne zuschreibt, sondern als Qualität von Lebendigkeit und als ein Weg zur Freiheit. Um eben diesen erweiterten Sinn von Erotik soll es in diesem Buch gehen.
Eine weitere entscheidende Erfahrung hat dieses Projekt maßgeblich beeinflusst. Mein Ehemann leitet das Programm für internationale Traumastudien (International Trauma Studies) an der Columbia University und widmet sich in dieser Funktion der Unterstützung von Flüchtlingen, Kindern aus Kriegsgebieten und Folteropfern, die schwere Traumata erfahren haben. Indem diese Menschen ihren Sinn für Spiel und Freude und ihr kreatives Vermögen wiederherzustellen versuchen, finden sie in ihr Leben und zu der Hoffnung zurück, durch die es genährt wird. Mein Mann beschäftigt sich mit Schmerz; ich beschäftige mich mit Freude. Beides ist eng miteinander verknüpft.
Die Personen, über die ich schreibe, bleiben anonym, obwohl ich mich namentlich bei ihnen bedanken müsste. Ihre Geschichten sind authentisch und fast wortwörtlich wiedergegeben. Während des gesamten Projekts habe ich die jeweiligen Protokolle mit den Betroffenen im Geiste redlicher Zusammenarbeit besprochen. Dieser Arbeit verdanke ich viele meiner Gedanken. Darüber hinaus habe ich aus dem reichhaltigen Fundus der Forschung zahlreicher Kollegen und Autoren geschöpft, die sich schon vor mir mit den Vieldeutigkeiten von Lust und Liebe auseinandergesetzt haben.
Jeden Tag sehe ich mich aufs Neue in meiner Arbeit mit Einzelschicksalen konfrontiert, die von allen Statistiken unterschlagen werden. Mir begegnen Menschen, die so gut befreundet sind, dass sie den sexuellen Umgang miteinander scheuen. Ich spreche mit Liebhabern, die so hartnäckig an der Vorstellung festhalten, Sex habe spontan zu sein, dass sie überhaupt nicht dazu kommen. Ich spreche mit Paaren, für die Verführung allzu mühselig ist und nun auch nicht mehr infrage kommt, da sich die Partner auf Dauer füreinander entschieden haben. Andere, die in meine Sprechstunde kommen, glauben, Intimität bedeute, alles über den anderen zu wissen; und wenn dann schließlich auch der Rest an Distanz verloren gegangen ist, wundern sie sich, wo die prickelnden Gefühle der anfänglichen Verliebtheit abgeblieben sein mögen. Ich spreche mit Ehefrauen, die sich lieber für den Rest ihres Lebens als »sexuell unterkühlt« bezeichnen, statt ihren Männern zu erklären, dass es mit einem flüchtigen Vorspiel, mit dem diese möglichst schnell zur Sache kommen wollen, nicht getan ist. Ich spreche mit Menschen, die so verzweifelt darum bemüht sind, gegen die Tristesse in ihren Partnerschaften anzukämpfen, dass sie alles zu riskieren bereit sind, um ein paar wenige Momente verbotener Stimulanz genießen zu können. Ich spreche mit Paaren, deren Sexleben dank einer außerehelichen Affäre wieder in Schwung gekommen ist, und mit anderen, für die der Seitensprung das Ende ihrer ohnehin gestörten Beziehung war. Ich spreche mit älteren Männern, die, weil sie zu keiner Erektion mehr imstande sind, all ihre Hoffnung auf Viagra setzen und damit die Angst vor den Tatsachen zu lindern versuchen; und ich spreche mit deren Frauen, die sich dadurch plötzlich in ihrer eigenen Passivität herausgefordert sehen und unglücklich darüber sind. Ich spreche mit jungen Eltern, deren erotische Energie von der Sorge um den Säugling aufgezehrt wird oder die sich von ihren Kindern so sehr haben vereinnahmen lassen, dass es ihnen gar nicht mehr einfällt, von Zeit zu Zeit die Schlafzimmertür hinter sich zuzuziehen. Ich spreche mit dem Mann, der sich über das Internet mit Pornografie eindeckt, und das nicht etwa, weil er seine Frau unattraktiv fände, sondern weil ihm ihre mangelnde Bereitschaft für Sex das Gefühl vermittelt, dass mit seinem Bedürfnis etwas nicht stimme. Ich spreche mit Menschen, die sich ihrer Sexualität so sehr schämen, dass sie diese dem anderen, den sie lieben, nicht zumuten wollen. Ich spreche mit Menschen, die nicht nur geliebt, sondern auch begehrt sein möchten. Sie alle suchen mich auf, weil sie sich nach erotischer Vitalität sehnen und nicht darauf verzichten wollen. Manche zeigen sich verlegen, andere verzweifelt, verbittert oder wütend. Es ist nicht so, dass sie lediglich den Geschlechtsakt entbehrten; was ihnen vielmehr fehlt, ist jenes Gefühl von Verbundenheit, Verspieltheit und Erneuerung, das Sex zu vermitteln vermag. Ich lade Sie ein, an den Gesprächen teilzunehmen, die ich mit diesen Leuten geführt habe und die darauf ausgerichtet sind, neue Einsichten zu gewinnen und der Erfahrung von Transzendenz einen Schritt näher zu kommen.
All denjenigen, die ab und an auf einen beschleunigten Herzschlag hoffen, sei schon vorab verraten: Erregung ist mit Ungewissheit verwoben, mit unserer Bereitschaft, Unbekanntes willkommen zu heißen, statt es von uns fernzuhalten. Diese Spannung erzeugt allerdings auch ein Gefühl von Verletzlichkeit. Ich warne meine Patienten vor der falschen Vorstellung, es gebe so etwas wie »Safe Sex«.
An dieser Stelle möchte ich auch anmerken, dass nicht alle Liebhaber auf Leidenschaft aus sind oder sie auch nur irgendwann einmal voll ausgekostet haben. Manche Beziehungen gründen auf Gefühlen von Wärme, Zärtlichkeit und liebevoller Zuwendung und trachten nach emotionaler Ruhe. Dem temporären Überschwang ziehen sie eine Liebe vor, die geduldig ist. Für sie besteht das höchste Glück in einer dauerhaften Verbindung. Es gibt mehr als ein Rezept und kein Richtig oder Falsch.
Was Liebe braucht will Sie, die Leserinnen und Leser, zu einer aufrichtigen, erhellenden und provozierenden Diskussion anregen und dazu ermutigen, dass Sie sich selbst beobachten, das Unausgesprochene frei äußern und keine Angst davor haben, das sexuell und emotional vermeintlich Korrekte infrage zu stellen. Ich möchte Sie einladen, frischen Wind in Ihr erotisches und häusliches Leben zu bringen, dem Unwägbaren Raum zu geben und somit dem Sex das »X« zurückzugeben.
1 VOM ABENTEUER ZUR GEFANGENSCHAFT
WENN DIE SUCHE NACH SICHERHEIT DIE EROTISCHE KRAFT AUFZEHRT
Die Flamme ist »das Subtilste am Feuer; sie erhebt sich und steigt pyramidenförmig empor.
Das Urfeuer, die Sexualität, weckt die rote Flamme der Erotik, und diese nährt eine weitere Flamme, die blau und flackernd sich erhebt: die der Liebe.
Erotik und Liebe: die doppelte Flamme des Lebens.«
– Octavio Paz, Die doppelte Flamme1
Partys in New York City sind wie anthropologische Feldforschung – man weiß nie, wem man begegnet und was einen erwartet. Als ich mich vor Kurzem einmal mehr, befangen und schüchtern, unter eine mondäne New Yorker Partygesellschaft mischte, bestätigte sich erneut, was für diese Stadt der erfolgsverwöhnten Überflieger typisch ist: Noch bevor man mich nach meinem Namen fragte, wollte man von mir wissen, welchen Beruf ich ausübe. Meine Antwort: »Ich bin Therapeutin und schreibe gerade ein Buch.« Neben mir stand ein gut aussehender junger Mann, der ebenfalls an einem Buch arbeitete. »Zu welchem Thema?«, fragte ich ihn. »Physik«, antwortete er. Höflich erkundigte ich mich: »Und was ist Ihr Fachgebiet?« An seine Antwort kann ich mich nicht erinnern, zumal unser Gespräch über Physik abrupt endete, als mich jemand anders fragte: »Und Sie? Worüber schreiben Sie?«
»Über Paarbeziehung und Erotik«, antwortete ich. Mein Marktwert war nie so hoch wie zu der Zeit, als ich dieses Buch über Sex zu schreiben anfing. Ob auf Partys oder im Taxi, ob im Maniküresalon, an Bord eines Flugzeugs, unter Teenagern oder an der Seite meines Mannes – überall traf ich auf Neugier. Es gibt Themen, die jeden Zuhörer in die Flucht schlagen, und solche, die magnetische Anziehungskraft zu haben scheinen. Über mangelnde Gesprächsbereitschaft konnte ich mich jedenfalls nicht beklagen – was natürlich nicht bedeutet, dass man mir immer nur reinen Wein einschenkte. Wie kaum ein anderes Thema lädt gerade dieses zu Unterschlagung und Heimlichtuerei ein.
»Paarbeziehung und Erotik? Können Sie das bitte genauer erklären?«, hakte ein Dritter nach.
»Ich untersuche die Natur sexuellen Begehrens und möchte in Erfahrung bringen, ob es möglich ist, dieses Begehren auch in langjähriger Partnerschaft aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass es sich mit der Zeit abnutzt.«
»Für Sex ist Liebe nebensächlich, andererseits kommt Liebe nicht ohne Sex aus«, meinte ein Mann, der am Rand stand und noch unentschlossen zu sein schien, ob er an dem Gespräch teilnehmen sollte oder nicht.
»Richten Sie Ihr Augenmerk hauptsächlich auf verheiratete, heterosexuelle Paare?«, fragte ein anderer. Sprich: Geht es in diesem Buch auch um mich? Ich versicherte ihm: »Ich schaue mir alle möglichen Paare an. Heterosexuelle, schwule, junge, alte, verheiratete und unentschiedene.«
Ich erklärte, dass ich herausfinden wollte, ob und wie es uns gelingen könnte, unsere Beziehungen dauerhaft lebendig und aufregend zu gestalten. Führt Treue womöglich zwangsläufig zum Absterben der Lust? Können wir jemals Zusammenhalt sichern, ohne uns gleichzeitig der Monotonie zu unterwerfen? Ich frage mich, ob es gelingen kann, einen Sinn für Poesie zu bewahren, dasjenige, was Octavio Paz als die doppelte Flamme der Liebe und Erotik bezeichnet hat.
Gespräche dieser Art hatte ich schon unzählige Male geführt, und die Ansichten, die mir auf dieser Party zu Ohren kamen, waren alles andere als neu.
»Unmöglich.«
»Nun, genau darin liegt ja das Problem der Monogamie, oder?«
»Aus eben diesem Grund lege ich mich nicht fest. Und das hat nichts mit Angst zu tun; ich habe einfach keinen Bock auf langweiligen Sex.«
»Lust, die lange vorhält? Was ist mit Lust, die sich in einer Nacht erschöpft?«
»Beziehungen entwickeln sich. Aus Leidenschaft wird etwas anderes.«
»Als die Kinder kamen, war für mich die Leidenschaft passé.«
»Hören Sie, es gibt Männer fürs Bett und solche, die man heiratet.«
Im öffentlichen Diskurs führen häufig gerade die komplexeren Themen zu polarisierendem Streit, in dem Nuancen zur Karikatur geraten oder gänzlich auf der Strecke bleiben. Auf der einen Seite stehen die Romantiker, auf der anderen die Realisten. 2 Romantiker lehnen ein Leben ohne Leidenschaft ab und beteuern, auf wahre Liebe niemals verzichten zu können. Sie suchen – wenn es sein muss, ewig – nach einem Partner, an dessen Seite das glühende Begehren nie versiegt. Schwindendes Verlangen ist für sie gleichbedeutend mit dem Erkalten der Liebe. Sie stirbt, wenn der Eros seine Kraft verliert. Romantiker wollen sich mit dem Verlust sinnlicher Erregung nicht abfinden und fürchten das alltägliche Einerlei.
Realisten beziehen eine diametral entgegengesetzte Position. Für sie ist dauerhafte Liebe wichtiger als heißer Sex. Leidenschaft, so fürchten sie, führt zu törichten Handlungen. Sie ist gefährlich, richtet Unheil an und bietet der Ehe ein allzu schwaches Fundament. Marge Simpson fand dafür die unvergessenen Worte: »Leidenschaft ist für Teenager und Ausländer.« Realisten bauen auf Reife. Die anfängliche Erregung verwandelt sich in Liebe, gegenseitigen Respekt, Gemeinsamkeiten und Gemeinschaft. Das Schwinden sinnlichen Begehrens ist unvermeidlich und für erwachsene Menschen kein ernstliches Problem.
Im weiteren Verlauf der Diskussion beäugen sich die Vertreter beider Lager mit einer diffusen Mischung aus Mitleid, Zärtlichkeit, Neid, Erbitterung und unumwundenem Groll. Doch während sie jeweils extrem entgegengesetzte Standpunkte einnehmen, stimmen sie grundsätzlich darin überein, dass Leidenschaftlichkeit mit der Zeit abkühlt.
»Manche von Ihnen sträuben sich gegen den Verlust an Intensität, andere akzeptieren ihn, aber Sie alle scheinen davon auszugehen, dass das gegenseitige Verlangen über kurz oder lang zwangsläufig abstumpft«, entgegne ich. »Sie unterscheiden sich lediglich in der Einschätzung dessen, wie bedeutsam dieser Verlust tatsächlich ist.« Für Romantiker rangiert Intensität über Stabilität. Realisten schätzen Sicherheit höher ein als Leidenschaft. Aber sowohl die einen als auch die anderen sind häufig enttäuscht, denn nur wenige finden ihre jeweils extreme Haltung wirklich befriedigend.
Ich werde immer wieder gefragt, ob mein Buch eine Lösung anbietet. Was lässt sich tun? Hinter dieser oder ähnlichen Fragen verbirgt sich der heimliche Wunsch nach dem Élan vital, jener erotischen Kraft, die uns belebt. Auch wenn sich viele für Sicherheit und Geborgenheit entscheiden, bleibt doch für die meisten dieser Wunsch bestehen. Darum höre ich ganz genau hin und achte auf den Moment, an dem hinter all den Überlegungen zu jenem scheinbar unausweichlichen Verlust der Leidenschaft ein Hoffnungsschimmer zum Vorschein kommt. Sämtliche Kommentare laufen auf eine zentrale Frage hinaus: Können wir in ein und derselben dauerhaften Beziehung beides haben, Liebe und Verlangen? Wenn ja, wie? Wie sähe eine solche Beziehung aus?
ANKER UND WELLE
Vielleicht bin ich eine Idealistin, aber ich glaube, dass sich Liebe und Lust nicht ausschließen müssen; sie passen nur nicht immer zusammen. Sicherheit und Leidenschaft sind zwei menschliche Grundbedürfnisse, die unterschiedlichen Beweggründen entspringen und uns in verschiedene Richtungen drängen. In seinem einsichtsvollen Buch Kann denn Liebe ewig sein? unterbreitet der Psychoanalytiker Stephen Mitchell 3 Denkanstöße zur Lösung dieses Rätsels. Er stellt fest, dass wir alle nach Sicherheit trachten: nach Konstanz, Verlässlichkeit, Stabilität und Kontinuität. Diese tief verwurzelten Instinkte erden gewissermaßen unsere menschliche Erfahrung. Gleichwohl brauchen wir auch den Reiz des Neuen und Veränderung. Sie sorgen für frische Energie und schenken unserem Leben Fülle und Abwechslung. Risiko und Abenteuer locken. Wir sind wandelnde Widersprüche, verlangen einerseits nach Sicherheit und Vorhersehbarkeit, suchen aber andererseits auch bereichernde Vielfalt.
Ich denke in diesem Zusammenhang an ein Kleinkind, das Verstecken spielt, oder an eines, das sich neugierig vorwagt, aber immer wieder zurückläuft, um sich zu vergewissern, dass Mutter und Vater noch zur Stelle sind. Die Bereitschaft, Neues zu entdecken, setzt ein Gefühl von Sicherheit voraus; sobald das Kind seine Abenteuerlust befriedigt hat, will es an seinen sicheren Stützpunkt zurück, wo ihm alles vertraut ist. Phasen von Kühnheit und Risikobereitschaft wechseln sich mit Phasen der Suche nach Sicherheit und Geborgenheit ab. Das Kind mag schwanken, entscheidet sich aber schließlich für das, was ihm wichtiger erscheint.
Gleiches trifft auf alles Lebendige zu: Jeder Organismus bedarf alternierender Phasen von Wachstum und Ruhe. Das, was ständiger Veränderung ausgesetzt ist, droht im Chaos zu versinken; Rigidität und Stasis aber behindern Wachstum und lassen den Organismus absterben. Ruhe und Bewegung sind wie der Anker und die Wellen.
Beziehungen unter Erwachsenen spiegeln diese Dynamik überaus sinnfällig. Wir suchen in unserem Partner oder unserer Partnerin einen festen, verlässlichen Anker, erwarten von der Liebe aber gleichzeitig transzendierende Erfahrungen, die uns über den Alltag hinausheben. Modernen Paaren stellt sich die Aufgabe, das Bedürfnis nach Sicherheit und Vorhersehbarkeit mit dem Wunsch auf das, was aufregend, geheimnisvoll und tief beeindruckend ist, in Einklang zu bringen.
Einige wenige Paare sehen darin allenfalls eine Herausforderung. Sie dürfen sich glücklich schätzen, denn ihnen fällt es leicht, die nützlichen und sinnlichen Aspekte ihrer Partnerschaft zu integrieren. Verbindlichkeit und Überschwang, Verantwortung und Verspieltheit liegen für sie nicht im Widerstreit miteinander. Sie können sich häuslich einrichten, Eltern sein und trotzdem Liebhaber bleiben. Doch wir, die überwiegende Mehrheit, müssen feststellen, dass es ungemein schwierig ist, in einer auf Dauer angelegten Partnerschaft auch erotische Erfüllung zu finden. Leider entwickeln sich allzu viele Liebesgeschichten dahin gehend, dass in dem Bestreben nach Sicherheit die Leidenschaft auf der Strecke bleibt.
WAS WILL ICH?
Adele kommt in mein Sprechzimmer; in der einen Hand hält sie ein Sandwich, in der anderen den Fragebogen, den sie im Wartezimmer ausgefüllt hat. Sie ist achtunddreißig Jahre alt und unterhält als Anwältin ihre eigene Kanzlei. Seit sieben Jahren ist sie mit Alan verheiratet, einem Amerikaner chinesischer Abstammung. Für beide ist es die zweite Ehe. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Emilia; sie ist fünf. Adele trägt ein schlichtes, aber elegantes Kostüm. Ein Besuch beim Friseur wäre wohl wieder einmal fällig, doch scheinen andere Termine vorzugehen.
»Ich will gleich zur Sache kommen«, sagt sie. Zeit zu vertrödeln kommt für diese gut organisierte und erfolgreiche Frau nicht infrage. »Im Großen und Ganzen bin ich durchaus glücklich, was meine Ehe betrifft. Mein Mann ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem ich ausgesprochen zufrieden bin, zumal ich weiß, wie schlimm es in anderen Beziehungen zugehen kann. Was also will ich?
Mein Freund Marc lässt sich gerade von seiner dritten Frau scheiden. Seine Begründung: ›Sie inspiriert mich nicht.‹ Also fragte ich Alan: ›Inspiriere ich dich?‹ Und soll ich Ihnen sagen, was er mir darauf antwortete? ›Du inspirierst mich zur allsonntäglichen Zubereitung meiner Hähnchenspezialität.‹ Er kocht ein fantastisches Coq au vin, und das jeden Sonntag – aus Gefälligkeit; er weiß, es ist mein Leibgericht.
Ich versuche zu verstehen, was mir fehlt. Ist es dieses Gefühl, das man zu Anfang einer Liebschaft hat, diese Schmetterlinge im Bauch, diese Leidenschaftlichkeit? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es bei mir dazu überhaupt noch kommen könnte. Wenn ich dieses Thema anschneide, verzieht er das Gesicht. ›Aha‹, sagt er dann, ›du denkst wohl wieder an Brad und Jen.‹ Selbst Brad Pitt und Jennifer Aniston hatten sich nach einer Weile über. Tatsache. Ich habe Biologie studiert und weiß, wie Reizleiter funktionieren. Überbeanspruchung mindert die Erregbarkeit. Das habe ich verstanden, jaja. Aber wenn schon die Schmetterlinge nicht mehr flattern, so möchte ich doch zumindest irgendetwas fühlen.
Als Realistin weiß ich, dass das Kribbeln zu Anfang nicht zuletzt der Ungewissheit zu verdanken ist, wie der andere wohl empfinden mag. Wenn nach einem Rendezvous das Telefon klingelte, war ich vor allem deshalb so aufgeregt, weil ich nicht wissen konnte, ob er es war, der mich da gerade zu erreichen versuchte. Wenn er jetzt verreisen muss, bitte ich ihn ausdrücklich, nicht anzurufen. Es könnte ja sein, dass ich schlafe und nicht gestört werden will. Die Vernunft sagt mir: ›Ich möchte keine Unsicherheiten. Ich bin verheiratet, habe ein Kind und will mir, wenn er geschäftlich unterwegs ist, keine Sorgen machen müssen nach dem Motto: Hat er mich noch gern? Wird er mich betrügen?‹ Sie kennen ja diese Tests in Illustrierten: Woran merkt man, ob der andere einen noch liebt? Mit solchen Kinkerlitzchen will ich nichts mehr zu tun haben. Das hätte gerade noch gefehlt. Aber davon abgesehen, würde ich allzu gern einen Teil der Erregung von früher zurückgewinnen.
Wenn ich, aus der Kanzlei zurückgekehrt, den Haushalt in Ordnung gebracht, mich um Emilia gekümmert, das Essen vorbereitet und alles andere, was anstand, erledigt habe, ist mir jeglicher Sinn für Sex abhandengekommen. Ich möchte nicht einmal mehr mit irgendjemandem darüber reden. Manchmal setzt sich Alan vor den Fernseher; ich gehe ins Bett, um noch etwas zu lesen, und bin rundum zufrieden. Was also versuche ich hier eigentlich in Worte zu fassen? Um Sexualität geht es mir nicht. Ich will einfach als Frau wertgeschätzt werden. Nicht bloß als Mutter, als Ehefrau oder Partnerin. Und ich will ihn als Mann wertschätzen. So etwas könnte beispielsweise in einem Blick zum Ausdruck kommen, in einer Berührung, einem Wort. Ich möchte wahrgenommen werden.
Er sagt: Wie du mir, so ich dir. Klar. Aber im Negligé zu posieren und zu gurren ist meine Sache nicht. Streicheleinheiten zu verteilen finde ich einfach zu lästig. Als wir uns gerade erst kennengelernt hatten, habe ich ihm zum Geburtstag eine Aktentasche geschenkt – er sah sie in einem Schaufenster und fand sie schön. Darin steckten zwei Flugtickets nach Paris. In diesem Jahr war mein Geburtstagsgeschenk an ihn eine DVD; wir feierten mit ein paar Freunden und aßen Hackbraten, den seine Mutter gemacht hatte. Nichts gegen Hackbraten, aber so weit ist es inzwischen gekommen. Ich kann mir selbst nicht erklären, warum ich mich nicht stärker engagiere. Vielleicht bin ich zu bequem geworden.«
Adeles hastig vorgetragene Ausführungen schildern auf plastische Weise das spannungsgeladene Verhältnis von einvernehmlicher Liebe und erlahmender erotischer Vitalität. Vertrautheit ist in der Tat beruhigend und schafft ein Gefühl von Sicherheit, auf das Adele auf gar keinen Fall verzichten möchte. Gleichzeitig aber sehnt sie sich zurück nach jener Lebendigkeit und Erregtheit, die beide, sie und Alan, zu Anfang ihrer Beziehung empfunden haben. Sie will beides, das Behagliche und den Nervenkitzel; sie will beides mit ihm erfahren.
Das Bedürfnis, für den eigenen Ehemann leidenschaftliche Gefühle zu empfinden, galt noch bis vor Kurzem als ein Widerspruch in sich. Traditionellerweise wurden die hier verhandelten Lebensbereiche getrennt organisiert – die Ehe auf der einen Seite und Leidenschaftlichkeit, wenn überhaupt, aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwo anders. Die Vorstellung der romantischen Liebe, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkam, führte beide Bereiche erstmalig zusammen. Es dauerte noch Jahrzehnte, ehe die Sexualität in der Ehe eine zentrale Bedeutung gewann und mit gesteigerten Erwartungen verknüpft war.
DIE ÄRA DES VERGNÜGENS
Der gesellschaftliche und kulturelle Wandel der vergangenen fünfzig Jahre hat die moderne Paarbeziehung völlig neu definiert. Alan und Adele sind Nutznießer der sexuellen Revolution der sechziger Jahre, mit der die Emanzipation der Frau, Geburtenkontrolle und Schwulenbewegung ihren Anfang nahmen. Die Pille befreite den Sex von seiner Reproduktionsfunktion. Feministinnen und Homosexuelle kämpften für die Anerkennung ihrer sexuellen Präferenzen als unveräußerliches Recht. In seinem Buch The Transformation of Intimacy erklärt Anthony Giddens 4 diesen Wandel als persönliche Inbesitznahme unserer Sexualität, die wir entwickeln, definieren und im Laufe unseres Lebens immer wieder neu aushandeln. Sexualität ist für uns heute ein persönliches Projekt mit offenem Ausgang. Verstanden als Teil unserer Identität, kommt ihr und somit auch der sexuellen Befriedigung eine gesteigerte, ja, zentrale Bedeutung zu. Wir glauben, Anspruch darauf zu haben.
In Verbindung mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit haben diese Entwicklungen eine Phase unvergleichlicher Freiheit und Individualität eingeleitet. Wir werden heute dazu ermutigt, persönliche Erfüllung und sexuelle Befriedigung anzustreben und uns von jenen gesellschaftlichen und familiären Zwängen zu lösen, die bislang von Pflicht und Bindung gekennzeichnet waren. Im Schatten dieser manifesten Extravaganz lauert jedoch eine neue nagende Unsicherheit. Großfamilie, Nachbarschaft und Kirche haben vielleicht unsere persönlichen Freiheiten eingeschränkt, uns aber im Gegenzug ein wichtiges Zugehörigkeitsgefühl vermittelt. Über viele Generationen garantierten diese traditionellen Institutionen Ordnung, Sinnhaftigkeit, Kontinuität und soziale Unterstützung. Im Zuge ihrer Auflösung nehmen unsere Wahlmöglichkeiten in einem vordem ungeahnten Ausmaß zu, während all das, was früher eingeschränkt war, an Wirksamkeit verliert. Wir sind freier, aber auch einsamer oder, um mit Giddens zu sprechen, ängstlicher geworden, was unser Sein betrifft.
Diese unbestimmte Ängstlichkeit übertragen wir nicht zuletzt auf unsere Liebesbeziehungen. Liebe steht nicht mehr nur für emotionalen Unterhalt, Mitgefühl und Partnerschaft; darüber hinaus erwarten wir von ihr, dass sie als Allheilmittel gegen existenzielle Vereinzelung wirkt. Wir betrachten unseren Partner oder unsere Partnerin als ein Bollwerk gegen die Wechselhaftigkeit des modernen Lebens. Nicht, dass unsere Unsicherheit größer wäre als in früheren Zeiten – im Gegenteil. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass uns das moderne Leben von traditionellen Ressourcen abgeschnitten und eine Situation geschaffen hat, in der wir bei einer einzigen Person jenen Schutz und emotionalen Halt suchen, der früher durch ein differenziertes Netz sozialer Beziehungen gewährleistet wurde. Heutzutage sind die intimen Beziehungen unter Erwachsenen überfrachtet mit Erwartungen.
Wenn Adele den Zustand ihrer Ehe beschreibt, denkt sie natürlich nicht an jene besagte Angst. Ich glaube allerdings, dass die Gefahren der Liebe unter dem Einfluss dieser modernen Grundstimmung deutlicher hervortreten. Wir leben zumeist weit entfernt von unseren Familien, haben unsere Freunde der Kindheit aus den Augen verloren und sind mehr oder weniger entwurzelt. Alle diese aufgelösten Zusammenhänge haben einen kumulativen Effekt. Wir belasten unsere romantischen Beziehungen mit einem kaum erträglichen Gefühl von existenzieller Verwundbarkeit – als wäre die Liebe an sich nicht schon gefährlich genug.
EINE MODERNE LIEBESGESCHICHTE:
Kurzfassung
Von der Alchimie der Attraktion betört, lernen Sie jemanden kennen. Es ist ein unerwarteter, aber willkommener Zwischenfall. Sie sind erfüllt von einem Gefühl der Hoffnung und wähnen sich aus Ihrem Alltag hinausgehoben in eine Welt der Emotion und Verzauberung. Von Liebe beseelt, fühlen Sie sich stark. Sie genießen den Rausch und wollen daran festhalten. Aber Sie haben auch Angst. Je mehr Sie sich dem anderen zuneigen, desto mehr haben Sie zu verlieren. Darum schicken Sie sich an, die Liebe abzusichern. Sie versuchen, sie verlässlich zu machen, und gehen erste Verpflichtungen ein. Bereitwillig tauschen Sie einen kleinen Teil Ihrer Freiheit gegen ein weniges Mehr an Stabilität. Sie schaffen Annehmlichkeiten – Rituale, Kosewörter –, die das Bedürfnis nach Bestätigung erfüllen. Ihre anfänglichen Hochgefühle waren jedoch nicht zuletzt auf ein gewisses Maß an Ungewissheit zurückzuführen, und indem Sie nun davon loszukommen versuchen, beschneiden Sie die Vitalität Ihrer Beziehung. Sie erfreuen sich an der behaglichen Verlässlichkeit, beklagen aber das aufkommende Gefühl von Gebundenheit und den Mangel an Spontaneität. In Ihrem Versuch, die Risiken zu kontrollieren, ist Ihnen die Leidenschaftlichkeit abhandengekommen. Von nun an stellt sich eheliche Langeweile ein.
Liebe verspricht, uns vom Alleinsein zu befreien; gleichzeitig aber lässt sie uns abhängiger werden von einer Person. Liebe ist von Natur aus verwundbar. Wir neigen dazu, unsere Ängste mit Kontrollversuchen zu besänftigen, und fühlen uns sicherer, wenn es uns gelingt, die Distanz zum Partner zu verringern, Gewissheit zu maximieren, Gefahren zu minimieren und alles Unbekannte auf Abstand zu halten. Manche von uns setzen sich derart eifrig gegen die Unwägbarkeiten der Liebe zur Wehr, dass sie sich um ihren Reichtum bringen.
In lang andauernden Beziehungen macht sich die Tendenz bemerkbar, das Vorhersehbare dem Unvorhersehbaren vorzuziehen. Erotik aber lebt vom Unvorhersehbaren. Lust verträgt sich nicht mit Gewohnheit und Wiederholung. Sie ist unbändig und trotzt allen Versuchen der Kontrolle. Wie sollen wir damit umgehen? Auf Verlässlichkeit möchten wir nicht verzichten, denn davon hängt unsere Beziehung ab. Ein Mindestmaß an physischer und emotionaler Sicherheit ist für unser Wohlbefinden unerlässlich. Doch ohne ein Element von Ungewissheit gibt es kein Sehnen, keine Vorfreude, keinen Nervenkitzel. Der Motivationsforscher Anthony Robbins erklärt kurz und bündig, dass die Leidenschaftlichkeit in einer Beziehung dem zugelassenen Maß an Ungewissheit proportional entspricht. 5
MIT NEUEN AUGEN
Wie lässt sich diese Ungewissheit in unsere intimen Beziehungen integrieren? Auf welche Weise können wir dieses fragile Ungleichgewicht herstellen? Die Frage erübrigt sich, denn es ist tatsächlich immer schon da. Philosophen des Ostens wissen seit Langem, dass Unbeständigkeit das einzig Konstante ist. Angesichts der Vergänglichkeit des Lebens und seines permanenten Wandels wäre es geradezu arrogant anzunehmen, dass wir unsere Beziehungen auf Dauer anlegen und absichern könnten. Von Woody Allen stammt der treffende Ausspruch: »Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen.« Nichtsdestotrotz machen wir uns im blinden Vertrauen auf den Weg. Als loyale Bürger unserer modernen Welt glauben wir unbeirrt an unsere eigene Effizienz.
Wir vergleichen die Leidenschaftlichkeit zu Beginn einer Liebesbeziehung gern mit jugendlicher Schwärmerei und unterstellen ihr damit, dass sie sowohl flüchtig als auch unrealistisch ist. Als Trost für ihre Preisgabe erwarten wir Sicherheit. Doch ist der Tausch von Leidenschaftlichkeit gegen Sicherheit am Ende nicht bloß ein Handel mit Zitronen? Mitchell weist darauf hin, dass die Vorstellung von Dauer die Vorstellung von Leidenschaftlichkeit zwar übertrumpfen mag, beide aber lediglich Produkte unserer Fantasie sind. 6 Wir sehnen uns nach Konstanz, werden aber, auch wenn wir uns noch so sehr dafür einsetzen, nie eine Garantie dafür erhalten. Wenn wir lieben, riskieren wir immer auch die Möglichkeit des Verlusts – durch Kritik, Ablehnung, Trennung und letztlich den Tod. Ungewissheit zuzulassen erfordert manchmal nicht mehr als die Preisgabe der Illusion von Sicherheit. Wenn wir diesen Wahrnehmungswechsel vollziehen, erkennen wir das unabdingbar Geheimnisvolle an unserem Partner.
Ich mache Adele darauf aufmerksam, dass es uns nur dann gelingen kann, ein und dieselbe Person über längere Zeit mit Lust zu begehren, wenn wir es fertigbringen, auch in vertrauter Umgebung einen Sinn für das Unbekannte zu entwickeln. Oder, um mit Proust zu sprechen: »Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern mit neuen Augen zu sehen.« 7
Adele erinnert sich, die Wirkung eines solchen Perspektivenwechsels schon einmal erfahren zu haben. »Es ist gut zwei Wochen her und war so ungewöhnlich, dass ich die Situation noch deutlich vor Augen habe«, berichtet sie. »Wir nahmen an einem Arbeitstreffen teil. Alan unterhielt sich mit irgendwelchen Kollegen. Ich sah ihn an und dachte: Mann, ist der aber attraktiv. Und wissen Sie, was ich so attraktiv an ihm fand? Für einen Moment lang vergaß ich, dass ich mit ihm verheiratet bin, dass ich mich immer wieder über ihn und seine unerträglichen Macken ärgere. In diesem Moment sah ich ihn wie einen Fremden und fühlte mich spontan zu ihm hingezogen, genauso wie zu Anfang. Er ist sehr gescheit, äußerst redegewandt und wirkt ausgesprochen sexy auf mich. All die albernen Streitereien waren ausgeblendet, seine Vorhaltungen, warum ich mir meine Zeit nicht besser einteilen könne, wieso ich dies oder jenes getan hätte, der Ärger um die Planung für Weihnachten oder das überfällige Gespräch mit meiner Mutter – von diesem ganzen absurden Gezänk war ich meilenweit entfernt. Ich sah nur ihn und war angetan. Jetzt frage ich mich, ob er mir gegenüber jemals wieder ähnliche Gefühle aufbringen könnte.«
Als ich Adele frage, ob sie mit Alan über diese Erfahrung gesprochen hat, beeilt sie sich zu verneinen. »Um Himmels willen, er würde sich nur lustig über mich machen.« Ich gebe ihr zu bedenken, dass das Verschwinden von Romantik womöglich weniger mit zunehmender Vertrautheit – nicht zuletzt im Hinblick auf die Beschwernisse der Realität – zu tun habe als mit schlichter Angst. Erotik ist riskant. Wir scheuen davor zurück, den Partner, mit dem wir zusammenleben, zu idealisieren und für ihn zu schwärmen. In solchen Momenten vermittelt sich uns eine Ahnung von Souveränität, die destabilisierend wirkt. Wenn wir unseren Partner auf sich allein gestellt sehen, von seinem eigenen Willen bewegt und in seiner ganzen Freiheit, spüren wir, wie delikat unsere Verbindung ist. Adeles Verletzlichkeit zeigt sich gerade darin, dass sie sich fragt, ob Alan ähnlich empfinden könnte, was sie betrifft.
Um Bedrohungen dieser Art abzuwehren, ziehen wir uns typischerweise in den Bereich des Vertrauten zurück – auf die kleinen Streitigkeiten, auf das übliche Geplänkel im Bett und den Alltag, der uns an unsere Wirklichkeit bindet und jegliche Chance auf Transzendenz vereitelt. In dem Moment aber, da Adele ihren Mann losgelöst vom Kontext ihrer Ehe betrachtet – also sozusagen nicht mehr unter dem Vergrößerungsglas, sondern durch ein Weitwinkelobjektiv –, zeigt sich seine Andersartigkeit, die ihn für Adele anziehend macht. Sie sieht ihn als Mann. Sie hat das vertraute Gegenüber in eine Person verwandelt, der selbst nach all den Jahren des Zusammenseins etwas Unbekanntes anhaftet.
KAUM HAST DU GEGLAUBT, SIE ZU KENNEN&nsbp;;…
Nicht nur das Merkmal der Ungewissheit ist allen Beziehungen eigen, sondern auch das des Geheimnisvollen. Viele Paare, die in meine Sprechstunde kommen, glauben, dass sie den Partner von Grund auf kennen. »Mein Mann redet nicht gern.« »Meine Freundin würde nie mit einem anderen Mann flirten. Dazu ist sie nicht der Typ.« »Mein Schatz hält nichts von Therapie.« »Ich weiß, was du denkst. Warum sprichst du es nicht aus?« »Ich brauche sie nicht mit Geschenken zu verwöhnen; sie weiß, dass ich sie liebe.« Ich versuche, ihnen klarzumachen, dass sie nur wenig wahrgenommen haben, und fordere sie auf, neugieriger zu sein und einen Blick hinter die Fassade des anderen zu werfen.
Tatsächlich wissen wir vom Partner weniger, als wir glauben. Mitchell macht darauf aufmerksam, dass es selbst in den langweiligsten Ehen unmöglich ist, verlässliche Prognosen zu stellen. Unser Wunsch nach Beständigkeit limitiert unsere Bereitschaft, die Person an unserer Seite wirklich kennenzulernen. Stattdessen sind wir darauf aus, sie mit jenem Bild in Übereinstimmung zu bringen, das wir uns nach Maßgabe unserer Bedürfnisse von ihr gemacht haben. »Er ist absolut furchtlos und steht wie ein Fels in der Brandung. Ich dagegen bin schrecklich neurotisch.« »Er würde mich nie verlassen, dazu fehlt ihm der Mumm.« »Sie lässt sich auf meine idiotischen Probleme gar nicht erst ein.« »Wir sind beide sehr konservativ. Sie hat zwar promoviert, bleibt aber viel lieber zu Hause bei den Kindern.« Wir sehen, was wir zu sehen wünschen oder akzeptieren können. Dadurch, dass wir von der Vielschichtigkeit des anderen absehen, bietet sich uns die Möglichkeit, seine Andersartigkeit gewissermaßen in den Griff zu bekommen. Wir nehmen nur Ausschnitte des Partners wahr und ignorieren solche Merkmale, die die bestehende Ordnung unserer Verbindung bedrohen. Gleichzeitig beschneiden wir uns auch selbst und verleugnen der Liebe wegen große Teile unserer Persönlichkeit.
Wenn wir uns und unsere Partner auf diese Weise zurechtstutzen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Leidenschaft in die Binsen geht. Und das betrifft leider beide Seiten. Mit dem Verlust der Leidenschaft ist kein bisschen mehr Sicherheit dazugewonnen. Die Fragilität eines solchermaßen hergestellten Gleichgewichts wird offensichtlich, wenn einer der beiden Partner die vereinbarten Regeln verletzt und darauf besteht, mehr authentische Teile seiner selbst in die Beziehung einzubringen.
Genau dazu kam es im Fall von Charles und Rose. Sie sind seit fast vierzig Jahren verheiratet und hatten viel Zeit, sich gegenseitig gewisse Eigenschaften zuzuschreiben. Charles ist ausgesprochen lebhaft, ein Provokateur und neckischer Verführer. Als überaus leidenschaftlicher Mensch braucht er jemanden, der ihm hilft, seine Energien zu zügeln. »Wenn ich Rose nicht hätte, wäre ich in meinem Beruf wahrscheinlich nicht so weit gekommen und stünde heute ohne Familie da«, sagt er. Rose ist beherrscht, unabhängig und klarsichtig. Ihre natürliche Gelassenheit bringt ihn in seiner Maßlosigkeit immer wieder auf die Spur. Beide stimmen darin überein, dass sie die Solide sei, er der Luftikus. Vor ihrer Ehe mit Charles hatte sich Rose einige wenige Male auszutoben versucht, was ihr aber nicht gut bekommen war. Charles repräsentiert für sie jene Leidenschaftlichkeit, an der es ihr mangelt. Rose fürchtet den Verlust von Kontrolle, während Charles Angst davor hat, den Kontrollverlust allzu sehr zu genießen. So ergänzen sich beide auf eine Weise, die ihrer Beziehung innerhalb klar abgesteckter Grenzen bislang zugutekam.