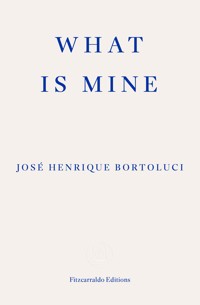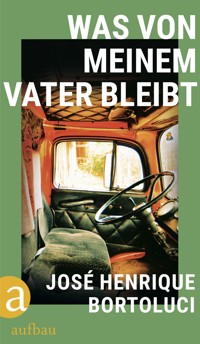
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Überraschungserfolg aus Brasilien – eine umwerfende Vater-Sohn-Geschichte
Was der Familie bleibt, sind nur zwei Postkarten und ein paar vergilbte Rechnungen. Fünfzig Jahre lang hat Didi, der Vater von José Henrique Bortoluci, als LKW-Fahrer in Brasilien gearbeitet und Hunderttausende von Kilometern zurückgelegt, immer auf der Straße, immer allein, weit weg von der Familie. In diesem Buch lässt Bortoluci seinen Vater erstmals von seinen Erlebnissen erzählen. Er schafft das Porträt eines einfachen Mannes, der den Bau der Transamazônica, die Abholzung des Regenwalds, den rasanten Ausbau des Landes und die Spuren des vermeintlichen Fortschritts erlebt hat. Die Strecke, die Didi mit dem LKW zurücklegt, ist dabei auch die Kluft, die sich zwischen seinem Leben und dem seines Sohnes, dem der soziale Aufstieg gelingt, auftut. Eine berührende Hommage an die Beziehung von Vater und Sohn, und an ein Leben, das bleibt.
„Vor dem Hintergrund der sozialen und politischen Geschichte Brasiliens zeichnet der Autor José Henrique Bortoluci das Leben seines Vaters nach, der als Lkw-Fahrer tätig war. Gleichzeitig analysiert er seinen eigenen Weg als Aufsteiger in eine andere soziale Klasse. Ein großartiges Buch.“ Didier Eribon.
»Eine herausragende Geschichte über Männlichkeit, Vaterschaft und über den sozialen Aufstieg von Bortoluci, dem Sohn von Eltern, die keinen Zugang zu Bildung hatten.« Folha de S. Paulo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Was der Familie bleibt, sind nur zwei Postkarten und ein paar vergilbte Rechnungen. Fünfzig Jahre lang hat Didi, der Vater von José Henrique Bortoluci, als Lkw-Fahrer in Brasilien gearbeitet und Hunderttausende von Kilometern zurückgelegt, immer auf der Straße, immer allein, weit weg von der Familie. In diesem Buch lässt Bortoluci seinen Vater erstmals von seinen Erlebnissen erzählen. Er schafft das Porträt eines einfachen Mannes, der den Bau der Transamazônica, die Abholzung des Regenwalds, den rasanten Ausbau des Landes und die Spuren des vermeintlichen Fortschritts in Brasilien erlebt hat. Die Strecke, die Didi mit dem Lkw zurücklegt, ist dabei auch die Kluft, die sich zwischen seinem Leben und dem seines Sohnes, dem der soziale Aufstieg gelingt, auftut. Eine profunde Reflexion, wie wichtig Familie und Herkunft für unsere Identität sind und eine berührende Hommage an die Beziehung von Vater und Sohn.
Über José Henrique Bortoluci
José Henrique Bortoluci, geboren 1984, stammt aus einer einfachen Familie. Aufgewachsen in Jaú, Brasilien, studierte er Soziologie in São Paulo und promovierte an der University of Michigan. Seit 2015 unterrichtet er an der Getúlio Vargas Foundation in São Paulo. Sein Debüt über seinen Vater erscheint in zehn Sprachen.
Maria Hummitzsch übersetzt Literatur aus dem Englischen und Portugiesischen, u. a. von Honorée Fanonne Jeffers, David Garnett und Carola Saavedra.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
José Henrique Bortoluci
Was von meinem Vater bleibt
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Maria Hummitzsch
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Zitat
Erinnern und Erzählen
Jetzt kennst du deine Geschichte
Der Wunsch zu sehen
Nestor
Nichts als töten
Manelão
Diese Leute
Jaques
Fahrersitz
Was mein ist
Dank
Impressum
Es gibt keinen Text ohne Filiation.
Roland Barthes
In jedem Fall wünschen wir uns für Brasilien ein Wunder über acht Millionen Kilometer.
Graciliano Ramos
Erinnern und Erzählen
Daran, dass mein Vater für mich nichts war als zu viel Abwesenheit. Und der Fluss … Fluss … Fluss … in einem fort.
João Guimarães RosaDas dritte Ufer des Flusses
Denk dran, dass dein Vater mitgeholfen hat, diesen Flughafen zu bauen, damit du fliegen kannst. Diesen Satz meines Vaters bekomme ich jedes Mal zu hören, wenn ich am Flughafen Guarulhos einen Flieger besteige. Und ich denke jedes Mal daran, aber es zu begreifen, hat eine Weile gedauert. Der Fernfahrervater besucht sein Zuhause, seine Frau und seine Kinder. Er kommt, fährt aber bald wieder los. Er und sein Lkw, ein Paar, fast schon ein einziges Ding, das zu viel war und zu wenig, beständig und flüchtig. Als kleiner Junge wollte ich, dass sie blieben, dass sie wegfuhren, wollte ich mit ihnen fahren.
Diesen Satz wiederholte er auch an dem Tag im August 2009, als ich in die USA flog, um meinen Doktor in Soziologie zu machen, und wir auf dem Weg zu besagtem Flughafen waren. In den Monaten, in denen ich mich auf diesen Umzug vorbereitete, zeigte ich ihm den Bundesstaat Michigan wiederholt auf der Landkarte. Wir errechneten die Entfernung zwischen Jaú und Ann Arbor, wo ich die kommenden sechs Jahre leben würde. Mein Vater versteht nichts von der Welt der Universitäten, er beherrscht weder die Terminologie noch die akademischen Gepflogenheiten. Er hat eine vage Vorstellung davon, was es heißt, einen Doktor zu machen. Von Entfernungen jedoch versteht er etwas.
Achttausend Kilometer trennen die beiden Städte. Diese Zahl beeindruckte ihn nicht. In fünf Jahrzehnten im Lkw hatte er diese Entfernung Hunderte Male zurückgelegt. Einmal bat er mich darum zu errechnen, wie viele Male man mit der Strecke, die er mit dem Lkw bewältigt hatte, die Erde umrunden könnte.
Kommt man damit bis zum Mond?
In der Vorstellung meines Vaters ist eine Lkw-Reise von der Erde bis zum Mond konkreter als mein Leben als Akademiker, Dozent und Autor.
Wörter sind Straßen. Mit ihnen verbinden wir die Punkte zwischen der Gegenwart und einer Vergangenheit, zu der wir keinen Zugang mehr haben.
Wörter sind Narben, die Überreste unserer Erfahrungen beim Zuschneiden und Zusammennähen der Welt, beim Zusammenflicken ihrer Teile, beim Zusammenklammern dessen, was auseinanderzureißen droht.
Wörter waren die Geschenke, die mir mein Vater in meiner Kindheit in seinem Lkw mitbrachte. Sie existierten für sich – Fahrersitz, Transamazônica, Lkw, Fernstraße, Amazonaswelle, Belém, Heimweh –, oder fügten sich zu Geschichten über eine Welt zusammen, die mir viel zu groß erschien. Ich musste sie mir in all ihren Farben ausmalen, sie mir einprägen und mich an ihnen festhalten, denn bald würde mein Vater erneut wegfahren und erst vierzig, fünfzig Tage später wiederkommen.
Die meisten dieser Geschichten waren Rekonstruktionen von Ereignissen, die er auf der Straße gesehen oder gehört hatte. Andere waren Fantasiegebilde: die spektakuläre Jagd auf einen Riesenvogel im Amazonas, die Legende von einem Schafbock, den er auf einer Fernstraße aufgegabelt und als Begleiter mitgenommen hatte, die Reisen über die bolivianische Grenze mit Hippiegruppen in den Siebzigern. Viele von ihnen waren wahrscheinlich eine Mischung aus Fakten und Phantasie. Er beschreibt detailliert das Auftauchen eines UFOs auf einer Straße in Mato Grosso, Nächte in abgelegenen indigenen Dörfern, Zusammenstöße mit bewaffneten Soldaten und heldenhafte Rettungen von Lkws, die in Schluchten gestürzt waren.
Mein Vater heißt José Bortoluci. In Jaú nennen ihn alle Didi, aber auf der Straße war er Jaú. Geboren wurde er im Dezember 1943 als fünftes von neun Kindern im ländlichen Teil einer Kleinstadt im Inland von São Paulo.
Mein Vater besuchte die Schule bis zur vierten Klasse, arbeitete ab seinem siebten Lebensjahr auf dem kleinen Bauernhof seiner Familie und zog mit fünfzehn mit ihr in die Stadt. Als er Fernfahrer wurde, war er gerade einmal 22 Jahre alt. Ich war jung, aber mutig wie ein Löwe. 1965 fing er mit dem Lkw-Fahren an, und 2015 ging er in Rente. Das Land, das er durchquerte und aufzubauen half, war damals ein anderes, fühlt sich in den letzten Jahren aber bekannt an: ein von der Logik der Grenze beherrschtes Land, von der Expansion um jeden Preis, der »Kolonisierung« neuer Territorien, der Umweltzerstörung, einer Gesellschaft der immer größeren Ungleichheit. Die Straßen und Lkws nehmen einen wesentlichen Platz in dieser Vorstellung von einer fortschrittlichen Nation ein, in der Wälder und Flüsse Fernstraßen, Minen, Weideflächen und Kraftwerken weichen.
Beladen war der Lkw mit meinem Vater, schmutziger Wäsche und wenig Geld. Meine Mutter war verzweifelt und füllte zwei Rollen aus: versorgte ihre Kinder und nähte für andere.
Ich bin der Älteste. Ich verstand sehr früh, dass unser Familienleben von den Risiken extremer Armut, galoppierender Inflation und früh einsetzender Krankheit überschattet war.
Wir gewöhnten uns daran, in einem Zustand der Ungewissheit zu leben, mit dem Druck offener Rechnungen und innerhalb der unmittelbaren Grenzen dessen, was wir essen, erleben und uns wünschen konnten. Hungern mussten wir nie, in manchen Zeiten, weil Nachbarn, Freunde und Verwandte uns halfen, wenn das Familieneinkommen zur Neige ging und die finanziellen Forderungen an meinen Vater ihren Höchststand erreichten. »Aber ich lernte einen Halbhunger kennen, wie man ihn beim Duft des Mittagessens spürt, der durch die Türen der Bessergestellten dringt«, wie ihn die dänische Autorin Tove Ditlevsen in »Kindheit« beschreibt, und ich weiß noch, wie ich mich an ihn gewöhnte. Ein drängender Halbhunger, den wir für gewöhnlich verachten und dem wir die irreführende Bezeichnung »Appetit« gegeben haben. In meinem Fall wurde dieses Gefühl von der Werbung für zuckerhaltige Joghurts und Cerealien befeuert, die in den Achtzigern und Neunzigern das Fernsehen überschwemmte und bis heute wie ein klangloses Echo jener vergangenen Sehnsüchte lästige Gelüste in mir auslöst.
Ein Großteil der Kleidungsstücke, die mein Bruder und ich in den ersten zwanzig Lebensjahren trugen, waren gebraucht, von einem Onkel oder einer Tante gespendet, oder aber in »Second Hand Shops« gekauft. Meine Mutter, die als Schneiderin arbeitete, um zu den Haushaltseinnahmen beizutragen, sorgte dafür, dass sie umgenäht und tadellos sauber waren. Die neueren waren »für den Gottesdienstbesuch«, die älteren für den Gebrauch unter der Woche.
Unser Haus war klein und stickig, nach und nach an die Rückseite des Hauses meiner Großeltern gebaut worden. Die offene Küche stand bei jedem stärkeren Regen unter Wasser. In diesem Raum lernten mein Bruder und ich für die Schule, und meine Mutter arbeitete dort den ganzen Tag. Die Klangkulisse in diesem Haus bildete das Nähmaschinenrattern und das auf irgendeinen Lokalsender eingestellte Radio meiner Mutter. Viel Arbeit, wenig Geld und keine Zeit, die Fäden des gewebten Tuchs wieder aufzutrennen: in dieser Geschichte gibt es keinen Odysseus und keine Penelope.
Meine Mutter hasste es, wenn mein Vater im Haus rauchte. Darum verbrachte er, wenn er in Jaú war, viel Zeit auf einer Treppenstufe von der Küche in den kleinen Hof, den wir uns mit meinen Großeltern mütterlicherseits teilten. Diese Stufe, ein begrenzter Raum zwischen Innen und Außen, verkörperte den unklaren Status, den mein Vater für mich besaß. Ein Mann, den ich als festen Teil meines Lebens ansah und zugleich als sporadischen Gast, der den Rhythmus unserer Tage störte.
Die finanziellen Forderungen an ihn hörten nie auf. Bei uns zu Hause hing ein stiller Schrecken in Verbindung mit dem Wort »Überziehungskredit« in der Luft, das ich wahrscheinlich schon in meinen frühen Lebensjahren lernte. Und mehr als alles andere mit »Schulden«: ein Würgemale auslösendes Wort, das sich wie Zigarettenrauch in den Zimmern ausbreitete. Dieses Wort kam mit dem Lkw und blieb auch nach der Abreise meines Vaters zurück. Bis heute ruft das Wort »Schulden« Erinnerungen an den Geruch von Zigaretten und das Bild jener Treppenstufe im Haus meiner Eltern wach.
Es gibt so gut wie keine schriftlichen Zeugnisse aus diesen fünfzig Jahre auf der Straße – nur zwei Postkarten an meine Mutter und einige vergilbte Rechnungen in einer Schublade. Doch mein Vater erinnert sich an vieles, und seine »Madeleines« tauchen vor allem dann auf, wenn man sie am wenigsten erwartet: ein Bild im Fernsehen erinnert ihn daran, wie er einmal tagelang ohne Essen auf einer schlammigen Straße im Süden von Pará feststeckte; jede Radiomeldung von einem schweren Verkehrsunfall öffnet eine Schachtel voller Geschichten von den vielen Unfällen, die er gesehen, und der Handvoll, an denen er selbst beteiligt war; Geschichten von Dörfern, Jägern, fernen tropischen Landschaften und von Gefährten – manche von ihnen loyal, andere nicht, die meisten verstorben. Erzählungen, die vorüberziehen und sich ohne Untermauerung von Fotos oder Aufzeichnungen neu zusammensetzen. Was bleibt, sind die Erinnerungen eines beinah Achtzigjährigen, durch die Zeit schon ein wenig trüb.
Ach, Junge, ich habe so viel gesehen. Ich hätte Fotos machen, was aufschreiben sollen. Aber ein Handy oder so was hatte ich nicht. Gab es nicht. Fotografieren konnte man damals nur mit einer Kodak, diesen Schwarz-Weiß-Dingern, aber so eine habe ich nie gehabt. Wenn ich alles festgehalten hätte, was ich gemacht habe, würdest du platzen vor Stolz. Parat habe ich das, was ich gesehen und abgespeichert habe. Darum versuch ich es einfach mit Erinnern und Erzählen.
Auch Fotos, auf denen mein Vater zu sehen ist, gibt es nur wenige aus diesen fünfzig Jahren, und nur zwei oder drei stammen von seinen Reisen. Die meisten zeigen Familienfeste in Jaú.
Auf einer dieser Aufnahmen sieht man uns beide in der Küche unseres Hauses. Es ist mein erster Geburtstag im November 1985. Mein Vater hält mich hoch, während Cousins und Cousinen rings um den Kuchen stehen und ein Geburtstagslied für mich singen. Bunte Luftballons, blaue Plastikbecher und eine Glasflasche Coca-Cola bilden die Kulisse. Er hält mich gut fest, und es wirkt, als würde ich ihm vertrauen; ich halte mich aufrecht, berühre nur mit den Spitzen meiner winzigen roten Turnschuhe den Tisch. Ich schaue in die Kamera, die Augen weit aufgerissen und wach, und er schaut zu mir. Meine Haare waren heller als heute, und seine hatten noch nicht ihre Farbe verloren: sie sind nach hinten gekämmt, lang, glänzend und fettig von Trim, dem Haaröl, das er jahrzehntelang verwendet hat, bis er vor Kurzem beschloss, dass er damit aufhören und die Haare kurz tragen würde – der gleiche Schnitt wie mein Großvater im Alter. Meine kleinen blassen Hände liegen auf der sonnengegerbten Haut meines Vaters, gezeichnet von der für Lkw-Fahrer typischen ungleichmäßigen Bräune, die sich bis heute hält, auch wenn seine Haut bleicher geworden und von Flecken und Narben übersät ist. Die eine kleine Hand auf seinem Arm, die andere auf den Fingern einer der beiden Hände, die mich halten. Es ist eines der wenigen Bilder ohne meine Mutter darauf (hat sie das Foto vielleicht gemacht?).
Wenige Tage nach dem Fest kehrte mein Vater auf die Straße zurück und kam erst Wochen später wieder nach Jaú, vielleicht zu Weihnachten oder zur Geburt meines Bruders sechs Wochen darauf. In einem Tagebuch, das meine Mutter jahrelang führte, vom Anfang der Beziehung mit meinem Vater im Jahr 1976 bis kurz nach meiner Geburt, beschreibt sie die aufgrund der Entfernung zerfaserte Zeit: »Didi, ich liebe dich so sehr und würde es dir Millionen Mal sagen, wenn du jeden Tag hier bei mir wärst. Aber ich weiß ja, dass das unmöglich ist, weil ich arbeiten muss und du auch, bis wir unser Ideal erreicht haben. Mit der Entfernung kommt die Sehnsucht, aber nie das Vergessen.«
Ich weiß nicht, was dieses Ideal ist, von dem sie spricht, und ob es sich heute so anfühlt, als hätte sie es erreicht. Dieser Eintrag stammt vom 3. Juni 1976, aber der Ton dieser Zeilen wiederholt sich im Laufe der nächsten neun Jahre etliche Male.
Als mein Vater wegen des zusammengebrochenen Gesundheitssystems in der Region Jaú, einer der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen zu Beginn dieses traurigen Starts in das Jahr 2021, isoliert zu Hause saß, schien er sich darauf zu freuen, seine Geschichten zu erzählen. Im Januar desselben Jahres begann ich damit, sie bei aufeinanderfolgenden Besuchen aufzunehmen, immer an warmen Abenden nach dem Essen. Er führte diese Gespräche mit mir am liebsten im Hof, in einer alten Hängematte liegend, die er in den Siebzigern in einer Stadt in Piauí gekauft und jahrzehntelang auf Reisen genommen hatte.
Dieses Gespräch, das wir hier führen, mein Junge, das bleibt dir als Erinnerung, weil du weißt ja, dass dein Vater bald geht..
Nach einer dieser Aufnahmen fragte er sich laut, ob er es noch schaffen würde, das Buch veröffentlicht zu sehen. Diese Frage habe ich mir seit Dezember 2020 auch gestellt, als er mir zum ersten Mal von seltsamen Unterleibschmerzen und dem seit einigen Wochen auftretenden Blut im Stuhl erzählte.
Während ich Anfang des Jahres 2021 diese Zeilen schrieb, begann mein Vater mit 78 eine Darmkrebs-Behandlung. Der Tumor in seinem Körper wuchs, befiel unser Familienleben und schaffte es bis in dieses Buch.
Am 29. Dezember 2020 wurde der Krebs diagnostiziert, noch bevor ich mit einer Reihe von Interviews mit ihm begann, aber nachdem ich ihm bereits gesagt hatte, dass ich Gespräche zwischen uns aufzeichnen wolle, um ihn von der Straße erzählen zu hören, von den Geschichten seines Lebens, seinen »Abenteuern«, seinen Erinnerungen und was er sonst noch zu sagen habe.
Als ich das erste Mal erwähnte, dass ich an einem Buch schreiben würde, fragte er mich, ob das gut für mich sei. Ich antwortete, ja, das dächte ich schon. Wenn es gut für dich ist, dann bin ich froh.
Am Tag vor der Diagnose hatte ich in São Paulo den gesamten Nachmittag Karten von Flüssen im Amazonas und Karten der Fernstraßen im Norden des Landes studiert. Ich las über Hochwasser – und Dürreperioden, die besten Zeiten für den Besuch der Flussstrände, das Segeln auf Nebenflüssen oder Abstecher in die umliegenden Wälder. Ich begann mit der Planung einer Reise entlang der gesamten Transamazônica (würde ich das hinbekommen, wo ich doch nicht Auto fahren kann?). Ich bestellte drei Karten der Region, und zwar diese großen zum Auseinander- und wieder Zusammenfalten, zusätzlich zu detaillierten Reiseführern und geographischen Karten der durch den Wald führenden Schnellstraßen, diese Asphaltungetüme, an deren Bau in dieser jahrzehntelang von ihm durchquerten Region mein Vater beteiligt war.
In derselben Nacht kam es in meiner Wohnung zu einem Rohrbruch. Das gesamte Bad stand unter Wasser, Teile der Küche, die Wäschekammer, der Eingangsbereich, und schon bald lief das Wasser auch aus der Wohnung heraus. Das bemerkte der Hausmeister des Gebäudes und rief mich aufgebracht an. Ich war nicht zu Hause, schaffte es jedoch schnell zurück. Das Wohnzimmer war am stärksten betroffen und vollständig mit einer dicken Schicht Flüssigkeit überzogen, eine Hand tief Wasser auf dem Holzfußboden, wie ein sanft schwingender Spiegel, der Lampen, Sessel, Pflanzen und auch mich reflektierte. Die kleine Wohnung im Zentrum von São Paulo, so ganz anders als das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, voller moderner Möbel, die es mir endlich ermöglichten, einen Ort zu schaffen, der das Zuhause eines Erwachsenen der Mittelschicht verkörperte, war vom Wasser verschluckt, das mir bis zu den Schienbeinen stand.
Ich spürte Aufregung und Angst. Das deplatzierte Wasser sah einfach zu schön aus, ein schlechtes Omen, als wäre es einem Kolonialroman von Marguerite Duras oder einem surrealistischen Gemälde entsprungen. Das Wasser lief mir in die Schuhe, durchtränkte meine Hosenbeine, die Kissen und Holzmöbel und drang in die zahlreichen kleinen Ritzen des Wohnzimmerparketts, das sich auf immer verzog. Im Schlafzimmer hatte sich meine Katze unter dem Bett versteckt, einem der wenigen vom Wasser verschonten Plätze.
Auch Krebs hat etwas Flutartiges: er besteht aus sich bewegender Materie, die sich unkontrolliert ausbreitet.
Am Tag darauf rief ich in Jaú an und fragte meine Mutter nach dem Befund der Darmbiopsie, den sie im Labor abgeholt hatten. Beim Ablesen der Diagnose verhaspelte sie sich. Sie buchstabiert das Wort lieber, und ich schrieb auf einen Zettel: A-d-e-n-o-k-a-r-z-i-n-o-m. Buchstabe für Buchstabe entstand das Wort, jeder Buchstabe eine Zelle, die sich mit einer anderen zu einem neuen Signifikanten verband, einer nicht zuordenbaren Masse Wort. Eine erste Googlesuche ergab, dass »Adenokarzinom« einen Tumor bezeichnet, der aus Drüsenepithelgewebe hervorgeht, im Falle meines Vaters dem des Enddarms. Es war das erste von vielen Wörtern, die in den kommenden Monaten Eingang in unser immer umfangreicher werdendes Familienlexikon fanden. Die Krankheit ist nicht nur ein biologisches Phänomen, sondern auch ein neues Reich der Wörter, ein Wust an Vokabeln und Ausdrücken, die unsere Alltagssprache bevölkern. Wir alle haben das in den vergangenen Jahren erlebt, als uns das Coronavirus dazu zwang, in ein Meer voller Terminologien wie »gleitender Mittelwert«, »Spike-Protein«, »Herdenimmunität«, »diagnostische Lücke« und anderer mehr einzutauchen. Im Fall meiner Familie waren wir zusätzlich von sich rasch vervielfältigenden Wörtern umgeben, die im Körper meines Vaters zirkulierten, sich mit ihm verbanden und ihm eine neue Form gaben.
Diesem Initialwort schlossen sich weitere an: »Stoma«, »Colostomie«, »Tumormarker«, »PET-CT«, »kolorektales Karzinom«. Und »bösartiges Neoplasma«, das grausamste Wort von allen, vielleicht weil es auf eine Art moralisches Drama verweist, oder vielleicht, weil es das aufrichtigste ist.
Bei meinen ersten Arztbesuchen erfahre ich schnell, dass sich das Tabu in Bezug auf das Wort »Krebs« nicht auf die Welt der Patienten und ihrer Angehörigen beschränkt. Ein aufmerksamer Beobachter müsste sich schon sehr anstrengen, um dem Wort in Berichten oder bei Untersuchungen, im Krankenhausalltag oder in Gesprächen mit Ärzten und Krankenschwestern zu begegnen. »Er hat diese schreckliche Krankheit« ist noch immer eine typische Formulierung, wenn wir uns auf dieses Übel beziehen, und schon mit wenigen angesammelten Lebensjahren versteht man, dass »diese schreckliche Krankheit« weder Grippe noch Cholera oder Lungenentzündung bedeutet. Das Beschweigen scheint die Krankheit noch lebendiger zu machen – durch das Unausgesprochene wissen wir alle, dass von Krebs die Rede ist.
Susan Sontag schrieb bekanntermaßen: »Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften, eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Und wenn wir alle es auch vorziehen, nur den guten Ruf zu benutzen, früher oder später ist doch jeder von uns gezwungen, wenigstens für eine Weile, sich als Bürger jenes anderen Ortes auszuweisen.« Die New Yorker Autorin erlebte diesen Zustand der zwei Zugehörigkeiten während ihrer Krebsbehandlungen und einer Reihe von Rezidiven in den letzten dreißig Jahren ihres Lebens.
Mein Vater reist nun mit diesem neuen Pass. Die Spuren, die er trägt, und die Rituale, denen er sich unterzieht – der dauerhafte Stomabeutel, das regelmäßige Entleeren der Blase mit einem Einmalkatheter – kennzeichnen seine Staatsbürgerschaft im Reich der Kranken.
In einem viel zitierten Dialog aus Fiesta von Ernest Hemingway erklärt ein Kriegsveteran und zahlungsunfähiger Ex-Millionär einem Freund, wie es zu seinem wirtschaftlichen Ruin gekommen ist:
»Wie bist du bankrottgegangen?
Auf zweierlei Weise. Erst schleichend und dann plötzlich.«
Nach den letzten zwei Jahren mit meinem Vater, habe ich gelernt, dass auch das Älterwerden diesen zweierlei Rhythmen gehorcht. Man altert schleichend: die Muskulatur baut ab, unbekannte Schmerzen treten auf, der Graue Star trübt allmählich die Sicht, das Gehör erfasst nicht mehr alle Frequenzen, vertraute Treppen verwandeln sich in olympische Hindernisse, Operationen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle im Bekanntenkreis beherrschen die Gespräche mit Gleichaltrigen.
Ebenso altert man plötzlich. Bei meinem Vater kam der große Sprung mit der Diagnose Darmkrebs und der darauffolgenden Behandlung.
Wenn man erst mal die vierzig erreicht hat, vergeht das Leben rasend schnell, aber seit ich von der Krankheit weiß, vergeht es wie im Flug.
»Schweres Herzleiden«, heißt es in den Krankenakten; »Ihr Vater ist ein komplizierter Fall«, sagen die ihn behandelnden Ärzte; »bei Ihnen haben wir weniger Behandlungsspielraum«, sagt der Onkologe in jedem Arztgespräch zu ihm.
Erinnerungen tauchen auf und gehen Verbindungen ein: Ihm wird bewusst, dass sowohl sein Vater als auch zwei seiner Brüder an Darmkrebs gestorben sind. Meine Großmutter Maria hat es auch gehabt. An dem Tag, an dem Brasília eingeweiht wurde, hat sie sich den Tumor wegoperieren lassen. Danach hat sie noch eine Weile gelebt. Ich glaube, sie ist an was anderem gestorben. Aber genau weiß ich es nicht.
Sein schwaches Herz hinderte die Ärzte daran, gleich zu Beginn der Behandlung eine Darmoperation durchzuführen und den Tumor zu entfernen. So jedenfalls sagte es uns einer der ersten Chirurgen, allerdings kamen uns die ärztlichen Empfehlungen selten schlüssig vor. Die Zweifel wurden zu einer Konstanten im Umgang mit der Erkrankung meines Vaters. Nie waren wir überzeugt