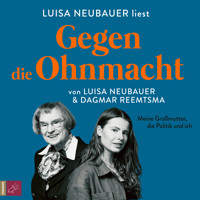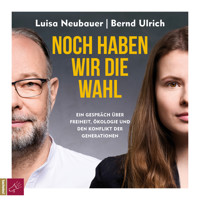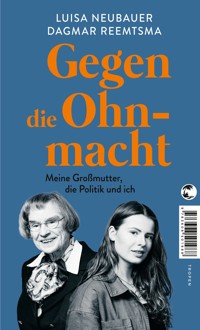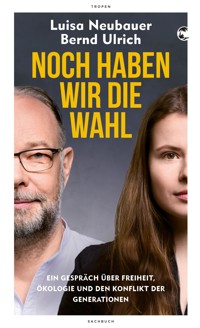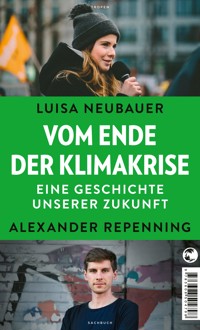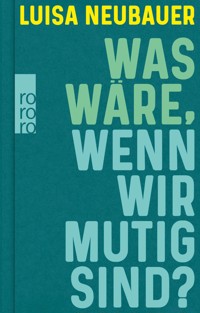
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie wächst Mut in harten Zeiten? Seit Jahren kämpfen Menschen um die künftige Bewohnbarkeit unseres Planeten. Luisa Neubauer ist eine von ihnen. Doch bis heute scheitert die Welt daran, den notwendigen Klimaschutz demokratisch zu organisieren. Warum passiert nicht mehr, obwohl die wissenschaftlichen Fakten schon lange bekannt sind? Woher kommt die Anti-Klima-Aggression der Rechten? Warum sorgen selbst die sichtbaren Klimakatastrophen nicht für ein gesellschaftliches Umdenken? Luisa Neubauer analysiert die Machtkämpfe hinter der Klimakrise, sie legt die fossilen Wurzeln unserer Demokratie frei und zeigt, wie eine realistische Utopie auf unserem Planeten aussehen kann. Dieses Buch ist ein Aufruf, zu intervenieren und unsere ökologischen Grenzen zu verteidigen. Eine Einladung, den Krisen in die Augen zu schauen. Und ein Plädoyer für die Hoffnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Luisa Neubauer
Was wäre, wenn wir mutig sind?
Vita
Luisa Neubauer, geboren 1996 in Hamburg, ist eine der weltweit bekanntesten Klimaaktivistinnen. Zuletzt erschien von ihr und Dagmar Reemtsma «Gegen die Ohnmacht» (2022). Seit 2020 hostet sie den Klimapodcast 1,5 Grad. Die Geografiestudentin lebt in Göttingen und Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-02040-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Teil IHoffnung in der Krise
Das Bücherregal
Wie viele meiner Geschichten beginnt auch diese mit meiner Großmutter. Während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich sie vor mir, am Herd in ihrer Küche, wie sie in den Töpfen rührt, energisch Petersilie hackt und zwischen dem Brodeln und Dampfen über die Weltpolitik referiert. Meine Großmutter ist seit Jahrzehnten aktiv, im Umwelt- und Klimaschutz, in Friedens- und Gerechtigkeitsfragen. Endlose Nachmittage haben wir über den Küchentisch hinweg diskutiert, zwischen Petersilienkartoffeln und Nachtisch mit zu viel Eierlikör. Uns gehen bis heute nicht die Gesprächsthemen aus. Für den Beginn dieser Geschichte ziehen wir ein Zimmer weiter, raus aus der Küche, durch die Holztür mit dem großen Glasfenster hindurch und links ein paar Stufen hinunter ins Wohnzimmer. Dann sieht man es sofort: das große Bücherregal. Wenn meine Großmutter und ich darauf blicken, dann seufzt sie, und manchmal fühlt es sich für mich an, als würden die Bücher mit ihr seufzen. Da steht sie, in mehr oder weniger ordentlichen Reihen und in absurder Vollständigkeit: die Klimaliteratur eines halben Jahrhunderts. Da findet sich «Small is beautiful. Die Rückkehr zum menschlichen Maß», erstmals 1977 auf Deutsch erschienen, «Haben oder Sein» von Erich Fromm, erschienen 1976[1], und auch: «Wir Klimamacher» von Hartmut Graßl aus dem Jahr 1990. Hinten im Buch sind Klimaschutz-Tipps für den Alltag aufgelistet: «Essen Sie weniger Fleisch!», steht da, oder auch: «Verzichten Sie auf unsinnige und überflüssige Produkte: Eine gute Übersicht bietet das Werbefernsehen, denn für die sinnlosen Güter muss die Industrie in einer Überflussgesellschaft den meisten Wirbel machen.»[2] Meine Großmutter zitiert diesen Satz oft und lacht dabei laut.
Wenn meine Großmutter seufzt, dann weil sie nicht fassen kann, wie die Dinge so schnell aus den Fugen geraten konnten.
Geht man von ihrem Bücherregal fünfzehn Kilometer Richtung Westen und dann noch mal achtzig Jahre in die Vergangenheit, trifft man auch auf meine Großmutter. Als Mädchen, im Nachkriegsdeutschland vor dem Kachelofen, in Wedel, Schleswig-Holstein. Es war kalt in diesem Winter 1945, meine Großmutter zählte nach, wie viele Kartoffeln noch da waren und für wie viele Mahlzeiten das noch reichen würde. Keine zehn Jahre später, im Wirtschaftswunder-Deutschland der 50er-Jahre, erlebte sie, wie alles anders wurde, in rasender Geschwindigkeit: die Autos größer, die Reisen länger und das Fleisch von der Ausnahme zur Regel.
Wiederum keine fünfundzwanzig Jahre später, Anfang der 70er, schlug die Welt meiner Großmutter vom Kartoffelzählen in die Maßlosigkeit um. Doch umgehend zeigte sich, dass das nicht gut gehen würde: Auf einmal, im Jahr 1972, lag sie auf dem Küchentisch, die Erstausgabe von «Die Grenzen des Wachstums»[3]. Kurz darauf zogen ihre vier Kinder aus, und meine Großmutter wurde Aktivistin. Nur dass man es damals nicht so nannte, sie war eine engagierte Bürgerin. Und das wollte sie auch sein. Auf die Demos nahm sie Hut und Handtasche mit, sie wollte zeigen: Für Ökologie und Gerechtigkeit setzen sich nicht nur linke Studierende ein, sondern auch diejenigen, die normalerweise nicht an der ökologischen Front erwartet werden – die Privilegierten.
Und für einen Moment schien es, als würde das alles aufgehen: Als hätte die Welt rechtzeitig verstanden, dass es so nicht weitergehen kann, mit immer mehr Zerstörung und Ausbeutung. Als hätte man verstanden, dass ein großes Unglück im Flur stand, ein menschengemachtes Ungetüm, das nur mit vereinten Kräften rechtzeitig besiegt werden konnte. Alles schien auf dem Tisch zu liegen, zu klar und zu deutlich, um nur eine Sekunde länger ignoriert zu werden: «Der von uns Menschen verursachte Treibhauseffekt droht […] die Bemühungen um wirtschaftliche Entwicklung, soziale Stabilität und Wohlstand zunichte zu machen. Klimaschutz ist eine gemeinsame Aufgabe der Zukunftssicherung. […] Wenn wir diese Verantwortung nun gegenüber unseren Kindern und kommenden Generationen vergessen würden, so wäre dies ein schlimmes moralisches Versagen.»[4] Das sagte nicht Robert Habeck beim Parteitag der Grünen, nein, das sagte CDU-Kanzler Helmut Kohl, und zwar im Jahr 1995 zur Eröffnung der ersten Weltklimakonferenz in Berlin. Zu der Zeit hatte meine Großmutter bereits Photovoltaikanlagen auf dem Dach.
Und heute? Heute erklärt der Klimaforscher Johan Rockström die Lage so: Von neun quantifizierbaren Erdsystemgrenzen seien sieben bereits überschritten.[5] Das heißt, dass ökologische Rückkopplungen erreicht werden, die in unkontrollierbare und unaufhaltsame Kettenreaktionen münden könnten. Dabei ist das Klima nur eine der planetaren Grenzen, die gefährdet sind, es geht wortwörtlich um alles – um die Menge verfügbaren Trinkwassers, die schwindende Fruchtbarkeit der Böden, die Durchsetzung der Umwelt mit Plastik, das Artensterben und vieles mehr.
Die Erderhitzung ist mittlerweile um 1,2 Grad Celsius angestiegen, das Jahr 2024 war wieder einmal das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen,[6] die ersten Lebensräume auf der Welt werden zurzeit unbewohnbar.
Das Bücherregal meiner Großmutter liest sich wie eine in Papierform gepresste Dokumentation eines unerklärlichen, unerträglichen, kollektiven Versagens. Die Studien, die Daten und Fakten liegen seit Jahrzehnten vor, ebenso wie Lösungsvorschläge und Konzepte für eine Verhinderung der schlimmsten Katastrophen. Jedenfalls in Grundzügen – Pläne zur Rettung der Ökosysteme, zur Beendigung der Ausbeutung des Planeten, zur Überwindung der globalen Ungleichheiten. Seit Jahrzehnten sammelt sich das Wissen im Wohnzimmer meiner Großmutter an, und selbst diese Bücher sind nicht mehr als ein Bruchteil der verfügbaren Literatur zu diesen Fragen. Mittlerweile nehmen die Regale eine vollständige Seite des Raumes ein. Wenn meine Großmutter und ich davorstehen, dann fühlt es sich an, als würde das Gewicht der Bücher längst nicht nur auf den Regalen lasten. Sondern auch auf unseren Schultern.
Toxische Beziehung
«‹Die Beeinträchtigung der Beziehung zur Welt› – so lautet die wissenschaftliche Definition von Wahn»,[7] schreibt Bruno Latour.
Die Wissenschaft hat dieses planetare Zerwürfnis in alle Sprachen und Tonlagen der Welt übersetzt, klargemacht, dass der Planet die Menschen überleben wird, wir ihn aber nicht. In historischer Deutlichkeit wird auf den weltweit größten Bühnen gewarnt. «Auf einem Highway in die Klimahölle»[8] seien wir, sagt UN-Generalsekretär António Guterres. Und wir? Wir nehmen uns umfänglich informiert an die Hand und marschieren los, schnurstracks in den Untergang.
Eine Weile lang wurde dieser Vorgang rationalisiert, etwa als Makroökonomen erklärten, dass ein Abwarten beim Klimaschutz sich lohnen werde, weil die Preise bestimmter Technologien absehbar fallen würden. Mehr noch, die Weltwirtschaft, so prominente Prognosen, könne von mehreren Graden Erwärmung sogar profitieren. Für diese Berechnung wurde William Nordhaus im Jahr 2018 mit einem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Kurze Zeit später wurden diese Ansätze von praktisch allen Seiten als falsch und ungenau kritisiert.[9]
Der Duden definiert Gaslighting als «Ausübung von psychischer Gewalt, durch die das Opfer manipuliert, desorientiert und in seiner Realitäts- und Selbstwahrnehmung stark verunsichert wird».[10] Die Welt bebt vor uns, brüllt uns praktisch an, macht es uns so leicht wie nie zu erkennen, dass da etwas nicht stimmt. Regierungen erklären jedoch, dass für das Klima jetzt keine Zeit sei, Ökonomen wie Nordhaus feuern das Brüllen zwecks Investitionspotenzial an, und auf YouTube meint irgendwer, es sei doch alles gar nicht so wild. Das, was vom Verhältnis der Menschen zur Welt noch übrig geblieben ist, erinnert an eine toxische Beziehung.
Vor fünfzig Jahren sang Gil Scott-Heron über den schwarzen Befreiungskampf «The Revolution Will Not Be Televised». Heute braucht es nicht mehr als einen rechten Daumen, um den Weltuntergang live auf unsere Couch zu holen. Der wird nämlich längst auf TikTok gestreamt, von strahlenden Influencer:innen etwa, die einen hochauflösenden Hot Girl Summer auf dem zelebrieren, was von den maledivischen Inseln übrig geblieben ist. Beim Schnorcheln zwischen den von uns zerkochten Korallen müssen wir stark sein – Leute, guckt euch das an, die Apokalypse zum Anfassen! Weinender Emoji, Gebrochenes-Herz-Emoji. Die gute Nachricht: Wer einen schnellen Daumen hat, kann später einen Rabattcode für eine All-inclusive-Reise zum selben Spot gewinnen. Für den ganz eigenen Fotomoment am Abgrund.
Wenn man uns später fragt, wo wir waren, als man die Katastrophe noch hätte aufhalten können, dann werden wir sagen müssen: Live dabei, gelangweilt in den Kommentarspalten.
Die Natur der Verzweiflung
Der Blick auf die Welt von heute und gestern kann einen in die Verzweiflung treiben. So geht es mir, wenn ich auf die Klimadaten blicke, wenn ich die toten Wälder sehe, wenn ich wieder einmal den Ausreden der Politik zuhöre. Und so fühlt sich meine Großmutter, wenn sie ratlos vor ihrem Bücherregal steht. Dabei geht es um weit mehr als die Bücher. Es geht um das Versprechen, das hinter dem angesammelten Wissen steht, ein Versprechen, das viel älter ist als die Bücher oder meine Großmutter oder der Klimadiskurs. Es ist das Versprechen einer Welt, die das blinde Hoffen ersetzen wollte: mit der Aufklärung und der westlichen Idee von Fortschritt. Vor rund dreihundert Jahren revolutionierten die Physik und die Philosophie, die Mathematik und die Kosmologie die menschliche Sicht auf die Welt – und sie wollten und konnten ersetzen, was einst einzig der Religion vorbehalten war. Der Zugang zu Erkenntnissen versprach den Menschen, nicht länger dem blinden Glauben ausgeliefert zu sein. Selbst die Zerstörung von Lebensräumen, die Ausbeutung von Menschen und ihrer Arbeitskraft oder der Kolonialismus konnten damals im Sinne der Aufklärung und des Fortschrittes legitimiert werden. Schaut her, die Natur, wie reich die Welt, wie viel Raubbau passt wohl auf einen einzelnen Planeten? Das finden wir heraus, los geht’s.
Die industrielle Revolution kam und ging, die ökologische Zerstörung kam und blieb. Und in der Überzeugung, dass Wissen die Menschen ja schon einmal befreit hatte – von der Unterdrückung durch Kirche und Gott –, wandte man sich in der Klimakrise erneut dem Versprechen der Aufklärung zu. Wenn wir die Erkenntnisse, die die Wissenschaft über die Klimakrise, ihre Ursachen und Folgen erzielt hatte, anwenden würden – so die Idee –, könnten wir uns von den Folgen des menschlichen Größenwahns der letzten dreihundert Jahre befreien.
Und heute? Wo sind wir angekommen, rund zweihundertfünfzig Jahre nachdem Voltaire das freie und unabhängige Denken in Europa bewarb, nachdem Lessing die Toleranz beschrieben und Beethoven die Revolution vertont hat? Wohin hat uns der Geist der Aufklärung, des wachsenden Wissens, der Supertechnologien und großen Träume gebracht? Was ist vom ersten Artikel der Erklärung der Menschenrechte geblieben: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren»[11]?
Befeuert von der Idee der Aufklärung wurde eine Gesellschaft erschaffen, die besser als jede vor ihr weiß, wie hart Gleichheit und Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit erkämpft werden müssen, eben weil wir anhand der Geschichte sehen können: Es ist möglich. Wenn meine Großmutter seufzend vor ihrem Bücherregal steht, dann steht sie nicht nur vor einem Sammelsurium an ignorierten Erkenntnissen zur Verteidigung unserer Lebensgrundlagen. Sie steht vor einer Kaskade an gebrochenen Versprechen: dass die Aufklärung die Menschen befreien werde, getrieben von den Erkenntnissen der Wissenschaft und durch die Ermutigung, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Mit über neunzig Lebensjahren ist sie fassungslos: Denn von all den Welten, die möglich gewesen wären, haben sich die Menschen ausgerechnet für diese Gegenwart entschieden.
Auch der Blick nach vorne lässt verzweifeln. Die Zukunft heißt im Bücherregal meiner Großmutter «3 Grad mehr» oder «Die unbewohnbare Erde»[12]. Bücher, die eine Zukunft skizzieren, die man zwar beschreiben, sich aber nicht vorstellen kann.
Anfang 2023 stellte eine Gruppe von Forscher:innen, die die Gefährdung der Menschheit bemisst, die Endzeit-Uhr auf neunzig Sekunden vor zwölf. Klimaforscher:innen sprechen davon, dass die Stabilität der Erdensysteme erstmals seit Menschheitsbeginn droht, vollständig zu kollabieren.[13]
Von all den Möglichkeiten, die sich der Menschheit über die Jahrhunderte geboten haben, hat man ausgerechnet zahllose ungerechte, ausgrenzende, zerstörerische und extraktivistische gewählt.
Einst versprach man, dass uns nicht der Glaube retten werde, sondern unser angewandtes Wissen. Doch das Wissen hat offensichtlich nicht gereicht. Eine Welt wurde geschaffen, die für einige ein Zuhause und für viel zu viele eine Gefahr ist. Was also, wenn das klarste Denken, die klügsten Ideen, das beste Wissen, das Menschen jemals besessen haben, uns nicht retten können?
Was ist die Welt der Gegenwart? Eine Welt, in der man versprochen hat, dass uns die Maschinen retten würden – glaube nicht an Gott, glaube an Elon Musk! Und was ist daraus geworden? Fortschritt, der immer unbezahlbarer wird, Technologien, die immer gefährlicher werden, Maschinen, die mehr zerstören, als dass sie helfen. Aber was, wenn auch die neueste Technik, die klügste Erfindung, die beste Maschine, die Menschen jemals besessen haben, uns nicht retten wird?
Wir sind «Menschen ohne Welt»[14]. Zu Hause in einer Welt, deren Existenz bis zur letzten Nanosekunde berechnet werden kann und die dennoch vor der größten Existenzfrage aller Zeiten steht. Zu Hause in einer Gesellschaft, die nicht nur ihre Ressourcen, ihre Lebensräume und ihr Klimagleichgewicht zerplündert, sondern zu allem Überfluss auch ihre Quellen der Hoffnung ausgetrocknet hat.
Und gerade weil es den Zufall nicht gibt, weil nichts im Universum einfach nur ist, steht das Konzept der Aufklärung heute wie die große Verräterin im Raum. Wissen ist Macht, sagten die Aufklärer. Wissen ist Ohnmacht, sagt das Bücherregal meiner Großmutter.
Drei Jahrhunderte nach der Aufklärung stehen wir wieder vor der Glaubensfrage. Nicht weil es plötzlich wieder viel zu glauben gibt, sondern weil da scheinbar nichts mehr ist, an das man noch glauben kann.
Bequeme Hoffnung
Es fühlt sich erdrückend an. Als würden wir gegen Wände laufen. Menschen sagen, es sei schön, dass wir uns engagieren. Wie merkwürdig. Als würden wir das hier für den Lebenslauf machen. Das schreibe ich in mein Notizbuch, fünf Minuten bevor ich in meiner ersten Talkshow sitze. Es ist das Frühjahr 2019, retrospektiv war diese Zeit eine des historischen Aufstieges von Fridays for Future. Woche um Woche wuchsen die Klimastreiks auf den Straßen an. Tagsüber protestierte ich, nachts zweifelte ich. Wenn das die Revolution sein sollte, dann fühlte sie sich relativ beschissen an. Ich notierte: Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man doch, und ich frage mich, ob das die größte Lüge diesseits des Universums ist.
Es gibt keine Frage, die mir so oft gestellt wird wie die Frage nach der Hoffnung in der Klimakrise. Früher hielt ich sie zuweilen für kitschig oder verlegen, ich fand Hoffnung nie so interessant wie das Loslegen. Lieber ohne Hoffnung auf den Barrikaden als hoffnungsvoll in der Untätigkeit!, wollte ich den Leuten zurufen. Ich hielt die Hoffnungsfrage auch für ein Problem der Privilegierten, nach dem Motto: Wenn du zu Hause sitzen und über die Beschaffenheit der Hoffnung sinnieren kannst, dann geht’s dir offensichtlich noch ganz gut.
Mir begegneten damals viele Menschen, die Hoffnung mit blindem Optimismus gleichsetzten, die in Wirklichkeit nicht Hoffnung, sondern eine Ausrede suchten, sich selbst nicht einbringen zu müssen. Deren Weg von der Entdeckung der Klimakrise als realem Problem hin zum Gefühl der Resignation, sprich: Hoffnungslosigkeit, verdächtig kurz war. Erst fanden sie alles noch nicht so schlimm, und kurz darauf war es ohnehin zu spät, um noch etwas zu tun. Bei diesen Menschen sah ich nicht den Funken einer Bereitschaft, sich in der Klimakrise selbst als verantwortlich zu erkennen, gleichzeitig wollten sie von mir Hoffnung geliefert bekommen, um dann mit dieser Hoffnung was genau zu tun? Sich besser zu fühlen? Ich konnte mit dieser Suche nach Hoffnung nicht viel anfangen.
Viel lieber als hoffnungsvoll wollte ich Menschen in Wut und Sorge versetzen. Auf einer der ersten Klima-Demos, die ich organisierte, sagte ich: «Wir wissen, dass wir keinen Tag mehr warten können. Manche werfen uns vor, Panik zu verbreiten. Und ich sage, sorry, wenn es Zeit gibt, Panik zu haben, dann jetzt. Und wir machen sie uns zunutze.»
Heute sehe ich es etwas anders. Ich kenne kaum noch jemanden, der nicht längst wütend oder panisch ist. Oder es zumindest bis vor Kurzem war. Denn was oft auf Wut und Panik folgt, sind Verzweiflung und Erschöpfung.
Es gab eine Zeit, da lag die Hoffnung praktisch auf der Straße. Heute kenne ich niemanden mehr, der nicht mit der Hoffnung hadert.