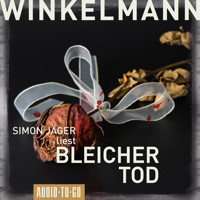9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gleich an ihrem ersten Tag in der Abteilung Mord muss sich Praktikantin Manuela Sperling mit dem grausigen Mord an einer Prostituierten befassen. Eingekeilt zwischen Baumwurzeln im seichten Teil des Flusses liegt ihre Leiche – ertränkt. Aber das Wasser in der Lunge des Mordopfers stammt nicht aus dem Fluss, und auf dem Bauch der toten Frau finden die Spurensicherer eine grausige Botschaft – ausgerechnet an Manuelas Chef, Kriminalhauptkommissar Stiffler. Bald steht sie mit ihrem Eifer im Präsidium ziemlich allein da, nur der nette Kollege Peter Nielsen ist auf ihrer Seite. Da ertrinkt erneut eine junge Frau, direkt vor Manuelas Augen. Und ihr Chef dreht durch...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Wassermanns Zorn
Thriller
Über dieses Buch
Manuela Sperling ist neu bei der Polizei. Gleich an ihrem ersten Tag muss sie sich mit einem Prostituiertenmord befassen. Die Leiche liegt eingekeilt zwischen Baumwurzeln im seichten Teil des Flusses. Doch das Wasser in ihrer Lunge ist nicht das, in dem sie liegt … Auf dem Bauch der Toten ist ein Name eingebrannt. Eine grausige Botschaft an Kriminalhauptkommissar Stiffler, Manuelas Chef.
Manuelas Eifer, den Fall aufzuklären, wird nicht von allen gern gesehen. Da ertrinkt erneut eine Frau, direkt vor ihren Augen. Eine unsichtbare Macht zieht das Opfer auf den See hinaus. Was wartet unten in der Tiefe?
Vita
In seiner Kindheit und Jugend verschlang Andreas Winkelmann die unheimlichen Geschichten von John Sinclair und Stephen King. Dabei erwachte in ihm der unbändige Wunsch, selbst zu schreiben und andere Menschen in Angst zu versetzen. Heute zählen seine Thriller zu den härtesten und meistgelesenen im deutschsprachigen Raum. In seinen Büchern gelingt es ihm, seine Leserinnen und Leser von der ersten Zeile an in die Handlung hineinzuziehen, um sie dann, gemeinsam mit seinen Figuren, in ein düsteres Labyrinth zu stürzen, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Die Geschichten sind stets nah an den Lebenswelten seines Publikums angesiedelt und werden in einer klaren, schnörkellosen Sprache erschreckend realistisch erzählt. Der Ort, an dem sie entstehen, könnte ein Schauplatz aus einem seiner Romane sein: der Dachboden eines vierhundert Jahre alten Hauses am Waldesrand in der Nähe von Bremen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung Getty Images
ISBN 978-3-644-20971-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dieses Buch ist für Steffi und Nina, die nie in dunkles Wasser gehen.
… bleibt dabei!
Vorher
Eiskaltes Wasser umschloss ihren Körper und spülte die Benommenheit fort, die der heftige Schlag auf ihren Hinterkopf ausgelöst hatte. Instinktiv presste sie die Lippen aufeinander, riss die Augen weit auf und spürte sofort das Wasser brennend auf ihren Augäpfeln.
Wenige Zentimeter unter sich sah sie einen Abfluss mit einem schwarzen Plastikstöpsel darin und einem schmutzig braunen Rand darum. An dem Stöpsel hing der kurze Rest einer silbernen Kugelkette, die schon zerrissen gewesen war, als sie die Wohnung bezogen hatten. Auch der braune Rand war damals schon da gewesen. Einige lange Haare waren unter dem Stöpsel eingeklemmt und trieben im Wasser wie Fangarme umher. Die meisten stammten von ihr. Ausgerechnet in diesem unpassenden Moment erinnerte sie sich an die häufigen Ermahnungen, endlich den Abfluss zu reinigen. Sie hatte nie darauf gehört und wünschte sich jetzt, es nachholen zu können. Zeit zu bekommen dafür. Doch ihre Zeit lief gerade unaufhaltsam ab.
Zwei kräftige Hände drückten sie unter Wasser. Eine packte sie im Nacken, die Finger der anderen gruben sich wie Stahlklauen in die Muskulatur ihres Hinterns.
Sie strampelte mit den Beinen, schlug mit den Händen auf den Wannenrand, fand aber keinen Halt, sondern glitt immer wieder ab an der nassen, rutschigen Emaillebeschichtung. Ihre langen Nägel kratzten darüber und quietschten jämmerlich.
Erst jetzt bemerkte sie, dass sie nackt war. Er musste sie entkleidet haben, während sie besinnungslos gewesen war. Alles war so schnell gegangen, sie hatte keine Chance gehabt, sich zu wehren. Dabei hätte sie es wissen können. Sie hätte aus den Geschehnissen der letzten Wochen nur die richtigen Schlüsse ziehen müssen.
Zu spät. Jetzt war es dafür zu spät.
Die Anstrengungen ihrer Gegenwehr forderten bereits nach wenigen Sekunden ihren Tribut. Ihre Lunge lechzte nach Sauerstoff, ihr ganzer Körper schrie danach. Aber ihr Verstand stemmte sich verzweifelt dagegen.
… nicht atmen, auf keinen Fall atmen …
Sie war es nicht gewohnt, die Luft anzuhalten, kämpfte gegen den Atemreflex an, presste weiterhin ihre Lippen fest aufeinander und nahm sich vor, sie nie, nie, nie zu öffnen. Denn mit dem Wasser würde der Tod in sie eindringen, und sie wollte nicht sterben, nicht jetzt und nicht hier. Nicht in ihrer Wanne, jenem Platz in der Wohnung, an dem sie sich, eingehüllt in warmes Wasser und Schaumberge, stets so sicher und geborgen gefühlt hatte.
… nicht atmen, auf keinen Fall atmen …
Sie mobilisierte all ihre Kräfte, trat noch heftiger aus, wand sich wie ein Aal, und tatsächlich schaffte sie es, den Kopf aus dem Wasser zu recken. Sofort riss sie den Mund auf und schnappte mit einem gierigen Geräusch nach Luft.
Doch mit brachialer Gewalt wurde sie wieder hinuntergedrückt und atmete unweigerlich Wasser ein.
Jetzt war es in ihr, in ihrem Hals, wo es einen Würgereflex auslöste. Obwohl sie es nicht wollte, atmete sie ein weiteres Mal ein. Ihre Lunge verkrampfte sich.
Unbarmherzig wurde sie tiefer hinuntergedrückt, gegen den Wannenboden, bis ihre Nase brach. Der heftige Schmerz ließ sie die Augen erneut weit aufreißen, und sie sah, wie sich ihr Blut wie roter Nebel mit dem Wasser vermischte. Die langen, unter dem schwarzen Plastikstöpsel eingeklemmten Haare verschwanden hinter dem Rot.
Das Letzte, was ich sehe, sind unsere Haare, dachte sie. Meine und ihre, miteinander verflochten, so wie unsere Leben.
Ein paar Luftblasen stiegen von ihren Lippen auf. Silbrig schimmernde Kugeln, die sie so gern zurückgestopft hätte in ihren Mund, damit das bisschen Sauerstoff ihr noch eine Sekunde verschaffte. Eine Sekunde länger im Leben, im Hier und Jetzt …
Ihre unkontrollierten Zuckungen erlahmten. Durch das Wasser gedämpft und verzerrt hörte sie ihre eigenen Schluckgeräusche, entsetzlich, unmenschlich. Die dröhnende Stimme des Todes hallte durch ihren Kopf, füllte ihn aus, lauter als die Angst, lauter noch als der Schrei nach Leben.
Sie atmete ein letztes Mal ein.
Und dann war Stille.
Jetzt
1
«Hast du Lust zu baden, Stiffler?»
Die Stimme am anderen Ende des Telefons klang wässrig, so, als trinke der Mann beim Sprechen.
«Wer ist da?», fragte Eric Stiffler.
Ein paar Sekunden sagte niemand etwas. Der Anrufer atmete mühsam, und das rasselnde, schleimige Geräusch jagte Eric einen Schauer über den Rücken. In seinem Kopf wollte sich eine Erinnerung entfalten.
«Die Vergangenheit holt dich ein, Stiffler.»
Eric nahm das Handy vom Ohr und sah auf das Display. Entgegen seiner Gewohnheit hatte er es nicht getan, bevor er das Gespräch entgegengenommen hatte. Er hatte gerade Kaffee getrunken. Werkstatt ruft an, stand dort, gefolgt von einer Mobilnummer, die er nur zu gut kannte.
Er presste das Handy wieder ans Ohr.
«Hören Sie. Wenn …»
«Nein. Du hörst zu, und besser ganz genau, denn ich werde es nur einmal sagen. Sie badet, Stiffler … Sie badet, und wenn du sie nicht rechtzeitig findest, wird es das letzte Bad ihres Lebens sein. Sie hat nach dir gefragt, und ich habe ihr gesagt, dass du zu feige bist, um ihr zu helfen. Hab ich recht damit? Bist du immer noch so ein gottverdammter Feigling?»
Die Stimme troff geradezu vor Hass. Eric spürte, wie sich sein Magen zu einem festen Klumpen verkrampfte und die Säure in die Speiseröhre drückte.
Er hasste es, ein Feigling genannt zu werden, hatte es schon in der Schule gehasst. Schon damals war er klein und spindeldürr gewesen, keiner körperlichen Auseinandersetzung gewachsen. Er hatte früh gelernt, dass man den rauflustigen Rabauken nur durch Flucht oder Schlauheit entkommen konnte, und darauf seine Lebensstrategien aufgebaut. Auf dem Präsidium hatte mal jemand behauptet, er habe keinen Arsch in der Hose. In physischer Hinsicht stimmte das, jede Hose schlackerte an ihm herum wie ein Segel im Wind, aber der Kollege hatte es natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Tja, heute war er nicht mehr da, weil er sich nach diesem dummen Spruch auch noch einen Fehler geleistet hatte.
Eric drehte sich mit dem Handy am Ohr im Kreis. Er stand in der Nähe des Marktplatzes am Zeitungskiosk, an dem er sich seinen üblichen Feierabendkaffee geholt hatte. Jetzt, am späten Nachmittag, herrschte in der Fußgängerzone der Vierhunderttausend-Einwohner-Stadt reger Betrieb. Menschen eilten vorbei, ohne von ihm Notiz zu nehmen, aber er konnte in der Menge niemanden ausmachen, der sich für ihn interessierte. Trotzdem hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden.
«Wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst, ich schwöre dir …»
«Halt deine Klappe und beeil dich besser.»
Damit war das Gespräch beendet.
Eric Stiffler blieb mit dem Echo dieser nasal-nassen, hasserfüllten Stimme im Kopf zurück. Er fühlte sich wie gelähmt. Den Betrieb um sich herum nahm er nur noch als ein gedämpftes Hintergrundrauschen wahr.
Eben noch hatte er sich auf den Feierabend gefreut, hatte mit dem Duft des frischen Kaffees in der Nase und den warmen Sonnenstrahlen auf dem Gesicht überlegt, ob er heute vielleicht den Rasen mähen und sich danach auf die Terrasse legen sollte, statt wie immer nur vor der Glotze abzuhängen. Er könnte auch den Grill, der seit Jahren schon nicht mehr benutzt worden war, aus dem Schuppen holen und ein paar Würstchen auf den Rost legen. Das Wetter war danach, also warum nicht? Es war ein schöner Gedanke gewesen, und er hatte sich gut gefühlt. All die Schatten, die ihn sonst stets umgaben, waren einer sonnigen Helligkeit gewichen. Alles schien möglich.
Aber jetzt nicht mehr. Dieser Anruf hatte das kurze Aufflackern von Entschlossenheit und Unternehmungslust im Keim erstickt.
Er sah Annabells Gesicht vor sich. Ihr schwarzes Haar, ihre helle, ebenmäßige Haut. Die leichten Grübchen neben ihren Mundwinkeln, die ihr Lächeln so ehrlich wirken ließen. Ihre dunkelbraunen, mandelförmigen Augen, die Ruhe und Gelassenheit ausdrückten. In diesem Moment begriff er, dass ihn schon immer ihre Augen am allermeisten fasziniert hatten. Aber dieses Begreifen ging darüber hinaus, bohrte sich schmerzhaft in seine Eingeweide und riss ein Tor weit auf, hinter dem Einsamkeit und Verlust lauerten.
Mit zittrigen Fingern öffnete er das Telefonbuch seines Handys und suchte ihre Nummer heraus, die er unter «Werkstatt» gespeichert hatte. Er ließ es eine Weile klingeln, legte aber auf, bevor die Mailbox seinen Anruf entgegennehmen konnte.
Seine Gedanken überschlugen sich. Wieso jetzt? Wieso sie? Wer war das gewesen am Telefon? Die Vergangenheit holt dich ein, Stiffler. Die lange verschüttete Erinnerung drängte sich erneut machtvoll in sein Bewusstsein, und Eric bemühte sich nach Kräften, sie zurückzudrängen. Er durfte jetzt keinen Fehler machen und sich nicht zu überstürzten Aktionen hinreißen lassen, denn wahrscheinlich war es genau das, was der Anrufer beabsichtigte.
Eric warf den vollen Kaffeebecher in den Mülleimer. Dann fuhr er sich mit beiden Händen übers Gesicht und durch sein langes, dünnes Haar.
Denk nach, denk nach, denk nach …
Schließlich fällte er eine Entscheidung und machte sich mit langen Schritten auf den Weg.
2
Die alte Angst tauchte auf wie eine Hand aus dunklem Wasser, packte sie und riss sie aus der Realität zurück in den Albtraum, den sie nie vergessen hatte und der offenbar längst noch nicht zu Ende war. Augenblicklich brach ihr kalter Schweiß aus.
Lavinia Wolff sah in der Schaufensterscheibe nur das weichgezeichnete Spiegelbild einer schlanken Frau Mitte zwanzig, fast schon zu dünn, die Hüften knabenhaft, der Busen nicht der Rede wert. Das blond gefärbte Haar fiel ihr sanft auf die Schultern.
Ein Blinzeln wechselte die Perspektive. Lavinia konzentrierte sich und beobachtete ihre Umgebung im Fensterglas. Die Auslage dahinter störte. Sie stand vor einem auf Krimis und Thriller spezialisierten Buchladen. Auf blutrotem Tuch lagen die Bestseller aus dem Genre.
Zorn. Hass. Tod. Wut. Terror.
Die einzelnen Worte auf den Buchdeckeln drangen wie Gewehrfeuer in ihren Kopf. Angst wurde zu Panik. Lavinia begann am Nagel ihres rechten Zeigefingers zu kauen, wie sie es immer tat, wenn sie sich sehr unwohl fühlte. Es half, die Panik niederzuringen. Sie durfte es auf keinen Fall so weit kommen lassen.
Hatte er sie gefunden?
Oder erlag sie nur wieder einem dieser Anfälle, die sie in schöner Regelmäßigkeit heimsuchten? Sie wusste, dass sie paranoide Züge entwickelt hatte seit damals, aber das hatte nichts mit dem zu tun, was sie gerade fühlte.
Dabei war heute früh um acht, zum Schichtbeginn, noch alles in Ordnung gewesen – sah man davon ab, dass sie sich wieder einmal nur mühsam zu ihrem Arbeitsplatz beim Bekleidungsdiscounter geschleppt hatte. Die beschissene Bezahlung und der Gestank nach Plastik und Chemikalien in den billigen Klamotten konnte sie gerade noch ertragen. Nicht aber die neue Filialleiterin, die sie jeden Tag drangsalierte. Lavinia wäre spielend mit Frau Kropf fertiggeworden, wenn sie den Job nicht so dringend bräuchte. Sich jemandem unterzuordnen, dem sie eigentlich überlegen war, war so sehr gegen ihre Natur, dass es ihr körperliche Schmerzen verursachte.
Während der Acht-Stunden-Schicht hatte sie nichts bemerkt. Wie jeden Tag in den letzten zwei Jahren waren die Kunden wie eine graue Masse an ihr vorübergezogen. Aber kaum hatte sie gegen siebzehn Uhr die Filiale verlassen, hatte sie sofort das Gefühl gehabt, beobachtet und verfolgt zu werden.
Früher hatte Lavinia nie an ihren Instinkten gezweifelt, aber nachdem sie sie bereits ein paar Mal getrogen hatten, war sie vorsichtiger geworden. Sie wollte nur zu gern glauben, wieder einer Täuschung zu erliegen, doch da gab es so etwas wie eine Stimme in den Tiefen ihres Kopfes, und die sprach die Wahrheit aus.
Er ist wieder da … Er ist wieder da …, flüsterte sie … Und diesmal wird er dich ertränken.
Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und wandte sich mit einem Ruck von dem Schaufenster ab.
Und dann sah sie ihn.
Ungefähr fünfzig Meter die Straße hinunter stand er unter der ausgefahrenen dunkelgrünen Markise eines türkischen Gemüsehändlers. Er stand neben den mit Melonen vollbeladenen Körben ganz dicht an der Hauswand, wo der Schatten undurchdringlich war, und Lavinia konnte weder sein Gesicht noch seine Augen sehen. Aber sie wusste, dass er sie anstarrte.
Er war es, ganz sicher.
Lavinia starrte zurück. Sie war unfähig, sich zu bewegen.
Die warme Luft über dem sonnenheißen Pflaster begann zu flirren und zu schwimmen, so als verwandele sich der feste Boden in Wasser. Alles, was sich jenseits dieses Sees befand, geriet in geisterhafte Bewegung.
Schwindel erfasste Lavinia, Erinnerungsbilder schossen an ihren Augen vorbei. Ein See. Ein Kopf, der durch die Oberfläche brach. Ein zersprungener Glasbilderrahmen auf dem Flur. Aufgefächertes Haar in blutrotem Wasser. Sie schüttelte den Kopf, zwang ihren Blick zu Boden, um die Bilder loszuwerden, und als sie wieder aufsah, war die Gestalt unter der grünen Markise verschwunden.
Er schleicht sich an! Mach, dass du fortkommst!, schrie es in ihr.
Hektisch sah Lavinia sich um, konnte aber niemanden in der Nähe entdecken. Trotzdem wurde die Angst immer größer. Sie packte ihre Handtasche fester, wandte sich nach rechts und lief die Fußgängerzone hinunter. Die harten Absätze ihrer Stiefel klapperten geradezu ohrenbetäubend, sie zog Blicke auf sich, aber das war ihr egal. Sie musste weg hier. So schnell es ging.
Um sie herum waren zahllose Menschen, und doch hätte ihre Einsamkeit in diesem Moment nicht größer sein können. Niemand würde ihr jemals helfen können, solange dieser Schatten der Vergangenheit hinter ihr her war.
Mit wild pochendem Herzen und einem Stechen in der Lunge erreichte sie endlich die S-Bahn-Station und erwischte gerade noch eine Bahn. Sie sprang hinein, blieb mit der Handtasche am Griff hängen, zerrte daran, bis der billige Karabiner zersprang, und fiel dadurch beinahe hin.
Leise zischend schlossen sich die Türen. Die Bahn setzte sich in Bewegung.
Lavinia presste sich an die Tür, ihr Atem beschlug die schmutzige Scheibe. Durch den Nebel hindurch beobachtete sie die rasch kleiner werdende Haltestelle. Es war, als hätte die Bahn sie aus ihrem Leben gerissen.
3
«Hey, Superwoman, fang die bösen Buben. Ich bin stolz auf dich.»
Zum siebten Mal an diesem Tag las Manuela Sperling die SMS auf ihrem neuen Smartphone. Sie stammte von ihrem kleinen Bruder, Timmy. Er hatte sie ihr schon heute früh um sechs geschickt. Der Einzige aus der Familie, der an sie gedacht hatte und nachempfinden konnte, wie es ihr an ihrem ersten Tag in der neuen Dienststelle ging.
Es ging ihr beschissen. Seit gestern stand der Termin für das Gespräch mit dem Polizeichef fest, und seitdem spielte ihr Körper verrückt. Kein Appetit, kein Stuhlgang, dafür gebärdete sich ihre Blase, als hätte sie literweise Brennnesseltee getrunken, aber heraus kam so gut wie nichts.
Derart heftige körperliche Reaktionen auf Stress hatte sie während der gesamten Akademiezeit nicht gehabt. Sie verstand nicht, was die Aufregung sollte. Hans Bender war nur ein Mensch, wie hoch dekoriert und berühmt-berüchtigt er auch sein mochte. Aber seit Eric Stiffler, Leiter des Morddezernats und ihr direkter Vorgesetzter, sie heute früh vor dem cholerischen Wesen des Polizeichefs gewarnt hatte, war ihr gewohntes Selbstbewusstsein wie weggeblasen. Das irritierte Manuela ganz gewaltig, denn Angst vor Männern war ihr, die mit drei Brüdern aufgewachsen war und alle denkbaren Kämpfe mit ihnen ausgefochten hatte, eigentlich fremd.
In der stillen Abgeschiedenheit der Toilettenräume setzte sie sich abermals auf die kalte Klobrille. Sie schrieb Timmy eine Antwort-SMS, in der sie ihm von dem bevorstehenden Termin berichtete und ihm dankte, dass er an sie gedacht hatte. Zu Timmy hatte sie schon immer eine besondere Beziehung gehabt. Er war dreiundzwanzig, zwei Jahre jünger als sie und das jüngste Kind der Sperlings. Er studierte im zweiten Semester Journalismus und war der Erste aus der Familie, der eine richtige Uni besuchte. Die Polizeifachhochschule zählte nicht, egal wie oft Manuela ihrem Vater auch erklärte, dass sie dort ein reguläres Studium abgeschlossen hatte. In seinen Augen war sie eine gewöhnliche Beamtin, und die rangierten bei ihm gleich hinter Versicherungsvertretern. Als Timmy es noch nötig gehabt hatte, war es meistens Manuela gewesen, die auf ihn aufgepasst hatte. Wie alle Sperlinge konnte auch er seinen Mund nicht halten. Er redete zwar deutlich weniger als sie, mischte sich aber überall ein, wo es seiner Meinung nach ungerecht zuging. In der Schulzeit hatte er sich damit oft in die Bredouille gebracht. Timmy und sie waren sich sehr ähnlich. Manuela liebte Timmy, und er fehlte ihr. Heute war ihr Bruder zwei Köpfe größer als sie, ein Schrank von einem Kerl, der ihren Schutz nicht mehr benötigte.
Als sie die SMS abschickte, stellte Manuela fest, dass ihr nur noch neun Minuten blieben, um hinauf in die Teppichabteilung zu gelangen, wo der Chef residierte.
«Mist!» Mit einem Ruck sprang sie von der Klobrille auf. Dabei stieß sie mit dem rechten Oberschenkel gegen den viel zu niedrig angebrachten Papierrollenhalter, blieb mit dem Ledergürtel daran hängen und riss ihn mitsamt den Schrauben aus der dünnen Pressholzwand. Laut klappernd fiel das Metallteil zu Boden und übertönte ihren Fluch.
Manuela erstarrte. In dem gekachelten Raum hallte das Geräusch ewig nach. Als es wieder still war, zog sie sich an, hob den Papierrollenhalter auf und legte ihn auf den Spülkasten. Zum Glück war sie allein in der Toilette, sonst hätte sie an ihrem ersten Tag in der neuen Dienststelle schon eine Sachbeschädigung melden müssen.
Dann verließ sie die Kabine, trat ans Waschbecken und wusch sich eilig die Hände. Sie war, bereits eine Stunde bevor ihr Wecker am Morgen geklingelt hatte, auf Socken und im Schlafanzug durch ihre neue Wohnung getigert und hatte Regale eingeräumt. Dabei hatte sie es geschafft, die Zeit zu vertrödeln und zu spät loszukommen. Zwar war sie pünktlich zum ersten Dienstantritt im Büro erschienen, allerdings mit unfrisiertem Haar. Ein Blick in den Spiegel verriet ihr, dass ihre Haare jetzt, am Nachmittag, nicht besser aussahen.
Egal. Sie war schließlich nicht als Schönheitskönigin hier, sondern als frischgebackene Kommissarin. Ihr Aussehen sollte überhaupt keine Rolle spielen. Trotzdem versuchte sie mit ein paar geübten Griffen zu retten, was nicht zu retten war. Sie mochte ihr haselnussbraunes Haar, aber es war leider zu dünn und ließ sich nur schlecht frisieren. Feenhaar, wie ihre Mutter immer sagte.
Mit einem tiefen Seufzer gab sie es auf, verließ den Toilettenraum und eilte mit kleinen, schnellen Schritten durch das Treppenhaus nach oben. Es gab auch Fahrstühle, aber die waren nichts für sie, schon gar nicht, wenn sie so aufgeregt war wie jetzt. Dann musste sie entweder reden oder sich bewegen, am besten beides gleichzeitig.
Eine Minute vor der vereinbarten Zeit erreichte sie die Tür zum Vorzimmer. Sie vergaß zu klopfen und stürmte einfach hinein.
Im Blick der persönlichen Assistentin des Polizeichefs, die laut einem Schild auf dem Tisch Clara Heidkowski hieß, lag eine Mischung aus Überraschung und Missbilligung. Ihre dünngezupften Brauen zogen sich zur Mitte zusammen, als kreuzten sich zwei Klingen.
«Entschuldigung», sagte Manuela und deutete auf die Türklinke, als sei die schuld an allem. «Ich wollte nicht …»
Sie brach ab, atmete tief ein, versuchte sich zu sammeln und begann noch einmal von vorn.
«Ich bin Manuela Sperling. Ich habe einen Termin bei Herrn Bender.»
Die Assistentin wirkte jetzt belustigt. «Das ist schön», sagte sie. «Dann warten Sie doch bitte auf dem Gang. Herr Bender spricht gerade mit dem Innenminister.»
Die Fröhlichkeit in der Stimme dieser doch so streng wirkenden Frau irritierte Manuela. Sie wandte sich ab und wollte den Raum verlassen, als die Assistentin sich räusperte.
«Und ich würde etwas wegen Ihrer Hose unternehmen», sagte sie.
Manuela drehte sich zu ihr um, sah, dass die Frau mit dem Finger auf ihren Oberschenkel wies, und folgte dem Hinweis.
In ihrer dünnen schwarzen Stoffhose klaffte ein Loch in Form eines Dreiecks und entblößte die nackte Haut ihres Oberschenkels. Der Papierrollenhalter.
«O nein», stöhnte Manuela, presste die Hand darauf, verließ das Büro und zog die Tür hinter sich zu.
Diese Hose hatte sie sich extra für den ersten Tag neu gekauft. Sie war nicht billig gewesen. Sie untersuchte das Loch genauer und stellte fest, dass da nichts zu machen war. Der Stofffetzen klappte immer wieder herunter, selbst als sie versuchte, ihn mit Spucke an der Haut zu befestigen. Zwecklos. Und das Loch war auch noch vorn am Oberschenkel, für jeden gut sichtbar. Weiße Haut unter schwarzer Hose, einen auffälligeren Kontrast konnte es gar nicht geben.
«So ein verdammter Bockmist.»
Manuela stieß zornig mit dem Hacken in den Teppichboden wie ein kleines bockiges Kind. Wie konnte alles nur so schieflaufen? Weil es so warm war, hatte sie nicht einmal eine Jacke dabei, mit der sie das Loch hätte kaschieren können. Ihre schmalgeschnittene, violette Bluse war dafür viel zu kurz.
Im nächsten Moment wurde die Tür geöffnet, und Frau Heidkowski kam heraus.
«Herr Bender lässt bitten», sagte sie und reichte ihr eine braune, halblange Sommerjacke. «Nehmen Sie die, dann fällt es nicht so auf.»
Manuela war zu überrascht, um zu reagieren.
«Na los doch. Bender wartet nicht gern», sagte die Assistentin und lächelte.
Manuela griff zu und zog die Jacke an. Sie war bestimmt zehn Zentimeter kleiner als die Assistentin, aber dadurch war die Jacke so lang, dass sie das Loch in der Hose knapp verdeckte. Sie musste die Jacke nicht einmal schließen. Das hätte bei den sommerlichen Temperaturen sicher auch merkwürdig gewirkt.
«Vielen Dank», sagte sie.
Die Assistentin nickte und schob sie ins Büro.
«Auf in die Höhle des Löwen», sagte sie.
4
Das Haus stand unweit der City in einer Nebenstraße. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts als imposante Kaufmannsvilla gebaut, dreigeschossig, mit zehn Fenstern pro Geschoss in der Vorderfront und zwei Säulen, die die Eingangstür flankierten, wirkte es inzwischen heruntergekommen.
Putz bröckelte von den Säulen, stellenweise schienen ihn nur noch die Graffitischmierereien zusammenzuhalten. Der schmale Vorgarten diente als Stellplatz für drei hässliche Müllcontainer und eine Herde altersschwacher Fahrräder, von denen die meisten umgekippt waren. Sechs Satellitenschüsseln weinten rostige Tränen und verunstalteten die Front zusätzlich. Seit geraumer Zeit war die Stadt im Besitz des Hauses und vermietete die Wohnungen darin. Wegen der zentralen Lage waren sie beliebt, aber da hinter dem Haus eine Schule lag, war es bisher nicht gelungen, einen solventen Käufer für das Haus zu finden.
Eric Stiffler stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beobachtete das Haus aus dem Schatten einer mit unzähligen dummen Sprüchen beschmierten Bushaltestelle heraus. In zehn Minuten würde der nächste Bus halten. Wollte er keine Aufmerksamkeit erregen, musste er bis dahin verschwunden sein.
Er hatte sich entschieden, die Sache erst einmal allein zu überprüfen. Vielleicht wollte ihm der Anrufer ja nur einen Streich spielen, ihn dazu treiben, den ganzen Apparat in Gang zu setzen und sich selbst zu denunzieren. Es war möglich, dass er trotz aller Vorsichtsmaßnahmen mit Annabell zusammen gesehen worden war und sich dieses Arschloch nun einen Spaß daraus machte, ihn zu erschrecken.
Seine Erfahrung sagte ihm, dass er sich an eine Hoffnung klammerte, die die Realität nicht einlösen würde. Das tat sie nie, sie entschied sich immer für die schlimmste Variante. Leider schützte ihn seine Erfahrung nicht vor diesem letzten bisschen Hoffnung. Dabei war sie nichts anderes als die Feigheit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.
Sein Unterbewusstsein wollte nicht wahrhaben, was sein Verstand längst akzeptiert hatte: Der Anruf war von ihrem Handy gekommen, folglich musste ihr etwas passiert sein. Ausgerechnet Annabell, der Ersten, mit der er sich länger als ein Jahr regelmäßig traf. Die Gewohnheit und Routine beim Sex war ihm wichtig geworden, er hatte es satt, immer wieder von vorn beginnen zu müssen. Außerdem hatte Annabell Verständnis für ihn, und das war etwas, was er wirklich brauchte. Ihre mitfühlende Art war für ihn zu etwas geworden, worauf er nur noch schwer verzichten konnte.
In einem günstigen Moment, als die Straße leer und die Mutter mit dem Kinderwagen im Nachbarhaus verschwunden war, lief Stiffler mit den Händen in den Taschen und gesenktem Kopf hinüber. Ohne zu zögern, drückte er die alte metallene Pforte auf und ging auf die Haustür zu. Er war diesen Weg oft gegangen, aber bisher nur in der Dunkelheit, und es fühlte sich absolut falsch an, es jetzt bei Tageslicht zu tun.
Drinnen empfingen ihn sofort die intensiven Gerüche verschiedener Abendessen, die im Treppenhaus zu einem olfaktorischen Unwetter kumulierten. Ohne den Handlauf zu berühren – er ekelte sich vor dem Dreck daran –, stieg er die Treppe hinauf, wandte sich nach rechts und ging vor bis zur Mitte des Flures. Schon bevor er die Tür erreichte, sah er, dass sie einen Spaltbreit offen stand.
Mit rasendem Puls blieb er davor stehen, lauschte, hörte aber kein Geräusch. Er zog seine Waffe, sah sich nach rechts und links um, drückte die Tür mit dem Knie auf und schob sich durch den erweiterten Spalt in die Wohnung. Dort lehnte er sich gegen die Tür und drückte sie mit dem Rücken ins Schloss.
Er entsicherte die Waffe und rief Annabells Namen.
Kein Laut.
Es gab hier keinen Flur. Durch die Eingangstür gelangte man sofort in den Wohnraum. Der war großzügig bemessen und wirkte durch die drei Meter hohe Decke beinahe wie ein Saal. Zwei Fenster befanden sich in der Wand gegenüber. Auf die zugezogenen Vorhänge schien die Abendsonne und tauchte den Raum in Orange.
Annabells Parfum lag in der Luft.
Sein Blick ging sofort zu dem weißen Sideboard neben der Tür. Von seinen zahlreichen Besuchen wusste er, dass sie dort ihre Handtasche, ihr Schlüsselbund und ihr Handy abzulegen pflegte. Kratzspuren auf dem weißen Lack zeugten davon, wie oft sie das getan hatte, aber heute war der Platz leer.
Die Tür war nur angelehnt, ihre wichtigen persönlichen Sachen waren nicht da, das konnte bedeuten, dass Annabell nicht in der Wohnung gewesen war, als jemand eingedrungen war. Es konnte aber auch genauso gut bedeuten, dass der Täter ihre Sachen mitgenommen hatte, nachdem er sie …
Eric dachte den Gedanken nicht zu Ende. Das musste er auch nicht. Er wusste aus Erfahrung, worauf es bei solchen Konstellationen hinauslief.
Die Waffe mit beiden Händen umklammert, den kurzen Lauf zu Boden gerichtet, schlich Eric in Richtung des Badezimmers.
Dabei passte er auf, keinen Gegenstand zu berühren. Soweit er wusste, putzte Annabell regelmäßig, und er konnte nur hoffen, dass sie es nach seinem letzten Besuch auch getan hatte, ansonsten würde es eng für ihn werden, sollte sich die Wohnung als Tatort entpuppen.
Die Tür zum Bad war ebenfalls nur angelehnt.
Eric blieb davor stehen, um zu lauschen. Diesmal hörte er etwas: ein leises Tropfen in kurzen, aber regelmäßigen Abständen. Vor seinem geistigen Auge entstand ein Bild. Er sah die ausladende Badewanne, in der er selbst schon gelegen hatte, sah die altmodische Armatur aus Bronzeimitat, von der sich Tropfen lösten, um in die mit rotem Wasser gefüllte Badewanne zu fallen. Sah den wunderschönen Körper darin, die Haut noch bleicher als sonst, weil alles Blut herausgelaufen war und sich mit dem Wasser vermischt hatte.
Eric stieß die Tür auf.
Die Wanne war gefüllt mit klarem Wasser. Niemand lag darin.
Obwohl er hätte erleichtert sein müssen, versetzte ihm der Anblick einen Stich, den er bis tief in seinen Eingeweiden spürte. Wenn Annabell die Wanne nicht selbst gefüllt und später vergessen hatte, den Stöpsel zu ziehen, dann hatte es der Anrufer getan.
Er wandte sich ab und durchsuchte auch die anderen beiden Zimmer der Wohnung. Annabell war nicht da. Als er wieder im Wohnraum ankam, vibrierte sein Handy.
Werkstatt ruft an.
«Du verschwendest Zeit, Stiffler», sagte die wässrige Stimme.
«Was soll die Scheiße?»
«Sie badet an eurem Lieblingsplatz unter der Weide, Stiffler, und ich fürchte, du kommst zu spät.»
5
Das einzige Taxi parkte nicht vor der S-Bahn-Endstation, sondern im Schatten unter den Kastanienbäumen etwa hundert Meter entfernt. Schon als Lavinia sich dem silbernen Škoda mit dem gelben Schild auf dem Dach näherte, konnte sie erkennen, dass der Fahrer schlief. Vielleicht hatte er Pause und stand deshalb nicht auf dem Taxistreifen. Obwohl ihr Budget es nicht hergab und sie die Fahrt später sicher bereuen würde, hatte Lavinia sich entschieden, nicht zu Fuß durch die Flusswiesen zu gehen, sondern ein Taxi zu nehmen. Das hatte sie früher schon ein paar Mal getan, aber bisher nur im Winter, wenn es nach Feierabend bereits dunkel und ihre Angst mal wieder zu groß gewesen war.
Von der letzten S-Bahn-Haltestelle bis zu dem Haus, in dem sie zur Miete wohnte, war es ein Fußmarsch von fünfzehn Minuten, vorbei an einem Sportplatz, durch den kleinen Rhododendronpark und die Flusswiesen bis in ihr Wohnviertel. Diese fünfzehn Minuten genoss Lavinia in der Regel sehr, denn nach einem Achtstundentag in den Ausdünstungen der Billigklamotten war die frische Luft am Fluss wie eine Offenbarung.
Doch heute fürchtete sie sich.
Die Bahnfahrt hatte vierzehn Minuten gedauert. Die Zeit hatte nicht ausgereicht, um sich von dem Vorfall in der Innenstadt zu erholen. Lavinia war immer noch verwirrt und verängstigt. Vor dem Aussteigen aus der Bahn hatte sie ihr Schlüsselbund so in die Faust genommen, dass der längste Schlüssel zwischen Zeige- und Mittelfinger herausragte und als Stichwaffe dienen konnte.
Erst als sie das Taxi erreichte, ließ sie das Schlüsselbund in ihrer Handtasche verschwinden. Dann pochte sie heftig gegen die Seitenscheibe und riss den Fahrer aus dem Schlaf. Er schoss aus seiner Liegeposition hoch und sah für einen Moment so aus, als wüsste er nicht, wo er sich befand.
Er ließ das Fenster hinunter.
«Ich habe eigentlich …»
«Lassen Sie mich rein, bitte!»
Er brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, um die Türen zu entriegeln.
Lavinia stieg hinten ein.
«Fahren Sie», sagte sie und schaute durch das Heckfenster.
Der Fahrer startete den Motor und fuhr los.
«Alles in Ordnung mit Ihnen?», fragte er.
Lavinia wartete ab, bis sie die Haltestelle nicht mehr sehen konnte. Erst dann entspannte sie sich etwas, drehte sich um und sah den Taxifahrer im Rückspiegel an.
Er war etwa dreißig Jahre alt, hatte volles braunes Haar, eine blasse Gesichtsfarbe mit dunklen Schatten unter den Augen und vielleicht zehn Kilo Übergewicht. Er trug Jeans und ein einfaches schwarzes T-Shirt. Aus dem Rückspiegel blickten Lavinia bernsteinfarbene Augen an. Sie warf einen raschen Blick auf seine rechte Hand, die auf dem Schalthebel ruhte. Er trug keinen Ehering. Der Blick stammte aus ihrem anderen Leben, ein Reflex, den sie nicht mehr abstellen konnte.
«Ja, alles in Ordnung», sagte sie zögernd.
Natürlich musste ihr Verhalten einen merkwürdigen Eindruck auf den Fahrer gemacht haben. Jetzt, in der Sicherheit des Wagens, fragte Lavinia sich, warum sie so heftig reagiert hatte. Ein Mann hatte im Schatten einer Markise gestanden, und sie hatte seinen Blick mehr gespürt als gesehen. Das war es auch schon gewesen.
Das war es nicht, und das weißt du ganz genau, rief die Stimme in ihrem Kopf.
«Sie sehen aber so aus, als seien Sie auf der Flucht vor jemandem», sagte der Fahrer.
Im Grunde war es ziemlich dreist, dass er sich in ihre Angelegenheiten einmischte, aber die Art und Weise, wie er sprach und Lavinia dabei ansah, zeigte ihr, dass er sich wirklich sorgte und sie nicht nur anbaggern wollte. Taxifahrer machten in ihrem Job eine ganze Menge mit und hatten oft ein sensibles Gespür für Notsituationen. In ihrem anderen Leben hatte Lavinia sie immer als hilfsbereit erlebt.
«Stimmt», sagte sie kurz entschlossen. «Ich hatte tatsächlich das Gefühl, verfolgt zu werden.»
«Soll ich Sie zur Polizei bringen?», bot der Fahrer an.
Lavinia schüttelte den Kopf.
«Ist nicht nötig.»
Sie beugte sich zwischen den Sitzen vor.
«Wie heißt du?», fragte sie.
Falls der Fahrer von der Frage und dem Du überrascht wurde, ließ er es sich zumindest nicht anmerken.
«Frank.»
«Schön, dich kennenzulernen, Frank. Ich bin Lavinia.»
Da sie ihm während der Fahrt nicht die Hand schütteln konnte, berührte sie ihn kurz an der Schulter. Sie wusste, wie sehr Männer auf kleine und scheinbar unbewusste Berührungen hübscher Frauen reagierten.
«Könntest du vielleicht umdrehen und zurück zur Endstation fahren?», bat sie ihn. «Ich möchte etwas überprüfen.»
«Klar doch», sagte Frank. «Für dich steige ich auch aus und stelle den Kerl zur Rede.»
Lavinia berührte ihn abermals an der Schulter und schenkte ihm ein Lächeln. Sie kannten sich seit zwei Minuten, und schon würde er sich für sie in den Kampf stürzen. Wie konnten Männer nur so wunderbar mutig und so erschreckend dumm zugleich sein?
«Ist nett von dir, aber wirklich nicht nötig. Ich möchte nur wissen, ob mir jemand mit der Bahn gefolgt ist.»
«Kein Problem», sagte Frank und drückte eine Taste am Taxameter. Die Digitalanzeige hatte bereits bei sechs Euro gestanden, sprang jetzt aber auf null.
«Ich schalte es an der Haltestelle wieder ein, und wir fangen noch mal von vorn an», sagte er.
«Nicht, dass du meinetwegen Ärger bekommst.»
Er grinste sie durch den Spiegel hindurch an.
«Ich bin mein eigener Chef, ist also kein Problem.»
Nach ein paar Minuten erreichten sie die Haltestelle. Frank reihte sich nicht hinter die beiden wartenden Taxen ein, sondern blieb in einiger Entfernung in der Feuerwehreinfahrt zur Turnhalle des Sportvereins stehen.
«In zwei Minuten kommt die nächste», sagte er nach einem Blick auf die Uhr.
Lavinia nickte abwesend. Zwei Teenager spielten mit ihren Skateboards vor einem Geländer, ein in Orange gekleideter Mitarbeiter des Bauhofs leerte eine Mülltonne auf die Ladefläche seines Transporters. Sie begann wieder an ihrem Fingernagel zu kauen. War er doch mit ihr zusammen ausgestiegen und beobachtete sie aus einem der vielen tiefen Schatten des Überdachs heraus?
«Steigst du jeden Tag hier aus?», fragte Frank und riss sie damit aus ihrer Konzentration.
Lavinia suchte seinen Blick im Spiegel.
«Warum?»
«Nur so. Ich dachte, ich hätte dich schon mal gesehen. Arbeitest du in der Stadt?»
«Wird das ein Verhör?», konterte sie, versuchte aber, ihre Stimme trotz der Anspannung nett klingen zu lassen. Seine Augen gefielen ihr. Die Farbe war faszinierend.
«Nein, nur Konversation. Gehört bei Taxifahrern zur Jobbeschreibung.»
«Und du nimmst es damit sehr genau, oder?», sagte Lavinia.
«Da kommt die Bahn», wich er der Frage aus.
Beide starrten hinüber.
Etwa ein Dutzend Pendler strömten aus der kleinen Vororthaltestelle. Die meisten von ihnen strebten auf den kleinen Parkplatz am Rand des Platzes zu und stiegen dort in ihre Fahrzeuge. Zwei Mädchen im Teenageralter begrüßten die Skater-Jungs und zogen lachend mit ihnen davon. Eine ältere Dame stieg in ein Taxi. Nach ein paar Minuten lag der Vorplatz wieder verlassen da.
«Hm», machte Frank. «Das war wohl nichts.»
Lavinia antwortete nicht. Sie starrte immer noch hinüber.
«Da kommt niemand mehr», sagte Frank.
Sie sah ein, dass er recht hatte, drehte sich um und nickte.
«Okay, fahr los», sagte sie und ließ sich erleichtert in den Sitz sinken.
Frank fuhr aus der Feuerwehreinfahrt, wendete den Wagen auf dem Vorplatz und gab Gas.
Aus dem Schatten der Haltestelle trat ein Mann und sah ihnen lange nach.
6
Kriminalhauptkommissar Eric Stiffler stand unter der mächtigen Weide, deren lange Äste einen grünen Vorhang bildeten und wie Angelschnüre in das trübe Wasser des Flusses eintauchten.
Das große Frühjahrshochwasser lag noch keine drei Monate zurück. Es hatte einiges an Treibgut den Fluss hinuntergespült, und ein paar kleinere Stämme hatten sich zwischen dem Ufer und den ein Stück weit ins Wasser hineinragenden Wurzeln der Weide verkeilt. An dieser Barriere waren Zweige, Äste und Gräser hängen geblieben, sie war angewachsen, Müll hatte sich angesammelt, das Rot einiger Coladosen blitzte daraus hervor, aber auch das gelbe M einer Frittenkette auf einer braunen Tüte.
Das Gesicht daneben war weiß.
Der Körper war unter der schwimmenden Barriere aus Treibgut verborgen, das Gesicht jedoch lag frei, die weit aufgerissenen Augen waren zum Himmel gerichtet. Vorwurfsvoll.
Warum kommst du jetzt erst, Eric?
Vielleicht waren das ihre letzten Gedanken gewesen, als sie um ihr Leben gekämpft hatte, vielleicht auch nicht, aber in Erics Kopf würde es für immer so sein. Der Anrufer mit der wässrigen Stimme hatte dafür gesorgt. Dieser Wichser kannte sich aus mit dem Innenleben der Menschen, er wusste, wie man Gedanken einpflanzte.
Sie badet, Stiffler … sie badet …
Eric wandte den Blick ab von Annabells totem Gesicht und sah auf. Es war still hier am Flussufer, wie meistens. Die Luft roch nach lebendigem Wasser, und der feine weiße Sand am Ufer gab jetzt die gespeicherte Wärme des Tages frei. An diesem Sandstrand hatte er oft mit Annabell gelegen, meistens am Abend, wenn dort kein Mensch mehr war. Es war der einzige Platz, an dem er sich mit ihr in die Öffentlichkeit gewagt hatte. Sie fand das romantisch, aber um Romantik war es ihm nicht gegangen, als er den Platz ausgekundschaftet hatte. Sondern nur um Abgeschiedenheit.
Zuletzt hatte er sich vor einem Monat mit Annabell hier getroffen. Mindestens von dem Tag an musste der Anrufer ihn also beobachtet haben. Ihm wurde schlecht bei dem Gedanken. Warum hatte er nichts bemerkt?
Nach dem Anruf in ihrer Wohnung hatte er beinahe eine Stunde vergehen lassen, bis er rausgefahren war. Er hatte sich gelähmt und kraftlos gefühlt und nicht gewusst, was er tun sollte. Ob er überhaupt etwas tun sollte. Am Ende hatte die Logik gesiegt. Er war von ihrem Handy aus angerufen worden, so etwas ließ sich nachvollziehen, aus der Sache kam er also nicht raus. Den Zeitverlust zu erklären würde schon schwierig genug werden.
Eric folgte mit seinem Blick der schmalen Teerstraße, die aus der Ortschaft Hönisch hierherführte, direkt neben der Weide aber in einen Feldweg überging. Folgte man diesem Feldweg, gelangte man nach vierhundert Metern an einen Wald. Dieser Wald wurde in vier Kilometer Entfernung vom Fundort der Leiche von der A 27 durchschnitten. Über den Feldweg kam man auf den Parkplatz der Raststätte und von dort aus auf die Autobahn – ein idealer Fluchtweg. Zwei weitere Möglichkeiten führten von hier über Wirtschaftswege auf die B 215 und von dort aus in alle Richtungen. Für ihn selbst war es immer ideal gewesen. Für den Täter natürlich ebenso.
Dr. Heinemann, Mitarbeiter der Rechtsmedizin, trat neben ihn.
Heinemann war ein emsiger kleiner Streber mit dem Gesicht einer Ratte: spitz und schmal und auf eine unangenehme Art neugierig. Seine Augen zuckten ständig hin und her, als hätte er Angst, irgendwas zu verpassen.
«Sie wollen nicht näher ran, nehme ich an», sagte Heinemann mit dem für ihn typischen Unterton.
Eric kannte den Mann mehr als fünfzehn Jahre und hatte ihn nie anders sprechen hören. Immer dieses Vorwurfsvolle und Anmaßende, so, als wären alle anderen schuld an seinem beschissenen Job!
«Es reicht ja, wenn sich einer von uns beiden nasse Füße holt», erwiderte er und erntete den erwarteten missbilligenden Blick.
Heinemann trug eine wasserdichte Wathose, die ihm bis unter die Achseln reichte und von seinem schmalen Körper abstand, als hätte er eine zweite Person daraus vertrieben. Die Hosenträger spannten an seinen knochigen Schultern.
«Ich muss wissen, ob sie angetrieben oder absichtlich dort abgelegt wurde», sagte Eric. «Den Rest können wir nach der Leichenschau besprechen.»
Er wollte sich schon abwenden, hielt aber noch mal inne.
«Ach ja, und suchen Sie doch bitte nach Ausweispapieren. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen.»
Ohne auf eine Entgegnung zu warten, wandte Eric sich ab. Heinemann hätte sowieso danach gesucht, er war schließlich Profi, aber Eric hatte sich für eine bestimmte Strategie entschieden, und danach kannte er die Leiche in dem Treibguthaufen nicht. Bisher hatte er nur gesagt, dass er von einem unbekannten Anrufer auf die Tote aufmerksam gemacht worden sei. Den Leuten, die ihn jetzt umgaben, musste er nichts weiter erklären, und alle anderen Details würde er sich später zurechtlegen. Jetzt hatte er dafür keinen Kopf. Immer, wenn er versuchte, logisch zu denken, schlich sich diese wässrige Stimme in seine Gedanken.
Sie badet, Stiffler … sie badet …
Er ging zurück zu seinem Wagen, den er zweihundert Meter den Weg hinauf an der Kreuzung abgestellt hatte. An die Motorhaube gelehnt stand dort Manuela Sperling und telefonierte. Sie quasselte auf ihr Handy ein, als verkaufe sie Zeitungsabos.
Die Sperling war seit heute seine Assistentin. Sie war mit ihrem Studium fertig, hatte sich für eine feste Dienststelle im Fachbereich Mord beworben und machte gerade den obligatorischen Lehrgang, im Rahmen dessen sie alle Inspektionen durchlaufen würde. Ihr Praktikum hier würde nicht länger als vier Wochen dauern, nur deswegen hatte Eric sich von seinem Chef überreden lassen, sich um das Küken zu kümmern. Er ahnte allerdings schon, dass es sehr lange vier Wochen werden würden. Schon während des kurzen Gesprächs zum Kennenlernen am Vormittag war sie ihm mit ihrer emsigen Art und dem losen Mundwerk auf die Nerven gegangen.
Manuela Sperling war fünfundzwanzig Jahre alt, erreichte gerade so die vorgeschriebene Mindestgröße von 1,63 und war mit vielleicht 50 Kilo viel zu dünn. Ein kräftiger Windstoß würde sie einfach davonpusten. Sie hatte braunes Haar, braune Augen und genau die Art von knabenhafter Figur mit kleinen Titten und kleinem Hintern, auf die Eric überhaupt nicht stand. Er hielt sowieso nichts von elfenhaften Wesen bei der Polizei, die sich im Falle eines Falles nicht verteidigen konnten. Gab es für solche Frauen keine anderen Jobs? In Krankenhäusern oder Schönheitssalons vielleicht?
Die Sperling besaß aber eine schnelle Auffassungsgabe, das hatte Eric schon bemerkt, und in ihr brannte das Feuer der Frischlinge, die sich noch beweisen mussten. Sie war übereifrig, übermotiviert und konnte kaum zwei Minuten lang den Mund halten. Alles in allem waren das keine guten Voraussetzungen, um mit ihr auszukommen – vor allem jetzt nicht.
Als er seinen Wagen erreichte, steckte sie mit einer an Zauberei grenzenden Bewegung das Handy weg. Eric wusste nicht einmal, in welche Tasche sie es hatte verschwinden lassen.
«Also», begann sie und hob ihre Augenbrauen. «Der Fluss führt seit genau vierundsechzig Tagen Normalwasser. Hochwasser gab es über einen Zeitraum von vierzehn Tagen von Mitte bis Ende März. Am ersten April fand auf diesem Teilstück des Flusses eine traditionelle Kanu-Hochwasserrallye statt, an der mehr als vierzig Kanuten teilnahmen. Man kann also davon ausgehen, dass einer von denen die Leiche …»
«So lange liegt sie noch nicht im Wasser», schnitt Eric ihr Geplapper ab.
Sie war erst vor ein paar Minuten angekommen und konnte nichts von dem Anrufer wissen. Eric hatte Polizeichef Hans Bender telefonisch über die Sache informiert, nachdem er die Leiche im Fluss gefunden hatte. Da war die Sperling gerade bei dem Alten im Büro gewesen, und der hatte sie sofort wieder rausgeschickt. Wahrscheinlich war sie Bender ebenso auf die Nerven gegangen wie ihm.
Eric hatte überhaupt keine Lust, sie jetzt einzuweihen. Er brauchte ein paar Minuten für sich allein. Seit dem Anruf waren die Ereignisse mit der Geschwindigkeit eines ICE über ihn hinweggerast.
«Was ist mit ihrer Hose?», fragte er und deutete auf das klaffende Loch auf ihrem Oberschenkel.
Schnell presste sie ihre Hand darauf.
«Nichts, ich äh … hatte einen kleinen Unfall.»
«Unfall. Aha. Na schön. Dann gehen Sie doch bitte zu Heinemann. Der braucht Hilfe bei der Bergung, und Sie können noch was lernen. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht verunglücken.»
«Aber ich …»
«Gehen Sie schon.»
Sie verzog ihren zugegebenermaßen hübschen Mund zu einer Schnute, sah ihn mit einem prüfenden Blick an, machte sich dann aber auf den Weg.
Als sie fort war, lehnte sich Eric an die Motorhaube und zündete sich eine Zigarette an. Er war weit genug vom Fundort der Leiche entfernt, die Geräusche drangen nicht bis zu ihm, und es hatte etwas Tröstliches, den Spurentechnikern dabei zuzusehen, wie sie in akribischer Langsamkeit ihrer Arbeit nachgingen. Die drei Krähen in der hohen Krone der Weide schienen das genauso zu sehen. Vielleicht trauerten sie aber auch nur einem vielversprechenden Abendessen nach.
Im Inneren seiner Jacke begann das Handy zu brummen.
Eric erstarrte, und obwohl er es eigentlich nicht tun wollte, holte er es doch hervor.
Annabells Nummer.
«Ja», meldete er sich.
«Ich wusste, du würdest zu feige sein, Stiffler.»
«Ich werde dich erwischen, du krankes Arschloch, und dann werden wir beide zusammen ein Bad nehmen.» Stifflers Stimme kippte fast.
Der Anrufer lachte.
«Du weißt gar nicht, wie recht du damit hast, Stiffler. Am Ende werden wir alle baden. Denk an meine Worte. Wir hören bald wieder voneinander.»
«Wer bist du?», fragte Eric.
Rasselnde, schleimige Atemgeräusche drangen aus dem Telefon, und Eric meinte, etwas Feuchtes an seinem Ohr zu spüren.
«Das weißt du doch, Stiffler.»
«Nein. Sag es mir.»
Stille. So tief wie ein Bergsee.
«Der Wassermann, Stiffler. Ich bin der Wassermann.»
7
«Warum will er sich mit dir an einem See treffen? Findest du das nicht merkwürdig?», fragte Lavinia und sah ihre Freundin an.
«Bullshit», sagte Susan. Es war ihr Lieblingswort, sie benutzte es dauernd, und Lavinia kannte niemanden, bei dem es fröhlicher klang. «Bei diesem Wetter ein paar Stunden in der Sonne liegen, was ist daran merkwürdig? Das kann ich doch nicht ablehnen. Schon gar nicht, wenn ich dafür auch noch Geld bekomme.»
Seit sie angefangen hatten, für ihren großen Traum zu sparen, nahm Geld einen viel zu großen Raum in ihrem Leben ein. Vor allem Susan war gierig geworden und beachtete kaum noch die Sicherheitsregeln, die sie sich selbst auferlegt hatten.
«Und warum kann er nicht ein Hotelzimmer buchen wie die anderen auch?», fragte Lavinia.
Susan zuckte mit den Schultern und steckte die großen, perlmuttfarbenen Ohrringe in ihre Ohrläppchen. Sie waren handtellergroß und sehr auffällig. Susan liebte diese Art von Modeschmuck und war meistens behangen wie ein Weihnachtsbaum. Sie besaß eine große Kiste voll von dem Zeug. Bis auf ein paar Stücke, die richtig teuer gewesen waren, war das meiste billiger Tand.
«Ist ihm zu peinlich, sagt er. Und bei ihm zu Hause geht es wegen seiner Mutter nicht. Ich sag dir, der ist so verklemmt, da läuft heute gar nichts. Ich werde ein bisschen in der Sonne liegen und mich bräunen, das ist alles. Der Typ ist in Ordnung, glaub mir. Die ersten beiden Male hat er sich kaum getraut, mich anzuschauen. Der ist fast noch ein Kind, ein großes, schüchternes Kind. Aber süß.»
Lavinia schüttelte den Kopf. «Ich weiß nicht.»
«Komm, hab dich nicht so. Du fährst doch hinterher. Was soll schon passieren?»
Susan zwinkerte ihr aufmunternd zu, stieg dann mit einer einzigen eleganten Bewegung aus dem engen Wagen, schlug die Tür zu, klopfte einmal aufs Dach und lief über die Straße. Sie war eins achtzig groß und hatte lange, schlanke Beine, die in Röhrenjeans atemberaubend aussahen. Ihr Gang war selbstbewusst, sie ging mit gestreckten Schultern, den Kopf erhoben. Susan versuchte nie, sich kleiner zu machen oder gar zu verstecken. Lavinia beneidete sie ein wenig um dieses Selbstbewusstsein.
Sie musste keine fünf Minuten warten, bis ein schwarzer Volvo an der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite hielt. Die Person hinterm Steuer konnte Lavinia nicht erkennen, weil sie selbst hinter einer Buchenhecke versteckt parkte. Sie sah Susans blondes, langes Haar, mehr nicht. Dem Kunden hatte Susan gesagt, sie würde mit dem Bus zu diesem Treffpunkt kommen. Er musste nicht wissen, dass sie zu zweit unterwegs waren und er beobachtet wurde.
Lavinia wartete, bis der Volvo in ihrem Rückspiegel kaum noch zu sehen war. Dann wendete sie den kleinen Twingo und folgte ihnen. Bei dem schwachen Verkehr hatte sie keine Probleme damit, weit zurück zu bleiben und dennoch den Anschluss nicht zu verlieren. Die Fahrt dauerte keine zwanzig Minuten, dann bog der Volvo von der Landstraße in einen unbefestigten Feldweg ab. Lavinia wartete, bis er nicht mehr zu sehen war, und fuhr dann hinterher. Das hohe Gras streifte am Unterboden des Wagens entlang. Rechts und links stand das Getreide hüfthoch.
Lavinia stoppte den Wagen, als die Getreidefelder in offene Feuchtwiesen übergingen und sie ihren Sichtschutz verlor. Sie stieg aus, ging ein paar Meter vor und sah den schwarzen Volvo am Ende des Feldweges vor einer hölzernen Schranke unter Bäumen stehen. Susan und der Fahrer saßen schon nicht mehr darin. Den See konnte Lavinia nicht sehen, weil er von einem dichten Baumgürtel umgeben war. Sie lief zu ihrem Wagen zurück und fuhr ein paar Meter vor, parkte und behielt den Volvo im Auge.
Schon nach fünf Minuten klingelte ihr Handy.
«Ich bin’s», meldete sich Susan. Sie klang unbeschwert. «Du glaubst es nicht, der Typ ist so schüchtern, der wollte mich nicht einmal mit Sonnencreme einreiben.»
«Wo ist er denn?», fragte Lavinia.
«Im Wasser. Er schwimmt. Ich hab’s ja gesagt, hier läuft heute nichts. Na, wenigstens werde ich schön braun.»
«Okay, ruf mich, wenn etwas ist. Ich müsste dich hier hören können.»
Lavinia legte auf. Sie war erleichtert. So wie Susan geklungen hatte, war wirklich alles in Ordnung, und wenn der Typ lieber schwamm, als sich mit einer schönen Frau zu beschäftigen, dann war er selbst schuld. Vielleicht, so dachte Lavinia, sollte sie öfter mal auf Susans Menschenkenntnis vertrauen. Die schien besser zu sein als ihre eigene, obwohl sie nur zwei Jahre älter war. Allerdings war Susan auch durch eine ganz andere, viel härtere Schule gegangen als sie selbst.
Susan war bis zu ihrem achten Lebensjahr bei ihrer Mutter aufgewachsen, ihren Vater kannte sie nicht. Ihre Mutter war psychisch labil gewesen, hatte sie geschlagen, einige Therapien durchgemacht und war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, um ein Kind aufzuziehen. Deshalb war Susan bei vier verschiedenen Pflegefamilien gewesen, hatte dort aber immer wieder Probleme gehabt. Sie war ein Freigeist, der sich nicht unterordnen wollte und seine eigenen Vorstellungen vom Leben hatte, auch in jungen Jahren schon. In die biedere Spießigkeit einer angepassten Durchschnittsfamilie passte sie nicht. Sie sprach nicht über das, was zwischen ihr und ihrer Mutter vorgefallen war, und auch nicht darüber, was sie in den Pflegefamilien erlebt hatte, aber immer, wenn sie in Gesprächen am Rand ihrer Erinnerungen entlangschrammte, konnte Lavinia den Schmerz und die Enttäuschung in den Augen ihrer Freundin sehen.
Sie selbst hatte immerhin bis zum fünfzehnten Lebensjahr Liebe und Fürsorge erfahren. Bevor ihre eigene Welt zerbrochen war.
Lavinia musste daran denken, dass ihre Mutter morgen Geburtstag hatte. Ein Jahr lang hatte sie sich immer wieder vorgenommen anzurufen, spürte aber, dass sie es wieder nicht tun würde. Sie hatten schon seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Ihre Mutter gab ihr eine Teilschuld am Tod ihres Vaters. Anfangs hatte Lavinia sie aus Wut darüber nicht angerufen. Jetzt tat sie es aus Scham nicht, denn ihre Mutter hatte recht.
Im Wagen wurde es ihr zu heiß, deshalb stieg Lavinia aus. Sie war gerade bis zur Motorhaube gekommen, da hörte sie den Schrei.
Laut und gellend.
Ohne nachzudenken, lief Lavinia los. Vorbei an dem Volvo, über die hölzerne Schranke, einem schmalen Weg folgend, dann durch dichtes Gebüsch, bis sie schließlich das Seeufer erreichte.
Was sie dort sah, ließ ihr Herz aussetzen.
Susan war im Wasser. Sie schwamm mit wilden, unkontrollierten Bewegungen auf das Ufer zu, hatte es auch schon fast erreicht, wurde dann aber mit einem heftigen Ruck unter Wasser gezogen und verschwand.
Lavinia rang ihre Angst nieder, überwand ihre Schockstarre, sah sich suchend um und entdeckte einen armdicken Ast im Unterholz. Sie hob ihn auf und lief damit zum Ufer. Als sie es erreichte, durchbrach Susan wieder die Wasseroberfläche, spie hustend und würgend Wasser aus und kraulte auf sie zu.
Lavinia watete bis zu den Knien ins Wasser, streckte einen Arm aus und half ihrer Freundin heraus.
«Wo ist er?», schrie sie.
«Im Wasser … im Wasser.»
Vor ihr tauchte ein Kopf auf, zumindest glaubte Lavinia das. Sie schlug zu. Sie spürte einen Widerstand, wusste aber nicht, ob sie ihn getroffen oder nur aufs Wasser geschlagen hatte.
Rückwärts, die Wasseroberfläche immer im Auge, den Ast zum Schlag erhoben, stolperte Lavinia mit Susan aus dem See ans Ufer.
«Komm her, du Arschloch», schrie sie in Angst und Wut, und ihre Worte trugen weit über den See.
«Hast du ihn getroffen?», keuchte Susan hinter ihr.
«Ja, am Kopf, ich hab ihn am Kopf getroffen.»
Lavinia zitterte am ganzen Körper. Sollte er auftauchen, würde sie so lange auf seinen verdammten Schädel einschlagen, bis er sich nicht mehr rührte. Er sollte nie wieder eine Chance bekommen, eine Frau anzugreifen!
Doch das Wasser blieb still. Es schien den Mann nicht mehr hergeben zu wollen.
Hatte sie ihn getötet?
Die Erinnerung war heiß und schmerzhaft. Die Tränen liefen wie Sturzbäche über ihre Wangen und versickerten im Kissen. Lavinia hatte ihren Kampf verloren, die Bilder ließen sich nicht zurückdrängen, dafür war das Gefühl, verfolgt zu werden, zu intensiv gewesen. Der Taxifahrer Frank hatte sie vor ihrem Haus abgesetzt und sogar noch gewartet, bis sie ihm aus dem vorderen Fenster heraus ein Zeichen gegeben hatte, dass alles in Ordnung war. Lavinia hatte, ohne vorher etwas zu essen, das erste Glas Rotwein nur so heruntergestürzt. Das war vor vier oder fünf Stunden gewesen. Jetzt war die Flasche leer, ihr Kopf schwer, aber der Alkohol hatte die Erinnerungen nicht zurückgedrängt. Er hatte sie nicht einmal blasser oder weniger schmerzhaft gemacht. Alles war noch genau so präsent, als wäre es erst gestern geschehen und nicht vor drei Jahren.
Nichts davon würde jemals verschwinden, nicht, solange sie in diesem Land und in dieser Stadt blieb. In jedem Schatten und hinter jeder Ecke lauerte er, jedes nächtliche Geräusch ließ die Angst erneut aufflammen. Da half es nicht, dass sie von neugierigen Nachbarn umgeben war, die alles mitbekamen.
Und die Nächte waren nach wie vor am schlimmsten.
Nicht alle, aber die schlaflosen, in denen die Bilder kamen. Dieses leuchtende Rot zwischen all dem Weiß, das schwarze Haar, ausgebreitet wie die Federn eines Pfaus, das nackte Fleisch …
Lavinia stöhnte laut und presste sich die Handballen auf die Augen, bis es weh tat und sie Sterne sah. Schmerz und Sterne waren immer noch besser, viel besser als diese entsetzlichen Bilder.
8
Die Dämmerung hatte eingesetzt, und der Himmel wechselte seine Farbe. In das Kobaltblau des Tages sickerte die Dunkelheit. Im Westen verteidigte noch ein heller Streifen den Horizont, aber über dem Osten lag bereits die sterngesprenkelte Schwärze der Nacht.
Frank Engler holte eine Packung Malboro aus der Seitenablage seines Taxis, klopfte eine Zigarette heraus und zündete sie an. Ans Auto gelehnt betrachtete er den Himmel. Diese Tageszeit mochte er besonders. Sie löste den Stress und Lärm des Tages ab, und wenn man sich darauf einließ, konnte man sich wie der einzige Mensch auf Erden fühlen.
Heute klappte das nicht, da Frank immer noch aufgeregt war. Schuld daran trug einzig und allein die Frau, die er von der S-Bahn nach Hause gefahren hatte: Lavinia. Jetzt, mehr als vier Stunden später, ärgerte er sich darüber, sie nicht zum Essen oder auf einen Kaffee eingeladen zu haben. Sie faszinierte ihn, und er hätte sie gern näher kennengelernt.
Aber er wusste, warum er sie nicht eingeladen hatte. Es war keiner Frau zuzumuten, mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen zu werden, um nach einem abgetrennten Bein zu suchen. Oder stets befürchten zu müssen, dass sich die Grenze zwischen Realität und Wahn irgendwann öffnete und das Messer im Rücken nicht länger nur eine unschöne Vorstellung blieb. Er war unzumutbar für jede Frau, und deshalb blieb er lieber allein. Nach all den Jahren war die Einsamkeit sein bester Freund geworden. Ein Freund, der schweigen konnte und keinen Anstoß nahm an blutbesudelten Laken, Nächten voller Angst oder Aussetzern, die andere Menschen das Leben kosten konnten.
Trotz alledem … diese Lavinia würde er wirklich gern wiedersehen.
Sein Handy klingelte. Er beugte sich ins Taxi, nahm es aus der Halterung und drückte den grünen Knopf.
«Hast du schon Schluss gemacht?», fragte Barbara.
Sie nahm es ihm nie krumm, wenn er mal vergaß, sich abzumelden. Streng genommen war er sein eigener Chef. Das Taxi gehörte ihm, und er fuhr auf eigene Rechnung, aber Teamwork war in einem kleinen Familienunternehmen unabdingbar.
«Nein, bin noch voll da. Hast du was für mich?»
«Draußen am Campingplatz beim Stedeberger See will jemand abgeholt werden.»
«Um diese Zeit! Wohin will er denn?»
«Hat er nicht gesagt. Er steht vorn an der Bushaltestelle.»
«Okay, ich fahr hin. Danach mach ich dann Schluss.»
«Alles klar, bis morgen … Und schlaf gut.»
Diesen Witz musste Barbara immer anhängen, sie konnte einfach nicht anders. Er war ihr nicht böse deswegen. Sie und Helmut durften das. Sie waren die einzigen Menschen, die ihn wirklich kannten. Ohne ihre Hilfe würde er wahrscheinlich vom Sozialamt leben.
Frank warf die Zigarette auf den Asphalt, trat sie aus, stieg ein und fuhr los. Bis zum Campingplatz am See dauerte es zwölf Minuten. Als er dort ankam, war es bereits dunkel. Um diese Zeit hatte er noch nie jemanden aus dieser einsamen Ecke weit draußen abgeholt. Hier gab es nichts weiter als Wald, Wiesen, den See und den Campingplatz, der zu dieser Jahreszeit noch nicht allzu gut besucht war. Die Camper blieben lieber unter sich. Von denen wollte kaum mal jemand abends in die Stadt.
Als er langsam auf die Bushaltestelle zurollte, war Frank schon ein bisschen mulmig zumute, und er erschrak, als tatsächlich ein Mann aus dem tiefen Schatten hervortrat.
Er war dunkel gekleidet und hielt den Rücken krumm.
Wie ein Wiesel eilte er auf das Taxi zu und war drin, ehe Frank es sich anders überlegen konnte.
9
Nach der Scheidung vor zwei Jahren war Eric Stiffler in dem gemeinsamen Haus geblieben. Kathi hatte keinen Anspruch darauf erhoben, aber eine faire Auszahlung erwartet. Die hatte sie bekommen – und ihn damit finanziell an den Rand des Ruins getrieben. Dafür durfte Eric in einem viel zu großen Haus mit einer viel zu hohen Hypothek leben, in dem er von neun Zimmern nur drei ständig nutzte: die Küche, das Bad und das Wohnzimmer. Ins Schlafzimmer kam er nur unregelmäßig, weil er die meisten Nächte auf der ausziehbaren Couch vor dem Fernseher verbrachte.
Trautes Heim, Glück allein.
Seine Augen brannten. Er konnte sie kaum noch offen halten, als er spätabends endlich die Tür hinter sich zudrückte und sorgfältig abschloss. Er legte sogar die Sicherheitskette vor – eine Anschaffung seiner Frau –, obwohl ihm klar war, dass sie zu nichts nütze war.
Im Haus war es warm und stickig. Wie immer waren tagsüber alle Fenster geschlossen gewesen. Er beließ es auch jetzt dabei. Statt zu lüften, zog er sich bis auf die Unterhose aus, ging dann in die Küche und holte eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Er entfernte den Kronkorken und trank den ersten Schluck an die Arbeitsplatte gelehnt.
Die Hoffnung, mit dem Bier den Tag hinunterspülen zu können, erfüllte sich natürlich nicht. So viel Bier konnte er gar nicht trinken, dass sich diese Bilder vertreiben ließen.
Ein Geschenk für Stiffler.
Die Worte waren nach dem vorläufigen Urteil Heinemanns mit einem Lötkolben in die zarte Bauchhaut gebrannt worden. Ob vor oder nach ihrem Tod, würde die Leichenschau ergeben.
Eric setzte die Flasche ab und hielt inne.