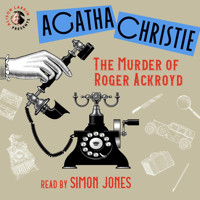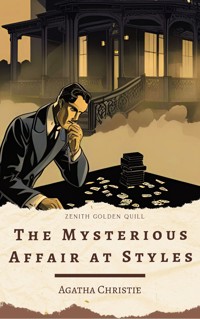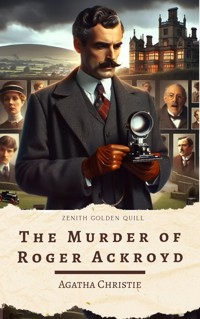16,99 €
Mehr erfahren.
Ob Miss Marple oder Hercule Poirot, ob Petrus, Maria und Josef oder Esel, Ochs und Kamel: Ihnen allen und vielen weiteren Figuren schenkt Agatha Christie in ihren Weihnachtsgeschichten einen denkwürdigen und charmanten Auftritt. Mal kriminell, mal besinnlich, oft überraschend und immer höchst unterhaltsam, laden die Geschichten der Queen of Crime zum ganz besonderen Einstimmen auf die Weihnachtszeit ein. Dieser Band versammelt sämtliche Weihnachtsgeschichten von Agatha Christie in hochwertiger Ausstattung, teilweise in neuer Übersetzung - das ideale Geschenk für Fans der legendären Autorin und für alle, die sich selbst auf eine genüssliche Lektürezeit voll Nostalgie zum Jahresausklang freuen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Agatha Christie
Weihnachten mit Agatha Christie
Alle Geschichten zum Fest
Aus dem Englischen von Günter Eichel, Lia Franken, Hans Erik Hausner, Michael Mundhenk, Renate Orth-Guttmann und Lotte Schwarz
Atlantik
Weihnachten auf Abney Hall
Wir pflegten die Weihnachten in Cheshire bei den Watts zu verleben. Um diese Zeit bekam Jimmy seinen Urlaub, und dann fuhr er mit Madge auf drei Wochen nach St. Moritz. Er war ein sehr guter Eisläufer, und deshalb behagte ihm diese Art von Urlaub am besten. Mutter und ich pflegten nach Cheadle hinaufzufahren, und da ihr neues Haus, das Manor Lodge hieß, noch nicht fertig war, verbrachten wir die Weihnachtsfeiertage mit den alten Watts, ihren vier Kindern und Jack auf Abney Hall. Für ein Kind war es ein wunderbares Haus, um darin Weihnachten zu feiern. Es besaß nicht nur eine Unzahl von Zimmern, Gängen, unerwarteten Stufen, Vordertreppen, Hintertreppen, Alkoven, Erkern – alles, was ein Kind sich nur wünschen kann –, sondern auch eine Orgel und drei verschiedene Klaviere, welche man spielen konnte. Was dem Haus fehlte, war Tageslicht. Es war ziemlich dunkel, ausgenommen der große Salon mit seinen grünen Seidentapeten und den großen Fenstern.
Abney Hall war ein wahres Schlemmerparadies. Mrs Watts’ sogenannte Speisekammer grenzte an die Halle an. Sie hatte nichts mit Omas Speisekammer gemein, dieser uneinnehmbaren Festung, aus der nur zu gewissen Tageszeiten Lebensmittel ausgegeben wurden. Hier hatte jedermann freien Zutritt, und an den Wänden standen Regale voll mit Naschereien aller Art. Schokolade in Tafeln, Schokoladebonbons, Kekse, Pfefferkuchen, eingemachte Früchte, Marmeladen und so weiter.
Weihnachten war das Fest aller Feste; es wird mir immer unvergesslich bleiben. Das Frühstück, wo jedes Kind schon sein Geschenk vorfand. Dann eilig zur Kirche und schnell wieder zurück, um weitere Geschenkpakete zu öffnen. Um zwei Uhr das Weihnachtsessen bei zugezogenen Vorhängen, hellem Licht und glitzernden Ornamenten. Austernsuppe (die ich nicht mochte), Steinbutt, gekochter Truthahn, gebratener Truthahn und ein riesiges Stück Roastbeef. Anschließend Plumpudding, Fleischpasteten, einen Auflauf und zum Nachtisch natürlich eine Menge köstlicher Süßigkeiten. In meinem Buch Ein diplomatischer Zwischenfall habe ich solch ein Festmahl ausführlich beschrieben. Es ist eines von jenen Dingen, die man in dieser Generation bestimmt nicht mehr erleben wird. Und ich bezweifle auch, dass es die Verdauung eines Menschen von heute durchstehen könnte. Unsere Verdauung allerdings stand es ausgezeichnet durch. An Verfressenheit wetteiferte ich mit Humphrey Watts, der altersmäßig nach James kam. Mit seinen einundzwanzig oder zweiundzwanzig war er etwa zehn Jahre älter als ich. Er war ein sehr gut aussehender junger Mann, dazu noch ein guter Schauspieler, unterhaltend und ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Sosehr ich dazu neigte, mich in Leute zu verlieben, in ihn verliebte ich mich nicht, was mich noch heute in Erstaunen setzt. Ich befand mich wohl noch in einem Stadium, in dem meine Affären ebenso romantisch wie unmöglich waren. Sie betrafen Personen des öffentlichen Lebens wie etwa den Bischof von London und König Alfons von Spanien, natürlich auch verschiedene Schauspieler. Ich weiß, dass ich mich unsterblich in Henry Ainley verliebte, als ich ihn in The Bondman erlebte.
Humphrey und ich aßen uns gewissenhaft durch das Weihnachtsdinner. Die Runde der Austernsuppe entschied er für sich, von da an aber ging es Kopf an Kopf. Beide aßen wir zuerst Truthahnbraten, dann gekochten Truthahn und schließlich vier oder fünf gewaltige Scheiben Roastbeef. Danach machten wir uns über den Plumpudding, die Fleischpasteten und den Auflauf her. Danach gab es Kekse, Trauben, Orangen und eingemachte Früchte. Am Nachmittag schließlich holten wir aus der Speisekammer noch einige Handvoll Pralinen, die uns besonders zusagten. War mir am nächsten Tag übel? Hatte ich Gallenbeschwerden? Nicht die Spur. Beschwerden hatte ich im September, wenn ich unreife Äpfel aß. Unreife Äpfel aß ich praktisch täglich, aber gelegentlich tat ich wohl des Guten zu viel.
Ich erinnere mich noch, welch ein Theater ich aufführte, als ich sechs oder sieben war und Pilze gegessen hatte. Um elf Uhr nachts wachte ich mit Schmerzen auf und stürzte in den Salon hinunter, wo meine Eltern mit Freunden zusammensaßen, und verkündete in dramatischem Ton: »Ich werde sterben! Ich habe mich mit Pilzen vergiftet!« Mutter beruhigte mich schnell, gab mir ein paar Schluck Brechwurzwein zu trinken – der in jenen Tagen in allen Medizinkästchen zu finden war – und versicherte mir, dass ich heute noch nicht sterben würde.
Jedenfalls erinnere ich mich nicht, zu Weihnachten jemals krank gewesen zu sein. Mit Nan Watts war es das Gleiche, sie hatte einen unverwüstlichen Magen. Und wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, dass damals alle Leute recht gute Mägen hatten. Ich nehme an, dass manche Menschen Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre hatten und aufpassen mussten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass einer nur von Fisch oder Milch gelebt hätte. Eine bäurische, gefräßige Zeit? Ja, aber auch eine Zeit des Lebensgenusses und der Lebensfreude. Wenn ich bedenke, was ich in meiner Jugend gefuttert habe – denn ich war immer hungrig –, kann ich einfach nicht verstehen, wie ich es schaffte, so mager zu bleiben – eine richtige Bohnenstange.
Nach der wohltuenden Untätigkeit des Weihnachtsnachmittags – Untätigkeit für die Älteren; die Jungen lasen, besahen sich ihre Geschenke, knabberten Schokolade – gab es einen herrlichen Tee mit einer großen, mit Zuckerglasur überzogenen Weihnachtstorte und alles Mögliche dazu und ein Abendessen, bestehend aus kaltem Truthahn und heißen Fleischpasteten. Gegen neun Uhr wurde der Weihnachtsbaum angezündet, an dem noch mehr Geschenke hingen. Ein wunderbarer Tag, an den man sich noch lange erinnerte – bis zum nächsten Weihnachtsfest.
Auch während des Jahres kam ich mit Mutter nach Abney Hall, und es war immer wunderschön. Im Garten, unter der Auffahrt, gab es einen Tunnel, der mir für das historische Drama, das ich gerade im Geiste über die Bühne gehen ließ, von großem Nutzen war. Gestikulierend stolzierte ich dort herum und murmelte vor mich hin. Sicherlich dachten die Gärtner, ich wäre nicht ganz normal, aber ich versuchte nur, mich in meine Rolle hineinzuversetzen. Es kam mir nie in den Sinn, etwas aufzuschreiben – und was die Gärtner von mir dachten, interessierte mich herzlich wenig. Gelegentlich spaziere ich auch heute noch in der Gegend herum und murmle vor mich hin – wobei ich versuche, ein Kapitel, das nicht so recht vorangeht, »hinzukriegen«.
Meine schöpferischen Kräfte entfaltete ich auch bei Sofakissen, die damals weitverbreitet waren. Daher waren bestickte Kissenüberzüge stets willkommen. In den Herbstmonaten war ich mit Feuereifer beim Sticken. Anfangs pflegte ich Abziehbilder zu kaufen, übertrug sie mit einem heißen Bügeleisen auf Satin und stickte dann mit Seide nach. Später kam ich von den Abziehbildern ab, weil es immer die gleichen Motive waren, und ich fing an, Blumenbilder von Porzellan zu kopieren. Wir hatten einige große Berliner und Dresdner Vasen mit wunderschönen Blumensträußen darauf; ich pauste sie ab, übertrug sie auf Satin und versuchte die Farben so getreu wie möglich nachzuahmen. Oma B. war sehr froh, als sie davon hörte; sie hatte in ihrem Leben so viel gestickt, dass ihr der Gedanke, eine Enkelin folge ihr auf diesem Wege, große Freude machte. Ihre eigene Kunstfertigkeit erlangte ich allerdings nicht, ich konnte nie so perfekt Landschaften und Figuren sticken wie sie. Ich besitze zwei Ofenschirme von ihr, beide exquisit gearbeitet: einen mit einer Schäferin, einen anderen mit einem Schäferpaar unter einem Baum, in dessen Rinde sie ein Herz schnitzen. Wie befriedigend muss doch diese Beschäftigung an den langen Winterabenden für die großen Damen zur Zeit der Wandteppiche von Bayeux gewesen sein!
Mr Watts, Jimmys Vater, war ein Mensch, in dessen Gegenwart mich eine seltsame Scheu befiel. Er pflegte mich »Traumkind« zu nennen – ich wand mich jedes Mal vor Verlegenheit. »Woran denkt jetzt unser Traumkind?«, pflegte er zu sagen. Ich wurde puterrot im Gesicht. Oft bat er mich, ihm irgendwelche sentimentalen Lieder vorzuspielen und vorzusingen. Ich konnte ganz gut Noten lesen, und so schleppte er mich zum Klavier, und ich musste ihm seine Lieblingslieder singen. Er war ein künstlerisch veranlagter Mensch und malte Landschaften mit Mooren und Sonnenuntergängen. Er war auch ein großer Möbelsammler, und seine Spezialität waren alte Eichenmöbel. Zusammen mit seinem Freund Fletcher Moss machte er auch gute Aufnahmen und veröffentlichte mehrere Bildbände mit Fotografien berühmter Häuser. Ich wollte, ich wäre ihm gegenüber nicht so schüchtern gewesen, aber ich war ja in einem Alter, in dem man ganz besonders gehemmt ist.
Viel lieber mochte ich Mrs Watts. Sie war ein erfrischend lebhafter, durch und durch wirklichkeitsnaher Mensch. Nan, die zwei Jahre älter war als ich, gefiel sich in der Rolle eines enfant terrible und hatte besondere Freude daran, zu schreien, ungezogen zu sein und hässliche Worte zu gebrauchen. Es schmerzte Mrs Watts, wenn Nan ihre »Verflucht!« und »Verdammt!« abfeuerte. Sie mochte es auch nicht leiden, wenn ihre Tochter auf Vorhaltungen mit »Ach, sei doch nicht so dumm, Mutter!« reagierte. Nie hätte sie sich gedacht, dass eine Tochter so zu ihrer Mutter sprechen könnte, aber in der Welt war eine Zeit angebrochen, wo man offen und unverblümt miteinander redete. Nun ja, die meisten Mütter müssen so ein Stadium durchmachen, in dem ihre Töchter sie auf diese oder jene Weise in eine harte Schule schicken.
Am zweiten Feiertag besuchten wir immer das Weihnachtsspiel in Manchester – und es waren ausgezeichnete Weihnachtsspiele. Auf der Heimfahrt im Zug sangen wir noch einmal alle Lieder durch, die wir gehört hatten.
Das Weihnachtsspiel in Manchester war nicht mein erstes. Oma hatte mich schon einmal ins Drury-Lane-Theater geführt. Dan Leno spielte die Märchenerzählerin. Ich kann mich noch gut an dieses Weihnachtsspiel erinnern. Ich träumte noch wochenlang von Dan Leno – für mich war er der wunderbarste Mensch, den ich kannte. Auch ein aufregender Zwischenfall ereignete sich an jenem Abend. In der Hofloge saßen die zwei kleinen Prinzen. Prinz Eddy, wie das Volk ihn nannte, ließ sein Programm und sein Opernglas über die Logenbrüstung fallen. Die Dinge fielen ins Parkett ganz nahe bei unserem Platz, und – welches Entzücken! – es kam nicht ein Beamter des königlichen Haushalts, um die Dinge heraufzuholen, sondern Prinz Eddy persönlich. Er entschuldigte sich sehr höflich und sagte, er hoffte, er hätte niemanden verletzt.
Bevor ich an jenem Abend einschlief, schwelgte ich in Phantasien: Eines Tages würde ich Prinz Eddy heiraten. Vielleicht könnte ich ihn noch vorher vor dem Ertrinken retten … Die dankbare Königin würde ihre königliche Einwilligung geben. Oder vielleicht würde sich ein Unfall ereignen – es bestand die Gefahr, dass er verbluten könnte, und ich willigte in eine Bluttransfusion ein. Ich würde in den Adelsstand erhoben werden, und wir würden eine morganatische Ehe schließen. Aber selbst für eine Sechsjährige waren solche Phantasien ein wenig zu phantastisch, um von Dauer zu sein.
Im Alter von vier Jahren dachte sich mein Neffe Jack eine wirklich vorteilhafte königliche Verbindung aus. »Angenommen, Mutti«, sagte er, »du würdest König Eduard heiraten. Dann würde ich Mitglied der königlichen Familie werden.« Meine Schwester meinte, man müsse an die Königin denken und letztlich auch an Jacks eigenen Vater. Jack fand die Lösung: »Angenommen, die Königin würde sterben, und angenommen, Vati …«, er senkte taktvoll die Stimme – »angenommen, Vati wäre nicht da, und angenommen, König Eduard würde … würde dich sehen und …«, er brach ab und überließ den Rest unserer Vorstellung. Offenbar würde sich der König bis über beide Ohren verlieben und Jack im Nu sein Stiefsohn sein.
»Ich habe während der Predigt im Gebetbuch geblättert«, vertraute Jack mir ein Jahr später an. »Ich habe nämlich daran gedacht, dich zu heiraten, wenn ich groß bin, aber da ist so ein Verzeichnis in der Mitte, und da steht, dass der Herr es mir nicht erlauben wird.« Er seufzte. Es wäre sehr schmeichelhaft für mich, sagte ich, dass er an mich gedacht hätte.
Es ist wirklich erstaunlich, wie konsequent die Menschen in ihren Einstellungen sind. Seit der Zeit, da er mit einem Kindermädchen auf die Straße ging, hegte Jack brennendes Interesse für alles Kirchliche. Wenn man ihn aus den Augen verlor, fand man ihn gewöhnlich in einer Kirche wieder, wo er selbstvergessen zum Altar hinaufstarrte. Bekam er farbiges Plastilin zum Spielen, so formte er daraus immer wieder Kruzifixe, Triptychons oder irgendwelche ekklesiastischen Verzierungen. Römisch-katholische Kirchen faszinierten ihn ganz besonders. Er änderte nie seinen Sinn und las mehr Kirchengeschichte als sonst jemand. Mit dreißig Jahren trat er in die römisch-katholische Kirche ein, ein schwerer Schlag für meinen Schwager, der für mich den Inbegriff eines »schwarzen Protestanten« darstellte. »Ich bin nicht voreingenommen«, sagte er mit seiner sanften Stimme, »ich bin wirklich nicht voreingenommen. Ich muss nur immer wieder feststellen, dass die Katholiken allesamt schreckliche Lügner sind. Das ist kein Vorurteil, es ist einfach so.«
Auch Oma war eine typische schwarze Protestantin und genoss so richtig die Verruchtheiten der Baptisten. »Alle diese schönen Mädchen, die in den Klöstern verschwinden«, sagte sie mit geheimnisumwitterter Stimme, »und man sieht sie nie wieder!« Ich könnte schwören, sie war überzeugt, dass alle Priester ihre Mätressen aus Spezialklöstern für schöne Mädchen bezogen.
Die Watts waren Nonkonformisten, Methodisten, glaube ich, was dazu geführt haben mag, dass sie alle Katholiken als Nachkommen der »Großen Hure von Babylon« ansahen. Wo Jack seine Passion für die römisch-katholische Kirche herhatte, kann ich mir nicht vorstellen. Er scheint sie von niemandem in seiner Familie geerbt zu haben, aber sie war immer vorhanden, schon in seinen Kinderjahren. Einer seiner Freunde sagte einmal zu ihm: »Ich weiß wirklich nicht, Jack, warum du nicht ein fröhlicher Ketzer sein kannst wie wir alle. Es würde so viel friedlicher sein.«
Friedlich zu sein, das war wohl das Letzte, was Jack sich je vorstellen konnte. Wie ein Kindermädchen einmal sagte, nachdem sie ihn eine ganze Weile hatte suchen müssen: »Was Jack veranlasst, in die Kirchen zu laufen, das werde ich nie verstehen.« Meine persönliche Meinung ist, er muss die Reinkarnation eines mittelalterlichen Kirchenvaters gewesen sein. Als er älter wurde, bekam er ein Gesicht wie das eines Kirchenvaters – nicht das eines Mönches und auch nicht das eines Schwärmers – das eines in allen ekklesiastischen Belangen versierten Mannes, der auf dem Konzil von Trient eine gute Figur gemacht haben würde – und der jederzeit die genaue Zahl von Engeln nennen konnte, die auf dem Kopf einer Stecknadel Platz fanden.
Die Versuchung
Maria betrachtete das Kind, das vor ihr in der Krippe lag. Sie war allein im Stall – bis auf die Tiere. Ihr Herz war erfüllt von stolzem Glück, als sie auf ihr Kind hinablächelte.
Da vernahm sie plötzlich Flügelrauschen, und als sie sich umwandte, erblickte sie unter der Tür einen großen Engel.
Ein Strahlen wie der Glanz der Morgensonne umgab ihn, und die Schönheit seines Antlitzes war so groß, dass Marias Augen geblendet wurden und sie den Kopf abwenden musste.
Und der Engel sprach zu ihr, und seine Stimme glich einer goldenen Posaune: »Fürchte dich nicht, Maria …«
Maria aber antwortete mit ihrer lieben, sanften Stimme: »Ich fürchte mich nicht, o Abgesandter Gottes, aber das Licht deiner Erscheinung blendet mich.«
Der Engel sprach: »Ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen.«
Maria sagte: »So sprich. Lass mich hören, was Gott der Herr mir gebietet.«
Der Engel sprach: »Ich bin nicht mit Geboten gekommen. Aber da Gott dich besonders liebt, lässt er dich mit meiner Hilfe in die Zukunft sehen …«
Maria blickte auf ihr Kind und fragte eifrig: »In seine Zukunft?«
Ihr Gesicht erhellte sich in freudiger Erwartung.
»Ja«, antwortete der Engel ruhig, »in seine Zukunft. Gib mir deine Hand.«
Maria streckte ihre Hand aus und ergriff die des Engels.
Es war, als ob eine Flamme sie berühre – eine Flamme jedoch, die sie nicht versengte. Sie schrak ein wenig zurück, und der Engel sprach erneut:
»Fürchte dich nicht, Maria. Ich bin unsterblich, und du bist sterblich, aber meine Berührung wird dir nicht weh tun.«
Dann breitete der Engel seinen mächtigen goldenen Flügel über das schlafende Kind und sprach: »Sieh in die Zukunft, Mutter, und sieh deinen Sohn …«
Maria blickte geradeaus, und die Wände des Stalles schwanden und lösten sich auf, und sie schaute in einen Garten. Es war Nacht, und die Sterne leuchteten am Himmel, und ein Mann kniete dort und betete.
Etwas regte sich in Marias Herz und sagte ihr, dass dies ihr Sohn war, der dort kniete. Dankbar sagte sie zu sich selbst: »Er ist ein guter Mensch geworden – ein frommer Mensch –, er betet zu Gott.« Doch dann hielt sie plötzlich den Atem an, denn der Mann hob sein Gesicht, und sie sah den Schmerz darin, die Verzweiflung und die Trauer … Und sie wusste, dass sie größere Qualen sah, als sie jemals gekannt oder gesehen hatte. Denn der Mann war vollkommen allein. Er betete zu Gott, betete, dass dieser Kelch der Qualen von ihm genommen werde – doch sein Gebet blieb ohne Antwort. Gott war fern und schwieg.
Und Maria schrie auf: »Warum antwortet Gott ihm nicht und tröstet ihn?«
Und sie hörte die Stimme des Engels, die sagte: »Es ist nicht in Gottes Ratschluss, dass er getröstet werde.«
Da beugte Maria demütig ihr Haupt und sprach: »Es ist nicht an uns, die unerforschlichen Ratschlüsse Gottes zu kennen. Aber hat dieser Mensch – mein Sohn – keine mitfühlenden, menschlichen Freunde?«
Der Engel rauschte mit seinem Flügel, und das Bild wechselte zu einem anderen Teil des Gartens, und Maria sah darin schlafende Männer liegen.
Voller Bitterkeit sagte sie: »Er braucht sie – mein Sohn braucht sie –, und sie kümmern sich nicht!«
Der Engel sprach: »Sie sind nur fehlbare menschliche Geschöpfe.«
Maria murmelte zu sich selbst: »Aber er ist ein guter Mensch, mein Sohn. Ein guter und aufrechter Mensch.«
Und wieder rauschte der Engelsflügel, und Maria sah einen Weg, der sich einen Hügel hinaufwand, und darauf drei Männer, die Kreuze schleppten, und eine Menge, die ihnen folgte, und römische Soldaten.
Der Engel sprach: »Was siehst du jetzt?«
Maria sagte: »Ich sehe drei Verbrecher auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung.«
Der Mann zur Linken wandte den Kopf, und Maria sah ein grausames, verschlagenes Gesicht, einen niederen, bestialischen Kerl – und sie fuhr zurück.
»Ja«, sagte sie, »es sind Verbrecher.«
Da aber stolperte der Mann in der Mitte und stürzte beinahe, und als er sein Gesicht hob, erkannte Maria ihn und schrie heftig auf: »Nein, nein, es kann nicht sein, dass mein Sohn ein Verbrecher ist.«
Aber der Engel rauschte mit seinem Flügel, und sie sah drei aufgerichtete Kreuze, und die Gestalt, die in Qualen an dem mittleren hing, war der Mann, den sie als ihren Sohn erkannte. Seine gesprungenen Lippen öffneten sich, und sie vernahm die Worte, die sie hervorbrachten:
»Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«
Und Maria rief aus: »Nein, nein, das ist nicht wahr! Er kann nichts wirklich Böses getan haben. Es muss ein furchtbarer Irrtum sein. So etwas gibt es zuweilen. Man muss ihn verwechselt haben; man hat ihn für jemand anderen gehalten. Er büßt für das Verbrechen eines anderen.«
Abermals rauschte der Engel mit seinem Flügel, und diesmal erblickte Maria die Gestalt des Mannes, den sie auf Erden am meisten verehrte – den Hohepriester des Tempels. Er sah edel aus, und er erhob sich, und mit würdevoller Gebärde zerriss er das Gewand, das er trug, und rief mit lauter Stimme: »Dieser Mann hat Gott gelästert.«
Und Maria blickte über ihn hinweg und sah die Gestalt des Mannes, der Gott gelästert hatte – und es war ihr Sohn.
Dann verblassten die Bilder, und da war nur die Lehmwand des Stalles, und Maria bebte und schluchzte gebrochen: »Ich kann es nicht glauben – ich kann es nicht glauben. Wir sind eine gottesfürchtige, rechtschaffene Familie – meine ganze Familie und Josephs Familie auch. Und wir werden ihn sorgsam dazu erziehen, seiner Religion gemäß zu leben und den Glauben seiner Väter zu achten und zu ehren. Kein Sohn von uns könnte der Gotteslästerung schuldig sein – ich kann es nicht glauben! Was du mir gezeigt hast, kann nicht die Wahrheit sein.«
Doch der Engel sprach: »Sieh mich an, Maria.«
Und Maria sah ihn an und sah die Strahlen, die ihn umgaben, und die Schönheit seines Antlitzes.
Und der Engel sprach: »Was ich dir gezeigt habe, ist die Wahrheit. Denn ich bin der Morgenengel, und das Licht des Morgens ist die Wahrheit. Glaubst du mir jetzt?«
Und wider all ihren Willen erkannte Maria, dass wirklich Wahrheit war, was der Engel ihr gezeigt hatte. Sie konnte nicht mehr daran zweifeln.
Tränen strömten über ihre Wangen. Sie beugte sich über das Kind in der Krippe, die Arme ausgebreitet, wie um es zu beschützen.
»Mein Kind«, schluchzte sie. »Mein kleines, hilfloses Kind, was kann ich tun, um dich zu retten? Dir das zu ersparen, was da kommen wird? Nicht nur den Kummer und den Schmerz, sondern auch das Böse, das in deinem Herzen wachsen wird? Oh, es wäre besser, du wärest nie geboren worden oder bei deinem ersten Atemzug gestorben. Dann wärest du rein und unbefleckt zu Gott zurückgekehrt.«
Und der Engel sprach: »Deshalb bin ich zu dir gekommen, Maria.«
Maria sagte: »Was meinst du damit?«
Der Engel antwortete: »Du hast in die Zukunft gesehen. Es steht in deiner Macht zu sagen, ob dein Kind leben oder sterben soll.« Maria beugte ihr Haupt, und unter unterdrücktem Schluchzen flüsterte sie: »Der Herr hat ihn mir gegeben … Wenn der Herr ihn mir wieder nehmen wird, so sehe ich ein, dass es barmherzig ist, und auch wenn es mein Herz zerreißt, unterwerfe ich mich Gottes Willen.«
Aber der Engel sprach sanft: »So ist es nicht. Gott gebietet es dir nicht. Die Wahl ist die deine. Du hast in die Zukunft geschaut. Wähle nun, ob das Kind leben oder sterben soll.«
Da schwieg Maria eine Weile. Sie war eine Frau, die langsam dachte. Einmal blickte sie hin zu dem Engel um Rat, aber der Engel gab ihr keinen. Er war golden und schön und unendlich fern.
Sie dachte an die Bilder, die er ihr gezeigt hatte, an die Qual in dem Garten, den schmachvollen Tod eines Mannes, der in der Stunde seines Todes von Gott verlassen war, und sie hörte erneut das schreckliche Wort Gotteslästerung.
Und jetzt, in diesem Augenblick, war das schlafende Kind rein und unschuldig und glücklich …
Aber sie entschied sich nicht gleich, sie dachte weiter nach, rief sich immer und immer wieder die Bilder zurück, die ihr gezeigt worden waren. Und dabei geschah etwas Seltsames. Plötzlich erinnerte sie sich an Kleinigkeiten, die sie vorher nicht beachtet hatte. So sah sie zum Beispiel das Gesicht des Mannes an dem Kreuz zur Rechten: Kein böses Gesicht, nur ein schwaches – und es war dem Kreuz in der Mitte zugewandt, und ein Ausdruck von Liebe und Vertrauen und Bewunderung lag darin.
Mit plötzlichem Erstaunen wurde Maria bewusst: »Es war mein Sohn, den er so anschaute.«
Und ebenso plötzlich, klar und deutlich sah sie das Gesicht ihres Sohnes, wie es auf seine schlafenden Gefährten in dem Garten herabblickte. Trauer lag darin, Mitleid und Verstehen und große Liebe … Und sie dachte: »Es ist das Gesicht eines guten Menschen.« Und sie sah auch noch einmal den Gerichtshof. Aber dieses Mal schaute sie nicht auf den prächtigen Hohepriester, sondern auf das Gesicht des angeklagten Mannes: In seinen Augen war kein Bewusstsein von Schuld.
Und Marias Gesicht wurde sehr verwirrt.
Da sprach der Engel: »Hast du deine Wahl getroffen, Maria? Willst du deinem Sohn Leid und Sünde ersparen?«
Und Maria sagte langsam: »Es ist nicht an mir, einem unwissenden und einfachen Weib, den hohen Ratschluss Gottes zu verstehen. Der Herr gab mir mein Kind. Wenn der Herr es mir nimmt, dann ist es sein Wille. Aber da Gott ihm das Leben gegeben hat, ist es nicht an mir, ihm dieses Leben zu nehmen. Denn es mag sein, dass es im Leben meines Kindes Geschehnisse gibt, die ich nicht richtig verstehe. Es mag sein, dass ich nur einen Teil eines Bildes gesehen habe und nicht das ganze. Das Leben meines Kindes gehört ihm, nicht mir, und ich habe kein Recht, darüber zu bestimmen.«
»Denke noch einmal nach«, drängte der Engel. »Willst du mir nicht dein Kind in die Arme legen, und ich bringe es zurück zu Gott?«
»Nimm es in deine Arme, wenn dies Gottes Gebot ist«, sagte Maria. »Ich aber werde es dir nicht hineinlegen.«
Da erhob sich ein mächtiges Flügelrauschen, und ein Blitzstrahl flammte auf, und der Engel verschwand.
Ein wenig später kam Joseph, und Maria berichtete ihm, was geschehen war. Joseph billigte, was Maria getan hatte.
»Du hast recht getan, Weib«, sagte er. »Und wer weiß, vielleicht hat dieser Engel gelogen.«
»Nein«, sagte Maria. »Er hat nicht gelogen.«
Mit ihrem ganzen Fühlen war sie dessen sicher.
»Ich glaube von alldem kein Wort«, sagte Joseph fest. »Wir werden unseren Sohn sehr sorgsam erziehen und im Glauben unterweisen, denn es ist die Erziehung, die zählt. Er wird in meiner Werkstatt arbeiten, am Sabbat mit uns in die Synagoge gehen und alle Festtage und Gebote einhalten.«
Maria schaute in die Krippe und sagte: »Sieh nur, unser Sohn lächelt.«
Und wirklich, das Knäblein lächelte und streckte seine winzigen Hände der Mutter entgegen, als wollte es sagen: »Gut gemacht.«
Hoch droben jedoch, im blauen Himmelsgewölbe, bebte der Engel vor Hochmut und Zorn.
»Dass ich bei einem törichten, unwissenden Weib versagt habe! Aber es wird eine andere Gelegenheit geben. Eines Tages, wenn Er erschöpft und hungrig und schwach sein wird, werde ich ihn auf den Gipfel eines Berges führen und ihm die Königreiche dieser meiner Welt zeigen. Ich werde ihm die Herrschaft über sie alle anbieten. Er soll Städte und Könige und Völker beherrschen. Er soll die Macht haben, Krieg, Hunger und Unterdrückung ein Ende zu bereiten. Ein einziges Zeichen, dass er gewillt ist, mich anzubeten, und es soll ihm gegeben sein, Frieden und Überfluss, Zufriedenheit und guten Willen zu schaffen – sich selbst als höchste Kraft des Guten zu erkennen. Dieser Versuchung wird er niemals widerstehen können!«
Und Luzifer, der Sohn des Morgens, lachte in seiner Unwissenheit und seinem Hochmut laut auf und fuhr durch den Himmel wie ein brennender Feuerstrahl, hinab in die untersten Tiefen …
Im Osten aber traten drei Himmelskundige vor ihre Herren und sprachen: »Wir haben ein mächtiges Licht am Himmel gesehen. Ein großer Herrscher muss geboren worden sein.«
Doch während alle von Zeichen und Wundern flüsterten und redeten, murmelte ein sehr alter Sterndeuter: »Ein Zeichen Gottes? Gott hat keine Zeichen und Wunder nötig. Es scheint mir eher ein Zeichen Satans. Ich meine, wenn Gott zu uns kommen wollte, dann würde er ganz still kommen.«
Im Stall aber herrschten Freude und Jubel. Der Esel schrie, der Ochse brüllte, Pferde wieherten, und Männer und Frauen drängten herbei, um das Kind zu sehen, und reichten es von einem zum anderen, und es lachte und jauchzte und lächelte sie alle an.
»Seht«, riefen sie. »Es liebt uns alle. Noch nie hat es solch ein Kind gegeben …«
Die Pralinenschachtel
Es war eine wilde Nacht. Der Wind heulte wütend, und der Regen peitschte in heftigen Böen gegen die Fenster.
Poirot und ich saßen vor dem Kamin, die Beine den fröhlich knisternden Flammen entgegengestreckt. Zwischen uns stand ein kleiner Tisch. Auf meiner Seite dampfte ein sorgfältig zubereiteter Grog, neben Poirot eine Tasse dicker, kräftiger Schokolade, die ich nicht einmal für hundert Pfund getrunken hätte! Poirot nippte an dem dickflüssigen, braunen Modder in der rosafarbenen Porzellantasse und seufzte vor Zufriedenheit.
»Quelle belle vie!«, murmelte er.
»Ja, ja, wir leben schon in einer guten Welt«, pflichtete ich ihm bei. »Ich sitze hier, habe Arbeit, und sogar eine gute Arbeit! Und dort sitzen Sie, berühmt …«
»Ach, mon ami!«, protestierte Poirot.
»Aber das sind Sie doch. Und völlig zu Recht! Wenn ich an die lange Reihe Ihrer Erfolge zurückdenke, komme ich aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus. Ich glaube, ›scheitern‹ ist für Sie ein Fremdwort!«
»So etwas kann wirklich nur ein drolliger Kauz behaupten!«
»Nein, im Ernst, sind Sie jemals gescheitert?«
»Unzählige Male, wo denken Sie hin! La bonne chance, man kann es nicht immer auf seiner Seite haben. Ich bin zu spät zurate gezogen worden. Sehr oft war jemand anders vor mir am Ziel. Zweimal wurde ich, als ich bereits dicht vor dem Erfolg stand, von einer Krankheit heimgesucht. Man muss die Höhen und Tiefen nehmen, wie sie kommen, mon ami.«
»So habe ich das nicht gemeint«, sagte ich. »Ich meinte, sind Sie jemals in einem Fall durch eigenes Verschulden komplett auf die Nase gefallen?«
»Ah, ich verstehe! Sie wollen wissen, ob ich mich jemals zu einem ausgewachsenen Esel gemacht habe, wie man hierzulande sagt? Einmal, mon ami …« Ein leises, nachdenkliches Lächeln huschte über sein Gesicht. »Ja, einmal habe ich mich zum Narren gemacht.«
Plötzlich richtete er sich in seinem Sessel auf.
»Sehen Sie, mon ami, Sie haben, wie ich weiß, Buch über meine kleinen Erfolge geführt. Jetzt können Sie Ihrer Sammlung eine weitere Geschichte hinzufügen, die Geschichte eines Scheiterns!«
Er beugte sich vor und legte ein Scheit ins Feuer. Nachdem er sich die Hände sorgfältig an einem kleinen, neben dem Kamin an einem Nagel hängenden Tuch abgewischt hatte, lehnte er sich zurück und begann mit seiner Erzählung.
»Was ich Ihnen jetzt erzähle«, so Monsieur Poirot, »spielte sich vor vielen Jahren in Belgien ab, und zwar genau zu der Zeit, als in Frankreich dieser furchtbare Kampf zwischen Kirche und Staat tobte. Monsieur Paul Déroulard war damals ein bedeutender französischer Abgeordneter. Es war ein offenes Geheimnis, dass ein Ministerposten auf ihn wartete. Da er zu den erbittertsten Gegnern der Katholiken gehörte, war klar, dass er sich nach seinem Machtantritt heftigen Feindseligkeiten ausgesetzt sehen würde. Er war in vielerlei Hinsicht ein eigenartiger Mensch. Obwohl er weder trank noch rauchte, war er in anderen Dingen längst nicht so pingelig. Verstehen Sie, Hastings, c’était des femmes – toujours des femmes!
Einige Jahre zuvor hatte er eine junge Dame aus Brüssel geheiratet, die eine erhebliche dot in die Ehe eingebracht hatte. Diese Mitgift war ihm bei seiner Karriere zweifelsohne nützlich, denn seine Familie war nicht reich, obwohl er das Recht hatte, sich, wenn er wollte, Monsieur le Baron zu nennen. Aus der Ehe gingen keine Kinder hervor, und nach zwei Jahren starb seine Frau – an den Folgen eines Treppensturzes. Unter den Gütern, die sie ihm hinterließ, war auch ein Haus in der Avenue Louise in Brüssel.
In diesem Haus ereilte ihn auch sein plötzlicher Tod, der mit dem Rücktritt des Ministers zusammenfiel, dessen Amt er erben sollte. Sämtliche Zeitungen druckten ausführliche Würdigungen seiner Laufbahn. Seinen Tod, der recht überraschend nach einem Abendessen eingetreten war, hatte man einem Herzversagen zugeschrieben.
Zu jener Zeit, mon ami, arbeitete ich, wie Sie wissen, bei der belgischen Kriminalpolizei. Monsieur Paul Déroulards Tod interessierte mich nicht besonders. Ich bin, wie Sie ebenfalls wissen, ein bon catholique, und sein Ableben schien mir ein Glücksfall.
Etwa drei Tage später, mein Urlaub hatte gerade begonnen, erhielt ich bei mir zu Hause Besuch – von einer tief verschleierten, aber offensichtlich recht jungen Dame, die ich sofort als ein jeune fille tout à fait comme il faut erkannte.
›Sie sind Monsieur Hercule Poirot?‹, fragte sie mit einer leisen, weichen Stimme.
Ich verbeugte mich.
›Von der Kriminalpolizei?‹
Erneut verbeugte ich mich. ›Bitte nehmen Sie doch Platz, Mademoiselle‹, sagte ich.
Sie setzte sich in den angebotenen Sessel und schlug den Schleier zurück. Ihr Gesicht war bezaubernd, allerdings von Tränen gezeichnet und wie von quälender Angst gepeinigt.
›Monsieur‹, sagte sie, ›ich weiß, Sie haben Urlaub. Es steht Ihnen also frei, einen privaten Auftrag zu übernehmen. Sie werden verstehen, dass ich nicht die Polizei hinzuziehen möchte.‹
Ich schüttelte den Kopf. ›Ich fürchte, Sie verlangen Unmögliches von mir, Mademoiselle. Obwohl ich im Urlaub bin, gehöre ich trotzdem der Polizei an.‹
Sie beugte sich vor. ›Écoutez, Monsieur. Ich bitte Sie lediglich darum, einige Ermittlungen anzustellen. Das Ergebnis Ihrer Ermittlungen dürfen Sie gern der Polizei mitteilen. Wenn das, was ich vermute, tatsächlich wahr ist, benötigen wir sowieso den ganzen Polizeiapparat.‹
Das ließ die Angelegenheit in einem etwas anderen Licht erscheinen, und ich stellte ihr meine Dienste ohne weitere Umstände zur Verfügung.
Eine leichte Röte stieg in ihre Wangen. ›Ich danke Ihnen, Monsieur. Es ist der Tod von Monsieur Paul Déroulard, den ich Sie zu untersuchen bitte.‹
›Comment?‹, rief ich überrascht aus.
›Monsieur, ich habe keinerlei Anhaltspunkte, nichts als meinen weiblichen Instinkt, aber ich bin überzeugt – überzeugt, sage ich Ihnen –, dass Monsieur Déroulard keines natürlichen Todes gestorben ist!‹
›Aber die Ärzte haben doch sicherlich …‹
›Ärzte können sich täuschen. Er war so robust, so kräftig. Ah, Monsieur Poirot, ich flehe Sie an, mir zu helfen …‹
Das arme Kind war schier außer sich. Sie wäre sogar vor mir auf die Knie gefallen. Ich beruhigte sie, so gut es ging.
›Ich werde Ihnen helfen, Mademoiselle. Ich bin mir fast vollkommen sicher, dass Ihre Befürchtungen unbegründet sind, aber wir werden sehen. Als Erstes möchte ich Sie bitten, mir die Bewohner des Hauses zu beschreiben.‹
›Da ist natürlich einmal das Personal: Jeannette, Félice und Denise, die Köchin. Letztere steht dort schon seit vielen Jahren in Diensten; die anderen beiden sind einfache Mädchen vom Lande. Dann wäre da noch François, ein ebenfalls langjähriger Diener. Außerdem lebte noch Monsieur Déroulards Mutter bei ihm, und ich. Ich heiße Virginie Mesnard. Ich bin eine arme Cousine der verstorbenen Madame Déroulard, Monsieur Pauls Gattin, und gehöre seit über drei Jahren zu dem Haushalt, dessen Mitglieder ich Ihnen gerade beschrieben habe. Ferner wohnten noch zwei Gäste im Haus.‹
›Die da wären?‹
›Monsieur de Saint Alard, ein Nachbar von Monsieur Déroulard in Frankreich. Sowie ein englischer Freund, Mr John Wilson.‹
›Und die beiden wohnen immer noch bei Ihnen?‹
›Mr Wilson ja, Monsieur de Saint Alard hingegen reiste gestern ab.‹
›Und wie sieht Ihr Plan aus, Mademoiselle Mesnard?‹
›Wenn Sie in einer halben Stunde bei uns vorsprechen, werde ich mir eine Geschichte zurechtgelegt haben, um Ihre Anwesenheit zu erklären. Am besten wäre es wohl, wenn ich behaupten würde, Sie hätten irgendetwas mit der Presse zu tun. Ich sage einfach, Sie kämen aus Paris und hätten ein Empfehlungsschreiben von Monsieur de Saint Alard. Madame Déroulard ist sehr gebrechlich und wird kaum auf irgendwelche Einzelheiten achten.‹
Unter Mademoiselles geschicktem Vorwand gelangte ich ins Haus, und nach einem kurzen Gespräch mit der Mutter des verstorbenen Abgeordneten – einer ausgesprochen imposanten, allerdings eben schwächlichen Aristokratin – durfte ich mich in den Räumlichkeiten frei bewegen.
Ich frage mich, mon ami«, fuhr Poirot fort, »ob Sie sich überhaupt vorstellen können, wie schwierig meine Aufgabe war. Es ging hier um den drei Tage zurückliegenden Tod eines Mannes. War er tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen, so gab es nur eine Möglichkeit: Gift! Und es gab weder eine Aussicht darauf, den Leichnam zu sehen, noch eine Gelegenheit, die Substanz zu bestimmen oder zu analysieren, in der das Gift eventuell verabreicht worden war. Es gab keine Anhaltspunkte, die ich verfolgen konnte – keine Spuren, weder hilfreiche noch irreführende. War der Mann vergiftet worden? War er eines natürlichen Todes gestorben? Das musste ich, Hercule Poirot – ohne irgendwelche Indizien – entscheiden.
Zuerst sprach ich mit dem Personal, mit dessen Hilfe ich den Abend rekonstruierte. Besondere Beachtung schenkte ich dem Abendessen und der Art, wie es aufgetragen worden war. Die Suppe hatte Monsieur Déroulard selbst aus einer Terrine serviert. Dann gab es Kotelett, dann Hühnchen. Zum Schluss Kompott. Und alles hatte Monsieur höchstpersönlich aufgetragen und serviert. Der Kaffee war in einer großen Kanne auf den Esstisch gestellt worden. Fehlanzeige, mon ami – unmöglich, einen zu vergiften, ohne alle zu vergiften!
Nach dem Essen hatte sich Madame Déroulard, begleitet von Mademoiselle Virginie, in ihre Räume zurückgezogen. Die drei Männer hatten sich in Monsieur Déroulards Arbeitszimmer begeben. Dort hatten sie einige Zeit miteinander geplaudert, als der Abgeordnete urplötzlich, ohne jede Vorwarnung, krachend zu Boden gefallen war. Monsieur de Saint Alard war hinausgeeilt und hatte François aufgetragen, sofort den Arzt zu holen, denn er war sich, so der Diener, sicher, es handele sich um einen Schlaganfall. Doch als der Arzt eintraf, sei es für jede Hilfe zu spät gewesen.
Dann stellte mir Mademoiselle Virginie Mr John Wilson vor: stämmig und in mittlerem Alter, ein regelrechter John Bull, wie man den typischen Engländer damals nannte. Seine in sehr britischem Französisch vorgetragene Darstellung des Abends deckte sich im Wesentlichen mit den anderen Aussagen:
›Déroulard wurde ganz rot im Gesicht und fiel zu Boden.‹
Hier war nichts weiter in Erfahrung zu bringen. Danach ging ich zum Schauplatz der Tragödie, dem Arbeitszimmer, wo man mich auf meine Bitte hin allein ließ. Bisher gab es nichts, was Mademoiselle Mesnards Theorie untermauert hätte. Ich sah mich gezwungen, das Ganze für einen Irrglauben ihrerseits zu halten. Offensichtlich hatte sie romantisch-leidenschaftliche Gefühle für den Toten empfunden, die es ihr unmöglich machten, den Fall nüchtern zu betrachten. Trotzdem suchte ich das Arbeitszimmer peinlich genau ab. Es wäre ja beispielsweise möglich gewesen, dass eine Spritze so am Sessel des Toten angebracht worden war, dass er zwangsläufig eine tödliche Injektion verabreicht bekam. Wahrscheinlich wäre der winzige Einstich unbemerkt geblieben. Allerdings konnte ich keinerlei Beweise für diese Theorie finden. Mit einer Geste der Verzweiflung ließ ich mich in den Sessel fallen.
›Enfin, ich gebe auf!‹, sagte ich laut. ›Nirgends gibt es auch nur die geringste Spur! Alles ist absolut normal.‹
Während ich diese Worte sagte, fiel mein Blick auf eine große Pralinenschachtel, die ganz in der Nähe auf einem Tisch lag, und mein Herz machte einen Sprung. Sie war vielleicht kein Schlüssel zu Monsieur Déroulards Tod, aber wenigstens war da etwas, was nicht normal war. Ich hob den Deckel. Die Schachtel war voll, unangetastet; es fehlte keine einzige Praline, was die Eigentümlichkeit, die mir ins Auge gesprungen war, nur umso auffälliger machte. Denn, sehen Sie, Hastings, während die Schachtel selbst rosafarben war, war der Deckel blau. Nun sieht man zwar oft ein blaues Band um eine rosafarbene Schachtel und umgekehrt, aber eine Schachtel in einer Farbe und einen Deckel in einer anderen – ça ne se voit jamais!
Mir war noch nicht klar, ob mir diese kleine Eigentümlichkeit irgendwie nützen würde, aber dennoch beschloss ich, die Sache zu untersuchen, allein, weil sie so ungewöhnlich war. Ich läutete nach François und fragte ihn, ob sein verstorbener Herr gerne Süßigkeiten gegessen habe. Ein leises, melancholisches Lächeln spielte um seine Lippen.
›Leidenschaftlich gerne, Monsieur. Er hatte stets eine Schachtel Pralinen im Haus. Sehen Sie, er trank überhaupt keinen Wein.‹
›Und doch blieb diese Schachtel unangetastet.‹ Ich hob den Deckel, um es ihm zu zeigen.
›Pardon, Monsieur, aber diese Schachtel wurde erst am Tag seines Todes gekauft, da die andere fast leer war.‹
›Dann wurde die andere am Tag seines Todes leer gegessen‹, sagte ich langsam.
›Ja, Monsieur, ich fand die leere Schachtel am nächsten Morgen und warf sie weg.‹
›Hat Monsieur Déroulard zu allen Tageszeiten Süßigkeiten gegessen?‹
›Normalerweise nach dem Abendessen, Sir.‹
Langsam sah ich Licht am Ende des Tunnels.
›François‹, sagte ich, ›können Sie diskret sein?‹
›Wenn nötig, Monsieur.‹
›Bon! Dann sollen Sie wissen, dass ich von der Polizei bin. Meinen Sie, Sie können die alte Schachtel noch irgendwo aufstöbern?‹
›Auf jeden Fall, Monsieur. Sie ist im Mülleimer.‹
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: