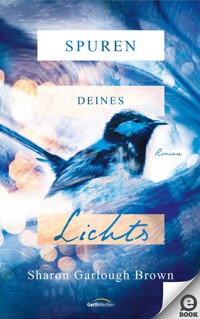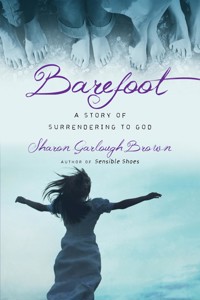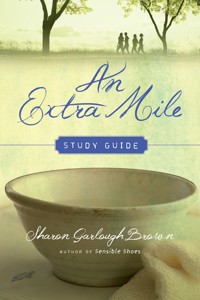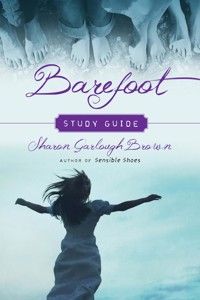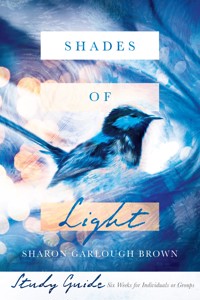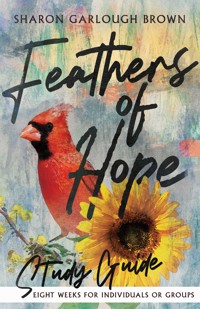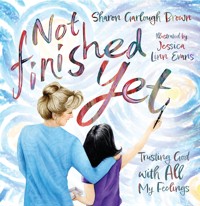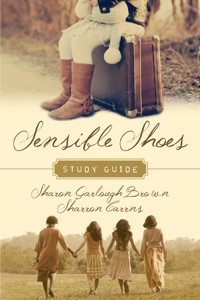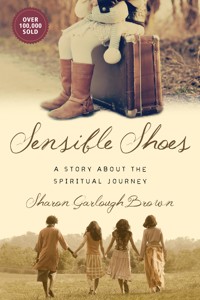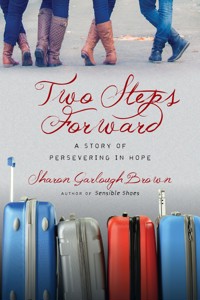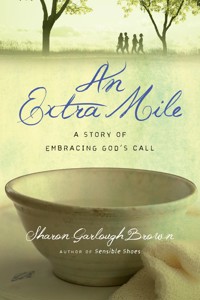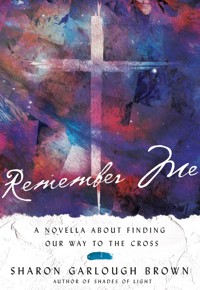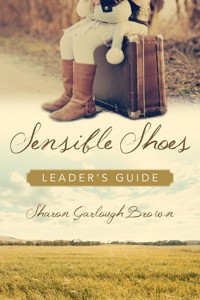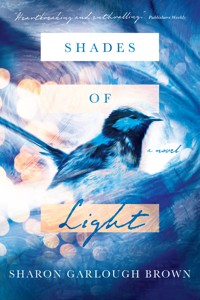Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Vier Frauen auf einer Glaubensreise
- Sprache: Deutsch
Ein Kurs zum Thema "Geistliche Reise" hat die vier Frauen Meg, Charissa, Hannah und Mara zusammengeführt. Nun gehen sie weiter - gemeinsam auf neuen Wegen. Meg hat sich endlich getraut, zu ihrer Tochter nach London zu fliegen. Doch statt einer unbeschwerten Urlaubszeit erlebt sie eine herbe Enttäuschung. Charissa bemüht sich, ihren Kontrollzwang loszuwerden und ihre ungeplante Schwangerschaft anzunehmen. Hannah ist glücklich mit ihrem "neuen" alten Freund Nathan, aber die Schatten der Vergangenheit sind noch spürbar. Und Mara versucht, ihre Familie zusammenzuhalten, als die Situation plötzlich eskaliert ... Werden sich die neu gefundenen Zugänge zu Gott, die sie im Kurs kennengelernt haben, in diesen sehr realen Schwierigkeiten bewähren? Und wie können sie einander beistehen und helfen? Genau wie der Vorgängerband Unterwegs mit dir ist auch dies ein Roman der ganz besonderen Art, der den Leser dazu herausfordert, über sein Leben und seinen Glauben nachzudenken - und sich gemeinsam mit den vier Frauen vorwärtszutasten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Sharon Garlough Brown ist Pastorin. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie eine Gemeinde in West Michigan. Ihren reichen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren geistlicher Retraiten und Kursen über geistliche Übungen hat sie in diesem Buch meisterhaft eingewoben.
Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen; er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben; es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden.
Lukas 1,78–79
* * *
Mit Liebe und Dankbarkeit dem Einen gegenüber, der mit mir geht. Und für Anne Schmidt, die nicht vergessen werden soll.
Inhalt
Prolog
Teil 1: Wachsam sein
Teil 2: Warten in der Dunkelheit
Teil 3: An einem Ort wie diesem
Teil 4: Die Liebe steigt herab
Leitfaden für Gebets- und Gesprächsrunden
Anmerkungen
Prolog
Katherine Rhodes stand am Fenster ihres Arbeitszimmers im New Hope-Einkehrzentrum und beobachtete die Wildgänse, die in Keilformation über den wolkenverhangenen Himmel zogen. Eine Schneedecke hätte die trostlose Landschaft aufheitern können, in der das Gras zu einem tristen Braun verwelkt war und ein paar noch nicht geerntete Äpfel wie Schmuckelemente an dem Obstbaum im Nachbargarten hingen. Der Winter im Westen Michigans konnte sehr hartnäckig und zermürbend sein, aber er war auch eine reinigende Jahreszeit, in der alle sichtbaren Zeichen von Leben erstarben und die darunterliegenden Formen in ihrer ausdrucksstarken, ehrlichen und verletzlichen Schönheit zum Vorschein kamen. Es war eine Zeit, in der man dem tiefen inneren Wirken Gottes vertrauen musste, eine Zeit, in der man in der andauernden Dunkelheit nach erwachendem Licht Ausschau halten musste, eine Zeit, in der man voller Hoffnung warten musste, während die Natur in tiefem Schlaf lag.
Ihre Gedanken wanderten zu den Menschen, die kürzlich ihren letzten „Geistliche Reise“-Kurs abgeschlossen hatten. Seit mehr als 20 Jahren führte Katherine nun schon solche Kurse im New Hope-Zentrum durch, und noch immer war es ein Grund zu großer Freude für sie, den Heiligen Geist wirken zu sehen. Immer wieder geriet sie ins Staunen darüber, was alles möglich war. Was für ein Vorrecht, dass sie die Kursteilnehmer, die sich nach einer tieferen Beziehung mit Gott sehnten, auf einer kleinen Wegstrecke dieser Reise begleiten durfte!
Auf einer kleinen Wegstrecke. Das war am Ende eines Kurses für sie immer eine große Herausforderung: diese Menschen wieder loszulassen und sie Gott anzuvertrauen. Nach einer sehr intensiven gemeinsamen Zeit, in der Katherine den Kursteilnehmern dabei geholfen hatte, sich in der ungeheuer vielschichtigen Landschaft ihres Innern zurechtzufinden und sie für die sanftesten Regungen des Heiligen Geistes empfänglich zu machen, musste sie nun loslassen. Sie hatte ihnen Mut gemacht, die unermessliche Liebe Gottes anzunehmen und ihnen geraten, sich Begleiter für diese Reise zu suchen. Denn auf dem Weg waren vertrauenswürdige Mitreisende unerlässlich.
Mit einem geflüsterten Gebet öffnete Katherine die Hände und vertraute ihre Teilnehmer der Fürsorge Gottes an. Wieder einmal.
Teil 1
Wachsam sein
* * *
Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, ich warte auf sein helfendes Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt.
Psalm 130,5–6
1
Meg
Meg Crane hatte die Hände in den Kragen ihres türkisfarbenen Pullovers gesteckt. Eiskalt lagen sie an ihrem Kinn. Seit dem Start hatte die gut gekleidete grauhaarige Dame neben ihr auf Platz 12-B immer wieder abschätzige Blicke in ihre Richtung geworfen. Verstieß sie vielleicht gegen irgendeine ihr unbekannte Flug-Etikette? Dies war schließlich ihr erster Flug. Vielleicht irritierten ihre Nachbarin ja die dunkelroten, verräterischen Flecken, die zweifellos ihren Hals hochkrochen. Warum nur hatte sie keinen Rollkragenpullover angezogen? Ihre schulterlangen aschblonden Locken verdeckten diese Flecken nur dürftig.
Die Frau holte eine pflaumenfarbene Damentasche unter dem Sitz ihres Vordermanns hervor. „In diese Flugzeuge werden neuerdings immer mehr Sitzreihen hineingequetscht“, bemerkte sie. „Flugreisen sind wirklich kein Vergnügen mehr, nicht?“
Meg räusperte sich. „Das ist mein erster Flug.“
„Wirklich? Wie schön für Sie.“
Diese gönnerhafte Bemerkung hatte sie vermutlich verdient. Bestimmt gab es nicht viele Frauen, die mit 46 noch nie in einem Flugzeug gesessen hatten.
„Wohin fliegen Sie?“, fragte die Frau.
„Nach London.“
„Im Ernst? Ich fliege auch nach London! Mit dem heutigen Nachtflug?“ Meg nickte. Die Frau nahm ihr Flugticket aus ihrer Tasche. „Flug 835 um 19 Uhr?“
„Ja.“ Meg hatte ihr Ticket schon so oft studiert, dass sie die Daten auswendig kannte.
„Das ist ja was! Die Welt ist doch wirklich klein!“ Sie spielte mit dem herzförmigen Medaillon an ihrer goldenen Kette. „Ich bringe etwas von der Asche meines Mannes nach London. Ich will sie in der Westminster Abbey verstreuen.“
Sie trug ihren Mann in einem Medaillon mit sich herum? So etwas hatte Meg noch nie gehört. War es überhaupt erlaubt, einfach so die Asche eines Menschen zu verstreuen? Meg konnte sich das nicht vorstellen.
Die Frau beugte sich zu ihr herüber. „Vor seinem Tod hat mein Mann eine Liste geschrieben – nicht mit den Dingen, die er noch tun wollte, bevor er stirbt, sondern mit den Orten, die er nach seinem Tod besuchen wollte. Seitdem reise ich nun durch die ganze Welt und verstreue seine Asche. Beim Tatsch Mahal, im Grand Canyon, in Paris – ganz oben von der Spitze des Eiffelturms! Meine Tochter findet das makaber, aber ich habe ihr gesagt: ‚Makaber wäre es, wenn ich mich im Haus einschließen, mir alte Fotos anschauen und mir bei einem Gin Tonic die Augen aus dem Kopf heulen würde.‘ In diesem Monat steht also London auf dem Programm und im nächsten Frühling der bolivianische Regenwald. Im kommenden Sommer will ich über den Inka-Trail nach Machu Picchu wandern. Mein Mann hatte immer gehofft, wir könnten diese Reise gemeinsam unternehmen, aber der Krebs kam uns dazwischen. Darum werde ich ein wenig von seiner Asche dort auf der Bergspitze inmitten der alten Ruinen verstreuen.“
Meg reagierte mit einem höflichen Lächeln und einem „Hm“, bevor sie einen neidischen Blick auf die allein reisenden und schweigenden Passagiere auf der anderen Seite des Ganges warf, die durch die Bücher vor ihrer Nase ganz klar das Signal aussandten: „Bitte nicht stören.“ Megs Bücher steckten in ihrem Handgepäck, das jetzt sicher verstaut im Gepäckfach über ihren Köpfen lag. Gerade als sie nach dem Flugmagazin greifen wollte, kam die Flugbegleiterin mit dem Getränkewagen vorbei. „Möchten Sie etwas trinken?“ Sie reichte ihnen eine kleine Tüte mit Snackbrezeln.
„Ein Ginger Ale, bitte“, erwiderte Meg. Vielleicht würde das ihren nervösen Magen ein wenig beruhigen.
„Ich nehme eine Bloody Mary.“ Die Frau öffnete ihre Geldbörse und wandte sich wieder Meg zu. „Wohnen Sie in Kingsbury?“
Meg nickte.
„Sie kommen mir so bekannt vor. Ich überlege schon die ganze Zeit, woher ich Sie kenne. Sind wir uns vielleicht schon mal begegnet?“
„Das glaube ich nicht.“ Ganz bestimmt wäre ihr eine so redselige Frau im Gedächtnis geblieben.
„Sind Sie im Elternbeirat der Schule?“
„Nein.“
„Im Fitnessstudio in der Petersborough Road?“
„Nein.“
„Die Frage wird mir keine Ruhe lassen, bis ich eine Antwort gefunden habe.“
„Vielleicht sind wir uns schon einmal in der Kirche begegnet? Das wäre eine Möglichkeit.“
„Ganz bestimmt nicht.“ Die Frau zog die Augenbrauen zusammen. „Im Kunstmuseum, in der Konzerthalle oder vielleicht im Gartenklub?“
„Ich fürchte nein.“
Die Frau schnippte mit den Fingern. „Ich hab’s!“
Meg legte fragend den Kopf zur Seite.
„Sie sehen einer Frau ähnlich, mit der mein Mann vor Jahren zusammengearbeitet hat. Beverly irgendwas. Beverly, Beverly, Beverly … Beverly Reese! Sie sind nicht zufällig mit einer Beverly Reese verwandt, oder?“
„Nein, tut mir leid. Dieser Name sagt mir nichts.“
Die Frau strich mit der linken Hand über ihre Wange und ihren Hals. In der rechten hielt sie ihr Getränk. „Sie erinnern mich an sie, weil sie auch so helle Haut hatte und dieselben Flecken bekam wie Sie, wenn sie nervös war. Haben Sie es eigentlich mal mit Akupunktur versucht?“
„Äh … nein.“ Wie lange dauerte der Flug nach New York?
„Ich glaube, bei ihr hat Akupunktur geholfen. Und Yoga. Das ist nur so eine Idee.“ Sie drückte den Knopf und stellte die Rückenlehne ihres Sitzes nach hinten. „Was führt Sie denn nach London?“
Ganz vorsichtig riss Meg ihre Brezeltüte auf. Sie wollte nicht, dass das Gebäck in alle Richtungen flog. „Meine Tochter studiert dort englische Literatur im ersten Semester.“
„Aha. Was für eine tolle Gelegenheit für sie.“
„Ja.“
„Und wie lange werden Sie bleiben?“
Dass sie ausgerechnet neben dieser Frau sitzen musste! „Ein paar Wochen. Über Weihnachten.“
„Weihnachten in London ist wunderschön. Werden Sie direkt in der Stadt wohnen?“
„Ganz in der Nähe des Colleges.“
„Wie schön für Sie.“
Ja, es würde ein Erlebnis werden. Seit Wochen träumte Meg nun schon von diesem Besuch. Und auch während des Fluges hatte sie ganz in Ruhe daran denken und sich alles vorstellen wollen. Langsam und bedächtig kaute sie eine Brezel.
Ohne auch nur einmal Luft zu holen, erzählte ihre Sitznachbarin sehr ausführlich von ihrer Familie: Sie selbst hieß Jean, ihre Tochter war Schauspielerin und nicht verheiratet. Sie hatte gerade in einer Broadway-Produktion mitgewirkt. Ihr Mann war an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben und ihr Sohn machte gerade eine überaus schwierige Scheidung durch. „Ich wusste von Anfang an, dass diese Ehe nicht halten würde“, sagte sie. „Wenigstens haben sie keine Kinder. Diese Frau war ein Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Ich bin froh, dass er endlich aufgewacht ist und die Reißleine gezogen hat.“
Irgendwann döste Jean dann endlich ein – ob nun wegen des Alkohols oder weil sie das Interesse an dieser doch recht einseitigen Unterhaltung verloren hatte, konnte Meg nicht sagen. Vorsichtig, um sie nicht aufzuwecken, suchte sie sich eine andere Sitzposition und zog ihre Schuhe aus.
Ihre Laufschuhe.
Wie weit war sie seit dem vergangenen September gekommen, als sie Hannah, Mara und Charissa im New Hope-Einkehrzentrum kennengelernt hatte. Was für ein Weg lag hinter ihr. Sie hatten zufällig alle an einem Tisch in der hintersten Ecke gesessen, und Meg hatte ihre hohen Absätze als Vorwand genutzt, um nicht durch das Gebetslabyrinth laufen zu müssen. „Ich fürchte, meine Schuhe sind nicht wirklich dafür geeignet“, hatte Meg sich entschuldigt. „Ich hatte die ‚geistliche Reise‘ nicht so wörtlich verstanden.“
Im Laufe der vergangenen drei Monate waren sie dem Herzen Gottes ein Stück nähergekommen – wenn auch manchmal nur mit zögernden und unsicheren Schritten. Meg hatte jede Einzelne von ihnen lieben und schätzen gelernt: Mara, die Ehefrau, Mutter von drei Söhnen und baldige Großmutter, Charissa, die verheiratete Doktorandin, die gerade herausgefunden hatte, dass sie schwanger war, und Hannah, die Pastorin, die eine neunmonatige Sabbatzeit von ihrer Gemeinde in Chicago verordnet bekommen hatte.
Alle drei hatten sie zum Flughafen begleitet, mit ihr gebetet und ihr Mut zugesprochen – was Meg sehr gefreut hatte. Ihre Gefährtinnen auf dieser geistlichen Reise waren wirklich ein großes Geschenk für sie!
„Es wird ein schrecklich langer Monat werden, bis wir alle wieder zusammen sind“, hatte Mara geseufzt, als sie in der Abflughalle noch einen Kaffee miteinander getrunken hatten. „Ich möchte nicht aus der Übung kommen, versteht ihr? Ich hoffe nur, dass ich wenigstens ein bisschen von all dem behalten kann, was ich im Kurs gelernt habe. Ich und mein Wechseljahrgedächtnis! Also erinnert mich bitte, okay?“
„Mich auch“, warf Charissa ein. „Ich habe eine ganze Liste mit geistlichen Übungen aufgeschrieben, die ich weiterhin praktizieren möchte. Aber in dieser Phase des Semesters, wo Abschlussarbeiten geschrieben werden müssen und Projekte abzuschließen sind, kann ich schlecht loslassen und mein Perfektionismus nimmt wieder überhand. In letzter Zeit konnte ich kaum etwas von der Liste umsetzen. Im Moment versuche ich einfach nur, heil durch den Tag zu kommen.“
„Dann fang doch etwas kleiner an“, schlug Hannah vor. „Such dir eine Sache aus, die dir dabei hilft, trotz der Hektik mit Gott in Verbindung zu bleiben. Und nach und nach kannst du dann vielleicht noch weitere Übungen einbauen.“
„Wenn es nur so einfach wäre“, stöhnte Charissa. „Es geht ums Loslassen, darum, die Kontrolle abzugeben. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde. Vielleicht werde ich mein Leben lang ein Kontrollfreak bleiben.“
„Aber wenigstens hast du deine Schwachstelle erkannt“, bemerkte Mara. „Das ist doch schon mal ein Fortschritt! Auch wenn du den Eindruck hast, dass es nur langsam vorwärtsgeht. Ich persönlich muss mir immer vor Augen halten, dass es in Ordnung ist, wenn ich zwei Schritte vor und dann wieder einen zurück mache. Natürlich habe ich manchmal den Eindruck, dass es nur ein paar winzig kleine Schritte nach vorn geht und dann wieder ein paar Riesenschritte zurück. Und mir wird immer noch schwindelig, weil ich ständig im Kreis herumlaufe und dieses alte Gepäck einfach nicht loswerden kann.“
Meg hatte daraufhin einige der Gebetsanliegen ihrer Freundinnen in ihrem Tagebuch notiert: Charissa wünschte sich Gelegenheiten, um anderen zu dienen und ihren Mitmenschen gegenüber ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Mara sehnte sich nach Gottes Frieden und nach einem ausdauernden Glauben, und sie brauchte Kraft für die ständigen Auseinandersetzungen mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen im Teenageralter, und Hannahs Wunsch war es, endlich zur Ruhe zu kommen und sich gut in ihre neue Beziehung einzufinden.
„Und du, Meg?“, fragte Mara. „Wie können wir für dich beten?“
„Was ich gerade besonders gut gebrauchen kann ist Hoffnung“, erwiderte Meg. „Hoffnung im Hinblick auf meine Reise und meine Zeit mit Becca. Gestern haben wir im Gottesdienst eine Adventskerze angezündet – die Hoffnungskerze. Der Pastor betonte in diesem Zusammenhang, dass ‚Hoffnung‘ im christlichen Sinne nicht bedeuten würde, sich einfach nur Dinge von Gott zu wünschen, sondern vielmehr darauf zu vertrauen, dass Gott treu ist, egal, was passiert.“ Sie hatte sich einige Sätze aus der Predigt aufgeschrieben, die sie nicht vergessen wollte: Unsere Hoffnung ist nicht ungewiss. Die Hoffnung eines Christen passt sich nicht an die Umstände an. Zu hoffen bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Gottes guter und liebevoller Plan für uns niemals vereitelt werden kann, egal, wie die Situation uns auch erscheinen mag.
„Ich werde jeden Tag für dich beten, meine Freundin“, hatte Mara versprochen.
Meg wusste, dass sie das auch ernst meinte.
Sie ließ mehrmals ihre Füße kreisen und stellte ihre Rückenlehne in Liegeposition. Ihre Sitznachbarin schnarchte leise. Megs Blick blieb an ihrem Medaillon hängen. Sie hatte sich über die Frau gewundert, weil sie die Asche ihres verstorbenen Mannes mit sich herumtrug, und dabei ganz vergessen, dass auch sie einen Teil ihres Mannes bei sich trug. Jims letzte Karte steckte in ihrem Handgepäck. Es war jene Karte, die er ihr an dem Tag geschrieben hatte, als sie beim Ultraschall zum ersten Mal ihr Baby gesehen hatten. Auf der Karte hatte er geschrieben, wie sehr er Meg und ihr ungeborenes Kind liebe, wie sehr er sich darauf freue, Vater zu werden und dass Meg ganz bestimmt eine wundervolle Mutter sein würde. Aber nur wenige Wochen später war Megs Welt in sich zusammengebrochen, als Jims Wagen auf einer vereisten Straße ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte. Als Meg im Krankenhaus eintraf, war er bereits gestorben. An Heiligabend brachte Meg schließlich ihr Baby zur Welt, ein hübsches Mädchen mit den großen, sanften Augen seiner Mutter – so, wie Jim es sich gewünscht hatte. Und jetzt wurde dieses kleine Mädchen schon 21 Jahre alt und Meg würde diesen Tag gemeinsam mit ihr in England verbringen können.
Es gab so viel zu feiern, so viel zu erzählen.
Nach Jims Tod hatte Meg die Erinnerungen an ihn aus ihrem Leben verbannt, weil sie sonst nicht hätte weiterleben können. Und weil sie sich nicht vorstellen konnte, Becca allein großzuziehen, gab sie ihr geliebtes Zuhause auf und kehrte dorthin zurück, wo sie ihre Kindheit verbracht hatte – an einen Ort, wo keine Tränen geduldet wurden.
Ihr Vater war gestorben, als Meg vier Jahre alt war. Ihre Mutter akzeptierte weder Schwäche noch Selbstmitleid und sie stellte Meg vor die Wahl: Wenn sie unter ihrem Dach leben wollte, müsste sie sich zusammenreißen und ihr Leben in den Griff bekommen. Aus Angst, unter der Last zusammenzubrechen, verdrängte Meg ihre Trauer und fügte sich den Forderungen ihrer Mutter, so gut sie konnte. Becca hingegen lernte schon früh im Leben, dass es ihre Mutter traurig machte, wenn sie nach ihrem Papa fragte, weshalb sie nach einer Weile ganz damit aufhörte. Die Jahre zogen ins Land, als hätte Jim nie existiert.
Doch nachdem Meg 21 Jahre lang jeden Gedanken an Jim verdrängt hatte, war sie seit Kurzem nun endlich wieder in der Lage, ihre Trauer zuzulassen. Auch wenn es schwierig war, den Schmerz über seinen Tod auszuhalten, so konnte sie die Erinnerungen an ihr glückliches Leben dennoch zulassen. Und einige dieser Erinnerungen wollte sie nun mit ihrer Tochter teilen. Becca sollte erfahren, wie sehr ihr Vater sie geliebt hatte – ohne sie je persönlich kennengelernt zu haben. Sie wollte Becca in die Augen schauen und ihr sagen, wie leid es ihr tue, dass sie ihr den eigenen Vater vorenthalten hatte, und wie sehr sie sich wünsche, sie hätte sich anders verhalten. Jetzt, wo Meg die Erinnerung an Jim wieder zulassen konnte, hoffte sie, dass er dadurch auch für Becca „lebendig“ werden würde.
Hoffnung. Da war sie schon wieder.
Während des Gottesdienstes hatte Meg ihren Blick auf die flackernde Hoffnungskerze gerichtet und im Gebet alles vor Gott gebracht: die Ängste, die sie jahrelang gelähmt hatten, die Schuldgefühle, die sie innerlich zerrissen, und die Sehnsüchte, die Gott in ihr hatte wachsen lassen. Katherine, Hannah, Mara und Charissa hatten sie während der ersten Schritte auf ihrer „Reise“ begleitet. Nun gab es weitere Schritte zu tun.
In England.
Jim wäre so stolz auf sie, wenn er wüsste, dass sie gerade in einem Flugzeug den Ozean überquerte. Und er wäre stolz auf seine selbstbewusste und lebensfrohe Tochter, die zum Glück vor den Ängsten ihrer Mutter verschont geblieben worden war. Danke, Gott. Mit einem zufriedenen Seufzen lehnte Meg ihren Kopf ans Fenster und schloss die Augen. Das leise Summen der Triebwerke ließ sie schließlich einschlafen.
Charissa
Charissa Sinclair wickelte eine Strähne ihrer langen dunklen Haare um ihren Finger und lauschte dem rhythmischen Quietschen der Scheibenwischer. Wieso kam John zu spät? Sie stand bereits seit sieben, nein acht Minuten mit laufendem Motor vor dem Bürogebäude und jetzt wollte sie ihn auch nicht mehr ausschalten.
Na los, komm schon!
Sie hätte sich niemals drei Stunden freinehmen dürfen – und schon gar nicht gegen Ende des Semesters! Aber sie meinte es wirklich ernst mit ihrem Wunsch, sich nicht mehr nur um sich selbst zu drehen, und darum hatte sie beschlossen, sich eine Pause von der Arbeit an ihrem Referat zu gönnen und zum Flughafen zu fahren, um Meg persönlich zu verabschieden. Anschließend hatte sie mit Mara noch einen Happen zu Mittag gegessen. Bis vor Kurzem war Mara für sie nur eine übergewichtige Hausfrau mittleren Alters mit einer schillernden Vergangenheit gewesen, mit der sie rein gar nichts gemeinsam hatte.
Wie man sich doch täuschen konnte!
Eine Gemeinsamkeit gab es nämlich doch, und zudem eine nicht ganz unerhebliche – auch wenn es Charissa schwerfiel, dies zuzugeben. Sie beide brauchten Gnade. Zu dieser Erkenntnis war Charissa in den vergangenen Monaten während des Kurses gekommen. Und es war keine leichte Erkenntnis für sie gewesen.
Außerdem hatte sie festgestellt, dass sie eigentlich ganz gern Zeit mit Mara verbrachte. Obwohl sie in ihrer Ausdrucksweise manchmal recht derb war und ihr gelegentlich auch das nötige Taktgefühl fehlte, hatte Mara mit ihren kastanienrot gefärbten Haaren, ihrer grellen Kleidung und dem auffälligen Modeschmuck das Herz dennoch am richtigen Fleck. „Wann immer du etwas brauchst, ruf mich an“, hatte Mara beim Mittagessen gesagt. „Deine Mutter wohnt doch so weit weg. Ich könnte eine, wie sagt man doch gleich …?“
„Ersatzmutter?“
„Ja genau, ich könnte deine Ersatzmutter sein. Oder eine Ersatzoma für dein Baby. Ich liebe Babys!“
Dies war ein weiterer Punkt, in dem sie sich voneinander unterschieden. Charissa hatte nie viel für Babys übriggehabt. Als Einzelkind hatte sie keine jüngeren Geschwister gehabt und auch im Teenager-Alter nie als Babysitterin gearbeitet. Während ihre Freundinnen viele Stunden in Erste-Hilfe- und Babysitter-Kurse investierten, hatte Charissa lieber in ihre Zukunft investiert. „Es ist wichtig, dass du dich auf das Lernen konzentrierst“, hatte ihr Vater ihr immer eingebläut. „Um alles andere kümmern sich deine Mutter und ich.“
Und jetzt war die Zukunft, auf die sie so zielstrebig hingearbeitet hatte, durch eine ungeplante Schwangerschaft gefährdet worden. Sie hatte ihr Doktorandenprogramm für englische Literatur an der Universität von Kingsbury bereits zur Hälfte hinter sich gebracht, und trotz Professor Allens Beteuerungen, das Programm könne flexibel gestaltet und an ihre Bedürfnisse angepasst werden, hatte Charissa schlicht und ergreifend keine Lust darauf, einen Umweg in Kauf zu nehmen.
Ein Klopfen an die Fensterscheibe ließ sie zusammenzucken, und als sie sich umdrehte, blickte sie in das strahlende Gesicht ihres Mannes. „Steig auf der anderen Seite ein!“, rief sie ihm zu und deutete auf die Beifahrerseite. Er rannte um den Wagen herum und sprang ins Auto.
„Ich habe genug vom Regen. Es ist Dezember! Wann kommt denn endlich der Schnee?“ John beugte sich vor und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. „Entschuldige die Verspätung. Ich hatte noch ein wichtiges Telefongespräch.“ Charissa fuhr schon los, während er sich noch anschnallte. „Hattest du einen guten Tag?“, fragte er.
In letzter Zeit war es schon „ein guter Tag“ für Charissa gewesen, wenn sie ein paar Bissen hatte zu sich nehmen können, ohne dass ihr übel wurde. In dieser Hinsicht war dieser Tag also recht gut gelaufen. „Ich hätte den Nachmittag vielleicht lieber für die Überarbeitung meines Referats nutzen sollen.“
„Du hast doch das ganze Semester über an diesem Referat gearbeitet. Ich dachte, es wäre längst fertig.“
„Das war doch nur der erste Entwurf. Ich muss ihn noch gründlich überarbeiten.“ Und dafür blieben ihr inzwischen weniger als zwei Wochen. Dr. Gardiner hatte ihren Studenten ans Herz gelegt, ihre Abschlussreferate sehr gründlich vorzubereiten, und Charissa war entschlossen, auf jede mögliche Frage ihrer Kommilitonen oder der Prüfungskommission eine Antwort zu haben. Solche Referate konnte man gar nicht gut genug vorbereiten.
„Du wirst das wie immer großartig machen“, sagte John. „Wie war’s mit Meg?“
„Sie war nervös und ziemlich aufgeregt. Aber wenn sie erst mal in London ist, wird sie sicher eine tolle Zeit haben.“ An der Kreuzung setzte Charissa dazu an, nach links abzubiegen.
„Bieg nach rechts ab, okay?“, bat John.
Charissa runzelte die Stirn. „Warum?“
„Vertrau mir. Bieg einfach rechts ab.“
„Wozu?“
„Tu mir einfach den Gefallen, okay? Es wird nicht lange dauern, versprochen!“
„Ich habe dir doch gesagt, dass ich heute bereits meinem Arbeitspensum hinterherhinke –“
„Und das hier wird maximal eine halbe Stunde dauern. Bieg rechts ab und an der nächsten Ampel dann links.“
Charissa zögerte und setzte schließlich mit einem übertriebenen Seufzer den Blinker nach rechts. „Wo fahren wir hin?“
„Das ist eine Überraschung.“
„Ich hasse Überraschungen.“
„Ich weiß.“
Sie folgte seinen Anweisungen und schließlich gelangten sie in einen Vorort von Kingsbury. „Okay, wir suchen den Columbia Court.“ John drückte sein Gesicht an die Fensterscheibe. „Da!“ Er deutete auf ein Stoppschild. „Bieg rechts ab und fahr langsam weiter.“ Charissa fuhr bereits langsam und bremste sichtlich übertrieben ab, um anschließend im Schneckentempo weiterzukriechen. John schien es nicht bemerkt zu haben. „464 … 468 … 472 – okay, da ist es: Nummer 480! Dort, wo das „Zu verkaufen“-Schild steht. Los, bieg in die Einfahrt ein.“
Charissa parkte den Wagen hinter einer schwarzen Limousine. John beugte sich vor. „Und? Wie findest du es?“
Charissa starrte auf den hübschen beigefarbenen Bungalow im Ranch-Stil. „Was soll das? Wem gehört dieses Haus?“
Er grinste sie verschmitzt an. „Möglicherweise bald schon uns. Also, wie findest du es?“
„Was redest du da?“
„Nun, du weißt doch, dass wir in letzter Zeit öfter mal darüber nachgedacht haben, ob wir uns ein eigenes Haus leisten könnten.“
Wollte er es einfach nicht kapieren? In den vergangenen Wochen hatten sie dieses Gespräch schon mehrmals geführt, und sie hatte keine Lust, es noch einmal zu tun. Sie erinnerte ihn daran, dass ein Hauskauf für sie beide einfach nicht drin war – und schon gar nicht, wenn das Haus in einem derart guten Viertel lag.
„Ich weiß“, erwiderte er. „Aber ich habe heute mit meinen Eltern telefoniert. Wir haben über das Baby gesprochen, und ich habe ihnen gesagt, dass unsere Wohnung eigentlich zu klein ist. Und als ich erwähnte, dass wir uns vielleicht eine größere Wohnung suchen müssen, bot mein Vater an, uns bei der Anzahlung für ein eigenes Haus zu unterstützen.“
Charissa starrte ihn verblüfft an. „Soll das ein Witz sein?“
„Würde ich bei so etwas scherzen?“
„Eine Anzahlung. Für ein Haus.“
Er strahlte sie an. „Du weißt doch, wie sehr sie sich auf ihr Enkelkind freuen. Und sie wollen uns helfen. Du wirst ihr Angebot doch wohl nicht aus lauter Stolz ablehnen, oder?“
„Nein – natürlich nicht – es ist nur –“
Er griff nach ihrer Hand. „Hör zu. Deine Eltern sind vielleicht nicht begeistert davon, ein Enkelkind zu bekommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass andere Menschen genauso empfinden müssen!“
„Nicht begeistert“ war eine leichte Untertreibung im Hinblick auf die Reaktion, mit der ihre Eltern die Nachricht von Charissas Schwangerschaft aufgenommen hatten. Und um ehrlich zu sein: Über ihre eigenen Gefühle wollte Charissa lieber gar nicht erst reden. Wenigstens hatte sie mittlerweile den ersten Schock überwunden und zu einer einigermaßen gesunden Haltung gegenüber ihrer Schwangerschaft gefunden, die, so hoffte sie, irgendwann vielleicht sogar in Dankbarkeit und Freude umschlagen würde.
Die Haustür wurde geöffnet und eine gut gekleidete Frau winkte sie herein. Charissa runzelte die Stirn. „John, was soll das jetzt bedeuten?“
Er zuckte die Achseln. „Na ja, nach dem Gespräch mit meinem Vater habe ich ein wenig im Internet gesucht, und als ich auf dieses Haus gestoßen bin, konnte ich einfach nicht widerstehen. Ich habe also gleich im Maklerbüro angerufen und einen Termin vereinbart.“
Ihr erster Impuls, ihm Vorwürfe zu machen, weil er sie unter einem Vorwand hierhergelockt hatte, ließ augenblicklich nach, als Charissa sich ausmalte, was das großzügige Geschenk seiner Eltern für sie bedeuten würde. Zwar würden sie von Johns Gehalt gut leben können, bis sie ihre Doktorarbeit geschrieben hatte, und sie hatten gerade sogar damit begonnen, ein wenig Geld für ein eigenes Haus zur Seite zu legen. Doch dieses unerwartete Geschenk veränderte alles.
„Was, wenn ich darauf bestanden hätte, links abzubiegen?“, fragte Charissa.
„Ich kann ziemlich überzeugend sein.“
„Hm“, erwiderte sie, während sie im Rückspiegel ihr Make-up überprüfte. „Wir werden sehen.“
* * *
Charissas Bemühungen, während der Besichtigung auf nonverbale Art mit John zu kommunizieren, scheiterten kläglich. Ihrer Meinung nach wäre es nämlich eine gute Strategie gewesen, etwas verhaltener zu reagieren, doch seine Begeisterung war nicht zu übersehen: Die drei Schlafzimmer waren sehr geräumig. Vom Wohnzimmer führte eine Tür auf eine große Terrasse und die Küche war erst vor Kurzem neu eingerichtet worden. Nachdem Charissa über Jahre hinweg in Studentenwohnheimen gelebt hatte und nun mit John ein kleines Zweizimmerapartment bewohnte, kam ihr dieses Haus mit seinen 185 Quadratmetern wie ein regelrechter Palast vor. „Im Keller gibt es außerdem noch eine große Waschküche“, erklärte die Maklerin.
John stieß Charissa mit dem Ellbogen in die Seite. Sie beklagte sich häufig darüber, dass sie die Wäsche immer über mehrere Etagen in den winzigen, muffigen Keller tragen musste. „Kein Kellerverlies mehr“, schwärmte John. „Lass uns unterschreiben!“
„Heute Abend werden wir ganz gewiss noch nicht unterschreiben“, verkündete Charissa – wobei sie dies nicht nur an John richtete, sondern vor allem an die Maklerin.
„Oh, natürlich nicht“, erwiderte diese. „Fahren Sie nach Hause und schlafen Sie eine Nacht darüber. Und wenn Sie ein Angebot abgeben möchten, dann rufen Sie mich einfach morgen früh an. Ihnen ist sicher bewusst, dass es noch andere Interessenten für dieses Objekt gibt. Und ich habe das Gefühl, dass uns dieses Haus regelrecht aus den Händen gerissen werden wird.“
„Ich spüre bei dir keine große Begeisterung, Riss“, sagte John, als sie den Wagen auf die Straße zurücksetzte. „Was hast du an dem Haus auszusetzen?“
„Ich kann nicht behaupten, dass es mir nicht gefallen würde. Aber du hast den ganzen Tag Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und ich wurde vollkommen überrumpelt. Du weißt doch, dass ich mich mit Entscheidungen schwertue.“ Das klang viel ärgerlicher, als sie beabsichtigt hatte. „Entschuldige bitte, das war nicht so gemeint. Aber ich möchte nichts überstürzen, okay?“
„Ich weiß, ich weiß. Seit meine Eltern ihre Hilfe angeboten haben, habe ich hin und her gerechnet. Wenn sie uns bei der Anzahlung unter die Arme greifen, könnten wir uns das Haus leisten, Riss. Ich bin wirklich der Meinung, wir sollten zugreifen. Findest du nicht auch, dass es perfekt für uns wäre?“
John schwärmte noch die gesamte Heimfahrt über von dem Haus, und auch während des Abendessens und beim anschließenden Geschirrspülen konnte er seine Begeisterung kaum für sich behalten. Charissa hingegen war damit beschäftigt, die Fußnoten und das Quellenverzeichnis für ihr Referat zusammenzustellen. John hatte sich zwischenzeitlich zu ihr gesetzt und suchte im Internet nach Fotos des Hauses, bombardierte sie mit Fragen und entschuldigte sich anschließend sofort wieder, weil er sie bei der Arbeit gestört hatte. Dann informierte er sie über die Umgebung und die Bewertung der Schulen in dieser Wohngegend. Es hatte einfach keinen Zweck! Charissa speicherte die Änderungen in ihrem Dokument ab und klappte den Laptop zu.
„Entschuldige“, sagte er. „Ich halte jetzt den Mund.“
„Nein – du hast ja recht. Ruf deinen Vater an und frag ihn, was er von dem Angebot hält.“
„Wirklich?“
„Ja. Ruf ihn an.“
„Aber gefällt es dir denn wirklich?“
„Es ist toll, John. Lass uns überlegen, wie viel wir bieten wollen. Sprich mit deinem Vater und frag ihn nach seiner Meinung.“ Hatte sie tatsächlich gerade einem Hauskauf zugestimmt?
John sprang von seinem Stuhl auf und umarmte sie. „Ich hatte direkt ein gutes Gefühl, als wir das Haus betreten haben. Ging es dir nicht auch so?“
Im Gegensatz zu ihrem Mann hatte Charissa nicht viel übrig für Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus getroffen wurden. Doch ihr sorgfältiges, pragmatisches Ich war schnell zu dem Schluss gekommen, dass die Vorteile alle Nachteile, die ihr im Laufe der nächsten Tage vielleicht noch in den Sinn kämen, weit überwiegen würden. Hatte sie nicht gerade erst ihren Freundinnen am Flughafen anvertraut, dass sie sich wünschte, ihren Kontrollzwang in den Griff zu bekommen? Vielleicht war dies ja das passende Übungsfeld. Oder um es in Dr. Allens Worten auszudrücken: Vielleicht war es an der Zeit, die Segel zu setzen, sich in den Wind zu legen und abzuwarten, wohin er sie tragen würde.
Hannah
Hannah Shepley und Nathan Allen saßen im Timber Creek Innund waren gerade mit ihrer Vorspeise beschäftigt, als Hannahs Mobiltelefon klingelte. Es war Meg, die doch eigentlich schon im Flugzeug nach London sitzen sollte. „Bestimmt ist irgendwas passiert“, meinte Hannah.
„Nimm den Anruf ruhig entgegen!“, forderte Nathan sie auf.
Hannah legte den angebissenen Mozzarella-Stick aus der Hand. „Hallo, Meg, ist alles in Ordnung?“
„Hannah, es tut mir so leid, dass ich dich stören muss. Bist du gerade mit Nathan beim Abendessen?“ Megs helle Sopranstimme klang noch eine Nuance höher als gewöhnlich und es lag noch ein kleines zusätzliches Vibrato darin.
„Ja, aber das ist kein Problem. Mach dir keine Gedanken“, erwiderte Hannah. „Wo bist du?“
„Am Flughafen in New York. Wir werden gleich wieder starten. Ich störe dich nur ungern, aber ich habe plötzlich Panik bekommen. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Haustür abgeschlossen habe, als ich weggefahren bin. Und heute Morgen habe ich noch gebügelt –“
Hannah formte mit dem Mund die Worte Alles gut und sagte zu Meg: „Kein Problem. Ich schaue nach, sobald wir mit dem Essen fertig sind.“
„Wirklich? Vermutlich habe ich mich da in etwas hineingesteigert.“
„Ist schon okay. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wie war dein erster Flug?“ Hannah drückte das Telefon noch fester ans Ohr, um Meg trotz des Flughafenlärms verstehen zu können.
„Ganz okay. Ich habe neben einer Frau gesessen, die auch nach London unterwegs ist, und sie hat mir geholfen, mich im Flughafen zurechtzufinden. Das war sehr hilfreich.“
„Das freut mich! Sag mir Bescheid, wenn du in London angekommen bist, okay? Und mach dir keine Sorgen wegen des Hauses. Ich werde alle paar Tage vorbeifahren.“
„Danke. Und denk an mein Angebot. Du kannst auch gerne dort übernachten, wenn du abends mal nicht mehr zum See zurückfahren möchtest, okay?“
Sie verabschiedeten sich und Hannah wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Nathan zu. Das Kerzenlicht spiegelte sich in seinen Brillengläsern. Für einen kurzen Moment konnte Hannah in seinen dunklen Augen eine Miniaturausgabe ihrer selbst erkennen. Wenigstens hatte sie sich ein wenig von ihrer Erschöpfung erholt. Die Sabbatzeit von ihrem Pastorenamt zeigte allmählich die gewünschte Wirkung, und sie hatte tatsächlich gelernt, sich auszuruhen – nicht nur körperlich und geistig, sondern auch geistlich und emotional.
„Was ist los?“, fragte Nathan. Sein Zeigefinger lag an seinem gepflegten grauen Kinnbart.
Hannah hatte sich immer noch nicht an die Intensität seines zumeist sehr eindringlichen und scharfsinnigen Blickes gewöhnt, aber jetzt lag nichts als uneingeschränkte Zuneigung darin. „Nichts Schlimmes.“
Sie tunkte das angebissene Ende ihres Mozzarella-Sticks in das Schälchen mit der Soße. Mit ihm in dasselbe Schälchen zu dippen war ungewohnt für sie. Es war etwas Intimes, das ihrer Meinung nach Ehepaaren vorbehalten sein sollte, oder zumindest Paaren, die länger als zwei Wochen zusammen waren. Nathan dagegen hatte keine Vorbehalte und tunkte seine Sticks ohne Scheu in die Soße. „Sie ist sich nicht sicher, ob sie das Haus abgeschlossen hat. Ich fahre heute Abend noch mal kurz vorbei – nur zur Sicherheit.“
„Ich begleite dich.“
„Nein, das ist nicht nötig. Ich komme schon klar.“
Er streckte die Hand aus und legte sie auf ihre linke Hand. „Das stelle ich auch gar nicht infrage, Hannah. Ich verbringe einfach gerne Zeit mit dir.“
Sie errötete. Mit ihren knapp 40 Jahren war sie es gewohnt, auf eigenen Beinen zu stehen, und auch wenn sie und Nate vor langer Zeit einmal gute Freunde gewesen waren, war eine romantische Beziehung noch immer unbekanntes Terrain für sie. „Nun, wenn das so ist“, erwiderte sie und schaute ihm in die Augen, „wie könnte ich dein Angebot dann ablehnen?“
„Gut. Ach, da fällt mir ein …“ Er zog einen Zettel aus seiner Jackentasche.
„Was ist das?“
„Jake hat für dich eine Liste mit Dingen zusammengestellt, die du hier in der Gegend unternehmen kannst.“
Hannah nahm die Liste, las sie durch und lachte leise auf. „Eine Schneemobilfahrt?“
„Ist das nichts für dich? Dann lies weiter. Er hat jede Menge Ideen, wie du lernen kannst, einfach nur Spaß zu haben.“
Sie las weiter. „Gokartfahren, Skifahren, Segeln. Bei Letzterem werde ich dich in die Pflicht nehmen.“
„Ich weiß doch, wie sehr du Sonnenuntergänge magst“, meinte Nathan. „Glaub mir, vom Wasser aus ist das ein noch viel schönerer Anblick. Einfach atemberaubend.“ Er beugte sich über den Tisch und überflog den Rest der Liste. „Jake besteht auch auf einer Revanche beim Scrabble. Er verliert nur ungern.“
Hannah lachte. „Ehrgeizig wie sein Vater, nicht?“
„Absolut! Wie der Vater, so der Sohn.“
Der Kellner füllte ihre Wassergläser auf, und Hannahs Blick wanderte zu der älteren Dame am Nachbartisch. Ihre Haare schimmerten silbergrau, und ihr gegenüber saß eine jüngere, adrett gekleidete Frau, die ihr sehr ähnlich sah. Hannah beobachtete, wie die ältere Frau einen Lippenstift aus ihrer Tasche holte, den Deckel abzog, ihn einen Augenblick lang verständnislos anschaute und, nachdem sie ihn an ihre Lippen gedrückt hatte, kurzerhand ein Stück davon abbiss. Sie blinzelte und legte den Kopf zur Seite, als überlege sie, ob sie den ungewohnten Geschmack und die Konsistenz noch näher erforschen wollte. Die jüngere Frau streckte ihre Hand aus.
„Mutter!“ Diese zwei schmerzerfüllten, flehenden Silben weckten Hannahs Mitgefühl – für Mutter und Tochter. „Spuck es aus!“ Die ältere Frau kniff die Lippen zusammen. „Bitte.“ Nur widerwillig öffnete sie den Mund und spuckte das abgebissene Stück in die ausgestreckte Hand ihrer Tochter.
Obwohl Hannah wusste, dass sie den Frauen eigentlich ihre Privatsphäre lassen sollte, konnte sie den Blick nicht von der Szene abwenden. Sie beobachtete, wie die Tochter ihre Hand an der weißen Stoffserviette abwischte und anschließend sanft das Kinn ihrer Mutter anhob, um ihren Mund abzutupfen. Die alte Frau lächelte sie mit ihren rot verschmierten Zähnen an. Die Tochter legte so diskret wie möglich ihren Finger an die eigenen Zähne, rieb darüber und bedeutete ihrer Mutter, dasselbe zu tun. Die ältere Dame ahmte die Handbewegung nach und rieb mit dem Zeigefinger unbeholfen über ihre Zähne. Hannah überlegte, was in diesem Moment wohl in der Tochter vorgehen mochte.
„Alles in Ordnung?“, fragte Nathan und folgte ihrem Blick zum Nachbartisch.
„Ja.“
„Sicher?“
Hannah räusperte sich. „Ja.“
In ihrem Kopf spielte sie die unterschiedlichsten Szenarien durch. Vielleicht erinnerte sich die Tochter daran, wie sie selbst einmal ein Stück Kreide abgebissen und ihre Mutter ihr befohlen hatte, es wieder auszuspucken. Vielleicht dachte sie aber auch daran, wie sie zum ersten Mal gemeinsam mit ihrer Mutter Make-up eingekauft und wie diese ihr beigebracht hatte, sich zu schminken. Vielleicht war die Mutter auch noch so klar im Kopf, dass sie die Augenblicke der Verwirrung erkennen konnte und um das trauerte, was gerade im Begriff war, für immer verloren zu gehen. Vielleicht wäre ihr Biss in den Lippenstift aber auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen und ihre Tochter dazu zwingen würde, sie schweren Herzens in ein Pflegeheim zu geben, um eine bessere Betreuung für sie zu gewährleisten.
„Woran denkst du gerade?“, fragte Nathan.
„Im Augenblick kämpfe ich gegen den Impuls an, zu dem Tisch hinüberzugehen und den beiden seelsorgerische Hilfe anzubieten.“
Er zog eine Augenbraue hoch.
„Das war nicht ernst gemeint. Na ja, zumindest nicht so ganz. Aber wenigstens bin ich in der Lage, der Versuchung zu widerstehen, richtig? Ich glaube, die Sabbatzeit ist gut für mich und hilft mir dabei, meine übertriebene Pastorenfürsorge endgültig abzulegen.“ Sie schickte ein Stoßgebet gen Himmel und bat Gott, Mutter und Tochter in dieser schwierigen Situation beizustehen.
„Was genau hat denn deine Aufmerksamkeit gefesselt?“, fragte er.
Leise beschrieb Hannah die Szene, die sie beobachtet hatte.
„Es ist wirklich schwer mit anzuschauen, wenn geliebte Menschen älter werden“, bemerkte er. Hannah nickte, und plötzlich schlug sie sich mit der flachen Hand an die Stirn. „Was ist?“, fragte Nathan.
„Morgen hat meine Mutter Geburtstag! Ich war so sehr mit meinem eigenen Leben beschäftigt, dass ich ganz vergessen habe, ihr eine Karte zu schreiben.“ Wie hatte ihr das nur passieren können?
„Wie wäre es, wenn du ihr Blumen schickst?“
Hannah seufzte. „Nein. Sie fahren übermorgen nach New York, um meinen Bruder und seine Familie zu besuchen.“
„Dann schick die Blumen und die Karte doch einfach an die Adresse deines Bruders.“
Hm. Das würde gehen. Nate hatte eine Lösung für ihr Problem gefunden. Sie könnte morgens anrufen und ihrer Mutter sagen, dass bei Joe ein Geschenk auf sie warten würde. „Das ist die perfekte Lösung. Danke.“ Sie steckte Jakes Liste in ihre Tasche. „Meine Eltern bleiben ein paar Wochen an der Ostküste und wollen Verwandte besuchen, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Und Weihnachten werden sie dann gemeinsam mit Joe und seiner Familie verbringen. Mein Bruder hat mich auch eingeladen, aber ich habe abgelehnt. Und gleich darauf Gewissensbisse gehabt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich hinfahre, gleich wieder anbieten werde, auf meine Nichten aufzupassen, damit er und meine Schwägerin ausgehen können. Ich liebe meine Nichten, aber sie sind auch ziemlich anstrengend. Und auch wenn ich weiß, dass ich wegen der Dinge aus meiner Vergangenheit irgendwann ein offenes Gespräch mit meinen Eltern werde führen müssen, fühle ich mich dazu im Augenblick noch nicht in der Lage.“ Sie steckte ihre kinnlangen braunen Haare hinter die Ohren. „Sag mir bitte, dass meine Absage kein Vorwand ist, um einer Auseinandersetzung mit meinen Eltern aus dem Weg zu gehen.“
Nathan zuckte mit den Achseln. „Tja, ich muss gestehen, ich habe großes Interesse daran, dass du hierbleibst, darum weiß ich nicht so genau, wie unvoreingenommen meine Einschätzung ist. Aber ich hoffe doch sehr, dass du Weihnachten mit mir und Jake feiern wirst.“
Sie hatte auf seine Einladung gehofft. Liebevoll legte sie ihre Hand auf seine, als der Kellner das Hauptgericht brachte. „Also gut, ich nehme deine Einladung an. Und ich freue mich schon sehr darauf, dich wieder beim Scrabble zu schlagen.“
Nathan nahm seine Gabel zur Hand und deutete auf sie. „Träum weiter, Shep. Träum weiter!“
* * *
Als sie bei Megs Haus ankamen, hatte der Regen nachgelassen. Die graue Wolkendecke war aufgerissen und einem sternenklaren Dezemberhimmel gewichen. Eine schmale Mondsichel strahlte vom Himmel auf sie herab.
„Was für ein hübsches Haus“, bemerkte Nathan, während er sich das große Herrenhaus mit dem spitzen Dach, den gedrechselten Zierleisten, den Giebeln und dem hübschen Türmchen genauer anschaute. In seiner Blütezeit war es vermutlich das eleganteste Haus in der Umgebung gewesen. „Die meisten dieser alten Häuser sind in Apartmenthäuser oder Büros umgewandelt worden“, merkte er an. „Und Meg wohnt hier wirklich ganz allein?“
Hannah nickte. „Ihre Mutter ist im Frühjahr gestorben. Und da Becca in London ist, lebt sie allein. Es gibt nicht mal einen Goldfisch, der ihr Gesellschaft leisten könnte.“
Nathan folgte ihr über die knarrenden Stufen hinauf zur Veranda. Eine der gedrechselten Spindeln war abgebrochen und die Farbe blätterte ab. Hannah versuchte, die Haustür zu öffnen. Sie war verschlossen. „Schon mal eine Sorge weniger“, sagte sie. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss, stieß die schwere Tür auf und tastete sich an der Wand des dunklen Flures entlang zum Lichtschalter. Der alte Kronleuchter flammte auf.
Nathan stieß einen leisen Pfiff aus, der von den Wänden zurückgeworfen wurde. „Wow. Beinah wie in einem Museum, nicht wahr?“ Er spähte in das mit antiken Möbeln eingerichtete Wohnzimmer.
Eher wie in einem Mausoleum, dachte Hannah. Vor allem, wenn sie bedachte, was hier geschehen war. Erst kürzlich hatte Meg entdeckt, dass ihr alkoholkranker Vater in einem der oberen Schlafräume Selbstmord begangen hatte. Damals war sie noch ein kleines Mädchen gewesen. In den vergangenen Monaten hatte Meg sehr viel verarbeiten müssen und sich dem Trauerprozess mit unglaublich viel Mut gestellt.
„Manchmal frage ich mich, warum sie hier wohnen bleibt“, sagte Hannah. „Meg hat zwar nicht viel über die Beziehung zu ihrer Mutter erzählt, aber ich habe den Eindruck, dass das Zusammenleben mit ihr nach Jims Tod nicht gerade leicht war.“ Langsam schüttelte sie den Kopf. „Das ganze Haus hat eine furchtbar traurige und bedrückende Ausstrahlung.“
„Wie wäre es denn, wenn wir ein wenig Leben hineinbringen würden?“, fragte Nathan.
„Was meinst du?“
„Ich meine, wie wäre es, wenn du Megs Angebot annehmen und während ihrer Abwesenheit hier wohnen würdest?“ Nathan legte seine Arme um sie. „Dann hätte ich dich ganz in meiner Nähe. Nur 10 Minuten Fahrt statt 45.“
Das Haus ihrer Freundin Nancy, in dem Hannah während ihrer neunmonatigen Sabbatzeit wohnte, war friedlich, aber sehr abgelegen und einsam. Obwohl sie sich anfangs gegen das großzügige Angebot ihres Pastors gewehrt und sich sogar darüber geärgert hatte, konnte Hannah ihrem Übergangszuhause inzwischen auch Gutes abgewinnen. Sie liebte es, von der Veranda aus die Sonnenuntergänge zu beobachten und sich vom Plätschern der Wellen am Strand in den Schlaf lullen zu lassen. Sie liebte es, an dem großen Fenster zu sitzen und ihren Tee zu trinken, in der Bibel zu lesen und Tagebuch zu schreiben. Sie liebte die Spaziergänge am frühen Morgen, wenn die Sonne am Horizont über dem See aufging und jede sich brechende Welle ein glitzerndes Segel hinter sich herzog, in dem sich die Herrlichkeit des Himmels spiegelte.
Doch ihr Lebensmittelpunkt hatte sich inzwischen nach Kingsbury verlagert, vor allem, seitdem sie Nathan nach so vielen Jahren wiedergetroffen hatte. Ein paar Nächte in der Woche würde sie in Megs Haus wohl überstehen können.
Nate hatte recht. Die Nähe zu ihm war das entscheidende Argument.
* * *
Hannah war gerade in der Hütte am See angekommen, als Meg erneut anrief, um ihr mitzuteilen, dass sich ihr Flug wegen technischer Probleme um einige Stunden verzögern würde. „Ich weiß nicht, ob wir heute noch starten oder Hotelgutscheine bekommen und auf einen anderen Flug umgebucht werden.“
Hannah hangelte sich aus ihrem Mantel, während sie das Telefon in der Hand hielt. Sie konnte die Angst und Erschöpfung in Megs Stimme hören. „Ich werde für dich beten“, sagte sie. „Soll ich Mara und Charissa Bescheid geben?“
„Würdest du das tun? Je mehr Menschen im Augenblick hinter mir stehen, desto besser.“
Da sie Charissa nicht beim Lernen stören wollte, schickte sie ihr eine E-Mail und rief anschließend Mara an. „Entschuldige, dass ich dich so spät störe“, sagte Hannah. „Habe ich dich geweckt?“
„Nein, ich bin noch wach.“
Hannah hörte eine Stimme im Hintergrund brüllen. Es klang, als wäre der Fernseher viel zu laut gestellt. „Alles in Ordnung?“, fragte Hannah.
„Ja, mir geht es gut. Was gibt’s?“
Während Hannah von Meg erzählte und davon, dass sie Gebetsunterstützung brauchte, wurde die Stimme des Mannes im Hintergrund noch lauter. Wer auch immer dort gerade mit Schimpfwörtern um sich warf, tat das nicht in einem Fernsehfilm. „Und bei dir ist ganz bestimmt alles in Ordnung?“, fragte Hannah vorsichtig.
„Ja. Entschuldige. Die arme Meg. Sie hatte solche Angst vorm Fliegen, und jetzt das …“
Genau. Jetzt auch noch das. „Ist das etwa Tom, der da so herumbrüllt?“, fragte Hannah. Sie hatte Maras Mann bisher noch nicht kennengelernt.
„Ja. Er ist sauer, weil ich ein paar Sachen für Jeremys Baby gekauft habe.“
Nur sauer? Das hörte sich nicht so an, als wäre jemand „nur sauer“.
„Bedroht er dich?“, fragte Hannah.
„Nee.“
Aber Hannahs seelsorgerische Alarmglocken begannen zu schrillen.
In den vergangenen Monaten hatte Mara ihre Ehe mit Tom als schwierig, aber erträglich beschrieben. Tom war sehr viel geschäftlich unterwegs und konzentrierte sich an den Wochenenden auf ihre beiden Söhne. Mara fühlte sich ziemlich einsam. Zwar hatte sie ihnen anvertraut, dass sie nicht sicher sei, ob ihre Ehe über den Highschool-Abschluss ihrer Söhne hinaus Bestand haben würde, aber von Gewaltausbrüchen ihr gegenüber war nie die Rede gewesen.
„Mara –“
Eine Tür knallte und das Gebrüll wurde leiser.
Mara stieß selbst eine Reihe von Schimpfwörtern aus. „Er wird die ganze Woche zu Hause sein. Ich Glückliche!“
„Und du kommst ganz bestimmt klar?“
„Ja, er ist jetzt weg. Hat sich in den Keller verzogen und schläft auf der Couch. Mann, ich hoffe nur, dass Meg gut ankommt. Wie erschöpft sie sein muss! Armes Ding. Ich werde ganz fest an sie denken.“
Während Mara sich weiter über ihre Wünsche für Meg ausließ, machte es sich Hannah mit einer Decke im Sessel gemütlich und wartete darauf, dass das Gebrüll endlich verstummte. Sie war sich nicht sicher, ob Toms Zorn durch ihr Telefonat nicht noch zusätzlich angefacht wurde oder ob es die Situation entschärfte, aber Mara schien es definitiv nicht eilig zu haben, das Gespräch zu beenden. Darum ließ Hannah sie ausführlich von ihrem Sohn Jeremy und dem Baby berichten, das in der ersten Januarwoche zur Welt kommen sollte, und wie sehr sie sich darauf freute, Großmutter zu werden. Als es im Hintergrund still wurde und Mara hörbar gähnte und sagte, sie sollten jetzt wirklich lieber schlafen gehen, verabschiedeten sie sich voneinander.
Hannah kochte sich noch eine Tasse Kamillentee und lauschte dem Knarren und Ächzen der Pinien im Wind. Vielleicht wäre es wirklich eine gute Idee, in Megs Haus zu ziehen. So würde sie nämlich nicht nur näher bei Nate wohnen, sondern auch bei Mara, falls sie doch noch ihre Hilfe brauchen sollte. Denn so, wie es sich eben angehört hatte, brauchte sie definitiv mehr Hilfe, als Hannah bisher gedacht hatte.
Mara
Mara trommelte mit den Fingern auf den Einkaufswagen, während sie in dem Babyladen in der Schlange wartete. Wenn sie die Einkaufstüten am Montagnachmittag sofort versteckt hätte, wäre Toms Wutausbruch wahrscheinlich vermeidbar gewesen. Aber er war früher als erwartet aus dem Büro nach Hause gekommen und hatte ihr mitgeteilt, dass sich seine Reisepläne für die Woche geändert hätten. Leider hatte sie ihre Einkäufe zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den üblichen Verstecken verstaut. Der Buggy hätte allerdings sowieso nicht in den Schrank im Keller gepasst. Wenn sie ihn doch nur im Kofferraum gelassen hätte! Aber nein, sie hatte ihn ja unbedingt mit ins Haus nehmen müssen, weil sie ihn anschauen und sich ausmalen wollte, wie sie das Baby darin spazieren fahren würde. Als Tom sie darauf ansprach, hatte sie nicht schnell genug reagieren und behaupten können, Jeremy habe ihn gekauft. Außerdem hätte er ihr das sowieso nicht geglaubt, bei all den anderen Einkaufstüten aus dem Babyladen, die im Wohnzimmer verstreut lagen und deren Inhalt Mara auf dem Esstisch ausgebreitet hatte, um sich daran zu erfreuen.
Wegen der Vorhänge war sie unsicher gewesen. 90 Dollar waren vermutlich zu viel für zwei Volants. Aber bei ihrem letzten Besuch in Jeremys Wohnung war das Kinderzimmer noch nicht fertig gewesen, und als sie die Vorhänge entdeckte, die so perfekt zu der Blumendecke passten, die Abbys Mutter Ellen bereits für das Kinderbettchen genäht hatte, konnte Mara nicht widerstehen und musste sie einfach kaufen.
Aber vielleicht würde Ellen die Vorhänge ja auch selbst nähen. Sie war nämlich die Art von Großmutter, die niedliche Sommerkleidchen mit passenden Hütchen selbst schneidern konnte. Und höchstwahrscheinlich würde sie auch noch jede Menge Babydecken, Pullover und Handschuhe stricken. Und was hatte Mara dem Baby zu bieten, wenn sie nicht für das Kind einkaufen konnte?
Mara hatte also im Wohnzimmer gestanden, an einem ihrer Fingernägel herumgekaut und über ihre Einkäufe nachgedacht, als Tom unerwartet ins Zimmer platzte, ihr einen bösen Blick zuwarf, dann ihre Einkäufe ins Visier nahm und schließlich explodierte. Wutausbrüche waren bei Tom eher eine Ausnahme: Meistens verzog er nur verächtlich die Lippen oder machte eine sarkastische Bemerkung, manchmal erhob er im Zorn auch die Faust. Aber das hier war einfach zu viel für ihn gewesen, und noch Stunden später verfolgte er sie schreiend durchs ganze Haus. Wie Mara es wagen könne, sein schwer verdientes Geld für Jeremys Kind auszugeben? Jeremy verdiene doch sein eigenes Geld und könne selbst für seine Familie sorgen, oder etwa nicht? Immer weiter versprühte er sein Gift über ihren Sohn und wertete dabei jede Auseinandersetzung, jeden Verstoß in seiner Teenagerzeit und jedes noch so kleine Vergehen als Beweis dafür, dass Jeremy schon immer ein wertloser Tunichtgut gewesen war. Irgendwann im Laufe ihrer Auseinandersetzung hatte Mara das Gefühl, Tom würde den Buggy jeden Augenblick an die Wand werfen. Stattdessen steckte er ihn in die Verpackung zurück. Mara solle gefälligst den ganzen Mist zurückbringen und sich jeden einzelnen Dollar erstatten lassen, denn kein Cent von seinem Geld würde für dieses Baby ausgegeben. Er fragte, ob sie ihn verstanden habe. Wenn sie Babyzeug kaufen wolle, solle sie sich gefälligst einen Aushilfsjob suchen und von ihrem eigenen Geld etwas kaufen. Ob er sich klar genug ausgedrückt habe?
In diesem Augenblick hatte das Telefon geklingelt.
„Haben Sie Ihre Meinung geändert?“, fragte die Verkäuferin am Rückgabetresen.
Mara reichte ihr die Quittung. „Ja.“
Die Verkäuferin starrte auf den voll beladenen Einkaufswagen. „Wollen Sie das wirklich alles zurückgeben?“
Mara trat nervös von einem Bein aufs andere. „Nun, ich habe die Sachen für meinen Sohn und meine Schwiegertochter gekauft, ohne es vorher mit ihnen abzusprechen.“
„Aha“, erwiderte die Frau, und ihr Gesichtsausdruck wurde sanfter. „Das kann ich sehr gut nachvollziehen! Ich habe drei verheiratete Söhne, und ich versuche noch immer herauszufinden, wie ich eine gute Schwiegermutter sein kann. Meine Schwiegertöchter rufen nur an, wenn ich auf die Enkelkinder aufpassen soll.“
Warum sollte sich Mara die Mühe machen, die Sache richtigzustellen? Sollte die Verkäuferin doch glauben, sie hätte es versäumt, sich mit den zukünftigen Eltern abzusprechen. Dass sich Mara ihrem herrschsüchtigen Ehemann beugen musste, brauchte die Verkäuferin ja nicht zu erfahren.
Auf dem Weg zum Ausgang blieb Mara vor einer Auslage mit Weihnachtsartikeln stehen. Zu schade, dass ihre Enkeltochter erst am zweiten Januar zur Welt kommen würde. Wie gern hätte sie ihr eine Nikolausmütze gekauft! Oder vielleicht die winzigen Elfensocken. Noch niedlicher waren die mit den kleinen Glöckchen an den Zehen – sie sollten vermutlich Unglück abwehren.
Erstaunlich, dass die Menschen über 40 ihre Kindheit heil überstanden hatten, wenn man bedachte, was heutzutage alles als gefährlich eingestuft wurde. Sogar die Autositze, in denen Kevin und Brian gesessen hatten, würden nach den neuesten Standards vermutlich als zu unsicher gelten. Und Jeremy, der mittlerweile 30 war, hatte sogar noch fröhlich auf dem Rücksitz ihres alten Fords herumgeturnt, in dem es noch nicht einmal Sicherheitsgurte gegeben hatte. Und er hatte mit allen möglichen Spielzeugen, Bändern und Kleinteilen gespielt. Aber damals waren es nun mal noch ganz andere Zeiten gewesen.
„Schau mal, Mama!“ Eine hochschwangere Frau trat auf die Auslage zu. Ihr Bauch war so dick, dass man Angst haben musste, sie könne jeden Augenblick platzen. „Sieh dir nur diese kleinen Elfenstiefelchen an!“
Ihre Mutter schob einen voll beladenen Einkaufswagen vor sich her. „Du hast recht, die sind ja niedlich!“ Sie nahm gleich zwei Paar davon. Und eine Nikolausmütze. Und ein Lätzchen mit der Aufschrift „Omas kleiner Engel“.
Wussten diese Frauen eigentlich, wie glücklich sie sich schätzen konnten? Hatten sie auch nur den Hauch einer Ahnung?
Vermutlich nicht.
Bei Jeremys Hochzeit hatte Mara noch auf eine gute Beziehung zu ihrer Schwiegertochter gehofft. Sie hatte sich ausgemalt, dass sie sich zum Mittagessen oder Einkaufen treffen würden; sie hatte von Gesprächen geträumt, in denen Abby sie um Rat fragte und von ihr wissen wollte, wie sie eine gute Ehefrau für Jeremy sein könne.
Nicht, dass sie keine gute Ehefrau gewesen wäre. Abby machte Jeremy glücklich und dafür sollte Mara eigentlich dankbar sein. Aber anderthalb Jahre nach der Hochzeit wartete Mara noch immer vergebens auf ein persönliches Gespräch wie dieses. Sie und ihre Schwiegertochter waren nie allein zum Mittagessen ausgegangen, obwohl sie nur 15 Minuten voneinander entfernt wohnten. Nicht, dass Abby unfreundlich gewesen wäre. Sie hatte sich Mara und Tom gegenüber stets höflich und respektvoll verhalten. Mara vermutete, dass das in ihrer asiatischen Herkunft begründet lag. Aber vielleicht würde Abby sie eines Tages endlich nicht mehr „Mrs Garrison“ nennen, sondern „Mama“ oder wenigstens „Mara“.
Natürlich konnte man es Abby nicht übel nehmen, dass sie in Gegenwart der Garrisons auf der Hut war. Jeder Besuch bei ihnen war der pure Stress, das ließ sich nicht leugnen. Und das Desaster am 4. Juli hatte Abby ihnen vermutlich noch immer nicht verziehen. Allein beim Gedanken daran zuckte Mara zusammen: Tom, der in seinem T-Shirt mit der Aufschrift „Grillkönig“ Burger grillte und sich dabei lautstark über die „Fremden“ ausließ, „die sein Land ins Verderben führen würden“; Brian und Kevin, die in der Auffahrt ein Feuerwerk zündeten und Abby damit zu Tode erschreckten; und Mara, die in ihrem – zugegebenermaßen sehr kitschigen – Lieblingskleid im Flaggen-Look Limonade in rot-weiß-blaue Plastikbecher einschenkte. Sie hatte Tom gesagt, er solle bitte kein Feuerwerk kaufen, doch er hatte natürlich nicht auf sie gehört.
„Wir haben Neuigkeiten, Mama“, hatte Jeremy damals gesagt und seine Hand auf die Rückenlehne von Abbys Stuhl gelegt. Und Mara hatte gewusst, was nun kommen würde. Auf diesen Augenblick hatte sie seit der Hochzeit gewartet!
Als Jeremy wieder zum Sprechen ansetzte, schoss Brian eine Rakete ab, die mit einem ohrenbetäubenden Knall explodierte.
Wumm!
Da sie nicht vorschnell in Jubelgeschrei ausbrechen wollte, bat sie Jeremy, noch einmal zu wiederholen, was er gerade gesagt hatte, nur um sicherzugehen.
„Ich sagte: Abby ist schwanger. Das Baby kommt im Januar.“
Maras Lippen entfuhr ein Freudenschrei, der den Feuerwerkskörpern Konkurrenz hätte machen können. Sie riss Jeremy an sich und umarmte ihn, und ohne darüber nachzudenken, dass sie dadurch vielleicht eine Grenze überschreiten könnte, zerrte sie Abby auf die Beine und erstickte sie beinah in einem wabbeligen Berg aus feuchtem, schwitzendem Fleisch. Noch immer sah sie Abbys unbehagliches, aber höfliches Lächeln vor sich, nachdem sie sich befreit hatte.
„Ich kann es nicht glauben! Tom, hast du das gehört? Ich werde Großmutter!“
Ohne zu antworten, spießte Tom mit seiner Grillgabel einen Hotdog auf. Mara umarmte Jeremy noch einmal und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. „Gratuliere! Was für wundervolle Neuigkeiten!“
Abby ließ sich wieder in ihren Gartenstuhl fallen.
„Wie das Baby wohl aussehen wird?“, überlegte Mara laut, bevor sie plötzlich errötete. „Ich meine, Mischlingsbabys sind doch wunderschön … Sieh dir doch nur Jeremy –“
Das war der Augenblick gewesen, in dem sich Toms Lippen zu seinem höhnischen Lächeln verzogen hatten. Die Beschimpfung, die er anschließend von sich gab, hätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt, wenn Mara nicht ihre Hand auf Jeremys Arm gelegt und ihn gebeten hätte, sich noch ein weiteres Glas Limonade zu nehmen.
In guten wie in schlechten Zeiten.
Nein, sie würde es Abby nicht übel nehmen, dass sie sie mit Tom und den Jungen auf eine Stufe stellte, und dass sie für Abby definitiv zu den „schlechten Zeiten“ gehörten, die sie am Tag ihrer Eheschließung mit in Kauf genommen hatte. Das würde sie ihr ganz bestimmt nicht übel nehmen.
Sie seufzte, als sie in ihre Straße einbog. Die Häuser der Nachbarn waren bereits mit Tannenzweigen und dunkelroten Schleifen geschmückt, und vor ihren Haustüren standen riesige Vasen mit Kiefern- und Hartriegelzweigen, an denen Tannenzapfen und getrocknete Granatäpfel herunterhingen. In einer Zeitschrift im Wartezimmer ihrer Therapeutin Dawn hatte Mara hübsche Gestecke für Pflanzvasen entdeckt, aber Tom hätte garantiert kein Verständnis dafür, wenn sie für so etwas sein Geld ausgäbe. „Dummer Kinderkram“, würde er sagen. Während nun alle anderen in ihrer Straße ihre Sträucher und Bäume mit dezent funkelnden Lichterketten schmückten, bestand Tom jedes Jahr auf Lichterketten mit großen, bunten, blinkenden Glühbirnen. Vor Jahren hatten sich die Nachbarn sogar schon einmal über den Plastik-Nikolaus mit dem Rentier und dem Schlitten auf ihrem Rasen beschwert. Den hatte Tom schließlich wutentbrannt weggeräumt, aber nicht ohne vorher noch anzudrohen, gleich das komplette Ensemble aufs Dach zu stellen. Bald würde er auch sicher wieder die großen Plastikzuckerstangen in der Einfahrt aufstellen – nur, um damit die Nachbarn zu ärgern.
Irgendwann einmal würde Mara sich durchsetzen und einen echten Kranz mit Äpfeln und Tannenzapfen kaufen, um damit ihre Haustür zu schmücken. Doch jetzt sollte sie vielleicht erst einmal die verfaulten Kürbisse und verwelkten Chrysanthemen wegwerfen, die noch immer auf ihrer Veranda vor sich hin gammelten. Normalerweise betrat sie das Haus durch die Garage, weshalb sie nur selten einen Fuß auf die Veranda setzte. Ein Wunder, dass sich Alexis Harding noch nicht über den Zustand ihres Vorgartens geäußert hatte. Alexis hatte nämlich noch nie ein Problem damit gehabt, sie von ihrem perfekt gepflegten Grundstück auf der anderen Straßenseite aus mit Kritik zu bombardieren. Wie sollte sie auch? Schließlich war jedes Fenster ihres Hauses mit Kerzen beleuchtet, Tannenzweige prangten in ihren schmiedeeisernen Blumenkästen und der Torbogen zu ihrem Garten war mit einer Lichterkette geschmückt. Jetzt fehlte nur noch ein weißer Gartenzaun, um das Bild perfekt zu machen.
Widerlich!
„Und, wie geht’s?“, rief Mara drei Nachbarinnen zu, die gerade einen Powerwalk durch das Viertel machten, während Mara vorsichtig die Kürbisse an ihren Stielen berührte. „Jetzt könnte es wirklich bald mal schneien!“
„Ich habe gehört, dass es morgen Nacht schneien könnte, vielleicht sogar ein paar Zentimeter“, erwiderte eine von ihnen.
Mara fragte sich, worüber sie sich wohl unterhielten, während sie gemeinsam unterwegs waren – ob sie nur oberflächlich miteinander plauderten, tratschten oder vielleicht sogar tiefsinnige Gespräche führten? Früher war Mara sehr neidisch auf sie gewesen. Aber jetzt hatte auch sie Gefährtinnen, die sie auf ihrer geistlichen und emotionalen Reise begleiteten. Doch leider würden sie sich in den kommenden Wochen nicht treffen können, um miteinander zu beten. Aber im Januar, sobald Meg wieder zu Hause war, würden sie sich wieder häufiger sehen, hoffte Mara. Vielleicht würden sie auch irgendwann noch mal einen Kurs zusammen belegen. Aber jetzt galt es erst mal, Weihnachten zu überleben.
Sie warf die Post auf den Küchentisch – Rechnungen, Werbung und Weihnachtsgrüße. Die Weihnachtspost öffnete sie erst gar nicht, weil sie sich am Ende doch nur ärgern würde. Es gab nämlich drei Sorten von Karten: erstens die, auf denen nur eine Unterschrift zu finden war – mal ehrlich: Was sollte das? –, zweitens die Karten mit dem Foto einer glücklichen Familie an einem ausgefallenen Reiseziel und drittens Briefe, die die Botschaft vermittelten: „Seht uns an, wir sind die Größten!“ Letztere enthielten nämlich immer jede Menge Fotos und ausführliche Berichte über die Leistungen der perfekten, überambitionierten Kinder.
Widerlich!
Nur ein einziges Mal würde sie gern einen ehrlichen Brief lesen über eine Ehe, die in Scherben lag, einen Sohn, der null Ahnung von Algebra hatte, und egozentrische Teenager, die viel zu viel Zeit mit Computerspielen verbrachten. Vielleicht könnte sie selbst mal einen solchen Brief verfassen …
Und eigentlich war das auch genau die Situation, die Pastor Jeff am ersten Adventssonntag in seiner Predigt beschrieben hatte. „Jesus kam nicht im Hilton von Bethlehem zur Welt“, hatte er gesagt. „Er kam in das Chaos unserer Welt. Und wenn wir uns in dem stinkenden Durcheinander unseres Lebens umschauen, dann fragen wir uns vielleicht auch selbst: ‚Was kann an einem Ort wie diesem schon geboren werden?‘“
Das war die entscheidende Frage, nicht wahr?
Was kann an einem Ort wie diesem schon geboren werden?
Sie zündete ihre Zimt-Duftkerze an, ließ sich am Küchentisch nieder und stützte den Kopf in ihre Hände.
Sie hatte keine Ahnung – absolut keine Ahnung!