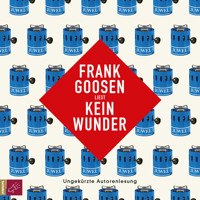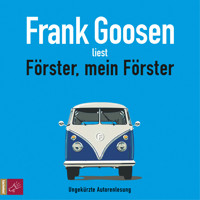7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Wieso gehst du ins Stadion? – Weil Samstach is!
»Wir im Ruhrgebiet gehen nicht ins Stadion, um uns zu amüsieren. Wir gehen da hin, um uns aufzuregen. Beispiel? Jedes Jahr wieder ist das erste Heimspiel der neuen Spielzeit gerade mal fünf Minuten alt, da brüllt der Mann in der Reihe vor mir zum ersten Mal: ›DAT ISS DOCH DIESELBE SCHEISSE WIE INNER LETZTEN SÄSONG!!!‹« Die schönsten Fußballgeschichten vom literarischen Großmeister des runden Leders.
Vom Vorsitz der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur zum Fußballbuch des Jahres nominiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Ähnliche
Frank Goosen
Weil Samstag ist
Fussballgeschichten
WILHELMHEYNE VERLAG MÜNCHEN
ZUM BUCH
Weil Samstag ist versammelt die besten Fußballgeschichten des Bochumer Autors und Kabarettisten Frank Goosen endlich in einem Band. Hier schreibt der bekennende Ruhri über die Leidenschaft für den Fußballsport im Allgemeinen und zu den Blüten, die diese Leidenschaft gerade zwischen Duisburg und Unna, Recklinghausen und Hattingen treibt, im Besonderen. Es geht um die noch immer berühmten, die leider vergessenen und die nie gekannten Helden, ums Gewinnen und Verlieren und wie man das alles an seine Kinder weitergibt. Goosen gibt ungeübten Zuschauern mit dem „Kleinen Stadionknigge“ einen Leitfaden an die Hand, wie man sich während eines Spiels zu benehmen hat, er berichtet von bekloppten Engländern, die mit dem Taxi quer durch Europa zum Champions-League-Endspiel fahren und von den Schwierigkeiten, Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft zu bekommen. Er trifft gegnerische Fans auf der Stadiontoilette, geht fremd mit Wacker Burghausen und denkt sogar in New York nur an seinen Heimatverein.
Weil Samstag ist wurde vom Vorsitz der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur als »Fußballbuch des Jahres« nominiert.
ZUM AUTOR
Frank Goosen, geboren 1966, hat sich Ruhm und Ehre als eine Hälfte des Kabarett-Duos Tresenlesen erworben. Sein Durchbruch war der Roman Liegen lernen, der lange auf den Bestsellerlisten war und erfolgreich verfilmt wurde. 2003 erhielt Frank Goosen den Literaturpreis Ruhrgebiet. Mit dem Ruhrpott-Geschichtenband Radio Heimat gelang Frank Goosen der Sprung in die Top-10 der Bestsellerlisten.
LIEFERBARE TITEL
Liegen lernen – Pokorny lacht – So viel Zeit – Pink Moon – Fritz Walter, Kaiser Franz und wir – Mein Ich und sein Leben – Sechs silberne Saiten
Für Robert und Ludwig
»Ich ziele nicht.
Wenn ich nicht weiß, wohin der Ball geht,woher soll es dann der Torwart wissen?«
Wayne Rooney
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
3. Auflage
Vollständige Taschenbucherstausgabe 06/2010 Copyright © 2008 by Eichborn AG, Frankfurt am Main Copyright © 2010 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlagfoto: © picture alliance / IMAGNO / Walter Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München nach einer Idee von Christiane Hahn
eISBN: 978-3-641-21502-6V001
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Grundlagen
I
Wieso Fußball?
Ich stelle mir das so vor: Menschen, die Briefmarken sammeln, Modellflugzeuge bauen oder Turniertanz betreiben, sitzen an einem ereignisarmen Sonntagnachmittag sinnend auf ihrem Wohnzimmersofa und fragen sich: »Wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen?«
So eine Frage stellt sich ein Fußballfan überhaupt nicht. Fragen Sie bei uns in der Gegend einen Fußballfan: »Wieso gehst du ins Stadion?«, antwortet der nur: »Watt?«
Der versteht die Frage überhaupt nicht.
»Wieso gehst du zum Fußball?«
»Is doch Samstach!«
Fußball ist uns zwischen Duisburg und Unna, zwischen Recklinghausen und Hattingen ins Genom übergegangen, unsere Doppelhelix besteht nicht aus Aminosäuresequenzen, sondern aus echtem Leder. Legt ein werdender Vater die Hand auf den Bauch seiner hochschwangeren Frau und spürt den Tritt des Thronfolgers, kann er nicht anders, er sagt: »Kumma, der flankt!«
Und kaum bist du aus dem Bauch raus, bestimmt Fußball über deinen Platz im sozialen Gefüge. Bei uns war das so: Spüli, Pommes, Mücke und ich trafen uns zum Pöhlen zunächst auf den Grundstücken zwischen den Mietskasernen in Stahlhausen, dem »Blaubuxenviertel«, wobei korrodierende Teppichstangen als Tore dienten. Fragten wir unterwegs jemanden, ob er mitspielen wolle, und der sagte: »Nee, ich interessier mich nicht für Fußball«, knallte Mücke ihm vor den Latz: »Wie, du willz nich pöhlen? Bis du schwul oderwas?«
Als sich dann Jahre später herausstellte, dass unser Freund Hans Jürgen Spülberger, genannt »Spüli«, tatsächlich lieber auf der anderen Seite des Hügels graste, sah Mücke sich nachträglich bestätigt: »Wundert mich nicht! Wenn der am Ball war, hat der Ball geweint!«
Irgendwann wechselten wir auf die Wiese vor der Schule am Springerplatz. Die Mannschaften wurden zusammengestellt, indem die beiden Jungs mit der größten Klappe – also ich und ein anderer – immer einen Fuß vor den anderen setzend aufeinander zugingen, wobei die Hacke die Spitze berühren musste. Der, dessen Fuß am Ende gerade noch in die Lücke passte, durfte den ersten Spieler auswählen. Das hieß »Pisspott«, und zwar, weil der eine bei jedem Schritt »Piss« sagte und der andere »Pott« antwortete. Bei der Aufstellung bevorzugt wurden technisch versierte »Fummler«, die zwar oft sehr eigensinnig, also wenig mannschaftsdienlichspielten, dafür aber Erfolgversprachen. Und da wir deutsche Jungs beim Fußball waren, stand Erfolg bei uns immer höher im Kurs als so etwas Mädchenhaftes wie »Spaß«.
Am Ende blieben immer ein oder zwei Jungs übrig, mit denen schon auf dem Schulhof keiner spielen wollte. Solche Typen, die auch noch den obersten Hemdknopf zumachten und selbst im Sommer Pullunder trugen. Dummerweise gehörte meistens einem von denen der Ball.
Ich stand bei diesen Spielen gern im Tor, weil man da nicht so viel rennen musste. Außerdem hatte ich nichts dagegen, mich »zu schmeißen«, also panthergleich noch hinter jedem aussichtslos erscheinenden Ball hinterherzuhechten. Denn ich gehörte zu den Kindern, die sich dreckig machen durften. Andere Mütter waren sauer, wenn ihre Blagen schlammverkrustet und mit dicken Grasflecken auf den Hosen nach Hause kamen. Wenn ich hingegen vom Spiel nicht genug gezeichnet war, schickte meine Mutter mich zurück auf die Wiese!
Ich hatte schon ziemlich früh einen langfristigen Ausrüstervertrag abgeschlossen – mit meiner Omma. Zum Geburtstag und zu Weihnachten gab es regelmäßig die neuesten Trikots, Schuhe und Handschuhe. Auch wenn sich Omma dabei nicht so richtig auskannte. Einmal stand sie im Sporthaus Koch und ließ sich diverse Modelle von Torwarthandschuhen vorführen, wobei ihr die Verkäuferin ein Paar besonders ans Herz legte: »Das sind die besten. Die sind von Kleff!« Darauf meine Omma: »Von welcher Firma die sind, ist doch egal!«
Und auch später, auf dem Gymnasium, war eine Eins im Vokabeltest ein nutzloser Scheiß, wenn man nicht in der Lage war, den Elfer gegen die Penner aus der Quarta B zu versenken.
In den Achtzigern ließ das etwas nach. Man wandte sich alternativen Betätigungsfeldern zu, experimentierte mit Drogen, Alkohol und schmalen, pastellfarbenen Lederkrawatten zu ebenfalls pastellfarbenen Polo-Shirts, probierte universitäre Bildung, intelligente Romane und schlagfertige Frauen, meinte, sich eine ironische Distanz zu seinen tieferen Bedürfnissen ebenso wie zu seiner Herkunft auferlegen zu müssen, und kehrte nach Mauerfall, Heirat, Börsencrash und Vaterschaft wieder dorthin zurück, wo maßgebend is: auffen Platz.
Weil der Platz die Birne frei macht. Viele belastende Fragen kommen überhaupt nicht mehr vor, zum Beispiel: Darf meine Mannschaft gewinnen, auch wenn sie 89 Minuten über den Platz gestolpert ist wie eine Horde Einbeiniger und dann Sekunden vor dem Abpfiff, aus klarer Abseitsposition und nach grobem Foulspiel, die entscheidende Bude macht? Sie darf nicht gewinnen, sie muss! Glück is mit die Doofen, und wenn die Doofen unsere Doofen sind, ist es kein Glück mehr, sondern die bessere Spielanlage!
Wir im Ruhrgebiet gehen auch nicht ins Stadion, um uns zu amüsieren. Wir gehen da hin, um uns aufzuregen! Beispiel? Jedes Jahr wieder: Das erste Heimspiel der neuen Spielzeit ist gerade mal fünf Minuten alt, noch ist nichts passiert, da brüllt der Mann vor mir zum ersten Mal: »DATIS DOCH DIESELBE SCHEISSE WIE IN DER LETZTEN SÄSONG!«
In dieser Lautstärke und in diesem Tonfall redet der auch mit seinem Sitznachbarn: »ICH GEH MA PISSEN!«
Und der: »BRING MIR EINS MIT!«
Aufs Klo gehen, ohne Bier mitzubringen, das geht natürlich nicht.
Auch die eigenen Spieler stehen nicht außerhalb der Kritik. Erst neulich, als einer unserer Mittelfeldspieler erfolglos versuchte, einen Ball zu erlaufen, sprang der Orthopäde hinter mir auf und schrie: »SO GEHT MEINE OMMA BRÖTCHEN HOLEN!«
Daraufhin drehte sich der Steuerberater neben mir um und sagte: »Deiner Omma geht es aber nicht gut, was?«
Der echte Fan muss leiden. Und meine Mannschaft, der VfL Bochum, sagt sich immer wieder: Wir geben den Leuten, was sie brauchen! Man muss die Täler durchschritten haben, um die Gipfel wirklich schätzen zu können, und in diesem Sinne hat der FC Bayern keine Fans, sondern nur Zuschauer.
Und wenn meine Frau mich fragt, ob ich mir für den unwahrscheinlichen Fall eines Abstiegs wieder eine Dauerkarte zulegen würde, tut sie das nur, weil sie mich so gerne zurückfragen hört: »Watt?«
Frühe Führung
Meine erste Erinnerung an Fußball ist eine Autofahrt. Ich saß auf der riesigen Rückbank des dunkelgrünen Mercedes 190, den meine Eltern sich eigentlich nicht leisten konnten, in Erwartung einer glorreichen Zukunft aber trotzdem angeschafft hatten, und wir fuhren die Castroper Straße in Bochum hinauf. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die Straße voller Männer war, dass wir meinen Vater am Stadion aussteigen ließen und er die Straße überquerte, ohne sich umzuschauen. Mehr als zwei Jahrzehnte später haben wir versucht zu rekonstruieren, zu welchem Spiel mein Vater an diesem Tag ging, und kamen zu dem Ergebnis, es müsse das Halbfinale im DFB-Pokal am 15. Mai 1968 gewesen sein, das der VfL vor 40 000 begeisterten Zuschauern, die sogar auf den Laufbahnen rund um das Feld und bis einen Meter hinter den Toren saßen, mit 2:1 gewann und als erster Regionalligist ins Finale einzog. Das kann aber eigentlich nicht sein, zwei Wochen später wurde ich gerade mal zwei Jahre alt, und dass man sich derart genau an einen Tag so früh in meinem Leben erinnern kann, wird im Allgemeinen als unwahrscheinlich erachtet.
Egal, jedenfalls hat sich irgendwann in frühester Kindheit dieses Bild in mir festgesetzt: Männer auf dem Weg zum Stadion.
Wann ich nach dieser ominösen Autofahrt wieder mit Fußball in Berührung kam, weiß ich nicht mehr genau. Keine Erinnerungen habe ich an etwaige Nachtübertragungen der WM 1970 in Mexiko, und auch die EM 1972, die eine der besten deutschen Nationalmannschaften aller Zeiten erlebte, ist bei mir ein weißer Fleck. Ich bekam nichts mit vom Aufstieg des VfL in die Bundesliga, den Hans Walitza mit herausgeschossen hatte, um dann nach Nürnberg verkauft zu werden. Der Name aber war damals virulent bei uns. »Der schöne Hans«, sagte meine Omma immer. Und mein Oppa: »Der pinkelt auch kein Gold!« So was sagte er immer, wenn ihm die Heldenverehrung meiner Omma auf die Nerven ging.
Die ersten Bundesliga-Jahre meines natürlichen Lieblingsvereins rauschten an mir vorbei. Wie gern würde ich sagen können, ich sei einer der 29 000 gewesen, die im ersten Bundesligaspiel am 14. August 1971 den 1:0-Sieg durch ein Tor von Hannes Hartl bejubelt haben, aber wahrscheinlich habe ich nur zu Hause am Fenster gesessen und Autos gezählt.
Einigermaßen deutlich habe ich die WM 1974 in Erinnerung. Nicht zuletzt deshalb, weil ich bald danach mein erstes WM-Buch geschenkt bekam, das mir beim Nachbereiten half. Halb totgelacht habe ich mich über das Bild aus dem Spiel gegen Schweden, wo Georg Schwarzenbeck von einem Schweden mit dem Finger am Hosenbund festgehalten wurde. Oder hat er selber festgehalten? Das Buch ist leider verschollen. Selbstredend hat sich mir auch die Wasserschlacht von Frankfurt eingebrannt, wo man mit dicken Walzen versuchte, das Wasser wieder aus dem Rasen zu drücken, nachdem es sintflutartig geregnet hatte. Auch das Spiel gegen die DDR spukt noch bei mir im Kopf herum, und dass mein Vater es nicht fassen konnte, mein Oppa aber noch weniger.
Und mit Oppa und Omma habe ich dann auch das Finale gesehen. Keine Ahnung, warum nicht zu Hause mit meinem Vater. Wahrscheinlich hat er mit seinen Kumpels in der Vereinsgaststätte der Kleingartenanlage Engelsburg e.V. in Stahlhausen geschaut.
Meine Omma berichtet heute, mein Oppa und ich hätten uns vor dem Spiel mächtig aufgeregt, da er mit Holländern, den »Käsköppen«, nie was anfangen konnte. Ich hatte noch keine Ahnung vom »totaal voetbal« der Elftal und wusste nicht, dass Jan Jongbloed so ziemlich der erste mitspielende Torwart im modernen Fußball war. Wohl aber war ich über die Maßen irritiert, dass mein Oppa kurz vor der Halbzeit mit einer schwarzen Lederaktentasche Bier holen ging und dadurch Gerd Müllers 2:1 verpasste. Dafür fehlt mir noch heute jedes Verständnis. Wie kann man am Tag eines WM-Finales nicht genug Bier im Kühlschrank haben! Aber auch daraus habe ich etwas fürs Leben gelernt: Man darf nicht unvorbereitet in ein wichtiges Spiel gehen. In unserem Keller steht ein zweiter Kühlschrank, der stets zwei Tage vor einem großen Turnier eingeschaltet und aufgefüllt wird.
Keine Chance für Wuppertal
Deinen Verein suchst du dir nicht aus, hat Nick Hornby gesagt, er wird dir gegeben. Ich weiß noch, wie es bei mir angefangen hat: Am 15. Februar 1975 stand ich, im zarten, noch formbaren Alter von acht Jahren, an der Hand meines Vaters zum ersten Mal auf den Stehplatzrängen des Stadions an der Castroper Straße in Bochum. Der VfL gewann mit 4:2 gegen den Wuppertaler SV, und das brachte mich auf die falsche Spur: Ich hielt diesen Verein für potenziell erfolgreich. Aber er bereitete mich aufs Leben vor – ich lernte leiden. Das wichtigste Wort im Leben eines VfL-Fans ist das Wort »trotzdem«. Oder, wie es einmal ein unbekannter Meister in der Lokalpresse ausdrückte: »Zum VfL gehen ist, wie wenn dich jede Woche deine Frau verlässt.«
Damals aber, Mitte der Siebziger, schien eine goldene Zukunft unmittelbar bevorzustehen: Ein neues Stadion sollte gebaut werden, das schönste in ganz Deutschland, eines, in dem man gar nicht mehr verlieren KONNTE! Während die alte Spielstätte umgebaut wurde, absolvierte man einige Spiele in Herne am Schloss Strünkede. Und weil bis dahin noch niemand dieses bescheuerte Wort »unabsteigbar« in den Mund genommen hatte, waren sie es noch: Sie konnten einfach nicht absteigen. Zur Not drehten sie es im letzten Spiel. Schön sah das meistens nicht aus, aber egal, Arschlecken, Rasieren einsfuffzich, Mund abputzen, weitermachen.
Am 18. September 1576 dann das erste Spiel vor der neuen Südtribüne, ein Spiel auf der Baustelle. Zur Feier des Tages hatte mein Vater Sitzplatzkarten springen lassen, ganz außen, wo sie etwas günstiger waren: Block A, Reihe 22, Sitz 1 und 2.
Eine nicht ganz erfolglose Thekenmannschaft aus Süddeutschland hatte sich angesagt, der sogenannte »FC Bayern München«, komplett mit Beckenbauer, Maier, Müller, Hoeneß, aber auch Schwarzenbeck und Kapellmann. »Das wird schwer«, hatte mein Vater gesagt, aber zunächst mal sah es gar nicht danach aus. Zur Halbzeit führten Tiger Gerland, Jupp Tenhagen, Ata Lameck und Co. tatsächlich mit 3:0, und mein Vater raunte mir auf dem Weg zur Pausenbratwurst lebensweise zu: »Datt kannze dir gleich ma merken: Die kochen auch nur mit Wasser, die Tiroler!«
Nach dem Seitenwechsel gelang dem VfL sogar das vierte Tor. Und wohl nur wenige Mannschaften wären in der Lage gewesen, ein solches Spiel doch noch zu verlieren. Aber der VfL, die tollste Mannschaft der Welt, schaffte auch das. Mit 5:6 hatten die Bayern uns am Ende die Lederhosen angezogen.
Man redet heute ja viel darüber, wie man ein solches Spiel »verarbeiten« soll.Als der Bochumer StürmerJupp Kaczor fast dreißig Jahre später gefragt wurde, wie die Mannschaft dieses Spiel »verarbeitet« habe, sagte er: »Kär, wir haben uns drei Tage lang die Glatze zugezogen.«
Seitdem sind wir die einzige Mannschaft Deutschlands, für die es keinen beruhigenden Vorsprung gibt. In der Saison 2007/2008 führten wir zur Halbzeit gegen den VfL Wolfsburg mit 4:0. In anderen Stadien wird in solchen Momenten auf den Sitzen getanzt, bei uns heißt es nur: »Dat is noch nich gewonnen!« Und: »Weiße noch damals, gegen Bayern?« Kurz nach der Halbzeitpause ging ich aufs Klo, und als ich zurück zu meinem Platz eilte, kam mir auf der Treppe ein mir unbekannter Fan entgegen und sagte mit Beerdigungsmiene: »4:1!«, als wollte er sagen: Jetzt geht’s los! Tatsächlich endete das Spiel 5:3, und am Ende waren wir alle froh, dass es vorbei war.
1979 war das neue Stadion fertig und die Zukunft nur noch eine Frage der Zeit. Mittlerweile war ich bei fast jedem Heimspiel. Kamen Krachermannschaften wie Gladbach oder Dortmund, waren wir schon um ein Uhr in der Ostkurve. Wir verunglimpften die gegnerischen Fans als haltloses Pack, das Unzucht mit Tieren trieb, und ziehen den Torwart einer Gelsenkirchener Vorortmannschaft der gleichgeschlechtlichen Liebe: »Norbert Nigbur ist homosexuell!«, zur Melodie von »Yellow Submarine«. Ob’s passte oder nicht, forderten wir immer wieder: »Gelbe Karte, Rote Karte, Raus-die-Sau!«
Seinerzeit waren Stadionsprecher noch keine geföhnten Animateure, sondern gesetzte, ernsthafte Herren mit sonorer Stimme und allenfalls der Lizenz zum Schmunzelnmachen. In Bochum war das der »Jugendwart« Erwin Steden, dessen seriös-monotoner, angenehm leidenschaftsloser Vorschlag zur Abendgestaltung des angebrochenen Samstags sich mir besonders ins akustische Gedächtnis gebrannt hat: »Und nach dem Spiel: Zagreb-Rauchfang!« (Heute muss man den Jüngeren erklären, dass das mal ein jugoslawisches Restaurant gewesen ist. Und den ganz jungen, was mal Jugoslawien gewesen ist.)
Legendär auch die erfundenen Ansagen zur Aufheiterung des Publikums, wenn das Spiel mal wieder verflachte: »Herr Erwin Lindemann wird gebeten, seine Frau anzurufen, er ist soeben Vater von Drillingen geworden!« Ringsum dann immer wieder Gelächter, weil sich niemand vorstellen konnte, dass man wegen einer solchen Lappalie von einem Bundesligaspiel davonlief!
Ein paar Mal schien die Zukunft endlich da zu sein, durfte der VfL am großen Erfolg schnuppern: 1968, als man nach einem denkwürdigen Halbfinale, in dem man den FC Bayern mit 2:1 ausgeschaltet hatte, erstmals ins Endspiel um den DFB-Pokal einzog, wo man allerdings mit 1:4 gegen den 1. FC Köln unterlag.
Genau zwanzig Jahre später war es wieder so weit, diesmal gegen die Eintracht aus Frankfurt. Selbstverständlich wurde uns ein klares, reguläres Tor von Uwe Leifeld wegen angeblicher Abseitsstellung nicht anerkannt. Und dann, in der 81. Minute, das Freistoßtor von Lajos Detari: Nie wieder war ich nüchtern den Tränen so nah!
Was man in so einer Situation nicht braucht, sind dumme Sprüche. Wir verfolgten das Spiel damals, ein paar Mann und Frau hoch, im elterlichen Wohnzimmer meines besten Freundes, während seine Erzeuger sich mit einem befreundeten Ehepaar ins immer noch so bezeichnete »Kinderzimmer« zurückgezogen hatten. Nach dem Schlusspfiff hockten wir wie ausgespuckt da und fühlten uns scheiße, als der Mann des befreundeten Ehepaares zur Tür hereinschaute und sagte, man gehe nun zum Italiener. Und grinsend fügte er hinzu: »Ihr könnt uns ja anrufen, falls der VfL doch noch gewinnt!« Wohlgemerkt, der Endstand war dem Mann bekannt. Selten war ich so nah davor, einen Menschen unter den nächsten Bus zu stoßen.
Am nächsten Tag waren dennoch mehr als 10 000 Menschen auf dem Bochumer Rathausplatz. Trainer Gerland, der Harte Hermann aus Weitmar, schämte sich seiner Tränen nicht.
1997 erreichte der VfL dann tatsächlich den UEFA-Pokal und drang bis in die dritte Runde vor. Und warum? Weil sich die ersten beiden Gegner über die vom Hauptsponsor aufgezwungenen, schreiend bunten Papageienleibchen halbtot lachten.
Das Ausscheiden aus dem gleichen Wettbewerb im Jahre 2004, nach zwei Unentschieden gegen Standard Lüttich durch ein Tor in der Nachspielzeit, hat den Psychotherapeuten viele neue Patienten in die Arme getrieben. (Näheres regelt eine eigene Geschichte weiter hinten.)
Als Vaterbesteht meine wichtigste Aufgabe darin, den eigenen Nachwuchs anzufixen, beziehungsweise »behutsam an die Materie heranzuführen«. Am frühen Samstagabend liegen wir drei Mann hoch vor der Glotze. Zwischendurch lasse ich die Jungs an der Bierflasche riechen oder zeige ihnen, dass zwischen der geschlossenen Zwiebeldecke und dem nährstoffarmen Weizenbrötchen doch auch Mett lungert. Dann üben wir maskulines Am-Sack-Kratzen und wie man die Forderung »Lauf, du faule Sau!« in einem einzigen Rülpser unterbringt.
Und wenn es mal nicht so läuft, beruhige ich sie: »Macht euch nichts draus. Wuppertal packen wir immer!«
Kleiner Stadion-Knigge
Die zunehmende Popularität des Fußballsports hat dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen in den Stadien aufhalten, die mit der dort gängigen Etikette nicht ausreichend vertraut sind. Dies kann zu Missstimmungen führen, die nicht selten in Ausschreitungen enden. Um dies zu vermeiden, seien Gelegenheits-Stadionbesuchern hiermit ein paar Regeln an die Hand gegeben.
1. Erscheine rechtzeitig! Eine halbe bis dreiviertel Stunde vor Beginn sollte man sich eingefunden haben, um nicht kalt ins Spiel zu gehen und um den Getränke- und Wurstverkauf anzukurbeln. Es ist für einen guten Zweck: den Verein!
2. Zeig deine Farben! Speziell wenn man Karten für lau ergattert hat, sollte man irgendwas Blaues tragen. Trikot ist wünschenswert, aber es gibt auch schöne T-Shirts. Fehlender Schal sollte meiner Ansicht nach ein Grund sein, gar nicht erst reingelassen zu werden.
3. Mach Krach! Das Heimteam ist anzufeuern, bis der Hals wehtut. Wird man von der Fankurve dazu aufgefordert, hat man sich zu erheben. Auf die Frage »Wen lieben wir?« ist nicht mit einem Frauen- oder auch nicht mit einem Männernamen zu antworten, sondern mit der jeweils gebräuchlichen Kurzform des Namens der gastgebenden Mannschaft.
4. Zick nicht rum beim Bierholen! Jeder ist mal dran. Kleinliches Nachkarten, wer am Ende des Spiels mehr bezahlt hat, ist verpönt. Das ist wie mit den Fehlentscheidungen des Schiedsrichters: Über die Saison gleicht sich das aus. Sorge überhaupt mit deinem Verhalten am Bierstand dafür, dass die Abwicklung des Getränkeverkaufs weitgehend reibungslos vonstatten gehen kann. Der Autor dieser Zeilen musste während eines Bundesligaspiels einmal miterleben, wie der Mann vor ihm um einen Bewirtungsbeleg bat! Solche Menschen wollen wir nicht um uns haben!
5. Sei freundlich zu Leuten, die Softdrinks zu sich nehmen. Sie mögen ihre Gründe haben. Nur holen müssen sie sich das Zeug selbst.
6. Mach bei uns in Bochum keine Bemerkungen über die Toiletten! Wir können es nicht mehr hören! Ja, sie sind mies! Aber: Ein Fußballstadion ist kein Ballhaus. Zu unserem Leitbild gehören soziale Verantwortung und Toleranz. Das heißt, wir solidarisieren uns mit Menschen in ärmeren Gegenden der Welt, indem wir das Niveau unserer sanitären Anlagen dem ihren angleichen.
7. Frag NIEMALS UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, warum wir den Stürmer XY oder den Torwart Z, die in der letzten Saison so gut waren, verkauft haben!
8. Solltest du einen Stehplatz haben, mach dich nicht über Leute auf der Sitztribüne lustig! Sie könnten Kolumnen über dich schreiben!
9. Erwähne NIEMALS UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN Mannschaften, gegen die das Heimteam irgendwann mal tragisch aus einem nationalen oder internationalen Wettbewerb ausgeschieden ist. Benutze zum Beispiel in Bochum NIEMALS UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN das Wort »Lüttich«. Sag nicht mal was über Belgien. Solltest du es doch tun, bedenke: Du handelst grob fahrlässig, und die Folgen werden von keiner Krankenkasse getragen!
10. Komm wieder! Geh nicht nach nebenan, egal ob Osten oder Westen. Ansonsten soll eitriger Grind deinen Schädel überziehen, und 18 x 48 Jahre soll schwerer Alpdruck deine Nächte beherrschen, bis du erkennst, dass mehr Geld keinen schöneren Verein macht!
Außer natürlich, der Verein wäre unser.
Sätze, die ich beim Fußball nicht hören will
1. »Wer spielt da eigentlich?«
Wer es nicht weiß, den interessiert es nicht, und wen es nicht interessiert, der soll anderen nicht die Sicht nehmen! Raus!
2.»Ist das Grüne der Rasen?«
Sogenannte »scherzhafte Bemerkung« von fußballophoben Subjekten, die ihre ironische Distanz zum Spiel ausdrücken wollen. Ebenfalls raus! Bei Weigerung Körperstrafen ohne vorherige Androhung!
3. »Ist noch Bier da?«
Sollte während einer Fußballübertragung nie eine Frage sein. Die Kommunikation in dieser Beziehung sollte sich auf das Nötigste beschränken: etwa auf Bestellungen mit »Mamma« und »Nonne«: »Mamma nonne Runde!« (Achtung Flachspaß!) Oder auf Trinksprüche wie »Hau wech, is Beute!«
4. »Nee, aber in der Halbzeit fahre ich zur Tanke!«
Das ist der GAU. Beziehungsweise DIE GAU: Die Größte Anzunehmende Unfähigkeit des Gastgebers, der einerseits völlig unnötig diese Versorgungslücke hat entstehen lassen, andererseits dann auch noch zur Deckung dieser Lücke überteuertes Tankstellenbier besorgen will!
5.»Ich glaube, das war Abseits!«
Wie die Altvorderen schon sagten: »Glauben kannze inne Kirche!« Faustregel bei Abseits: Der Gegner ist drin, wir nicht!
6.»Also, die Abseitsregel habe ich nie verstanden!«
Ist ungefähr so peinlich wie die Behauptung, man könne seinen Videorecorder nicht programmieren oder kein Ikea-Regal