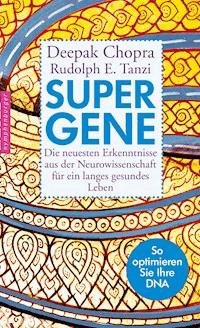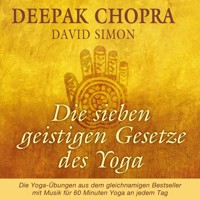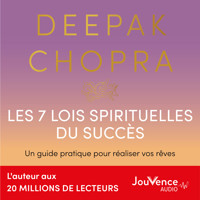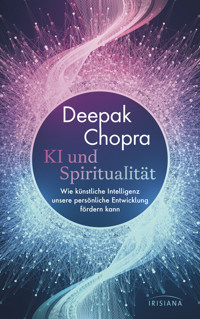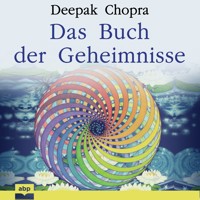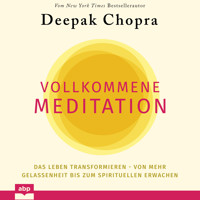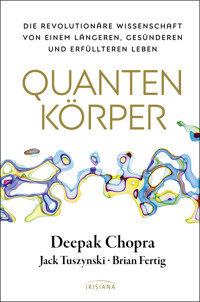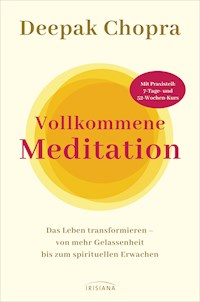7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nymphenburger
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hunde handeln nach Instinkt, nicht nach Erwartungshaltungen; sie können einfach nur sein und haben kein Problem mit Verbindlichkeit. Michael Jackson war ein Freund der Familie und er mochte keine Hunde. Hund Cleo sah in ihm nicht den Star, sondern einen ganz normalen Menschen und begegnete ihm völlig unvoreingenommen (mit höchster spiritueller Qualität!), sodass die beiden dicke Freunde wurden. Hunde sind in vielem gute spirituelle Lehrmeister - vor allem für Deepak und Gotham Chopra, Vater und Sohn. Die Beschreibung ihres gewöhnlichen, chaotischen Alltags ist vermischt mit spirituellen Erkenntnissen - humorvoll und tiefgründig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gotham mit Deepak Chopra
Weisheit auf
vier Pfoten
Drei Generationen,
zwei Hunde
und die Suche nach einem
glücklichen Leben
Aus dem Englischen
von Ursula Bischoff
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.nymphenburger-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook:
2012 nymphenburger in der
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten.
Schutzumschlaggestaltung: atelier-sanna.com, München
Satz und eBook-Produktion: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
www.Buch-Werkstatt.de
ISBN 978-3-485-06040-0
Für:
Krishu, Leela, Tara, Kiran, Noah, Alex, Aanya, Mira, Dakshu, Sumair, Cleo und Nicholas. Ihr seid meine Babys.
Danke für eure Liebe und Abschlecker.
Einführung
Besessen, es gibt kein besseres Wort dafür. Wir waren besessen. Als ich sieben und meine Schwester Mallika elf Jahre alt war, gab es für uns nur noch ein Thema und einen Gedanken: Wir wollten unbedingt einen Hund haben. Wie die meisten Obsessionen war auch diese vermutlich alles andere als einzigartig, denn die meisten Kinder sind versessen auf Hunde und Katzen und die meisten Familien kennen diese leidige Phase aus eigener Erfahrung. Doch wenn man sieben ist und der Wunsch oder vielmehr das verzweifelte, unstillbare Bedürfnis jede wache Minute ausfüllt, spielt die Vorstellung, dass es sich um ein weltweites Phänomen handelt, keine Rolle. Hier ging es um mehr als eine Phase, die sich irgendwann auswachsen würde. Es ging um Leben oder Tod. Und entsprechend verhielten wir uns.
Mallika und ich lagen unseren Eltern morgens, mittags und abends in den Ohren. Wir bliesen Trübsal. Wir bettelten. Wir versuchten, sie nach allen Regeln der Kunst zu überreden. Wir ließen uns zu Versprechungen hinreißen, von denen wir wussten, dass wir sie nie halten würden. Ich bot an, auf mein Taschengeld zu verzichten und außerdem noch die eine oder andere Arbeit im Austausch gegen das Trockenfutter zu verrichten, während Mallika schwor, den Hund jeden Tag zu baden. Wir würden dafür sorgen, dass keine Unordnung entstand. Wir würden dafür sorgen, dass er genug Auslauf hatte. Wir würden für alles sorgen.
»Wir kümmern uns um den Hund, Mom. Ehrenwort.« Der Spruch kam von mir.
»Du musst keinen Handschlag tun. Du wirst kaum merken, dass der Hund überhaupt existiert.« Der Spruch kam von Mallika.
Meine Mutter, immer offen für Verhandlungen, nutzte die Situation für Zugeständnisse hinsichtlich der Erledigung unliebsamer Aufgaben, die sie uns schon seit geraumer Zeit abzuringen versuchte. Mein Vater blieb dagegen ungerührt. Als viel beschäftigter Arzt mit diversen weiteren beruflichen Verpflichtungen hatte er kein Interesse daran, unseren Haushalt um ein zusätzliches Mitglied zu vergrößern, ganz zu schweigen von einem vierbeinigen. Er war nie das, was man einen ›Hundemenschen‹ nennt. Papa betrachtete den Bernhardiner unserer Nachbarn, ein tollpatschiges, unkoordiniertes, schmutziges und ständig sabberndes Tier, mit unverhohlenem Abscheu. Folglich waren für ihn alle Hunde tollpatschig, unkoordiniert, schmutzig, ständig sabbernd… und dumm wie Bohnenstroh.
Das hätte das Ende der Debatte sein können, aber wie immer in unserer Familie hatte meine Mutter das letzte Wort und bereits grünes Licht für das Vorhaben gegeben; mein Vater war überstimmt, seine Meinung fiel nicht wirklich ins Gewicht.
Mallika und ich feierten den bevorstehenden Familienzuwachs.
Die Chopras würden einen Hund bekommen.
Nicholas war ein Energiebündel und Anarchist, ein kleiner Samojede, ein flauschiges weißes Fellknäuel. Wir konnten das hintere und vordere Ende kaum voneinander unterscheiden. Er war übermütig, verspielt und bestrebt, es allen recht zu machen, doch wie die meisten Welpen noch nicht dafür gerüstet, alles richtig zu machen. Was war schon dabei, wenn er nicht stubenrein war? Oder wenn er Tischbeine, Besenstiele oder Sofakissen anknabberte. Solche Aktionen machten ihn nur umso liebenswerter. Was immer er anstellte, wie übermütig er sich auch gebärden mochte, Mallika und ich waren glücklich. Überglücklich. Was auch sonst! Unser Traum war in Erfüllung gegangen: Wir hatten einen Hund.
Nicholas verbrachte die meiste Zeit damit, im Haus herumzutoben und Ringkämpfe mit den Plüschtieren und Kauknochen zu veranstalten, die wir jeden Tag im nächstgelegenen Tierbedarfsladen besorgten. Er war blitzschnell und schaffte es mit List und Tücke, das Haus unbemerkt von einem Ende zum anderen zu durchqueren. Wenn die Familie ihn endlich aufgespürt hatte, war er vollauf damit beschäftigt, ein Kissen oder irgendeinen anderen Teil der Einrichtung zu bearbeiten. Schuhe erfreuten sich bei ihm besonderer Beliebtheit, genau wie die Kuscheltiere in unseren Kinderzimmern.
Anfangs dachten wir arglos, wir könnten ihn sauber halten, doch die Badezeit entpuppte sich als Schaum sprühendes Chaos, dem sich Nicholas oft durch Flucht entzog. Wir folgten der glitschigen Seifenspur durchs ganze Haus, von dem mit Büchern zugestellten Arbeitszimmer bis zu dem mit Kunst beladenen Wohnzimmer, meistens in eines unserer Kinderzimmer, wo unser Hund an einem Kissen kaute oder ein Paar von Mallikas Gummi-Badeschuhen zerriss.
»Na ja.« Sie zuckte die Achseln und ließ die Überreste klammheimlich verschwinden, bevor sie mit Nicholas kuschelte. »Kein Problem.«
Es war gleichwohl ein großes Problem, wenn man bedenkt, wie sehr meine elfjährige Schwester ihre Schuhe liebte.
»Nicholas ist unser Ein und Alles«, pflegte sie zu sagen. »Er ist mit nichts zu vergleichen.«
Das traf den Nagel auf den Kopf. Bei uns beiden.
Mein Vater versuchte einstweilen, die Regeln festzulegen. Er bestand darauf, dass Nicholas im Untergeschoss blieb, wo wir eine ausgeklügelte Konstruktion aus Laufstall und Hundehütte aufgestellt hatten, mit Fress- und Wassernapf, Spielsachen, Decken und einem ausrangierten Paar Schuhe, die ihm ja so viel Spaß machten. Doch als er zu uns kam, winselte er die ganze Nacht. Das Jaulen hallte im ganzen Haus wider. Keiner von uns tat ein Auge zu. Die erste Nacht im Erdgeschoss sollte sich als die letzte erweisen.
Im Lauf der nächsten Monate wuchs Nicholas rapide: Aus dem kleinen weißen Fellknäuel wurde ein ansehnlicher Hund in Optik und Ausmaßen. Doch trotz einiger halbherziger Versuche, ihn zu erziehen, war er ein tollpatschiges, unkoordiniertes, schmutziges und ständig sabberndes Energiebündel. Für meinen Vater ein wahr gewordener Albtraum. Für den Rest der Familie Liebe auf den ersten Blick.
Nicholas wurde ein Teil der Familie. Unsere Cousinen und Cousins, die nur eine Viertelstunde entfernt in einem Vorort von Boston wohnten und in unseren Augen eher Geschwister waren, kamen fast täglich zu Besuch, sodass wir alle mit Nicholas spielen und toben konnten. Anarchie pur.
Mein Vater blieb seiner strikten Linie treu. Nicholas wurde während der Mahlzeiten in einen anderen Raum verbannt und bekam nur Hundefutter vorgesetzt; schaute Papa gerade nicht hin, zweigten Mallika und ich einen Teil unserer Menschennahrungsration ab, die wir ihm heimlich zusteckten. Und wenn es Nicholas gelang, dem Untergeschoss zu entkommen, das in Mallikas und meinen Augen inzwischen kaum mehr als ein Verlies war, durfte er nur mit einem schmutzigen Wäschestück am Fußende eines der Betten kuscheln, in dem meine Schwester oder ich schliefen. Auf ärztliche Anweisung.
Trotz seiner Proteste und offenen Missfallensbekundungen war Nicholas ein weiterer Kandidat, der sich unkooperativ verhielt. Schon im zarten Kindesalter hatten Mallika und ich gelernt, Front gegen die Experimente unseres Vaters zu machen. Solange ich denken kann, probierte er alle möglichen Routinen und Rituale, über die er gerade etwas gelesen hatte, an uns aus: von der Hypnose bis hin zu bestimmten Ernährungsvorschriften, stundenlangem Schweigen (um unsere Kreativität zu fördern, wie er behauptete) oder der ›Kommunikation mit dem Universum‹ mithilfe eines Ouija-Bretts, um uns auf eine höhere Bewusstseinsebene zu versetzen, was immer das bedeuten mochte. Mallika und ich waren daran gewöhnt, Papas Versuchskaninchen zu sein, und reagierten darauf mit einer Mischung aus Frustration und Unternehmergeist. Mallika, seit jeher ein Ass in Mathe, entwarf eine Tabelle mit gestaffelten Tarifen, die entsprechend der Intensität des jeweiligen Experiments eine Erhöhung unseres wöchentlichen Taschengelds erforderten. Netterweise übernahm sie auch meine Kontoführung und verlangte dafür einen Obolus von mir– eine Geschäftsbeziehung, die ich zweckmäßig fand.
Nicholas war im Gegensatz dazu für jedes neue Spiel zu haben, wenn am Ende ein Kauknochen oder Hundeleckerli winkten. Er ließ beachtliche Fähigkeiten beim Erlernen von Routineverrichtungen erkennen, gleich ob es sich um stillstehen, einen Ball apportieren oder andere ausgeklügelte Versuche nach Art des Deepak Chopra handelte, nur um sich sofort aus dem Staub zu machen, sobald er seine Belohnung in Empfang genommen hatte. Das war für meinen Vater, einen Bewunderer des Wissenschaftlers Rupert Sheldrake, der auf der Grundlage seiner Tierverhaltensstudien Pionierarbeit bei der Entwicklung vieler progressiver Theorien über das Bewusstsein geleistet hatte, ein großes Ärgernis. Nicholas’ Verhalten stellte für Sheldrakes und Papas gemeinsame Hypothese, dass die Entwicklung von Intelligenz und Bewusstsein nicht von einem Knochen oder Hundeleckerli abhängen konnte, eine echte Herausforderung dar.
»Darwin hatte vermutlich bessere Versuchstiere zum Arbeiten als wir«, meinte Papa frustriert.
Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete, aber Mallika war voll im Bilde. »Wir könnten uns noch einen weiteren Hund zulegen«, schlug sie vor. »Einen ausgebildeten. Du weißt schon… dann hättest du eine Vergleichsgröße.«
»Nein danke. Ich begnüge mich mit dem, was ich habe.« Der verrückte Wissenschaftler in ihm war offenbar fest entschlossen, es dabei zu belassen.
Eine lang gehegte Absicht meines Vaters war, uns mit Nicholas’ Hilfe vor Augen zu führen, wie wichtig instinktives gegenseitiges Vertrauen war. Um selbiges zu bekunden, galt es, ihn von der Leine loszumachen und darauf zu vertrauen, dass er an unserer Seite blieb und nicht davonlief. Mallika und ich wussten, dass andere Hunde dieses Kunststück beherrschten, dass sie gelernt hatten, auch ohne Leinen-Unterstützung bei Fuß zu gehen. Keine große Sache. Aber trotzdem waren wir nervös.
Papa wollte die ungeheure Macht des Vertrauens demonstrieren und uns beweisen: Wenn wir ihm Liebe und Vertrauen entgegenbrachten, würde er Gleiches mit Gleichem vergelten. »Vertrauen ist die Grundlage jeder fürsorglichen, entwicklungsfähigen Beziehung«, erklärte er. »Nur auf einem so grundlegenden und starken Fundament können wir aufbauen und den nächsten Schritt einleiten, eine ortsunabhängige Kommunikation.«
Das klang verdächtig. Aber wer waren wir, die Weisheiten eines Menschen in Zweifel zu ziehen, der so unerschütterlich an sie glaubte? Wer waren wir, an Papa zu zweifeln?
Und deshalb war an einem Herbstnachmittag in Neuengland, als die Blätter unsere Straße in eine spektakuläre Kulisse aus feurigen Orange- und satten Gelbschattierungen verwandelte hatte, der Beginn der Vorstellung und damit die Stunde der Wahrheit gekommen. Zum Auftakt klärte Papa Nicholas über sein Vorhaben auf, wie er es mit jedem anderen Familienmitglied getan hätte. »Ich werde gleich die Leine von deinem Halsband lösen, in Ordnung?«
Nicholas blickte ihn ausdruckslos an. Sein Brustkorb hob und senkte sich. Sein Herz klopfte. »Wir vertrauen dir und lieben dich und wir möchten nicht, dass du dich jemals in deinem Bewegungsspielraum eingeschränkt fühlst«, fuhr Papa fort. »Wir wissen, dass du unsere Liebe und unser Vertrauen erwidern wirst, indem du dicht bei uns bleibst.«
Nicholas spielte geschickt mit, als Papa mit sanfter Hand die Leine aushakte. »Wir vertrauen dir«, sagte er erneut. »Wir alle vertrauen dir.«
Nicholas stand eine Sekunde reglos da, von einem Ohr zum anderen grinsend, wobei ihm Speichelfäden von den Lefzen hingen. In den Augen meines Vaters bot er ein göttliches, wenngleich ziemlich tollpatschiges Bild der Unschuld und des bedingungslosen Gehorsams. Mallika und ich wussten es besser. Nicholas schoss davon, schneller als jemand »limbische Resonanz« sagen konnte.
Ich brach in Tränen aus.
Mallika war außer sich.
Papa wirkte völlig verwirrt.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich das erste Mal das Wort unverantwortlich hörte, das Mallika gleich zu Beginn der Junior High School gelernt hatte und nun auf Papa abfeuerte. Er war ebenfalls bestürzt, vor allem angesichts der Erkenntnis, dass er sich mit seiner neuesten Theorie bezüglich des Hundes auf dem Holzweg befand, mit möglicherweise katastrophalen Folgen. Wir verbrachten die nächsten beiden Stunden damit, den Wald, die Nachbargärten und einen nahe gelegenen Park zu durchkämmen, aber von Nicholas war keine Spur zu entdecken. Wir waren am Boden zerstört– sowohl über den Verlust unseres heiß geliebten Hundes als auch angesichts der Frage, wie wir diese Neuigkeit unserer Mutter beibringen sollten.
Wie ich Jahre später feststellen sollte, gibt es nur eines im Leben, das dem instinktiven Bedürfnis gleichkommt, das eigene Kind vor Kummer und Leid zu bewahren, und das ist der Wunsch, die eigene Mutter vor Kummer und Leid zu bewahren. Diese Aufgabe rückte mit jedem Moment unerbittlich näher.
Auf dem Heimweg brüteten Mallika und ich schweigend vor uns hin. Wir waren überzeugt, dass wir Nicholas niemals wiedersehen würden, und waren entschlossen, unseren Vater für den gleichen Zeitraum zu ächten. Doch als wir die Auffahrt zu unserem Haus hinaufstapften, absichtlich langsam, damit Papa an jedem schweren Schritt den Grad unserer Traurigkeit ermessen konnte, entdeckten wir meine Mutter und neben ihr– Nicholas. Sie lächelte. Wir lächelten. Eine Welle der Erleichterung überkam uns.
»Mr. Casparian hat gesehen, wie Nicholas im Wasserspeicher herumpaddelte. Zum Glück hat er ihn erkannt«, teilte uns Mom mit, während Papa eine Grimasse schnitt. »Dem Himmel sei Dank für unsere netten Nachbarn.«
Sie streichelte Nicholas liebevoll. Sein weißes Fell wies getrocknete Blutspuren auf, Überreste eines Kratzers, den er sich vermutlich bei einem Ringkampf mit einem anderen Hund zugezogen hatte. Mallika und ich liefen zu ihm und überschütteten ihn mit Zärtlichkeiten.
»Mach das nie wieder«, schalt ich Nicholas, vergrub meine Hände in seinem Fell und versetzte seiner nassen Nase einen Nasenstüber, damit er wusste, dass ich es ernst meinte.
»Es ist nicht seine Schuld«, gab Mallika zu bedenken und warf Papa einen zornigen Blick zu. Sie bedeckte Nicholas’ Scheitel mit Küssen und rubbelte seinen Bauch.
»Hat Mr. Casparian ihn nach Hause gebracht?«, erkundigte sich Papa.
Mom schüttelte den Kopf. »Er hat es versucht, aber nicht geschafft. Nicholas ist allein nach Hause gekommen.«
Papa konnte nicht umhin, triumphierend zu lächeln. Jahre später, wenn wir den Zwischenfall wieder einmal Revue passieren ließen, erklärte mein Vater, Nicholas habe an jenem Tag bewiesen, dass wir recht gehabt hatten: Er war gehorsam, hatte aber seinen eigenen Kopf. Es forderte Freiheit ein, aber er wusste, dass wir seine Familie waren, und deshalb kehrte er treu und brav nach Hause zurück. Und wichtiger noch, er hatte uns ein wunderbares Geschenk gemacht: Durch die Sorgen, die er uns allen bereitet hatte, waren wir noch enger zusammengerückt. Nicholas hat uns eine Menge gelehrt, sagte Papa. Nicht nur über sich selbst und sein unverfälschtes Dasein, sondern auch übereinander und uns selbst.
»Wisst ihr, vielleicht kann uns dieser Hund viel mehr beibringen als wir ihm«, bestätigte Papa beim Abendessen einige Tage später, als die frostige Atmosphäre zwischen uns aufzutauen begann.
Nicholas blickte mit einem breiten, treuherzigen Grinsen zu Papa auf. Er hatte sich seinen Platz neben dem Tisch während der Essenszeiten redlich verdient und Mallika und ich durften ihm volle Menschennahrungsrationen zukommen lassen, ohne dass Papa uns einen scharfen Verweis erteilte. Nicholas wusste, was er ihm verdankte, denn er hatte seine Vorliebe für Schweinekoteletts entdeckt.
Solange ich zurückdenken kann, hat mich ständig irgendwer irgendwo gefragt, wie es ist, Deepak Chopra als Vater zu haben. Die Leute wollen wissen, ob ich Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs aus dem Effeff beherrsche. Oder ob ich dank der Lektüre des Buches Vollständige Gesundheit topfit bin, den ganzen Tag meditiere, ausschließlich gewaltfrei kommuniziere, meinen Dosha-Quotienten kenne oder ein perfekter Yogibin– summa summarum, ob ich ein perfektes spirituelles Leben führe.
Die Antwort lautet natürlich: beinahe.
Und wenn ich ehrlich bin: NEIN.
Ich halte mich für relativ normal, für einen Menschen, dessen Stimmung zu oft davon abhängt, welches Ergebnis die Boston Red Sox, meine Lieblingsbaseballmannschaft, am Vorabend erzielt haben, den die Debatte über die private versus staatliche Schule für mein Kind stresst und der davon träumt, seinen Beruf an den Nagel zu hängen und eines Tages als Spitzenkoch die TV-Show Top Chef Masters zu gewinnen. Zugegeben, es war ein ziemlich aufregendes Leben. Von der Bibel bis zur Biologie der menschlichen Seele, von der Bhagavad Gita, einer der zentralen Schriften des Hinduismus, bis Der Große Gatsby– mein Vater war immer bestrebt, meine Schwester und mich mit den tiefsten Wissensreservoiren vertraut zu machen, die er ausfindig machen konnte. Auf diesem Weg begegneten wir auch vielen interessanten Menschen, Seher, Psychotiker und etliche Prominente eingeschlossen, die während oder am Ende ihres kurzlebigen Ruhms von meinem Vater Deepak Chopra spirituell besessen waren. Wir kamen auch mit ein paar Propheten in Kontakt, von denen einige ihr Augenmerk auf den Frieden und andere auf den Profit richteten. Viele hatten nützliche Lektionen zu vermitteln… andere waren weniger bereit, ihr kostbares Wissen zu teilen.
Dennoch erzählte ich unlängst auf die Frage, wie es war, mit einem Vater wie Deepak aufzuwachsen, die Geschichte von Nicholas und den Lektionen, die wir von ihm gelernt hatten, vor allem mein Vater. Und vor noch kürzerer Zeit dachte ich bei einem Spaziergang mit meinem Vater, meinem zweijährigen Sohn Krishu und meiner jetzigen Hündin Cleo wieder an die Zeit mit Nicholas zurück. Plötzlich entdeckte Krishu irgendetwas in der Ferne und deutete darauf. Instinktiv blickten mein Vater und ich in die Richtung, in die er wies, während Cleo auf seinen Finger starrte.
Papa lachte.
Ich wollte wissen, was daran so lustig sei.
»Das ist ein typisches Beispiel für den Unterschied zwischen Menschen und Hunden«, sagte er. »Hunde sind im gegenwärtigen Augenblick verwurzelt. Sie sorgen sich nicht um die Zukunft oder trauern der Vergangenheit nach. Ihre Wahrnehmung ist ausschließlich auf das Hier und Jetzt gerichtet und ihre Aufmerksamkeit ist fokussiert.«
Papa deutete auf den Weg vor uns, ahmte Krishu nach. »Menschen halten immer nach Sinn und Bedeutung der Dinge Ausschau, blicken sehnsüchtig zum Horizont, auf der Suche nach einer tiefgründigeren Erklärung für das Dasein.«
Papa bückte sich und tätschelte Cleos flauschigen Kopf. Dann wandte er sich Krishu zu. »Wenn du ein großer Junge bist, lernen wir alle voneinander. Cleo auch.«
»Dada!« Krishu lächelte, erfreut über Papas Zuwendung.
Wenn ich heute über die zahlreichen Einflussfaktoren in meinem Leben nachdenke, tauchen die üblichen Verdächtigen auf: Lehrer und Mentoren, Freunde, Geschwister, andere Bezugspersonen, Geschäftspartner, sogar Gegner und Rivalen, denen es gelungen ist, mir auf meinem Weg wichtige Lektionen zu vermitteln. Doch drei kristallisieren sich als besonders nachhaltig heraus. Der eine ist, was wohl kaum überrascht, mein Vater. Die beiden anderen sind, weniger vorhersehbar, meine beiden Hunde.
Mein Vater hat mich gelehrt, was Weisheit, Neugier, Aufgeschlossenheit und der Reichtum, einen unerschöpflichen Wissensdurst zu haben, bedeutet. Meine Hunde Nicholas und Cleo haben mich gelehrt, was Einfachheit, Unschuld, Hingabe und echte geistige Freiheit bedeuten. Und es gibt noch einige weitere Eigenschaften, die ich von ihnen übernommen habe: Loyalität, Vertrauen, Versöhnlichkeit und die Freude am Spiel. Je häufiger ich nachfragte, wie es anderen Hundebesitzern in dieser Hinsicht erging, desto häufiger bekam ich zu hören, dass auch sie viele (ich wage zu behaupten, spirituelle) Lektionen von ihren vierbeinigen Gefährten gelernt hatten.
Inzwischen habe ich mich wie zahllose andere vor mir auf einen neuen, kritischen Weg in meinem Leben begeben: Kindererziehung. Ich lasse all die üblichen Klischees aus, wie sich mein Leben seit dem Tag verändert hat, als mein Sohn geboren wurde. Dabei zu sein und zu sehen, wie er das Licht der Welt erblickte, stand auf meiner Prioritätenliste nicht unbedingt ganz oben. Ich wäre vollkommen zufrieden damit gewesen, draußen vor dem Kreißsaal zu warten und die frohe Botschaft mit einem anerkennenden Klaps auf die Schulter und einer Zigarre zu empfangen. Aber ich traf die richtige Entscheidung. Ich blieb bei Candice, meiner Frau, hielt ihre Hand und unterstützte sie, so hoffe ich, mit beruhigenden und ermutigenden Worten. Dennoch beeindruckte mich dieses sogenannte Wunder weniger, als es vielleicht sollte. (Ein echtes Wunder war für mich zuzuschauen, wie die Red Sox 2004 die Yankees im siebten Spiel besiegten, nachdem sie die ersten drei Spiele der Baseball-Serie verloren hatten, oder wie die New England Patriots den Super Bowl XXXVI im Football gegen die St. Louis Rams gewannen.)
Vielleicht bin ich ein wenig begriffsstutzig, aber eines wurde mir erst vor ein paar Monaten klar, als ich sah, wie sich mein Sohn allmählich von einer klebrigen fremdartigen Lebensform in ein echtes, von Bewusstsein überflutetes menschliches Wesen verwandelte: Ich musste dringend herausfinden, welche Werte ich meinem Sohn vermitteln wollte.
Für mich war das buchstäblich ein Erwachen, ein Aufflackern in meinem eigenen Bewusstsein. Durch den Zugang zu meinem Vater hatte ich unendlich viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht– diese Quelle des Wissens galt es auszuschöpfen. Außerdem dachte ich seit geraumer Zeit häufig über Cleo nach. Seit der Zeit, als Candice sie mitbrachte– eine einsame kleine Mischlingshündin mit ›Essstörungen‹ aus dem Tierheim–, hatte sie uns viele wichtige Lektionen fürs Leben erteilt, auf eine Weise, die nur ihre Familie zu entschlüsseln oder zu schätzen wusste. Zumindest redeten wir uns das ein.
Angesichts all dessen beschloss ich, den ›Rat der Weisen‹ einzuberufen. Eines Sonntags brachte ich meinen Vater und meinen Hund zusammen, kochte eine Kanne Kaffee und schüttete ein Füllhorn von Leckereien aus (Greenies für Cleo und Brownies für Papa und mich). Mein Ziel: Zu sehen, ob sich die Lebensphilosophien meines Vaters und meines Hundes auf einen gemeinsamen Nenner bringen ließen. Wir sprachen über Nicholas und Cleo, über einige der erinnerungswürdigen Begebenheiten aus ihrem Leben und die Eigenschaften, die wir bei beiden beobachtet hatten und am meisten schätzten. Das Ergebnis ist dieses Buch.
Während wir über unsere Erinnerungen lachten, machte mich mein Vater darauf aufmerksam, dass die aufgezählten bei den Hunden weitgehend angeborenen instinktgesteuerten Eigenschaften auch bei Menschen latent vorhanden sind.
»Wir Menschen schaffen oft Barrieren, die diese Grundinstinkte ausschalten«, erklärte mein Vater, als wir uns eingehender mit dem Gedanken beschäftigten. »Wenn wir diese Eigenschaften bei unseren Hunden erkennen und fördern, pflegen wir sie auch in unserem eigenen Leben, was letztlich jeden Tag aufs Neue zu einem Gefühl wachsender Erfüllung beiträgt.
Das wird auch deutlich, wenn man sich mit der Abstammungslehre befasst«, fuhr mein Vater fort, unfähig, der Versuchung zu widerstehen, das Thema zu wechseln und über sein bevorzugtes Gebiet der Wissenschaft und Evolution zu sprechen. »Das kann man googeln« gehört seit geraumer Zeit zu seinen Standardaussprüchen. »Vor mehreren Zehntausend Jahren machten sich Wölfe und Menschen gegenseitig die Nahrung streitig. Doch im Lauf der Zeit veränderte sich diese Beziehung von Grund auf. Aus den ehemaligen Feinden wurden Freunde, denn die beiden Spezies erkannten, dass sie Seelenverwandte waren. Wölfe, die genetischen Vorläufer der Hunde, leben genau wie wir in Kernfamilien mit zwei Elternteilen und einer kleinen Anzahl von Nachkommen.«
Wie sich herausstellte, hatte er wieder mal recht. Der Weg vom Wolf zum besten Freund des Menschen begann ungefähr vor zwölfttausend bis fünfzehntausend Jahren. Wir reden hier über die Zeit der Jäger und Sammler, sowohl für die Menschen als auch für die Wölfe, lange bevor die Menschen sesshaft wurden und Ackerbau betrieben. Als Teil des ›Zivilisierungsprozesses‹ begannen die Menschen, ihr Fleisch über dem Feuer zu garen. Der aromatische Duft lockte bestimmte Wölfe in die Nähe der ersten menschlichen Ansiedlungen. Als die Bewohner entdeckten, dass einige weniger furchterregend waren als gedacht und sich sogar als nützlich bei der Verrichtung bestimmter Aufgaben erweisen könnten, boten sie ihnen großzügig Fleisch an, um sie bei Laune zu halten. Im Lauf der Zeit entstand dadurch eine wechselseitige Abhängigkeit– Wolfsrudel und Angehörige der Nomadenstämme gingen gemeinsam auf die Jagd. Beide Seiten profitierten von dem Handel: Mit ihrem überlegenen Geruchssinn und der größeren Geschwindigkeit erwiesen sich die Wölfe als eine enorme Bereicherung bei der Verfolgung potenzieller Beutetiere. Als Gegenleistung brieten die Menschen nach der Rückkehr ins Lager das Fleisch und versorgten die Wölfe mit Nahrung. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Die Wölfe, die wussten, wo es langging, sprich, wo sie verköstigt wurden, erwiesen sich als hervorragende Wächter, die jeden in die Flucht schlugen, der dieses vorteilhafte Arrangement mit ihren Wohltätern zu gefährden drohte.
Im Lauf der Zeit wurde aus der Vernunftehe eine ›Liebesehe‹, wie meine Großeltern es nennen. Zwischen dem Wolf aus grauer Vorzeit und dem Hund, der brav zu unseren Füßen sitzt, kamen die Zwischenstufen der Evolution mit dem Schutzhund, dem Wachhund und dem Hirtenhund. Kurz gesagt, auch wenn sich der Zeitraum über mehrere Jahrtausende erstreckt, aber wer zählt schon genau mit: Der treue domestizierte Hund, mit dem uns eine unzertrennliche emotionale Beziehung verbindet, hat viele Eigenschaften und Instinkte des ursprünglichen Wolfs bewahrt, der auf der Suche nach gegartem Fleisch war. Probieren Sie es einmal aus, am besten mit einem gegrillten T-Bone-Steak, halb durch. Sie werden sehen, was ich meine.
Wenn man einen Schritt weitergeht, oder zurück in diesem Fall, erkennt man, was uns mit unseren Hunden verbindet. Mein Vater erinnerte mich nun an etliche Artikel, die er gelesen hatte, als Nicholas zu uns kam und er bestrebt war, sich schnellstmöglich als Hundeexperte zu profilieren. »Hunde sind imstande, uns– unser Verhalten– zu entschlüsseln und unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erraten. Sie können die sozialen Signale der Menschen entschlüsseln. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass selbst Schimpansen, unsere nächsten lebenden Verwandten im Tierreich, mit denen wir genetisch zu 96 Prozent übereinstimmen, einige unserer Gesten nicht so gut deuten können wie ein Hund.«
Auch diese Theorie wird durch wissenschaftliche Untersuchungen und die Entstehungsgeschichte von Menschen und Hunden untermauert. Da sich beide über Tausende von Jahren gemeinsam entwickelt haben, wurde die Fähigkeit, mit uns zu kommunizieren, Teil der DNA von Hunden.
»Ganz einfach«, schloss mein Vater. »Der Hund wurde nicht durch reinen Zufall unser bester Freund, sondern aufgrund der Beziehung, die sich im Lauf der Zeiten entwickelte. Physische Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse, psychische Bedürfnisse– wir erfüllen sie für die Hunde und die Hunde erfüllen sie für uns. Klingt nach einer ganz gesunden Beziehung, finde ich«, fügte mein Vater hinzu.
Einfacher ausgedrückt: Hunde fördern unsere physische Gesundheit, weil sie uns Bewegung verschaffen. Sie fördern unsere emotionale Gesundheit, weil sie um Streicheleinheiten bitten, die nicht nur beruhigende Auswirkungen auf ihren Körper haben, sondern Balsam für unsere Seele sind. Schon wenn wir einen Hund streicheln, kann sich der Blutdruck senken. Ganz im Ernst– probieren Sie es selber aus. Und viele Menschen kommen der Natur nie näher als bei einem Spaziergang mit ihrem Hund, selbst auf dem Gehsteig einer Großstadt.
Für die Experten: Es gibt zwar verschiedene Hunderassen, die für verschiedene Zwecke gezüchtet wurden– angefangen von den Retrievern, die Fischern beim Einholen des Fangs dienen, bis hin zu den Hirtenhunden, die den Viehbestand bewachen, oder den Zwergpudeln, die vor allem wegen ihrer Gesellschaft und schoßfreundlichen Größe gefragt sind–, aber alle Hunde besitzen die Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren.
Bleibt die Frage, ob es möglich ist, diese Beziehung einen Schritt weiterzuführen, auf eine höhere Ebene. Ihr eine spirituelle Dimension zu verleihen.
Die beste Lektion, die ich im Lauf der Jahre von meinem Vater gelernt habe, lautet: »Nimm dich selbst nie zu ernst.« Natürlich besteht in unserer Kultur die Neigung, das genaue Gegenteil zu tun und Menschen unverzüglich mit bestimmten Vorstellungen und Erwartungen zu begegnen, um dann enttäuscht zu sein, wenn sie ihnen nicht gerecht werden. Oft stürzen wir sie dann von ebenjenem Podest, auf das wir sie selber gestellt haben.
Wenn man in Hollywood lebt und arbeitet, wo jede Menge hübsche junge Schauspielerinnen auf ihren großen Durchbruch warten, trifft der Ausspruch »Männer und Hunde haben vieles gemein« voll und ganz zu. Als glücklich verheirateter Mann und Vater würde ich mich gerne von dieser Gattung distanzieren, doch ich weiß, dass ich unterschwellig ebenfalls zu ihr gehöre. Nicht nur, weil ich bisweilen hormongesteuert bin, sondern weil ich in meinem tiefsten Innern noch einen animalischen Instinkt besitze, gepaart mit ungeschliffenen Emotionen und urzeitlichen Verhaltensweisen. Zum Glück zählen zu meinem Repertoire aber auch positive Eigenschaften, wie Liebe, Treue, emotionale Intelligenz und die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung. Ich sinne gerne über die Dinge nach– wie ich mein Leben verbessern, einen sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten, meinen Sohn erziehen und mich um meine Eltern kümmern kann– und ich bilde mir gerne ein, für jeden guten Rat empfänglich zu sein. Ich bin nicht so vermessen zu glauben, auf alles eine Antwort zu haben, ungeachtet dessen, wer mein Vater ist, vor allem, weil er nach seiner eigenen Aussage selber noch einen weiten Weg vor sich hat.
»Ich versuche mir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, was andere von mir denken könnten. Unvoreingenommenheit ist eine zentrale Eigenschaft der Spiritualität, bei der es darum geht, kein Werturteil über andere zu fällen, aber mir auch nicht den Kopf über andere zu zerbrechen, die ein Werturteil über mich fällen.«
Ich war beruhigt. Wir waren bereits bei der zweiten Kanne Kaffee angelangt.
»Und noch etwas«, fügte mein Vater hinzu. »Spiritualität beginnt und endet nicht. Sie ist ein allgegenwärtiger Teil des Lebens, in jedem Augenblick, in jeder Begegnung und in jeder Beziehung präsent. Jeder Winkel unseres Lebens ist von Selbsterfahrung durchdrungen, die sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.«
Er nahm ein Leckerli und reichte es Krishu, der Cleo befahl, Sitz zu machen, und ihr die Belohnung verabreichte. Mein Vater lächelte. Wenn ich seine Interaktionen mit meinem Sohn beobachte, habe ich bisweilen das Gefühl, dass er sich mir gegenüber genauso verhalten würde, wenn er noch einmal ganz von vorne anfangen könnte.
»Alle zwischenmenschlichen Interaktionen sollten Sinn und Bedeutung haben.« Er nickte. »Was könnte spiritueller sein?«
1
Bist du eigentlich ein Hundefreund, Papa?
Ich soll jetzt wohl Ja sagen, oder?
Genau.
Ja, bin ich. Ich war aber keiner, bis ihr aufgetaucht seid.
Und?
Und… je mehr ich über Tiere im Allgemeinen lerne, desto mehr begreife ich, dass die meisten von ihnen emotionale Wesen sind. Sie entwickeln eine soziale Rangordnung. Sie unterhalten enge, fürsorgliche Beziehungen zu ihren Nachkommen. Sie singen und spielen. Und einige Arten besitzen sogar ein gewisses Maß an Bewusstsein, das beinahe an Selbstbewusstsein grenzt und sich beispielsweise darin äußert, dass sie Sinn für Humor erkennen lassen. Auch mit den Menschen gehen Tiere bestimmte Verbindungen auf der Ebene der limbischen Resonanz ein, ein Verstehen, das jenseits der Rationalität entsteht, mit denen sie ihr physiologisches und emotionales Wohlbefinden untermauern. Säugetiere verfügen über ein limbisches Gehirn und können folglich emotionale und spirituelle Beziehungen zu uns Menschen aufbauen. Ich sollte wahrscheinlich mehr Zeit mit Tieren verbringen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!