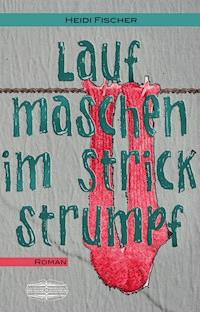Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Diana Mittermeier lebt seit vielen Jahren im Nordwesten der Ferieninsel Mallorca. Ihr sorgloses Dasein ändert sich schlagartig mit dem Tod von Konstantin Matern. Sie übernimmt die Aufsicht über dessen sechsjährigen Sohn Max und lernt zufällig die Clan-Chefin Pilar Martinez kennen. Ohne es zu ahnen, stolpert sie in kriminelle Machenschaften und wird immer tiefer in den Sumpf der Drogenmafia hineingezogen. Auch ihre Beziehung zu dem gutaussehenden Mallorquiner Antonio muss sie in Frage stellen. Was hat er mit dem Überfall auf ihren Bruder zu tun? Wie kann sie den sechsjährigen Max schützen? Und wieweit darf sie ihrer Freundin Pilar über den Weg trauen? Comisario Casas warnt sie vor der Macht der Drogen-Clans, doch Diana Mittermeier will nicht wahrhaben, was vor ihren Augen an Bösem passiert!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Diana Mittermeier lebt seit vielen Jahren im Nordwesten der Ferieninsel Mallorca. Ihr sorgloses Dasein ändert sich schlagartig mit dem Tod von Konstantin Matern. Sie übernimmt die Aufsicht über dessen sechsjährigen Sohn Max und lernt zufällig die Clan-Chefin Pilar Martinez kennen. Ohne es zu ahnen, stolpert sie in kriminelle Machenschaften und wird immer tiefer in den Sumpf der Drogenmafia hineingezogen.
Auch ihre Beziehung zu dem gutaussehenden Mallorquiner Antonio muss sie in Frage stellen. Was hat er mit dem Überfall auf ihren Bruder zu tun? Wie kann sie Max schützen? Und kann sie ihrer neuen Freundin Pilar trauen?
Comisario Casas warnt sie vor der Macht der Drogen-Clans, doch Diana Mittermeier will nicht wahrhaben, was vor ihren Augen an Bösem passiert!
Die Autorin
Heidi Fischer wurde 1954 in Oberfranken geboren, lebte einige Jahre in München, um dann mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern wieder nach Coburg zurückzukehren. Sie arbeitete als Lehrerin, Mutter und Hausfrau und schreibt seit vielen Jahren Gedichte und Kurzgeschichten. Ihre Arbeiten wurden in unterschiedlichen Anthologien und der Literaturzeitschrift Wortlaut veröffentlicht.
Seit ihre jüngste Tochter den Wohnsitz nach Mallorca verlegt hat, ist Heidi Fischer ein Fan der Insel und verbringt mehrere Wochen im Jahr auf der Balearen-Insel.
Bisher erschienen beim Lauinger Verlag: Laufmaschen im Strickstrumpf (2013), Wer später stirbt ist länger alt (2015), Der verlorene Mann (2016) und Tod der Schmetterlingsfrau (2018).
HEIDI FISCHER
MALLORCA KRIMI
Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2020 Lauinger Verlag, Karlsruhe
Projektmanagement, Umschlaggestaltung, Bildbearbeitung, Satz & Layout: Sonia Lauinger
Lektorat: Miriam Bengert
Korrektorat: Elisa Klausmann
Druck: AKRA, Polen
Titelfoto: Heidi Fischer
Die Künstlerin der Skulptur ist die dänische Bildhauerin Hanne Varming, *1939.
Blumen im Satz: © iStock, Ganna Aibetova/alamy Vektografik
Karte S. 209: OpenStreetMap Mallorca
Fotos S. 200-201, 214-215: Heidi Fischer
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
ISBN: 978-3-7650-9146-9
Dieser Titel erscheint auch als E-Book:
ISBN: 978-3-7650-9147-6
http://www.lauinger-verlag.de
http://www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
https://twitter.com/DKBVerlag
https://www.instagram.com/lauingerverlag/
Inhalt
MALLORCA – ANFANG MAI
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
DIANAS LIEBLINGSREZEPTE
»Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.Es wär’ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.«Die Ärzte, »Deine Schuld«, 2003
MALLORCA – ANFANG MAI
Die Luft in der Szene-Disco am Ballermann von Mallorca war zum Schneiden. Im »Paradise« herrschte Hochstimmung. Es war Anfang Mai, noch keine Hauptsaison auf der Baleareninsel, doch die Lokale entlang der Partymeile, besser bekannt als Bier- und Schinkenstraße, waren gut besucht. Lautes Pfeifkonzert begleitete den unbeholfenen Strip einer neunzehnjährigen Touristin. Sie tänzelte unprofessionell, aber leidenschaftlich, über die Bühne. Nur mit hochhackigen Schuhen, Spitzen-BH und Minislip bekleidet, erfüllte sie sich und den meisten Besuchern der Disco ihren Traum von sexueller Freizügigkeit, oder was sie dafür hielten. Sie genoss die uneingeschränkte Bewunderung, der zum Großteil sturzbetrunkenen, männlichen Gäste. Die Happy-Hour war soeben unter dem Motto »Drei für Zwei« zu Ende gegangen, viele Urlauber hatten sich noch schnell mit reichlich Getränken eingedeckt. Prosecco, Bier und Schnaps flossen in Strömen, die Bedienungen kamen kaum nach mit dem Servieren.
Daheim in Deutschland arbeitete die Stripperin als brave Schreibkraft in einer Betonplattenfirma, im Urlaub verwirklichte sie sich einmal im Jahr ihren Wunsch nach dem Verbotenen. Vor einer halben Stunde hatte sie das erste Mal in ihrem Leben eine Ecstasy-Pille eingeworfen. Gemeinsam mit einigen Freundinnen, die ihren Auftritt mit Anfeuerungsrufen begleiteten. Der smarte Typ, der sie im Auftrag der Discobetreiber gestern am Strand angesprochen hatte, beobachtete von seinem Platz am Eingang zufrieden die enthemmende Wirkung der Droge und die Reaktionen der Zuschauer. Seine Augen wanderten prüfend über die Menge, er hielt Ausschau nach weiteren potentiellen Opfern.
Johlen und Klatschen, Kreischen und Pfeifen. Die Stimmung versprach gute Umsatzzahlen.
Drei Stockwerke höher, in einem Zimmer, das direkt über der Bühne lag, auf der die junge Frau aus Düsseldorf sich ihres Slips entledigte, ereilte zur gleichen Zeit Konstantin Matern ein jämmerlicher Tod.
Vielleicht hätte er länger gelebt, wenn er das Auto nicht gemietet hätte. Er hatte am Vormittag einen Golf Cabrio auf dem Flughafen Son Sant Joan von Palma de Mallorca abgeholt.
Vom Flughafen aus war es ein kurzer Schlenker auf dem Weg nach Palma, um in Son Banya an richtig guten Stoff zu kommen. Die Tatsache, dass er ein Auto zur Verfügung hatte, nutzte Konstantin für den Abstecher. Er freute sich auf das Eintauchen in die rauschhafte Euphorie des Kokains. Sein Einkommen war in letzter Zeit sehr schmal gewesen, hatte nur für Alkohol und ein paar Pillen gereicht. Am Ballermann wurde meist nur mäßig gutes Kokain vertickt. Der Reinheitsgehalt lag um die fünfunddreißig Prozent und es war im Verhältnis zur erzielten Wirkung viel zu teuer. In Son Banya kannte er einen zuverlässigen Dealer, der ihm bisher stets super Ware zu einem angemessenen Preis angeboten hatte.
Die Elendssiedlung am Rande von Palma stellte viele soziale Brennpunkte Europas in den Schatten. Zwischen Baracken und Müll lag in Son Banya das reinste Drogenparadies, das einschlägige Kunden anzog, um billig und unproblematisch an Rauschgift zu kommen. Schon vor einem Jahr hatte die mallorquinische Regierung den Abriss des Elendsviertels beschlossen, aber sowohl die geplante Umsiedlung der Einwohner, als auch das Einstampfen der Häuser gestaltete sich zögerlich. Kaum hatte das Abrisskommando der Regierung eine Baracke dem Erdboden gleichgemacht wurde sie von einem Bautrupp der Drogenclans wiederaufgebaut. Wäre die ganze Sache nicht kostspielig und von den Steuergeldern der Einwohner Mallorcas finanziert, hätte man sich darüber ausschütten können vor Lachen.
Konstantin hatte jedenfalls keine Mühe gehabt, sich eine großzügige Menge Koks und eine Handvoll Ecstasy-Pillen zu beschaffen. Der Dealer, er nannte sich augenzwinkernd Charlie, kannte ihn schon von früheren Geschäften. Er bat ihn um einen Gefallen, den er natürlich entsprechend honorierte. Konstantin bekam eine Extra-Portion reines Koks dafür. Mit einem Handschlag hatten sie den Deal besiegelt und ein unscheinbarer Beutel wechselte den Besitzer.
Für Konstantin Matern war die Fahrt nach Son Banya nur ein Umweg von zehn Minuten, aber ein paar Stunden später sollte dieser Umweg ihn das Leben kosten.
Dabei lief erst einmal alles wie am Schnürchen.
Seine Hände zitterten bereits erwartungsvoll, niemals würde er mehr als ein paar Tage auf eine Nase Weißes Gold verzichten können.
Als seine aktuelle Flamme Beatrix sechs Stunden später an seine Zimmertür klopfte, öffnete niemand. Aber es war nicht abgeschlossen und sie ging ganz selbstverständlich hinein. Sie kannten sich erst seit ein paar Tagen, ihr Verhältnis war jedoch bereits so weit gediehen, dass sie nicht auf eine Einladung zum Eintreten warten musste. Wie lange ihre Beziehung bestehen würde, war ungewiss. Als Beatrix das Hotelzimmer betrat, glaubte sie an ein dauerhaftes Band ihrer Freundschaft, so wie sie nie zu Beginn eines Verhältnisses die Ewigkeit anzweifelte. Und sie hatte schon viele Ewigkeiten hinter sich gebracht.
Mit Schwung schleuderte sie ihre Umhängetasche in die Ecke und kickte ihre Sandaletten hinterher. Ihre Füße schmerzten vom stundenlangen Gehen in dem unbequemen Schuhwerk. Sie trug am liebsten flache Sandalen, aber in ihrem Arbeitsvertrag war ausdrücklich angegeben, dass Absatzschuhe mit einer Mindesthöhe von sieben Zentimetern verpflichtend waren. Genauso wie das Tragen von Minirock und hautengem Top. Beatrix war nicht zimperlich, sie war es gewohnt, von gierigen Männerhänden begrabscht zu werden. Wer auf der Partymeile am Ballermann sein Geld verdiente, wusste, worauf er sich einließ.
»Diese scheißhohen Absätze muss ein Mann erfunden haben. Keine Frau käme auf so eine hirnverbrannte Idee.« Sie schaute sich im Zimmer um und stellte fest, dass Konstantin nicht zu sehen war. Aber sie hörte Geräusche aus dem Bad. »Mensch, war das heute ein beschissener Tag. Nichts als meckernde Arschgeigen und null Trinkgeld.«
Beatrix war bester Laune. Es sollte ein besonderer Abend werden, mit einer Fahrt im Cabrio. Das hatte ihr Konstantin versprochen. Schon lange träumte sie davon, einmal in einem Cabrio über die Insel zu düsen.
»Ich mach mir schon mal ein Bier auf. Hast du den Wagen abgeholt? Ich freu mich auf eine Spritztour!« Sie lauschte auf eine Antwort. Als keine Reaktion kam, legte sie sich rücklings auf das ungemachte Bett und schloss für einen Moment die Augen. Sie hatte Konstantin vor genau zehn Tagen am Strand getroffen. Er hatte eine Gitarre dabeigehabt und ganz in sich versunken ein Lied gespielt. Die Tattoos auf seinem Rücken waren ihr zuerst aufgefallen: eine Kobra, die sich um eine Rose schlängelte, darüber ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen. Seine tiefe Singstimme und die Schlange hatten ihr gefallen, auch wenn sein Gesicht ziemlich verquollen ausgesehen hatte. Aber sein Lächeln hatte etwas Spitzbübisches, als er sie auf einen Drink einlud. Und sie durfte nicht allzu wählerisch sein, denn die Flugzeuge aus Deutschland brachten täglich neue Konkurrentinnen auf die Insel.
»Wir fahren bis nach Andratx rüber, schwimmen im Mondlicht, ich singe ein Lied nur für dich und dann gehen wir richtig schick essen.« Er spielte gerne den Romantiker und Beatrix war, wie die meisten Frauen, voller Hoffnung, dass sie diesmal den Richtigen gefunden hätte.
Konstantin hatte gestern seine erste Gage bekommen und wollte noch einmal so richtig abfeiern, bevor sein sechsjähriger Sohn bei ihm Urlaub machte.
»Was für eine Schnapsidee«, hatte sie geschimpft, als er ihr erzählte, dass er in diesem Hotel am Ballermann sein Kind einquartieren wollte. Aber wenn für sie bei dieser Aktion nächtliche Autofahrten und Einladungen zum Essen heraussprangen, würde sie nicht meckern.
Beinahe wäre sie eingenickt. Lautes Gejohle eines Betrunkenen auf dem Flur riss sie aus dem Halbschlaf.
»Kon, kommst du endlich? Was machst du denn so lange?« Sie stand vom Bett auf und klopfte an die Badezimmertür.
Von drinnen war nur ein Stöhnen zu hören.
»Kon, mir ist langweilig. Wir wollten doch ans Meer.«
Wieder nur Stöhnen.
»Kon!« Beatrix begann sauer zu werden.
Vorsichtig öffnete sie die Tür einen Spalt. Sie klemmte und ließ sich nicht weiter als ein paar Zentimeter aufschieben. Gestank nach Erbrochenem und Urin schwappte aus dem Raum. So hatte es gerochen, als sie im letzten Jahr einen Magen-Darm-Virus gehabt hatte und nicht mehr rechtzeitig zur Kloschüssel gekommen war.
Angewidert zuckte Beatrix zurück, sie spürte sofort, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Ihr Herz wummerte bis hinauf in den Hals.
Mit schweißfeuchten Händen drückte sie gegen die Tür, stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Als es ihr gelang, den Spalt um weitere zehn Zentimeter zu verbreitern, nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und quetschte sich hinein. Drinnen roch es noch schlimmer. Sie versuchte flach zu atmen, um den Gestank besser zu ertragen.
Konstantin lag mit verdrehten Augen auf dem Fußboden. Er musste mit dem Kopf gegen das Waschbecken geknallt sein und blutete aus einer aufgeplatzten Wunde an der Stirn. Ein dünnes Rinnsal lief zwischen den Augenbrauen über den Nasenrücken. Dort teilte es sich und zwei schmale Streifen zogen sich über die Wangen bis zum Hals. Es sah aus wie eine exotische Kriegsbemalung. Mit dem Rücken hatte er die Tür blockiert, seine Arme lagen wie schützend über seinem Bauch. Die Augen sahen nicht mehr aus, als gehörten sie zu ihm. Sie quollen wie bei einem Frosch aus den Höhlen, starrten leer auf einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand. Als Beatrix ihnen folgte, um zu sehen, warum sie genau dorthin glotzten, entdeckte sie eine Spinne, die sich an einem hauchdünnen Faden von der Decke herunterseilte. Beatrix hatte schon immer Angst vor Spinnen und dieses Exemplar sollte ihre krankhafte Furcht noch weiter befeuern und sie noch lange verfolgen. In den Albträumen, die sie nach diesem Ereignis fast jede Nacht heimsuchten, spielte das Tier eine tragende Rolle.
Konstantin atmete röchelnd. Erbrochenes quoll aus seinem Mund und aus der Nase, aber auch seine Luftröhre und den Rachenraum hatten Speisereste verstopft. Er war blau angelaufen und bewusstlos.
Beatrix ekelte sich vor dem Anblick.
Vorsichtig, bedacht darauf, nicht in das Erbrochene zu langen und ohne die Spinne dabei aus den Augen zu lassen, rüttelte Beatrix ihn an der Schulter. Es kam ihr so vor, als würde das Röcheln ein bisschen leiser werden.
»Kon, wach auf, da ist eine Spinne!« Tränen liefen ihr aus den Augen und rollten über die vor Aufregung und Angst geröteten Backen, an ihrem Hals entlang in ihr enganliegendes T-Shirt. Auf dem Weg hinterließen sie eine salzige Spur.
Sie rüttelte ihn erneut.
»Kon, du musst aufstehen!«
Aber er zeigte keine Reaktion. Beatrix setzte sich auf den Rand der Badewanne, möglichst weit entfernt von der Wand, an der sich die Spinne abseilte. In ihrem Hals spürte sie Enge, ihr Herz klopfte heftig.
Ein paar Minuten saß sie dort und dachte fieberhaft nach, was sie tun sollte. Wenn sie den Rettungsdienst anrufen würde, wäre Kon seinen Job los. Sie würden ihn mit dem Notarzt ins Krankenhaus bringen und natürlich auch einen Drogentest machen. Der Bandleader hatte gleich zu Beginn seines Engagements klargestellt, dass er keinen Drogenkonsum duldete. Und dass Kon etwas eingeworfen hatte, war Beatrix sofort klar. Minuten, die ihr wie Stunden vorkamen, vergingen. Die Spinne verharrte ebenfalls an ihrem Faden in der Luft zwischen Decke und Fliesenboden.
Das Röcheln war verstummt. Unheimliche Stille lag in dem Raum. Beatrix unterdrückte ein Schluchzen. Sie musste an das Cabrio denken und spürte eine aufsteigende Wut, dass Kon ihr wieder einmal eine leere Versprechung gemacht hatte. Ganz entfernt konnte man Discomusik hören.
Nach den Klängen dieser Musik bewegte sich die bekiffte Touristin tanzend über die Bühne und warf dabei ihre Unterwäsche ins Publikum. Ein paar Männer rissen Witze über ihren kleinen Busen, einer ging zum Onanieren aufs Klo. Ihre Freundinnen klatschten begeistert.
Beatrix schnäuzte sich in das schmuddelige Handtuch, das an der Badezimmertür hing, quetschte sich wieder durch den Türspalt nach draußen und suchte auf dem Bett nach ihrem Handy, das hinter ein Kissen gerutscht war. Dann wählte sie die 112 und holte Hilfe.
EINS
Als sich um elf Uhr am Vormittag das Gefängnistor öffnete und Pilar Martinez herauskam, regnete es rote Rosen für die Chefin des Sánchez-Clans. Mehr als dreißig Personen standen Spalier und begrüßten sie klatschend und jubelnd. Freundinnen, Nachbarn und Verwandte waren gekommen. Ihre Schwester Luisa hatte die Blumen besorgt und sie unter den Wartenden verteilt. Einige ließen schon die Köpfe hängen. Es war ein heißer Tag, sie hatten seit zwei Stunden kein Wasser mehr gesehen und welkten bereits vor sich hin. Pilar blinzelte ins helle Sonnenlicht. Sie versuchte sich an einem freundlichen Lächeln, das ziemlich misslang. Sie hasste es, im Mittelpunkt zu stehen, wollte aber den Wartenden zeigen, dass sie den Empfang in der Freiheit zu schätzen wusste.
Drei Jahre von einer fünfjährigen Haftstrafe wegen Drogenhandels hatte Pilar Martinez abgesessen. Heute war der Tag ihrer Entlassung. In den vergangenen Monaten hatte sie schon zweimal für drei Tage Freigang erhalten. Bisher war sie nicht auf diese Weise begrüßt worden. Sie wurde von den Mitgliedern des Clans verehrt, auch die in Son Banya ansässigen Sinti und Roma respektierten sie. Das Empfangskomitee, vorbereitet von ihrem Sohn, hatte wohl durchdachte Gründe. Es sollte den anderen Clans klarmachen, dass Pilar Martinez nicht durch die Haft an Ansehen und Einfluss eingebüßt hatte. Im Gegenteil, mit ihrer Entlassung würde die Macht des Sánchez-Clans wieder steigen, seine Stellung wieder unangefochten an der Spitze der Drogenclans von Mallorca stehen.
Wer sie nicht näher kannte, hätte nie vermutet, dass Pilar Martinez die Chefin des Sánchez-Clans war. Sie war vor einer Woche neunundfünfzig geworden. Ihre von weißen Strähnen durchzogenen, schwarzgelockten Haare hatte sie zu einem lockeren Knoten hochgesteckt. Sie trug einen dezent gemusterten Rock zu weißer Bluse, schlicht und elegant. Von weitem betrachtet, sah man ihr das Alter nicht an, aber aus der Nähe wirkte ihr Gesicht verbraucht und blass. Zwei tiefe Falten, die sich entlang der Mundwinkel bis zum Beginn des Kinns zogen, und unzählige kleine Fältchen um Augen und Stirn verrieten ihr Alter. Ungeschminkt beschönigte nichts den Eindruck der Erschöpfung. Sie war schlank und hatte einen aufrechten Gang. Rote, hochhackige, aus weichem Leder gearbeitete Sandalen waren das Auffälligste an ihrer Kleidung. Die Neigung zu extravaganten Schuhen war, neben dem Rauchen, die einzige Schwäche dieser Frau, die sich ansonsten keine Laster leistete. Sie hatte sich ihr Lieblingspaar für diesen besonderen Tag mitbringen lassen und sie vor dem Verlassen des Gefängnisses mit Vergnügen gegen die ausgetretenen Anstaltsschuhe gewechselt.
»Wir lassen uns auf Dauer nicht aus Son Banya vertreiben. Vertraut mir. Ab sofort bin ich wieder am Ball und werde meinen Sohn Juan nach Kräften unterstützen.« Sie deutete mit der rechten Hand ein Siegeszeichen an, bevor sie sich zu ihrer Enkeltochter María hinunterbeugte, um ihr einen Kuss auf die Stirn zu geben. Die Kleine lächelte sie freudestrahlend an.
»Oma, gibt es im Gefängnis wirklich Klos, die keine Türen haben?«
»Lass Oma in Ruhe! Solche Fragen stellt man nicht.«
Ihr Sohn Juan Sánchez Martinez, der natürlich auch gekommen war, um sie abzuholen, zog seine fünfjährige Tochter unwirsch zur Seite und öffnete respektvoll die Fahrertür.
»Wer hat dir das mit den Klos erzählt?«
»Das habe ich im Fernsehen gesehen. Ein Krimi. Papa hat geschlafen, deshalb weiß er es nicht.«
Pilar musste lachen, aber ihr Sohn verzog keine Miene. Er war, so wie meist, ganz in Schwarz gekleidet. Makellos glatt das Hemd, Bügelfalte in der Hose und Lackschuhe, in denen man sich spiegeln konnte. Sie wusste, dass er zuhause lange das Bad blockiert hatte, um seine schwarzen Locken mit Gel in Form zu bringen. Er rasierte sich dreimal am Tag, weil er es nicht leiden konnte, wenn sich ein bläulicher Schatten auf seinem Kinn zeigte. Seine Eitelkeit war für sie schon immer schwer erträglich gewesen. Sie bemühte sich, ihren Unmut zu unterdrücken und konzentrierte sich darauf, freundlich zu wirken. Sie hatte das Autofahren in der Zeit der Inhaftierung vermisst und freute sich wie ein Kind, endlich wieder hinter dem Steuer sitzen zu dürfen.
Heute würde sie sich noch nicht den Geschäften widmen. Dieser erste Tag in Freiheit war für eine Spritztour über die Insel reserviert: Sie wollte den frischen Fahrtwind spüren, das Gefühl frei zu sein, genießen. Hinauf zum Cap de Formentor, die Küstenstraße entlang, über Kloster Lluc nach Sóller und dann zum Hafen nach Port Sóller. Dort oben, im Nordwesten der Insel, war für Pilar Martinez ihr Sehnsuchtsort. Schon bei ihrem ersten Besuch, es war ein Schulausflug in der Grundschule mit dem Roten Blitz von Palma nach Sóller gewesen, hatte sie sich in diesen Ort verliebt. Ein Städtchen, in dem das Leben ruhiger und langsamer floss, als im Süden der Insel. Durch die Gassen des Städtchens zu schlendern oder auf der Plaza Constitucio zu sitzen und sich die Sonne auf den Rücken scheinen zu lassen, würde ihr vielleicht wieder die Gelassenheit früherer Tage geben. Im Hafen wollte sie eine Pause an der Strandpromenade einlegen und den Sonnenuntergang genießen. Eine Auszeit, die sie brauchte, nach den endlosen Tagen in der Gefängniszelle. Anschließend würde sie bereit sein, im Kreis der Familie zu essen und sich ihr neues Zuhause anzuschauen. Nicht mehr in Son Banya zu wohnen, würde schwer werden, aber es musste wohl sein. Juan hatte für sich und seine Tochter eine Villa am Rand von Port Sóller angemietet, es gab ein großes Gästezimmer mit Bad und separatem Eingang. Dort würde sie erst einmal einziehen.
Die Probleme von Son Banya würden bis morgen oder vielleicht auch bis nächste Woche warten müssen.
Die Zeitungen auf Mallorca waren schon das ganze Jahr voll davon. Son Banya sollte abgerissen werden. Die Einwohner, meist Roma, die sich Anfang der 60er Jahre dort niedergelassen hatten, würden umgesiedelt und damit ein sozialer Brennpunkt beseitigt werden.
In der Siedlung Son Banya variierte die Anzahl der Drogen-Clans. Zehn oder zwölf, schätzte die Polizei. Die Schwankungen ergaben sich daraus, dass nach der Festnahme von mehreren Mitgliedern eines Clans, ein Neffe, Cousin oder eine Tante den Verkauf der Drogen übernahm und damit wieder einen neuen Clan gründete, während der alte in abgeschwächter Form weiterbestand.
»Warum geht der Abriss der Häuser so schleppend? Will die Verwaltung von Palma wirklich bis 2020 oder noch länger damit warten?«, fragten Journalisten in reißerischen Zeitungsartikeln.
Aufgebrachte Bürger beschwerten sich. Sie wollten den größten Drogenumschlagplatz auf Mallorca endlich beseitigt wissen, schrieben erboste Leserbriefe und demonstrierten vor dem Rathaus.
Als Begründung dieser Verzögerung wurde der Bau von Ersatzwohnungen genannt. Das Schaffen neuen Wohnraums war eine Kostenfrage auf der Baleareninsel.
»Vielleicht ist es sogar einfacher, dass Son Banya weiterexistiert. Dann wissen wir wenigstens, wo wir die Händler und Dealer suchen müssen.« Diese Einstellung einiger Mitarbeiter des Drogendezernates wurde nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert, aber sie war sicher nicht ganz unbegründet. Dabei war die Überlegung Son Banya niederzureißen absolut nicht neu. Als die Siedlung Ende der 60er Jahre für Roma gegründet wurde, war sie nur dazu gedacht, die gitanos, wie sie in Spanien hießen, von der Straße zu holen. Es sollte eine Übergangslösung sein, die lediglich für ein paar Jahre angedacht war. Doch Son Banya entwickelte sich zu einer Dauerlösung und einem Dauerproblem.
2011 hatte die Stadt schon einmal fünfzig Häuser abgerissen. So schnell wie sie dem Erdboden gleichgemacht worden waren, genauso schnell waren sie mit Hilfe der Drogenbosse wiederaufgebaut worden.
Angeblich gab es nicht nur heruntergekommene Bauwerke in der Siedlung, sondern hinter den erbärmlichen Fassaden versteckten sich auch Luxuswohnungen, die mit Panzertüren gesichert waren. Edelkarossen parkten neben alten Karren, Junkies vegetierten in Holzverschlägen, Kinder spielten zwischen Müll und weggeworfenen Spritzen.
Ehrenamtliche Ärzte und Sozialarbeiter versuchten das Elend zu verkleinern, indem sie täglich saubere Spritzen an ankommende Drogenabhängige verteilten. Diese gaben ihnen dafür ihre gebrauchten Spritzen ab. Es war ein kläglicher Versuch HIV, Hepatitis und andere Infektionen einzudämmen.
Pilar Martinez war 1969 mit ihrer Familie nach Son Banya gezogen. Sie war sechs Jahre alt gewesen, als ihre Mutter die Wohnung von den Behörden zugewiesen bekommen hatte. Mit fünf Geschwistern hatten sie sich ein Kinderzimmer geteilt, das den Namen nicht verdiente. Es war nicht mehr als eine Abstellkammer gewesen. Zu sechst hatten sie auf zwei Matratzen, die am Boden lagen, geschlafen. Platz zum Spielen oder Hausaufgabenmachen hatte es in dem Raum nicht gegeben. Von der Decke hatte eine Glühbirne gebaumelt und aufgespannte Schnüre führten von einer Seite des Zimmers zur anderen. Sie waren dazu da gewesen, die Kleidung der Kinder einigermaßen übersichtlich aufzubewahren.
Pilar war die Jüngste in der Familie. Ihr ältester Bruder Fernando hatte mit siebzehn Jahren die Aufgaben des Familienoberhauptes übernommen, nachdem ihr Vater nur kurze Zeit nach ihrer Ankunft in Son Banya wegen Doppelmord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war. Er war überfordert gewesen, hatte aber sein Bestes gegeben. Während die Mutter sich mit Putzarbeiten etwas Geld verdiente, hatte er den Traum, Schreiner zu werden. Irgendwann einmal Möbel zu entwerfen und sie in der eigenen Werkstatt zu bauen, war sein Ziel gewesen. Aber er war schon im Ansatz gescheitert, weil kein Betrieb bereit gewesen war, einem Jugendlichen aus Son Banya eine Lehrstelle zu geben. Das Viertel und seine Bewohner waren viel zu verrufen. Schon kurz nach der Gründung der Siedlung wurde über einen Abriss nachgedacht und die Anwohner waren mit dem Stigma der Asozialen behaftet.
Dennoch träumte er seinen Traum weiter, verdiente sich aber in der Zwischenzeit Geld als Drogenbote. Er war kein Dealer gewesen, sondern nur ein junger Mann, der zuerst Haschisch, später Heroin, in handlichen Beuteln auf seinem Motorroller vom Hafen abholte, wo es in Schiffen aus Südamerika oder Afrika nach Mallorca gebracht wurde.
Diese Beutel hatte er stets pflichtbewusst, ohne jemals etwas zu unterschlagen, bei einer vorher festgelegten Adresse abgeliefert, hatte dafür ein paar Geldscheine bekommen und musste sich nicht um den weiteren Verbleib des Rauschgiftes kümmern. Das hatte die Familie über Wasser gehalten.
Für Pilar waren die ersten Jahre in Son Banya die glücklichsten in ihrem Leben gewesen. Obwohl sie bereits sechs Jahre alt gewesen war, als sie dort ansiedelten, ging sie die nächsten drei Jahre nicht zur Schule, sondern hatte die Hinterhöfe und Straßen als Spielplatz entdeckt, der die tollsten Abenteuer bot, die sich ein phantasiebegabtes Kind nur wünschen konnte. Aus alten Autoreifen hatten sie Schaukeln gebaut, freilaufende Hühner konnten gejagt werden, Müllhalden hatten zur Schatzsuche gedient und hinter den Wellblechhütten spielten sie Verstecken. Sie hatte jede Menge Freundinnen und Freunde im gleichen Alter gehabt, die ebenfalls nicht zur Schule gingen, denn die Behörden hatten zwar die Wohnsiedlung Son Banya errichtet, aber vergessen, für ein soziales Netz zu sorgen. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen gab es schlichtweg nicht. Und die Nachbargemeinden weigerten sich, Kinder aus dem Armenviertel in ihren Schulen aufzunehmen. Es entstand ein Ghetto, eine Siedlung der Vergessenen.
Was hätten sie anderes tun sollen, als mit Drogen zu handeln, in der Prostitution zu arbeiten oder Taschendiebe zu werden?
Mallorca war ein idealer Umschlagplatz für Drogen, die mit Schiffen aus Amerika oder Afrika kamen und nach Europa weitertransportiert werden sollten, und die Familien in Son Banya waren geschäftstüchtig. Sie merkten schnell, dass man zwar an einer Überdosis Kokain oder Heroin sterben konnte, aber wer es schlau anstellte, konnte auch sehr reich damit werden.
Als Pilar neun Jahre wurde, hatte es die Stadt doch noch geschafft, eine Schule zu errichten, sie war eingeschult worden und besuchte den Unterricht mit nicht allzu großer Begeisterung. Ihren anderen Geschwistern war es ähnlich ergangen. Zu lange hatten sie das ungebundene und freie Dasein zuhause genossen. Sie hatten zwar alle ein bisschen Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt, aber bei keinem der Kinder hatte es ausgereicht, um eine weiterführende Schule zu besuchen oder gar zu studieren.
Pilar Martinez öffnete das Schiebedach des Wagens. Sonnenstrahlen blitzten zwischen Wolken hervor. Sie startete den Motor und suchte auf der Ablage nach ihrer Sonnenbrille. Als ihr einfiel, dass das Cabrio in den vergangenen Monaten nur von ihrem Sohn gefahren worden war, fluchte sie laut.
»Hostia!«
»Nana, wenn du solche Wörter sagst, dann kommst du nicht in den Himmel, wenn du gestorben bist.«
»Wer erzählt dir denn solchen Mist?«
»Darf ich mitfahren?« Die kleine María stand mit schiefgelegtem Kopf neben der Autotür. Der bettelnden Stimme und dem bittenden Blick ihrer Enkeltochter konnte Pilar nicht widerstehen.
»Na los, steig ein. Dann machen wir einen Frauenausflug zu zweit!« Pilars Ton war barsch, sie wollte sich nicht anmerken lassen, dass sie die offen zur Schau gestellte Zuneigung des Kindes rührte. Die Kleine ließ sich nicht davon beeindrucken, schulterte einen rosafarbenen Rucksack und kletterte auf die Rücksitzbank.
»Ich habe meinen Quadrocopter dabei. Möchtest du ihn sehen?« Sie öffnete den Reißverschluss ihres Rucksackes.
»Was ist das denn?«
»Eine Drohne, mit Kamera. Die habe ich von Papa zum Geburtstag bekommen. Total cool!«
Pilar runzelte die Stirn und seufzte. »Wenn das Ding so cool ist, dann musst du mir unbedingt zeigen, wie es funktioniert.«
ZWEI
Als der Anruf von einem Toten im »Paradise« einging, war Comisario José Maria Casas selbst am Telefon, da seine Sekretärin bereits Feierabend gemacht hatte. Auch er wollte sich gerade auf den Weg nachhause begeben. Vor seinem inneren Auge sah er sich bereits mit seiner Katze in der Hängematte auf der Terrasse schaukeln, neben sich ein gekühltes Glas Wein und ein paar Tapas, die zum Feierabend nicht fehlen durften.
»Qué mierda«, zur Hölle brummte er übellaunig, nahm aber dennoch den Hörer ab, weil sein Pflichtbewusstsein siegte.
»Ich habe eine hysterische Frau in der Leitung, die ihren Freund tot aufgefunden hat. Außerdem erzählt sie mir ständig etwas von einer Spinne, die jemand für sie totmachen muss. Kennen Sie das ›Paradise‹? Es ist direkt am Ballermann. Klingt nach Drogen. Schauen Sie sich die Sache an oder soll ich die Policia Local informieren?«
»Stellen Sie durch: Ich bin Spezialist für Spinnen.« Die Beamtin am Telefon hatte keine Ahnung, warum der Comisario sich anscheinend mehr für die Spinne als den Toten interessierte. Aber Comisario Casas Laune besserte sich, als er an den Vorfall auf der Dienststelle dachte. Er hatte vor zwei Tagen eines dieser langbeinigen Tiere aus dem Bürofenster in die Freiheit entlassen, weil einer seiner Beamten einen Schreikrampf bekommen hatte, als er sie auf seinem Schreibtisch entdeckte. Es war dem Kollegen im Nachhinein schrecklich peinlich gewesen. Er war seit zwanzig Jahren im Polizeidienst, ein Bär von einem Mann, aber er litt an einer Spinnenphobie, die er bis dato erfolgreich vor seinen Kollegen verborgen hatte. Der Ärmste wurde seitdem mit Spott überschüttet.
Der Comisario wusste aus Erfahrung, dass bei einem Drogentoten die Guardia Civil sowieso hinzugezogen werden würde, auch wenn es sich meist um eine tödliche Überdosis handelte, die der Betroffene selbst verschuldet hatte. Sollte der Tote auch als Dealer unterwegs gewesen sein, würde mal wieder eine Menge Kleinarbeit auf ihn zukommen. Seit er von der Mordkommission in die Drogenabteilung versetzt worden war, machte ihm die Polizeiarbeit weniger Spaß. Oder lag es vielleicht daran, dass er im kommenden Jahr sechzig wurde und sich Altersmüdigkeit einstellte? José Casas wollte spätestens in zwei Jahren in Rente gehen und mehr Zeit mit seinen beiden Enkelkindern, Wandern und seiner Frau Angela verbringen. Immer öfter saß er an seinem Schreibtisch und verlor sich in Tagträumen. Nur in der Nacht suchten ihn die Toten heim, alle ungeklärten Fälle der vergangenen Jahre schwirrten durch die dunklen Stunden, in denen er nicht schlafen konnte oder schweißgebadet aufwachte, weil ein Albtraum ihn quälte.
Ihm und seinen Kollegen gingen meist nur die kleinen Fische ins Netz. Die wirklichen Drahtzieher des Drogenhandels, die Bosse der Drogen-Clans, arbeiteten im Verborgenen. Und wenn sie doch einmal einem eine Straftat nachweisen konnten und er vor Gericht landete, dann wurden Zeugen erpresst, bestochen oder bedroht und es kam nur selten eine Verurteilung zustande.
Mit Pilar Martinez war vor drei Jahren endlich einmal eine Clan-Chefin in den Knast gewandert. Doch zu welchem Preis? Die Kronzeugin hatte man zwei Monate nach ihrem Haftantritt mit durchgeschnittener Kehle auf einer Mülldeponie gefunden. Der Dealer, der gegen sie ausgesagt hatte und sich in einem Zeugenschutzprogramm sicher gewähnt hatte, war in Barcelona an einer Ampel überfahren worden, als er die Straße überqueren wollte. Der Fahrer war geflüchtet und es gab keine Zeugen des Unfalls.
Comisario Casas kämpfte nicht mehr mit dem gleichen Enthusiasmus gegen das Verbrechen wie noch vor ein paar Jahren. Er war müde geworden.
Obwohl er zutiefst bedauerte, dass seine Vorstellungen von einem gemütlichen Feierabend wieder einmal zunichte gemacht worden waren, setzte er sich nach dem Anruf in seinen Dienstwagen und fuhr ins »Paradise«, um sich den Toten anzusehen. Das Hotelzimmer war vollgestellt mit unterschiedlichsten Musikinstrumenten. Mehrere Gitarren lehnten an der Wand, ein Saxophon hing am Kleiderhaken neben der Tür und unter dem Fenster stand eine Harfe, die zwar klein war, aber trotzdem einen beachtlichen Raum einnahm. Offensichtlich war das Drogenopfer ein vielseitig begabter Musiker, zumindest, wenn er diese Instrumente alle selbst spielen konnte.
Notarzt und Sanitäter waren schon vor Ort. Sie hatten nur noch den Tod des 26-jährigen Mannes feststellen können.
»Wahrscheinlich eine Polyintoxikation. Sieht so aus, als hätte er Kokain, Ecstasy und Alkohol konsumiert. Typischer Risiko-Mix bei vorgeschädigtem Herz-Kreislauf-System.«
»Also keine Fremdeinwirkung?«
»Kann ich noch nicht definitiv sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Er hat es wohl selbst geschafft, sich ins Jenseits zu befördern. In seiner Hosentasche sind noch ein paar von den Wunderpillen gewesen, die er sich eingeworfen haben muss.« Der Gerichtsmediziner deutete auf einige eingetütete Tabletten, die auf dem Rand der Badewanne lagen.
»Meinen Sie, er hat gedealt?«
»Weiß ich auch nicht. Bin ich vielleicht ein Hellseher?«, brummte der Arzt. »Aber die Menge in der Hosentasche hat bestimmt nur ihm selbst für ein paar Tage gereicht. Der war nicht zum ersten Mal auf Sendung.«
»Bis wann wissen Sie Genaueres?«
»Das kann ein paar Tage dauern.«