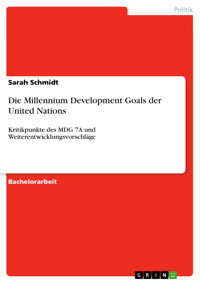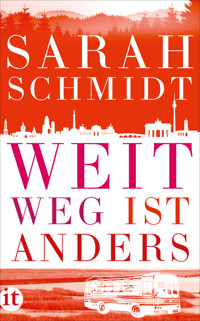
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kratzbürstige Berlinerin die eine, norddeutsche Kleinstädterin mit einer Vorliebe für Yoga und Handarbeiten die andere: Außer einer gegenseitigen tiefen Abneigung haben Edith Scholz und Christel Jacobi nichts miteinander am Hut – dennoch lassen sich die beiden 70-Jährigen auf ein Abenteuer ein, das sie quer durch Deutschland führt.
»Frei sein heißt allein sein können«, ist die verwitwete Edith Scholz überzeugt, die in ihrer Berliner Mietwohnung mit einer Zigarette und hin und wieder einem Gläschen Schnaps ganz zufrieden ist. Doch ein Sturz macht ihr einen Strich durch die Rechnung – Frau Scholz muss zur Reha nach Usedom. Was im Grunde recht erholsam sein könnte. Wäre da nicht Christel Jacobi, ihre viel zu freundliche und esoterische Zimmernachbarin: »Wir alten Weiber – wir müssen doch zusammenhalten«, meint die, überschüttet die knurrige Frau Scholz mit Freundlichkeiten und schafft es schließlich sogar, sie zu ihrer Verbündeten zu machen. Denn Christel Jacobi will sich nicht länger dem Willen ihrer Familie beugen, sondern endlich mal ein Abenteuer erleben, bevor es zu spät ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kratzbürstige Berlinerin die eine, norddeutsche Kleinstädterin mit einer Vorliebe für Yoga und Handarbeiten die andere: außer einer gegen seitigen tiefen Abneigung haben Edith Scholz und Christel Jacobi nichts miteinander am Hut – dennoch lassen sich die beiden 70-Jährigen auf ein Abenteuer ein, das sie gemeinsam quer durch Deutschland führt.
»Frei sein heißt allein sein können«, ist die verwitwete Edith Scholz überzeugt, die in ihrer Berliner Mietwohnung mit einer Zigarette und hin und wieder einem Gläschen Schnaps ganz zufrieden ist. Doch ein Sturz macht ihr einen Strich durch die Rechnung – Frau Scholz muss zur Reha nach Usedom. Was im Grunde recht erholsam sein könnte. Wäre da nicht Christel Jacobi, ihre viel zu freundliche und esoterische Zimmernachbarin: »Wir alten Weiber – wir müssen doch zusammenhalten«, meint die, überschüttet die knurrige Frau Scholz mit Freundlichkeiten und schafft es schließlich sogar, sie zu ihrer Verbündeten zu machen. Denn Christel Jacobi will sich nicht länger dem Willen ihrer Familie beugen, sondern endlich mal ein Abenteuer erleben, bevor es zu spät ist.
Sarah Schmidt lebt in Berlin. Seit Mitte der neunziger Jahre ist sie freie Autorin und hat mehrere Bücher veröffentlicht.
SARAH SCHMIDT
Weit weg ist anders
ROMAN
Das Manuskript wurde gefördert mit Mitteln des Berliner Kultursenats.
eBook Insel Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4556.
Originalausgabe
© Insel Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Weit weg ist anders
1
Die Lampe hing zu hoch und warf mehr Schatten als Licht in den langen Wohnungsflur. So war das. Hinge sie tiefer, würde man ständig mit dem Kopf dagegenstoßen. Also blieb sie, wo sie war. Auch Edith Scholz blieb, wo sie war. Der Fußboden, auf dem verschiedene Teppiche lagen, die sich teilweise überlappten, wirkte aus ihrem Blickwinkel fast wie ein kleiner Wohnungswald, eine Lichtung, auf der statt Moosen, Pilzen und Farnen Auslegware, Perser und Brücken aus bunten Stoffstreifen lebten, über viele Jahre natürlich gewachsen.
War alles mal modern, dachte Edith. Sie hatte viel Muße, ihre Teppiche so genau wie nie zuvor anzusehen. Sie lag sonst nicht auf dem Boden, zu nichts anderem fähig, als die Teppiche anzustarren, damit die Zeit verging. Entweder den Fußboden gründlich unter die Lupe nehmen oder über Zeit nachdenken, so sahen ihre derzeitigen Optionen aus. Mit dem Boden war sie langsam durch, also begann sie auszurechnen, seit wann sie hier lag.
Am Sonnenstand konnte sie sich nicht orientieren, kein Fenster in Sichtnähe. Hätte sie die Schlafzimmertür nicht geschlossen, wäre das anders. Hatte sie aber. Licht aus und Türe zu, wenn man den Raum verlässt, darüber denkt man nicht nach, das macht man einfach, wie im Schlaf. Apropos: Ob sie zwischenzeitlich mal eingeschlafen oder ohnmächtig war? Möglich.
Rechnen jedenfalls mochte sie gerne wegen der beruhigenden und verlässlichen Komponente, die den Zahlen innewohnte. Nach einigem Hin und Her einigte sie sich auf drei bis sieben Stunden, die vergangen sein könnten. Genauere Eingrenzung unmöglich. War sie mit dem Kopf gegen etwas gestoßen, vielleicht gegen den Schuhschrank oder das Regenschirmdings? Ebenfalls nicht sicher. Nur dass sie gestolpert war, das war klar wie Kloßbrühe. Über die Ecke des Flickenteppichs. Genau die Ecke, die sich schon seit vielen Jahren nach oben bog und über die man sich jedes Mal aufregte.
Ich müsste diese blöde Kante anders hinlegen, die wird langsam gefährlich, ich bin nicht mehr die Jüngste, oder ich hänge die Lampe endlich richtig auf, damit man auch was sehen kann. Aber wie das so ist. Bequemlichkeit siegt.
Die Teppichecke blieb, wie der Fettfleck an der Küchenwand, über den sie sich, wenn ihr Blick zufällig auf ihn fiel, genauso ärgerte. Es war beim Frittieren passiert, die Kelle mit Pfannkuchenteig, ein bisschen zu viel Elan – seitdem klebte da der Fleck auf der gekalkten Wand.
Allerdings, das fiel ihr nun, mit Muße zum Nachdenken, ein, bemerkte sie den Fleck in letzter Zeit kaum noch. War da was mit ihren Augen nicht in Ordnung oder hatte sie sich im Laufe der Jahre schlicht daran gewöhnt und übersah ihn, oder war er tatsächlich verschwunden, hatten sich die Farbe der Wand und das alte Fett angeglichen? Sie wollte aufstehen und nachsehen, und wenn er noch da wäre, würde sie auf der Stelle einen Lappen nehmen, um ihn wegzuwischen. Sofort würde sie das machen, es nicht wieder auf morgen verschieben.
Unglücklicherweise aber konnte sie nicht aufstehen. Seit drei Stunden, schätzungsweise, es könnten auch vier sein, gab es daran nicht mehr den geringsten Zweifel. Ein solch scharfer Schmerz hatte ihren Körper beim letzten Versuch durchfahren, dass sie noch lange danach zitterte. Irgendetwas in ihr war zerbrochen, die Hüfte oder das Rückgrat, denn es war unmöglich, eine etwas bequemere Position einzunehmen, wenn sie schon hier liegen musste.
Gut, dachte Edith, nachdem sie begriffen hatte, dass sie nichts, rein gar nichts tun konnte, um sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien, dann sterbe ich jetzt wohl. Ob heute oder irgendwann, ist mir auch egal. Obwohl es doch ziemlich früh ist. Ich glaubte immer, die achtzig schaff ich auf alle Fälle. Sieht nicht danach aus. Fast zehn Jahre früher. Zum Glück – wenn man das in meiner Situation so sagen kann – bin ich dabei klar im Kopf, das kann lange nicht jeder behaupten.
Edith kam mit sich überein, ihr Sterben genau zu beobachten. Sonst gab es wenig, mit dem sie sich hätte beschäftigen können, und das eigene Ableben verfolgen, quasi als einzige Zuschauerin einer einmaligen Uraufführung, das hatte was. Sie grübelte, ob sie nur aus Verzweiflung so tat, als wäre das eine tolle Sache, aber nein, sie fühlte sich ehrlich glücklich, dabei anwesend zu sein. Und gleichzeitig traurig, weil sie niemandem davon erzählen können würde. Aber auch wenn das möglich wäre, wen würde es interessieren?
Ich wär im Traum nicht darauf gekommen, dass es mich im Flur erwischt. Bei Gregor kam der Tod nicht überraschend, sondern im Krankenhaus. Das passte zu ihm. Aber weiß ich, wie er darüber dachte? Vielleicht hatte er gehofft, im Geschäft das Zeitliche zu segnen. Oder auf mir drauf. Edith kicherte lautlos bei der Vorstellung. Na ja, das nun eher nicht, Gregor und Fantasie! Er ist trotzdem ein guter Ehemann gewesen. Wirklich. Zumindest so im Nachhinein gesehen. Er fehlt mir.
Sie ließ diesem schlichten Gedanken Platz, spürte seiner Leere nach, dachte eine Weile nichts anderes, dann gar nichts, bis ihr aufging, dass in dieser Erkenntnis nicht die ganze Wahrheit steckte.
Nicht er fehlt mir, mehr irgendjemand. Und das war einfach meistens Gregor. Der war da. So wie ich. Wie die Teppiche, der Fleck, die Lampe. Wie sich das so ergibt. Er hat allerdings auch ziemlich oft gestört. Diese Geräusche, wenn ich da nur dran denke, werde ich ganz kribbelig. Immer kamen Geräusche aus ihm raus. Das muss doch nicht sein, dieses Ächzen und Naseschnauben, wie ein Elefant, das Aufstoßen und beim Sex, also ich weiß nicht, ob das normal war. Obwohl ich immer gerne mit ihm geschlafen habe. Man gewöhnt sich aneinander. An einen anderen Mann hätte ich mich wahrscheinlich genauso gewöhnt. Gregor war ein erträglicher Gefährte. Schade, dass er jetzt nicht da ist. »Gregor!« Sie lauschte in die stille Wohnung, einen Moment lang unsicher, ob er nicht doch noch lebte und im Schlafzimmer lag. Keine Antwort.
Natürlich ist er tot. Ich kann mich an sein Begräbnis erinnern. Das hab ich mir nicht nur eingebildet. Hab ich gedacht, der eilt mir zu Hilfe? Schwebt aus dem Himmel herab, mit großen Flügeln auf seinem haarigen Rücken, und ruft mal eben die Feuerwehr.
Sie musste über den fliegenden Gregor lachen, schrie aber auf, ob der Schmerzen, die das verursachte. Verdammt! Wenn die alte Schildhorn noch unter mir wohnen würde, die könnte mich hören, wenn ich auf den Fußboden klopfe. Ist leider längst tot, die blöde Kuh, und die Wohnung steht seitdem leer. Hab sie nie leiden können, die Schildhorn.
Es dauert viel länger, als ich gedacht hätte, dieses Sterben. Und es ist auch viel lauter. Und heller. Ob ich mal die Augen aufmache? Vielleicht war es das schon und ich bin im Himmel. An den lieben Gott hab ich nie geglaubt, und nun so etwas! Sagt der doch tatsächlich »Frau Scholz« zu mir. Sie verschluckte sich vor Lachen. Und schrie erneut auf.
»Wissen Sie, was passiert ist? Können Sie mich verstehen? Welchen Wochentag haben wir heute?«
Gott zog an ihrem rechten Augenlid, grelles Licht, Edith wollte antworten, aber ihr Mund, was war nur mit ihrem Mund los? Die Zunge klebte viel zu groß am Gaumen fest. Feuchtigkeit träufelte auf die Lippen, erst jetzt bemerkte sie ihren furchtbaren Durst.
»Wir legen Ihnen einen Zugang, Sie bekommen Flüssigkeit. Haben Sie Schmerzen? Hallo! Frau Scholz!«
Sie nickte, natürlich hatte sie Schmerzen, würde sie sonst hier liegen?
In der nächsten halben Stunde passierte viel um sie herum, während sie weiterhin auf dem Fußboden lag. Sie begriff, dass sie nicht gestorben war, sie hörte, wie fremde Männer miteinander sprachen, vermutlich über sie, sie konnte nur nicht verstehen, was sie sagten. Nach und nach fühlte sie sich ein bisschen besser beziehungsweise fühlte überhaupt wieder etwas. Dass es an ihrem Po nass und kalt war, sie wird doch nicht in die Hosen …? Edith schloss die Augen. Wie peinlich, vor all den Leuten.
Na ja, nun haben es sowieso schon alle gesehen. Irgendetwas Furchtbares ist mit mir geschehen, etwas, an das ich mich nicht genau erinnern kann. Wenn ich nur erst etwas Trockenes anziehen könnte.
Sie richtete sich auf, und in diesem Moment wusste sie alles wieder, der Schmerz war so deutlich und klar, da passte nichts anderes dazwischen, sie hatte sich etwas gebrochen und lag seit … »Wie spät ist es?«
»Gleich Mittag, wie geht es Ihnen? Wir stabilisieren Sie und bringen Sie anschließend ins Krankenhaus.«
Mittag also. Woran sie sich sicher erinnerte: ihre Abendbrotstulle, Zervelatwurst und eine Spreewälder Gurke und noch schnell im Bad das Fenster zumachen. Aber dann? Jedenfalls war klar, ihre zeitlichen Berechnungen wiesen trotz der einbezogenen Variablen Schlaf und Ohnmacht einen ziemlichen Fehler auf. Wenn es Mittag war, müsste sie erst einmal wissen, welcher Mittag von welchem Tag. Sie verlor sich in Dreisatzversuchen, fand aber keine Lösung. Vielleicht sollte sie es eher mit Prozentrechnung versuchen?
Sie schlug die Augen wieder auf und sah den Briefträger. Wenigstens ein bekanntes Gesicht.
»Hallo Frau Scholz, was machen Sie denn für Sachen?«
»Seit wann besitzen Sie einen Schlüssel für meine Wohnung?«
»Sie sind gestürzt, die Feuerwehr hat die Tür aufgebrochen und bringt Sie gleich ins Krankenhaus. Ihre Post lege ich auf die Kommode. Ist nur von der Rentenkasse. Nichts Wichtiges. Sie müssen sich ausruhen. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen?«
Jemanden benachrichtigen. Wovon sprach der Mann? Bekam sie von nun an keine Rente mehr? Ihr Herz klopfte schnell.
»Nichts verraten, bitte nichts verraten.«
Der Briefträger nahm ihre Hand. »Ist ja gut, machen Sie sich keine Sorgen.«
Oskar Mannstein las den Zettel, der über seiner Ablagebox hing. »Verehrte Zusteller, bitte denken Sie jetzt schon an die Anmeldung für unser herbstliches Grillfest am 22. September.«
Er ordnete wie an jedem Morgen die Post in seine Briefkarre ein. Werbung für alle Haushalte, heute die Prospekte eines Kabel-TV-Anbieters und eines Möbelhauses, dazu personalisierte Werbepost, die den Eindruck machte, da sei tatsächlich jemand persönlich gemeint, und ein paar Zeitschriften. Briefe und Karten nahmen gewöhnlich nicht mal mehr die Hälfte der Karre ein.
Schon über fünfundzwanzig Grad an diesem Junimorgen und Hitze ist schlimmer als Schnee und Eis, das sagte er immer den jüngeren Kollegen. Er stieß dabei ein scharfes und verächtliches »Pfffff« aus. Kollegen, die meisten sind überhaupt keine Kollegen mehr, sondern Aushilfskräfte, die weder gewerkschaftlich organisiert sind noch eine feste Tour haben. Seine Stammtour hat man ihm bislang gelassen, immerhin, da müsste er wohl dankbar sein, dass man ihm wegen des Alters – er war im vergangenen Herbst zweiundfünfzig geworden – nicht zumutete, als Springer für erkrankte Kollegen zu arbeiten. Sie sollten alle flexibler werden, forderte ihre Chefin gebetsmühlenartig. Oskar spürte Wut in sich hochsteigen, er atmete ein und aus und wieder ein, wie er es im Entspannungskurs der Krankenkasse gelernt hatte. Bringt nichts, wenn ich mich so aufrege, dann fall ich nachher noch mit 'nem Herzkasper um. Nee, ich sterbe nicht während der Arbeit, das kommt nicht infrage.
Langsam löste er sich aus seiner Starre, zog den Bauch ein und die Post-Sommershorts höher und trat hinaus auf die Straße. Die Füße wussten mechanisch, wo es lang ging, er fühlte sich dabei wie ein zufriedener Gaul, der einen altbekannten Acker pflügte, einfach immer weiter Furchen ziehen, jeden Tag, ohne Nachdenken, so lief Oskar seine Straßen mit den rund vierhundert Kunden ab.
Die Kunden – jetzt denkt er schon in dieser furchtbaren Unternehmenssprache –, das sind Leute, die Post bekommen, nicht mehr und nicht weniger, die kannste auch fast alle in 'nen Sack stecken und mit dem Knüppel drauf, haben ihre Manieren verloren. Früher bekam man zwischen Weihnachten und Silvester Trinkgeld, einen Fünfmarkschein von den Geizigen, einen Zehner oder einen Zwanni von den anderen, manche kauften eine Flasche Weinbrand oder eine Schachtel Pralinen, und die Guten, die gaben beides, Geld und Schnaps. Konnte ja niemand wissen, dass er keinen Schnaps trank, hin und wieder zwei, drei Biere, wenn's hoch kam, auch vier, doch von harten Sachen hatte er immer die Finger gelassen. Aber sollte er den Leuten die Freude verderben, ihm Cognac zu schenken? So lag immer ein Mitbringsel für die Betriebsfeiern, Geburtstage und Hochzeiten bereit. In letzter Zeit allerdings waren es eher Beerdigungen, zu denen er eingeladen wurde, und was würde das für einen Eindruck hinterlassen, zu einer Beerdigung Schnaps mitzubringen. Seine Vorräte waren mittlerweile sowieso weitestgehend erschöpft, machte ja niemand mehr, sich beim Briefträger am Ende des Jahres zu bedanken, na, so gesehen, passte es doch wieder. Er wurde nicht mehr eingeladen und besaß keine Reserveflaschen mehr.
Als er aus seinen Gedanken zum ersten Mal auftauchte, lagen schon vier Laufhäuser hinter ihm. Laufhäuser, ohne Briefkästen im Flur, sondern mit Einwurfschlitzen an den Wohnungstüren, waren wegen der vielen Treppen unbeliebt. Man musste in jede Etage steigen, das brauchte seine Zeit. Aber Oskar wusste, solange er im richtigen Stufen-Rhythmus blieb, immer zwei beim Runterlaufen, nur eine beim Hochlaufen, schmerzten seine Waden erst gegen Ende der Tour.
Früher hat man den Menschen die Rente noch persönlich übergeben, aus der dicken schwarzen Börse mit mehreren tausend Mark, auf die Hand abgezählt. Heute besitzt jeder ein Konto, aber die alten Frauen, die freuten sich trotzdem, wenn er klingelte und ihnen die Post persönlich in die Hand drückte. Er kannte manche von ihnen schon so lange, da kam niemand sonst, der mit ihnen zwei, drei Worte wechselte, und Oskar hatte für sich entschieden, weiterhin zu klingeln, auch wenn die Niederlassungsleiterin noch so aufs Tempo drückte. Er klingelte nur für Briefe, nicht wegen Werbung, und nur, so lautete seine zweite, selbst auferlegte Einschränkung, wenn er gut in der Zeit lag.
Er schaute kurz hoch, vergewisserte sich, die richtige Post in der Hand zu halten. Vergangenen Monat war er mal so in Selbstgespräche vertieft gewesen, dass er zwei Häuser komplett falsch bedient hatte. Seitdem schaute er zur Sicherheit immer noch mal extra auf die Hausnummer. Hier in der Nummer sechs hatte er den alten Hüffinghoff gefunden.
War keiner von denen, bei denen er klingelte. Aber nach einer Woche begann es im Treppenhaus zu riechen. Na ja, und dann tat er, was getan werden musste, er rief die Feuerwehr. Es folgte sogar ein Bericht mit Foto von ihm in der Lokalpresse. »Opa (76) einfach vergessen – Postbote fand den Toten erst nach einer Woche«. Was nicht ganz stimmte, er hatte ihn überhaupt nicht gefunden, nur gerochen. Das Wort ›erst‹ in der Schlagzeile ärgerte Oskar bis heute. Als wäre es seine Nachlässigkeit, nicht vorher nachgesehen zu haben.
Oskar sah auf seine Armbanduhr, viertel zwölf, jetzt aber ein bisschen zackiger, schneller laufen, um halb wollte er an der Ecke Hellmannstraße sein. Wegen Hannah. Die Hannah ist noch eine echte Briefträgerin, Ausbildung bei der Post und dann übernommen worden. Wie alt sie wohl sein mochte? Acht-, vielleicht neunundzwanzig. Jedenfalls jung und blond, und seit sie die Nachbartour lief, trafen sie sich regelmäßig an der Ecke, an der sich die Touren kreuzten. Sie freute sich auch jedes Mal, wenn sie gleichzeitig bei der Kreuzung ankamen. Hoffte er zumindest, denn Hannah lächelte immer, eine fröhliche Frau, richtig pfiffig mit ihrem wippenden Pferdeschwanz. Sie winkte, wenn sie noch ein oder zwei Häuser vor sich hatte, und dann wartete er. Hannah konnte laufen, mein lieber Herr Gesangsverein, mit ihren schönen Beinen, vom Fahrradfahren und Treppensteigen ganz feste Waden. Er wollte gerne einmal darüber streichen, über diese glatten braunen Beine. Selbstverständlich kam es nie dazu, niemals würde er das tun, nein, aber vorstellen durfte man es sich schon, oder?
Noch zwei Häuser, schnell das Gummiband vom Stapel für die Nummer 13 aus der Ablage greifen, nachsehen, ob Post für den obersten Stock dabei lag, gleichzeitig die Haustür aufschließen, Glück gehabt, für den fünften Stock heute nichts, dann schaffte er es leicht im zweiten bei der alten Scholz den dicken Brief von … er warf einen Blick auf das gedruckte Logo auf dem Umschlag, … von der BfA persönlich abzugeben. Er mochte die Gleichzeitigkeit seiner Bewegungen, wenn es lief wie geschmiert, sich rund anfühlte. Er drückte auf den Klingelknopf. Gleich würde sie öffnen, sie wartete jeden Tag auf ihn, er wusste, dass sie auf seine Schritte lauschte, so eilig, wie sie immer die Tür aufriss. Daran schätzte er die Einsamkeit der Alten ab, wie schnell sie an der Klinke waren, und danach entschied er, bei wem er immer klingelte und bei wem er auch mal einen Brief einwarf, weil er sonst Hannah verpasste. Bei Frau Scholz schellte er, seit ihr Mann gestorben war, zwar war sie fast noch zu jung, um zu seinen Alten zu gehören, aber sie wirkte einsam und darum hatte er sie in seinen Klingelkreis aufgenommen. Er schellte erneut.
»Frau Scholz, ich bin's, Ihr Briefträger.« Keine Schritte zu hören, vielleicht ist sie einkaufen, er nahm den dicken Umschlag, wollte ihn durch den Schlitz werfen. Das Wohnungslicht schien durch den Schlitz. Oskar beugte sich nach unten und schnupperte an der Öffnung. Nein, tot war hier niemand, das konnte er mit Gewissheit sagen. Hannah würde trotzdem heute vergeblich auf ihn warten. Denn ältere Damen löschen das Licht, wenn sie das Haus verlassen.
Einige Tage später stand Oskar mit einem Blumenstrauß in der Hand unschlüssig auf der orthopädischen Station des Krankenhauses. Ob er Frau Scholz wirklich besuchen sollte? Bis eben schien es ihm noch eine gute Idee, eigentlich hatte er sich den ganzen Tag darauf gefreut, doch jetzt: ernsthafte Zweifel. War das nicht viel zu dick aufgetragen? Er war nur der Briefträger, kein Verwandter, kein Freund. Andererseits stellte er sich seit Tagen ihre Einsamkeit vor und vielleicht freute sie sich doch. Er fühlte sich verantwortlich für sie, mit ihr verbunden, weil er sie gerettet hatte. Entschlossen atmete er ein, klopfte und betrat das Zimmer.
»Sie sind kein Arzt.« Frau Scholz warf ihm aus dem Bett einen enttäuschten Blick zu.
Oskar war verwirrt. »Nein, ich …«
»Und ein Pfleger sind Sie ebenfalls nicht. Nicht dass die mir gefallen würden, diese jungen Männer, die alte Menschen verhätscheln. Haben die keine andere Arbeit gefunden, oder warum machen die das? Na, egal. Wer sind Sie und was wollen Sie?«
Oskar sah unsicher an sich herunter, er hatte seine Dienstkleidung gegen Jeans und ein kurzärmeliges, kariertes Hemd getauscht. Ein Fehler, den er sofort bereute. Er hätte daran denken müssen, dass sie ihn nur in Postkleidung kannte, Oskar konnte Menschen, die ein Detail in ihrer Erscheinung veränderten, auch nicht erkennen. Traf er beispielsweise im Bus einen Kollegen, wusste er nicht, wer ihn da freundlich grüßte, war unsicher, ob er privat mit diesem Menschen Umgang pflegte, und wenn es ihm viel später einfiel, schämte er sich für seinen Fauxpas.
Oskar wedelte verlegen mit dem Blumenstrauß und sagte zu laut:
»Erkennen Sie mich nicht? Ich bin Ihr Briefträger. Wollte mal sehen, wie es Ihnen geht.«
»Sie müssen nicht schreien, ich bin nicht taub, ich bin nur hingefallen. Haben Sie meine Post dabei?«
»Nein, nur Blumen.«
Frau Scholz wies mit einer abschätzigen Geste zum Regal über dem Waschbecken, auf dem drei leere Nescafégläser standen.
»Die stellen hier keine Vasen zur Verfügung, lohnt sich wohl nicht. Wir sind ja nur Patienten.«
Oskar ging zum Waschbecken, füllte ein Glas mit Wasser und stellte die Gerbera hinein. Sie waren zu lang für das Gefäß, er musste die Stiele kürzen. Er tastete nach der auf Kniehöhe angebrachten Hosentasche, um sein Taschenmesser zu zücken. Mist! Falsche Hose. Außerdem, das fühlte er an seinen Händen, die die Blumen hin und her drehten, waren die Stiele mit Draht durchbohrt, den könnte er mit einem Messer kaum durchschneiden. Das gefiel ihm nicht, Draht-Blumen, es schien doppelt unfair, erst schnitt man sie ab und dann durchbohrte man sie, das hatte mit Natur doch überhaupt nichts mehr zu tun. Er hätte etwas anderes mitbringen sollen, Pralinen oder Obst oder Zeitschriften, an und für sich mochte er überhaupt keine Schnittblumen, es war halt so üblich und er hatte nicht darüber nachgedacht. War während der Arbeit zwar viel mit dem bevorstehenden Besuch beschäftigt gewesen, aber an das passende Mitbringsel? Kein einziger Gedanke.
Frau Scholz riss ihn aus seinen Überlegungen. »Falls Sie vorhaben, da noch länger rumzulungern, können Sie sich auch gerne einen Stuhl nehmen.«
Ertappt drehte er sich um und stellte den Strauß so auf den Nachttisch, dass er sich an der Wasserflasche anlehnte. Er wischte seine Hände an der Hose ab und reichte ihr die rechte.
»Tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, vielleicht stelle ich mich erst mal vor. Mein Name ist Oskar Mannstein. Ich habe die Feuerwehr gerufen, letzte Woche. Erinnern Sie sich daran?«
»Natürlich. Ja, da sollte ich mich wohl bei Ihnen bedanken. Wegen Ihnen werde ich möglicherweise doch noch achtzig. Also: Vielen Dank.«
Oskar war nicht sicher, ob das eine verschrobene Art Kompliment sein sollte oder eher eine Anklage. »Gern geschehen. Kann ich mich …«, er zeigte auf einen Stuhl, wartete das Nicken von Frau Scholz ab und nahm Platz. »Wurden Sie operiert? Haben Sie Schmerzen? Wie lange müssen Sie noch hierbleiben?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn es nach den Ärzten ginge, wäre ich längst wieder entlassen. Stellen Sie sich vor: Ich habe zwei neue Hüftgelenke bekommen. Zwei! Und kaum bin ich aus der Narkose aufgewacht, zerrt mich diese dumme Pute von Krankenschwester aus dem Bett und will mit mir herumtanzen.«
»Ach, das gibt es nicht.«
»Doch.« Sie äffte die Stimme der Pflegerin nach. »›Wir stehen vorsichtig auf und dann gehen wir ein paar Schritte, um unsere neue Hüfte einzuweihen.‹ Frühaktivierung nennt sich dieser Quatsch. Na, schönen Dank. Ich hing noch am Tropf und konnte gar nicht richtig denken. Aber am besten gleich Schuhe an, Mantel und Tasche gepackt und auf Wiedersehen. So geht das heutzutage.«
Oskar nickte und wusste nicht, was er sagen sollte.
»Na, und wie ich auf'm Koppe aussehe. Meinen Sie, hier kommt ein Friseur vorbei? Nee, ist nicht. Wurde abgeschafft. Morgens um fünf wird einem ein nasser Waschlappen ins Gesicht geklatscht und das war's, was es umsonst gibt. Man muss froh sein, wenn das Gebiss nicht über Nacht verschwindet.« Sie hielt einen Moment inne. »Wenn man ein Gebiss tragen muss.«
»Ja, ein Krankenhaus ist auch nicht mehr das, was es mal war«, sagte Oskar und schämte sich sogleich für diesen dämlichen Satz. Er hatte keine Ahnung vom Innenleben der Krankenhäuser, wurde noch nie operiert, konnte auch keine Unfälle oder plötzliche Herzattacken vorweisen. Er senkte den Blick verlegen auf seine Hände. Kaum unten angekommen, zwang er seinen Kopf wieder hoch. So ganz unberechtigt war ihre Beschwerde nicht, die kinnlangen, graumelierten Haare klebten glänzend – vor Schweiß oder Fett? – am Kopf, nur ein paar vorwitzige Locken standen kreuz und quer ab.
Na ja, dachte er, das ist sicher unangenehm, kann ich mir vorstellen, aber hat sie, seit sie hier ist, mal in einen Spiegel geguckt? Sie hat ein Veilchen, alle Achtung, so was hab ich noch nicht gesehen. Da achtet niemand auf die Frisur.
Frau Scholz beobachtete ihn wie ein interessantes Insekt unter dem Mikroskop, er musste jetzt endlich wieder etwas sagen.
»Also Ihre Haare sehen eigentlich ganz gut aus, Frau Scholz. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wie soll es denn sonst jetzt weitergehen?« Er hatte »Ihre Haare« so stark betont, als wären die ihr kleinstes Problem.
»Na, Sie wissen, wie man Frauen aufmuntert, was! Nächste Woche will man mich in eine Reha-Einrichtung verlegen, hat der Arzt gesagt. Weil meine Knochen wohl nicht so gut heilen, wie der Krankenhaus-Etat es vorsieht. Und da ich alleine lebe und im zweiten Stock, wurde das entschieden. So eine feine Dame vom Sozialdienst kam zu mir, um es mir ganz langsam zu erklären. Freitag werde ich entlassen, zwei Tage zu Hause und dann geht es ab nach Usedom.«
»Brauchen Sie irgendetwas? Ich könnte noch mal vorbeischauen, am Donnerstag nach dem Dienst.«
»Sie könnten mir tatsächlich helfen. Bringen Sie mir etwas zu lesen.«
»Ah, gut, ja gerne, natürlich. Was Bestimmtes?«
»Etwas Angemessenes.«
Während Frau Scholz darüber grübelte, was sie sich unter der in Usedom gewünschten »bequemen Sportkleidung« vorstellen sollte, dachte Oskar verzweifelt über angemessene Literatur nach.
Er war kein großer Leser, mal einen Mankell, das schon, aber sonst war er zu müde oder zu bequem, um abends noch nach einem Buch zu greifen. Fragte man ihn nach einem Lieblingsbuch, was selten vorkam, man unterhielt sich eher über das Tagesgeschehen, den letzten oder nächsten Urlaub, Kinder, Haus und Sport, antwortete er: Ich lese schon den ganzen Tag Adressen. Das reicht. Damit war ihm ein Lacher sicher und das Thema vom Tisch.
Jetzt aber war sein Ehrgeiz geweckt. Er wollte, aus einem ihm selbst nicht ganz verständlichen Grund, Frau Scholz mit seiner Wahl beeindrucken. Oskar versuchte während seiner Tour, Fakten zusammenzutragen, die ihn zum richtigen Buch führen würden. Was wusste er über die ältere Dame? Was man als Briefträger eben so wusste. Ziemlich viel, wenn er es genau bedachte. Sie bekam selten private Post, vermutlich gab es keine nahen Verwandten mehr oder der Kontakt war abgebrochen. Zu ihrem Geburtstag, er grübelte, im Februar oder März, jedenfalls am Ende des Winters, trudelten nur ein, zwei Glückwunschkarten ein, sie lebte zurückgezogen und war nicht an Tratsch interessiert, denn sie hielt ihn, wenn er klingelte, nie mit Banalitäten auf. Sie lebte, als er diese Tour vor zwölf Jahren zugewiesen bekam, bereits in der Wohnung und sie war Witwe. Er hatte noch ihren Mann gekannt, vor drei Jahren ungefähr dürfte der gestorben sein. Sie musste nach dessen Tod nicht umziehen, daraus schloss er, dass die Rente ausreichte. Keine großen Sprünge ermöglichend, das nicht, denn die Gegend war preiswert und das Haus, in dem sie wohnte, unrenoviert, eines, in dem noch mit Kachelöfen geheizt wurde, aber es schien eben zu reichen. Der Mann hatte als Bäcker gearbeitet, Oskar erinnerte sich dunkel an ein monatliches Fachmagazin und an Briefe der Innung, die noch manchmal in seiner Karre lagen. Aber half ihm das bei der Entscheidung? Ihm fiel kein Buch ein, in dem es ums Backen ging, und ein Kochbuch, das war ihm völlig klar, war nicht das, was sie erwartete. Vielleicht kam er über das Alter auf eine Idee. Er schätzte sie auf um die siebzig. Was lasen solche Frauen bloß? Liebesromane, Krimis, Biografien, Gedichte? Abenteuergeschichten? Er könnte die Buchhändlerin fragen, deren Geschäft auf seiner Strecke lag. Aber die schwatzte so viel, da würde seine ganze Mittagspause draufgehen, und ob er am Ende ein Buch, das angemessene Buch, in den Händen halten würde? Mehr als ungewiss. So grübelnd erledigte er nebenbei seinen Dienst, als ihn, im zweiten Stock der Rosenpromenade Nummer 29, ein Geistesblitz traf. Er würde einfach Hannah um Rat fragen! Die wüsste sicherlich, nach was er suchen musste. Vielleicht ließ sie sich sogar überreden, gemeinsam ein Buch auszuwählen, und danach könnte er sie auf ein Glas Wein einladen, als unaufdringliches Dankeschön. Leise vor sich hin pfeifend, hüpfte er die nächsten Stufen hinunter.
Edith Scholz fuhr zur gleichen Zeit ein gehöriger Schreck durch die Glieder: In der Reha musste man bestimmt schwimmen. Und dazu brauchte man Kleidung. Sie würde einen Bikini kaufen müssen. Und ihn benutzen. Ihr verging jegliche Lust auf Usedom. Vielleicht könnte ein Mittagsschläfchen helfen. Bald käme das Mittagessen, und danach wäre zum ersten Mal am Tag ein bisschen Ruhe. Man kam zu nichts an einem Krankenhausvormittag. Erst das Waschen, dann frühstücken, obligatorisches Fiebermessen, ihr Zimmer wurde geputzt, das Bett gemacht, eine Thrombosespritze gesetzt. Tür auf, Tür zu, Tür auf. Zusätzlich die Visite und Ergotherapie, die sie, begleitet von einem sanften, stillen Pferdeschwanz-Mädchen, an eine Gehhilfe geklammert mühsam den Stationsflur auf und ab schlurfend, absolvierte. Diese durchscheinende Elfe würde sie niemals auffangen können. War das der Trick bei der ganzen Chose? Dass Ergotherapeutinnen so zart wirkten, damit die Patienten sich nicht auf ihre Hilfe verließen, sondern schon aus Angst die Zähne zusammenbissen? Am Nachmittag würden sie es mit Krücken versuchen, hatte das junge Ding zum Abschied gedroht. Na, herzlichen Glückwunsch, dachte Edith.
Sie soll ab heute zum Essen aufstehen, verkündete der Pfleger gut gelaunt und stellte das Tablett mit dem Mittagessen außerhalb ihrer Reichweite auf dem Tisch ab. Anweisung der Ärzte und gleich käme noch die Dame vom Sozialdienst. Das hätten die Herren in Weiß ihr auch persönlich mitteilen können. Waren sich wohl zu fein, um mit einer Patientin zu sprechen. Sie zerquetschte gerade erbost die zweite Kartoffel auf ihrem Teller, als die Tür aufflog.
»Tach, Frau Scholz, erinnern Sie sich? Ich bin's noch mal, Frau Behrends vom Sozialdienst, darf ich mich setzen?«
Sie balancierte eine Plastikschale Salat und eine Gabel auf ihrem Klemmbrett, zog mit dem Fuß einen zweiten Stuhl an den Tisch und ließ sich darauf fallen. Sie streckte die Beine weit von sich, verschränkte die Arme im Nacken und ließ den Kopf genüsslich nach hinten sinken, bevor sie sagte: »Puh, was für ein Vormittag. Nur Stress. Bei Ihnen auch?«
Frau Scholz wackelte wie eine Inderin unbestimmt mit dem Kopf.
»Ich sag's Ihnen – das sind ungelogen die ersten zehn Minuten, die ich heute sitze. Stört Sie doch nicht, wenn ich auch esse, oder?« Sie öffnete den Deckel ihres Salats und pikste in ein Tomatenviertel. »Wahrscheinlich raucht Ihnen der Kopf und Sie wissen gar nicht, wie Sie die Vorbereitungen für die große Reise nach Usedom bis Montag schaffen sollen. Sie müssen packen, vermutlich noch shoppen gehen, und essen müssen Sie am Wochenende auch was. Haben Sie Verwandte, die Ihnen helfen? Ich hab noch gar keinen Besuch bei Ihnen gesehen.« Sie sah sich im Zimmer um und kaute. »Ah, doch, da sind ja Blumen. Hübsch!«
Frau Scholz folgte ihrem Blick. »Ach die, nein, die sind nicht von … Die hat … Egal. Also es gibt einen Sohn, aber der …« Sie machte eine wegwerfende Geste.
»Hab ich mir gedacht und eine Haushaltshilfe beantragt. Sie werden Freitag früh entlassen, und dann kommt gleich Frau …«, sie zog ein Blatt aus ihrer Mappe und tippte mit der Gabelspitze darauf, »Frau Berger, so heißt die Dame, das ist eine ganz Nette, keine Sorge. Die geht für Sie einkaufen, kocht, räumt auf und greift Ihnen bei der Körperpflege unter die Arme. Fünf Stunden täglich, glauben Sie, das reicht?«
Keine Ahnung. Eine fremde Frau bei mir zu Hause, an meinen Kochtöpfen, Handtüchern, Schränken. Wie soll ich wissen, ob das schön oder schrecklich ist? Da muss man einen Moment drüber nachdenken, oder? Und vorher endlich diese peinliche Vorstellung von mir im Bikini in Usedom aus dem Kopf verscheuchen.
»Mehr kann ich sowieso nicht durchsetzen. Aber vertrauen Sie mir, in der Zeit erledigt Frau Berger so einiges. Ein Krankentransport bringt Sie Montagmorgen zum Zug, in Usedom holt man Sie ab, und dann lassen Sie sich drei Wochen lang einfach bedienen. Das wird Ihnen gefallen, danach werden Sie sich wie neugeboren fühlen.« Sie blickte auf ihre Armbanduhr, packte ihren Salat ein und stand auf. »Ich muss dann wieder. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ach, bevor ich es vergesse, hier habe ich einen Prospekt von der Klinik und einen Flyer mit den allgemeinen Informationen. Auf der Rückseite steht, was Sie einpacken sollen. Tschüss, Frau Scholz und Kopf hoch. Die alte Maschine muss nur mal ordentlich geölt werden, dann läuft sie wieder rund.«
So viel war schon lange nicht mehr an einem einzigen Vormittag im Leben von Frau Scholz passiert. Sie musste dringend ein kurzes Nickerchen machen. Besser einen Badeanzug, oder? Und so Latschen brauchte sie auch.
2
Frau Scholz drückte vorsichtig die Türklinke herunter und warf einen ersten Blick in den Raum. Ein Einzelzimmer. So ein Glück. So eine Erleichterung. Das ganze Wochenende über, als sie zu Hause in ihrer Wohnung saß und ihr bewusst wurde, dass sie wirklich und wahrhaftig in weniger als 72 Stunden für drei Wochen verreisen würde, seit … ja, seit wann bloß? Ihr letzter Urlaub – wenn man von dem Besuch zum 60. Geburtstag der grässlichen Cousine Corinna in Goslar absah, dessen Einzelheiten sie verdrängt hatte – muss irgendwas mit Gregor gewesen sein. Jedenfalls hatte sie die ganze Zeit befürchtet, sich mit anderen ein Zimmer teilen zu müssen. Und diese anderen, die konnte sie nicht leiden. Überhaupt nicht leiden.
Als man Gregor 1985 wegen seiner Lunge zur Kur in den Harz schickte, lag er mit drei anderen Männern auf Stube. Das war zu der Zeit so normal, dass sie darüber kein Wort verloren, als sie ihn für ein Wochenende besuchte. Und ob sich daran etwas geändert hatte, das wusste Frau Scholz eben nicht. Aber es hatte.
Das Zimmer war freundlich gestaltet. Im Sinne von: was sich Einrichter derzeit so unter freundlich vorstellten. Helle Tapete, wolkig blaues Linoleum, ein Tisch aus nachgemachter Buche, zwei ockerrotblau gepolsterte Stühle, das verstellbare Bett an der Wand aus lackiertem Holz, sogar einen kleinen Balkon entdeckte sie, als sie die gelben Vorhänge und Gardinen beiseiteschob. Aussicht vorhanden. Eine Decken-, eine Steh- und eine Nachttischlampe, ein Spiegel, eine Garderobe mit drei Haken, eine Kofferablage, ein gerahmtes Bild mit Strand und Meer und Seesternen. Auf einer Papierserviette stand eine Wasserflasche auf dem Tisch. Daneben das Telefon und eine dunkelblaue Mappe. Frau Scholz schlug sie auf. »Willkommen in der Rehabilitationsklinik Konradshöhe Usedom.« Na ja, dafür hätte sie später sicher noch genug Zeit.
Sie griff nach der Krücke, zog sich daran hoch und musste dabei zugeben, dass die Übungen mit der Krankenhaus-Elfe das Gehen deutlich verbessert hatten. Sie lief zwar immer noch wie ein steifbeiniger Storch und musste sich an allem Erreichbaren festhalten, aber sie lief. Mit nur einer Krücke. Nicht für lange, doch immerhin. Sie warf einen Blick in das kleine, fensterlose Badezimmer, hängte die Jacke an den Garderobenhaken und öffnete den Reißverschluss des Koffers, als es klopfte.
»Brauchen Sie Hilfe beim Einräumen?«
Die Tage vergingen so flott, sie kam kaum zum Nachdenken, ein Termin jagte den nächsten, sie wurde gewogen, zu Arzt- und Diätassistenten-Gesprächen gebeten, turnte mit einer Pool-Nudel in den Achselhöhlen im Wasser, hielt Tonklumpen in den Händen oder saß festgezurrt in einer Art Rudermaschine. Dazu vier Mahlzeiten am Tag und abends Kulturprogramm. Ein Dia-Vortrag von einem alten, klapperdürren Mann über die Blumeninsel Madeira, ein miserabler Zauberkünstler, eine Singegruppe. Nur am Wochenende glich ihr Terminkalender nicht dem eines Managers. Nur eine Moor-Anwendung am frühen Sonntagvormittag, das mochte sie. Einfach im heißen Schlick liegen. Und danach den ganzen Tag tun und lassen, was ihr gefiel.
Frau Scholz hatte lange gezögert, sich eine kleine Extravaganz zu gönnen: Eine Tasse Milchkaffee mit Schaum aufs Zimmer bestellen. Musste man zwar extra bezahlen, aber dieser Service lockte sie schon die ganze Woche, und nun stand der dampfende Kaffee vor ihr auf dem Balkontischchen und duftete herrlich.
Die Nachmittagssonne schien auf das Päckchen, das Oskar Mannstein doch tatsächlich ins Krankenhaus gebracht hatte. Am Donnerstagabend stand er mit einem in Geschenkpapier eingewickelten Buch plötzlich vor ihrem Bett, wünschte eine erholsame Reha und verschwand schnell wieder. Ein komischer Kerl.
Bislang war noch nicht mal Zeit gewesen, das Buch auszupacken. Ungeduldig riss sie das Papier auf. Eine Ansichtskarte lag bei. »Ich wünsche beste Genesung und hoffe, meine Wahl sagt Ihnen zu. Ihr Briefträger Oskar Mannstein«. Schöne Handschrift. Ordentlich. An der Karte heftete seine Visitenkarte. Sollte sie ihn etwa anrufen, um sich zu bedanken? Auf keinen Fall. Sie legte das Kärtchen als zukünftiges Lesezeichen zwischen die Seiten und nahm das Buch in die Hand. »Diese Dinge geschehen nicht einfach so«. Nein, das tun sie tatsächlich nicht, dachte sie, ein schöner Titel, und noch mal war sie erstaunt über diesen Mann im mittleren Alter. Hat sich richtig Mühe gegeben, und ich wollte ihn ursprünglich nur loswerden.
Sie schlug das Buch auf, ein dickes Buch, das gefiel ihr gut, und versank in den ersten Seiten. Zwischendurch hob sie den Kopf. Vom Meer wehte eine leichte Brise. Himmel mit Möwen. Bienen. Und Sonne. Sie war so vertieft, dass sie nicht hörte, wie es an der Zimmertür klopfte. Mehrmals klopfte, und sie hörte auch nicht, wie die Tür vorsichtig geöffnet wurde und eine Frau verlegen erst den Kopf, dann den ganzen Körper ins Zimmer steckte und zum Balkon kam.
»Ich möchte nicht stören, aber …«
Frau Scholz fuhr entgeistert hoch. »Sind Sie verrückt! Wie können Sie mich so erschrecken?«
»Entschuldigen Sie, das war nicht meine Absicht. Ich dachte nur, Sie wollten vielleicht auch ein Stück Torte.« Zögernd streckte sich ein Arm mit einer Hand mit einem Teller Kuchen unter ihre Nase.
»Wir sind Zimmernachbarinnen. Gestern beim Sturztraining, da haben Sie neben mir gestanden, die Partnerübung, wissen Sie noch, die haben wir zusammen gemacht. Und heute am Besuchstag ist mir aufgefallen, dass niemand zu Ihnen kommt. Bei mir war meine Tochter und die hat das halbe Büfett aus der Konditorei mitgebracht, das ist ihr schlechtes Gewissen, und da dachte ich eben, warum bring ich nicht meiner Nachbarin ein Stück davon vorbei? Für mich ist das viel zu viel, und es wäre ja schade darum. Und wir alten Weiber – wir müssen doch zusammenhalten.«
»Sie sind wahnsinnig! Raus!«
Frau Scholz war außer sich. So eine dumme Nuss! Ihr Herz schlug auch eine halbe Stunde nach dem Rauswurf der Verrückten viel zu schnell. Am liebsten hätte sie der Frau ihre Krücke übergezogen.
Da konnte ich mich – Gott sei Dank – zurückhalten, die ist selber so ein olles Humpelbein, aber gibt ihr das ein Recht, mich zu überfallen? Noch nie was von Privatsphäre gehört, diese Person! Es ist doch mehr als genug Intimität, dass wir diese albernen Turnübungen zusammen machen. Wie man dabei aussieht. Da müssten nicht überall Spiegel hängen, wenn es nach mir ginge. Das ist ein Schock. Und nicht nur für mich. Wer hat zu Hause schon einen grell erleuchteten Ganzkörperspiegel? Niemand! Das muss man erst mal verdauen, was man da sieht. Und dazu guckt man halt, wie die anderen aussehen. Nämlich: auch nicht besser. Oft im Gegenteil. Ist zwangsläufig, dass man guckt und sich Gedanken macht: Wie sieht die aus? Und der hätte sich auch waschen können und rasieren, bevor er hier im Unterhemd reinschlurft, das denkt man, ohne dass man's will, das kommt von alleine. Damit die Zeit schneller vergeht und um diese Erniedrigung in Gymnastikhosen halbwegs erhobenen Hauptes zu überstehen. Wenn ich so einer Kuchen-Frau den kleinen Finger reiche, brauch ich mich nicht wundern, wenn die danach ihren Mittagsschlaf in meinem Bett machen will. Weil sie so schlecht alleine einschlafen kann. Und dann wird sie mir von ihren Krankheiten erzählen und jammern, und von ihrem Mann, ihren Kindern und Kanarienvögeln werde ich mehr wissen, als je ein Mensch wissen wollte, und morgens wird sie mit ihren knöchernen Fingern an meiner Tür kratzen. Ich höre das Geräusch schon und das bedeutet: Ich muss noch früher aufstehen, damit ich bereits beim Frühstück sitze, wenn sie klopft. Und ich muss dafür sorgen, dass alle Plätze an meinem Tisch besetzt sind, damit sie woanders hingeht. Das will ich mir gar nicht vorstellen! Was für eine Mühe macht die mir! Was erlaubt die sich? Ich hab es von Anfang an gewusst: Man wird nicht in Ruhe gelassen. Mich so zu erschrecken.
Wie ein freches Schulmädchen, das vom Lehrer vor die Klassentür geschickt wurde, so, genau so fühlte Christel Jacobi sich. Sie brauchte eine ganze Weile, um sich auf diesen Vergleich festzulegen. Es war anders als früher, wenn ihr Mann sie grundlos anschrie, und auch anders als beim Dauerstreit mit Frau Reet, ihrer ehemaligen Nachbarin, von der sie entweder als »dumme Schnepfe« oder »bescheuerte Kuh« beschimpft worden war. Ja, das mit dem Lehrer traf es ziemlich genau, die zitternden Knie, die Ungerechtigkeit, die Scham und die Wut – wie damals in der Volksschule. Wie hieß noch gleich der Klassenlehrer? Freiberg? Folkbert? So was in der Art. Der kam als Kriegsversehrter an die Schule, einen Arm in Russland verloren, und seine pädagogischen Künste beschränkten sich auf Kreidewerfen und Schläge mit dem Lineal. Das konnte er auch mit einem Arm gut. Wahrscheinlich besaß der nicht einmal Abitur. Hauptsache, die Kinder lernen was, dann wird alle Grausamkeit schon ihre Richtigkeit haben. Prügel haben noch niemandem geschadet, so dachten die Eltern. Ein Lehrer war wie ein Pfarrer unantastbar. Grässliche Zeit.