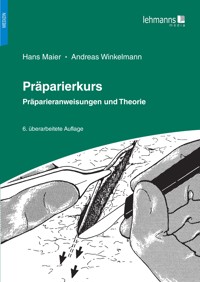Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Was wäre unsere Welt ohne das Christentum? Eine Frage, die man sich angesichtes der vielen Krisen in der Welt und der fortwährenden Abkehr von unseren Wurzeln immer wieder vor Augen führen sollte. Der Politikwissenschaftler, Publizist und Politiker Hans Maier liefert mit diesem Buch eine ebenso spannende wie fundierte Analyse zur Unterscheidung der Kulturen. Ein Klassiker!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Maier
Welt ohne Christentum – was wäre anders?
Sechste durchgesehene und aktualisierte Auflage
Impressum
Titel der Originalausgabe: Welt ohne Christentum - was wäre anders? 6. Durchgesehen und aktualisierte Auflage 2016
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 1999
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Pierre Hemmel d’Andlau. Adam au jardin du Paradis,
vers 1470 (detail). Strasbourg. Musée de l’oevre Notre Dame
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80759-6
ISBN (Buch): 978-3-451-06806-5
Inhalt
Vorwort
I. Spuren des Christentums
1. Menschenbild
2. Zeit
3. Arbeit
4. Natur
5. Staat
6. Künste
II. Welt ohne Christentum – was wäre anders?
Verzeichnis der zitierten Literatur
Personenregister
Sachregister
Christus ist nicht der Ordner der Welt. Er ist unsere tödliche Freiheit.
Reinhold Schneider
Die Forderung, auf den Hass zu verzichten, war eine Herausforderung des Christentums an die menschliche Natur und ist es geblieben.
Leszek Kolakowski
Das Christentum ist keine geschichtliche Größe: die Geschichte vielmehr ist eine christliche Größe.
Henri de Lubac
Vorwort
Gesetzt den Fall, es gäbe das Christentum nicht und es hätte es nie gegeben – wie sähe unsere Welt dann aus? Wäre sie besser, wäre sie schlechter? Darüber wird man lange streiten können. Sicher ist, dass sie anders wäre – auf diese Feststellung könnten sich Christen wie Nichtchristen wohl ohne Mühe einigen.
Auf welche Weise anders – das will dieses kleine Buch an einigen Beispielen (Menschenbild, Zeit, Arbeit, Natur, Staat, Künste) verdeutlichen.
Ich freue mich, dass dieses Herder-Taschenbuch nun in der sechsten Auflage vorliegt, und danke dem Verlag und den Lektoren!
München, Ostern 2016
Hans Maier
I. Spuren des Christentums
1. Menschenbild
Das Elend zeugt die Verzweiflung,
der Dünkel zeugt die Hoffart.
Die Größe des Heilmittels, das nötig war,
die Menschwerdung,
zeigt dem Menschen das Maß seines Elends.
Blaise Pascal
Das Christentum führt den Gekreuzigten im Schilde. Gegen alle Erwartungen einer „natürlichen Religion“ stellt es den Gläubigen eine Extremsituation vor Augen: den Menschen, zerrissen zwischen Himmel und Erde, den leidenden und sterbenden Gottesknecht. Das anstößige Symbol des Kreuzes hält diesen Ursprung für alle Zeiten fest, so blass und verwischt seine Präsenz in unserer Epoche auch sein mag. So herrschen im christlichen Menschenbild nicht die Elemente der Natur, des organisch Gewachsenen, Wohlgeratenen, Vollendeten vor (wie bei den Griechen), vielmehr sieht das Neue Testament die Menschen unter mancherlei Winkeln der Fragwürdigkeit: Es sind Arme, Kranke, Leidgeplagte, Irregeleitete, Besessene, die uns hier begegnen – Abbilder jenes „Menschensohnes“, der sich für die Sünder hingegeben hat, der die Leiden der Menschen annahm und in dem, nach der prophetischen Weissagung, „nicht Gestalt noch Schönheit“ war.
Armut, Krankheit, Besessenheit
Wie wird der Mensch in den Texten der Evangelien gesehen? Erzählt wird von einfachen Menschen in einfachem Ton. Es begegnen uns Handwerker, Fischer, Soldaten, Zöllner, Dirnen – Menschen also, die nach den Stilregeln der antiken Welt überhaupt keinen Anspruch auf literarische Gestaltung und Überlieferung hatten, es sei denn in der Komödie.1 Einfache Leute aus den unteren Schichten – sie kommen in den Evangelien nicht nur vor, sie spielen sogar eine beherrschende Rolle; selten genug, dass sich einmal ein paar Höhergestellte in die neutestamentlichen Schriften verirren (und im allgemeinen machen sie dort keine gute Figur). Und zu den einfachen Menschen kommen die an den Rand Gerückten hinzu, diejenigen, die ihr Leben nicht voll verwirklichen können, Kranke, von Dämonen Besessene, schuldig Gewordene, Verachtete, Ausgeschlossene.2 Auch Jesus selbst, der Wanderprediger, der oft nicht weiß, wo er sein Haupt hinlegen soll, der keine Einkünfte hat und von Almosen lebt, gehört, obwohl aus Davids Stamm geboren, zu den Niedrigen; er ist der Sohn eines Zimmermanns, und seine Heimat ist so unbedeutend, dass viele fragen, ob denn aus Nazareth etwas Gutes kommen könne.
Es sind also die Armen, Kranken, Niedrigen, die in den neutestamentlichen Schriften eine besondere Rolle spielen; die Kleinen hat Gott auserwählt; die Reichen ließ er leer ausgehen. Doch damit nicht genug: Der Mensch, wie die Evangelien ihn sehen, ist nicht nur krank, er wird auch von Dämonen geplagt, er ist nicht Herr seiner selbst, fremde Geister rauben ihm seine Selbstbestimmung. Und er ist verloren, entwurzelt: verloren „wie ein Schaf, das sich verirrt hat, wie ein Groschen, der davongerollt ist, wie ein Sohn, der davongelaufen ist“.3 Lauter Fehler, Lücken, Mängel scheinen das Eigentümliche dieses Menschenbildes auszumachen – nicht zufällig hat der aus der Welt gefallene Arme (Lazarus), die von den Pharisäern abgelehnte Sünderin (Magdalena), der von den Landsleuten verachtete Zöllner einen Platz im Herzen der neutestamentlichen Erzählungen. Das sind nicht Subproletarier, unanständige, unmoralische Leute, und Jesus hält nicht aus einem Hang zum Niedrigen und Immoralischen zu ihnen. Jesus inmitten der Sünder: Das heißt nicht, dass Jesus eine Vorliebe zu den Deklassierten, Zerstörten, zur Unterwelt oder Halbwelt hätte. Es heißt auch nicht, dass die Menschen Sünder werden müssten, um ihm näherzukommen. Wir müssen nicht Sünder werden, um Jesus zu verstehen; aber wir sind Sünder – so lautet die Botschaft; und die Überlegenheit der Armen und Deklassierten liegt darin, dass sie es schon wissen, während sich die Wohlmeinenden noch mit den Unterscheidungen des Anständigen und Unanständigen, mit der Sphäre des Moralischen zufriedengeben. Wer am Rand der Gesellschaft lebt, ist offener für das Heil – zumindest kann das so sein: so ist das Evangelium zu verstehen. Niemand soll ausgeschlossen werden, auch der Verlorenste hat Gelegenheit zur Umkehr, alle werden angenommen – über die Grenzen einer starren Gesetzlichkeit hinweg. So ist Christentum mehr als Ethik und Moralsystem – ja mehr als Religion; es wendet sich an alle, und es setzt zugleich, indem es an die Bereitschaft zur Umkehr appelliert, auf den Einzelnen.
Dass Arme, Kranke, Besessene, Hässliche und Niedrige zu den Adressaten der frohen Botschaft gehören, dass auch den letzten von ihnen, die am Rand der Welt leben, der Ruf des Menschensohnes gilt – das hebt das biblische Menschenbild ab vom griechischen Ideal der Schönheit und Wohlgeratenheit, vom „Menschen des Agon, der seinen nackten Leib der Sonne preisgibt …“ Dort gehören Krankheit, Hässlichkeit, Verfall kaum zum Menschen; hier dagegen treten sie auffallend stark hervor. „Der Mensch wird (in der Bibel) nicht gesehen, soweit er normal und gesund ist, sondern soweit er physisch defekt ist. Krankheit gehört mit zur Bestimmung des Menschen, der vor dem Menschensohn da ist.“4 Man vergleiche damit die Angst vor dem Abnormen bei Griechen wie Römern. „Eine Missgeburt ist nicht nur, wie heute, ein Unglück für die Familie, sondern ein Schrecken, der Versöhnung der Götter heischt, für die ganze Stadt, ja für das Volk. Man sollte also nichts Verstümmeltes aufziehen; schon der Verwachsene tat ja gut, wenn er sich stille hielt, weil er sonst einem Aristophanes in die Hände fallen konnte. Aber nach Plato sollten auch kränkliche Leute nicht leben und jedenfalls keine Nachkommenschaft hinterlassen.“ Nicht zu reden von „der sonstigen Beschränkung der Volksmenge durch Abtreibung, von der Nullität der Sklavenehen, die jedenfalls massenhafte Kindertötung mit sich brachte, von der Kindertötung der Armen …“5
Der Mensch wird im Christentum auf eine neue Weise gesehen. Er wird in seiner Schwäche, Unzulänglichkeit, Erbärmlichkeit erkannt und ohne Vorurteile angenommen. „Eine neue Welt im Menschen hat sich in dem Augenblick kundgetan, als eine Hure die Füße Jesu berührte. Aus der moralischen Sphäre wurde die des Sünders, und aus der Schamlosigkeit erwuchs die reuige Liebe; doch diese neue Antwort auf die Frage: ‚Was ist der Mensch?‘ – wie konnte sie anders als vor dem Menschensohn gewonnen werden? Diese neue Tiefe im Mensch-Sein, wie konnte sie anders sich enthüllen als vor dem, der Mensch geworden ist?“ Jesus ist nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. So ist auch die moralische Sphäre, die Sphäre der Gerechtigkeit nicht mehr die höchste; höher steht die Liebe, um derentwillen „viel vergeben wird“ – eine Liebe, die sich dem Menschen erst erschließt, seitdem „der Menschensohn mit Zöllnern und Sündern zu Tische gesessen hat“. „Der Menschensohn, der in die Hände des Menschen überliefert wird, ‚muss vieles leiden‘ (Lk 9,22). Aber in dem Opfer des Menschensohnes vollzieht sich nun ein Austausch der Begriffe vom Menschen. Es stirbt der alte Mensch mit seinen Fanghänden, und es ersteht der neue Mensch, der sich opfert. Wer also eine klare Antwort auf die Fragen haben will: ‚Was ist der Mensch?‘, dem ist sie in dem ‚Ecce homo‘ des mit Dornen gekrönten Menschensohnes gegeben.“6
Christliches Zusammenleben
Das frühe Christentum nimmt diese Linien auf; es entwickelt Formen des Zusammenlebens, die sich von den Gewohnheiten seiner Umgebung deutlich abheben.7 Neue charakteristische Elemente treten hervor: die Aufhebung sozialer Schranken; die Praxis des Miteinander (allelon); die Bruderliebe, die Feindesliebe – endlich das Verständnis der Gemeinde als Gemeinschaft der Heiligen in der Welt und als Zeichen für die Völker. Dabei kann sich christliches Bewusstsein in der frühen Kirche in sehr verschiedenen Formen äußern: im solidarischen In-der-Welt-Sein wie in der geheimen Zugehörigkeit zum „Reich in den Himmeln“8 – oder auch schon, in Abgrenzung zum Leben der Ungläubigen, ihren Theatern, Spielen, Ausschweifungen, Götzenopfern, im Sinne einer Alternativ- und Zukunftsgesellschaft, die sich bereithält für künftige Aufgaben, die sich anschickt, alte, verbrauchte Formen der Gesellschaft abzulösen.9 Im Modell ur- und frühchristlichen Zusammenlebens – die erste Gemeinde redet aus dem Geist und tut Wunder, sie teilt alles miteinander10 – steckt sowohl die Kraft langsamer Evolution wie die Gewalt revolutionärer Zuspitzung. Und so tritt auch das christliche Gemeindebewusstsein in der Geschichte in kontrastierenden Formen auf: als Element des Alltäglich-Selbstverständlichen wie als jäher pneumatischer Einschlag, als konkrete Gegenwart christlichen Lebens wie als Erinnerung an einen verpflichtenden, immer wieder vom Vergessen bedrohten Ursprung.
War das frühe Christentum eine Zeit der Distanz, der Kritik an der umgebenden Kultur, der Erwartung des Weltendes und der Wiederkunft Christi, so kehrten sich in der Folgezeit die Akzente um. Mit der Entstehung einer christlichen Gesellschaft in Ost- und Westrom, später im Norden, Nordwesten und Osten Europas erwachte eine stärkere Weltaktivität der Christen. Mit dem Christlich-Werden ganzer Völker wuchs die Kirche im Abendland aus ihrer alten Minderheits- und Diasporasituation heraus. Kirche und Staat begannen die Menschen eines bestimmten Raumes gemeinsam zu umfassen. Eine Identifikation der Kirche mit der politischen Gemeinschaft des Volkes wurde möglich. Christliche Impulse wirkten vielfältig in die Öffentlichkeit hinein. Der Staat wurde zum erweiterten Leib des Kirchenvolkes. Was wir heute „Volkskirche“ nennen, nimmt seinen Anfang von dieser historischen Konstellation.
Im Unterschied zur antiken Anschauung, die mit Herren und Sklaven als einem selbstverständlichen, „natürlichen“ Faktum rechnete, war das Vorhandensein von Herrschafts- und Diensträngen in einer vom Christentum geprägten Gesellschaft nicht einfach eine naturhafte, mit der Geburt gegebene Tatsache. So musste sich der jeweilige Herrschaftsträger vor seinen Mitmenschen und vor Gott verantworten, da er seine Herrschaft als Amt und Auftrag, als „Lehen“, nicht als willkürlichen Besitz innehatte. Hierin lag die Möglichkeit einer Auflockerung der starren herrschaftlichen Gliederung, ihrer Verwandlung in eine Ordnung, in der sich eine allseitige Verantwortlichkeit entwickeln konnte. Kirche und geistlicher Stand waren an diesem Prozess in doppelter Weise beteiligt. Einmal war der Klerus selbst – in Grenzen – ein Aufstiegsstand. Sodann hielt die kirchliche Predigt und Erziehung über der Vielfalt hierarchischer Rangstufen, der Pracht und dem Stolz der Mächtigen immer wieder den Gedanken der evangelischen Gleichheit wach. Diese Vorstellung begann vor allem im hohen und späteren Mittelalter wirksam zu werden. Sie wurde zum Ferment einer geistigen und politischen Neugestaltung. In den Totentanzdarstellungen malte sich die Zeit das Gegenbild ihrer purpurn-hochmütig einherschreitenden ständischen Ehren und Würden. Der große Rollentausch am Jüngsten Tag war ein Leitmotiv in der Predigt der Bettelmönche. So differenzierte die Kirche das adelig-bäuerliche Herrschaftsgefüge, formte es aus einer Beziehung von Gewalt und Gehorsam zu einem Verhältnis gegenseitiger Rechte und Pflichten um. Erst dadurch konnten aus Machtträgern und Machtunterworfenen „Stände“ innerhalb eines größeren Ganzen werden. Unreflektierte Machtausübung wurde zur Wahrnehmung eines „Amtes“. Noch die reformatorische Sittenlehre und in ihrer Fortsetzung die christliche Staatslehre eines Seckendorff stand in dieser Tradition, wenn sie die weltlichen Stände, Obrigkeiten und Untertanen in eine christliche Ordnung eingefügt und durch „allgemeine Vergliederung und Einleibung in die Gemeinschaft der Kirche“ zu einem „geistlichen Leibe“ verbunden sah.11
So versteht man, dass sich im Schoß der Kirche eine Vielzahl von Tätigkeiten entwickelte, die wir heute eher dem Staat zuschreiben: Personenstandswesen, Sorge für Arme und Kranke, Einrichtungen der Erziehung, Bildung, Wissenschaft. Sie entstanden aus dem Eingehen der Kirche – allgemeiner: der christlichen Botschaft – in die Welt. Eine christlich geprägte Ordnung des Lebens formte sich aus.12 Man denke an den Personenstand: der Einzelne wurde – über Familie, Sippe, Stand hinaus – in seiner Individualität erkannt. Oder an Erziehung und Bildung: Sie diente nicht nur der Verkündigung des Glaubens, sondern auch der Weckung und Entfaltung persönlicher Talente. Oder an das Armen- und Krankenwesen: In einer christlichen Umwelt durfte kein Mensch, wenn er krank oder in Not war, ins Leere fallen. Es sind Elemente moderner politischer Kultur, die hier vorentwickelt und vorgeprägt werden. Noch in der Neuzeit, ja bis in die Gegenwart hinein, haben sich Sitte und Gesetzgebung an diesem Kanon des christlichen Lebens orientiert.
Das hat in der antiken Welt kein Gegenstück. Die Antike kannte keine öffentliche Gesundheitsvorsorge, keine „Daseinsvorsorge“, keinen Sozialstaat im modernen Sinn – und übrigens auch keine allgemeine Schulbildung, die sich an Gruppen und Schichten und schließlich „an alle“ wandte. Die Arbeiten von Hendrik Bolkestein13 und Arthur R. Hands14 zeigen mit Deutlichkeit, dass die Armen- und Krankenpflege im vorchristlichen Altertum zwar über individuelle Wohltätigkeit hinausreichte, sich aber nirgends in dauerhaften Institutionen (Krankenhäusern, Sozialstationen) verfestigte. Ein Äquivalent zur modernen Daseinsvorsorge gibt es allenfalls in örtlichen und zeitlichen Grenzen, so in der öffentlichen Fürsorge für Invaliden und Kriegswaisen in Athen, oder in der kostenlosen Versorgung mit Getreide im Rom der späten Republik. „Dass öffentliche materielle Unterstützung von der Zugehörigkeit zur Bürgerschaft abhängt, ist der entscheidende Unterschied zum christlichen Verständnis von Armenpflege“, urteilt einer der besten Kenner, Wilfried Nippel.15 Auch hier zeigen sich die charakteristischen Unterschiede zwischen einer Kultur, die sich an „die Besten“ wendet, und einer anderen, die „für alle“ sorgen will: in der ersten gibt es Lehrer, Ärzte, Fürsorger – in der zweiten auch Schulen, Krankenhäuser und Sozialstationen.
So hinterlässt das biblische Menschenbild deutliche Spuren in der Geschichte des modernen Rechts-, Sozial-, Kulturstaats.16 Das Bild des leidenden, geopferten Menschensohnes hält die Erinnerung wach an die Leidenden und Armen – und an die Pflichten der Gesunden, Reichen, Mächtigen ihnen gegenüber. Das Kreuz wirft die Frage auf nach dem Sinn von Leid und Tod. Mit Recht ist vor wenigen Jahren im Streit um den Kruzifix-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts an diese Tatsachen erinnert worden: „Das Kreuz in seiner sublimierten Darstellung des Leides, das die Nichtleidenden und Satten an die Existenz des Leides mahnen, die Leidenden jedoch trösten soll, hat doch hier – in Kinderzimmern und Unterrichtsräumen – vor allem erzieherischen Zweck: Wenn das Leid bei den Kindern der Satten aus der Sicht gerät, dann werden diese Kinder zu Mitleidlosen. Denn wo kein Leid ist, kann auch kein Mitleid entstehen.“17
Verrat an der Erde?
Die Sozialethik der Moderne ist ohne den christlichen Blick auf den Menschen kaum zu verstehen. Diese Tatsache hat freilich auch Irritationen ausgelöst und Widerspruch gefunden. Unter den modernen Kritikern des Christentums hat der Pfarrerssohn Friedrich Nietzsche sich am entschiedensten gegen das aufgelehnt, was er als Verlust an Leben, Verrat an der Erde, Demütigung der Gesunden durch die Kranken, als Ressentiment und Décadence empfand.18 Dem christlichen „Krankengott“19 setzte er seinen „Übermenschen“ entgegen, jene vieldeutige Figur, die im Zarathustra beständig umkreist wird, ohne doch zu einer letzten Eindeutigkeit zu gelangen, und die wohl am präzisesten umschrieben wird als „Ideal eines menschlich-übermenschlichen Wohlseins und Wohlwollens“,20 als „Typus höchster Wohlgerathenheit“.21 Hier wirkt bis in die Wortwahl hinein die griechische Kalokagathia nach, der Zusammenklang von Adel und Vortrefflichkeit – es ist, wie Nietzsche anmerkt, ein neuer Adel, der „allem Pöbel und allem Gewalt-Herrischen Widersacher ist und auf neue Tafeln neu das Wort schreibt ‚edel‘“.22 In dieser Welt der Schaffenden gilt das Gesetz der Härte, nicht des Mitleids.23 Der Übermensch zerbricht das, was das Christentum an Menschenbildern hervorgebracht hat, er zersprengt das, was am Menschen Art, Gattung oder, christlich gesprochen, Geschöpflichkeit ist, und so fallen mit den Menschen-Bildern auch die Menschen-Rechte dahin. Nicht die Menschheit, sondern der höhere Mensch ist das Ziel. Die Ungleichheit der Rechte ist die Bedingung dafür, dass es überhaupt Rechte gibt, denn: „Ein Recht ist ein Vorrecht.“24 „Das Unrecht liegt niemals in ungleichen Rechten, es liegt im Anspruch auf ‚gleiche‘ Rechte … Was ist schlecht? Aber ich sagte es schon: Alles, was aus Schwäche, aus Neid, aus Rache stammt. – Der Anarchist und der Christ sind Einer Herkunft …“25
Die neutestamentliche „schlechte Gesellschaft“ um Jesus erregt den Widerwillen des zornigen Altphilologen und bekennenden Griechen Nietzsche. Er sieht in dem christlichen Appell „an alle“ auflösende Kräfte am Werk, sieht Form und Vornehmheit, das Aristokratische, Herrenhafte der Geschichte verlorengehen. Denn was ist die christliche Revolution im Grunde? Eine „Art Zusammendrängung und Organisation der Kranken auf der einen Seite (das Wort ‚Kirche‘ ist dafür der populärste Name), eine Art vorläufiger Sicherstellung der Gesünder-Gerathenen, der Voller-Ausgegossenen auf der andern, die Aufreißung einer Kluft somit zwischen Gesund und Krank …“26 „‚Die Herren‘ sind abgetan; die Moral des gemeinen Mannes hat gesiegt.“27 So steht es in der Schrift „Zur Genealogie der Moral“; mit diesen Worten zieht Nietzsche die Summe aus zweitausend Jahren Christentum. Entdeckt das Neue Testament die Krankheit als Normalzustand des Menschen, predigt Jesus wirklich allen, auch den Zöllnern und Sündern, ist überall in der biblischen Verkündigung die große Schar, die Eine Menschheit schon am Horizont erkennbar, so gilt dem allem Nietzsches heftigste Kritik: Gerade wenn das Kranke die Normalität des Menschen sein sollte, so argumentiert er, gerade dann muss man die Wohlgeratenen um so strenger vor der „schlechtesten Luft, der Kranken-Luft“ behüten. „Thut man das? … Die Kranken sind die größte Gefahr für die Gesunden; nicht von den Stärksten kommt das Unheil für die Starken, sondern von den Schwächsten. Weiß man das? … In’s Große gerechnet, ist es durchaus nicht die Furcht vor dem Menschen, deren Verminderung man wünschen dürfte; denn diese Furcht zwingt die Starken dazu, stark, unter Umständen furchtbar zu sein, – sie hält den wohlgerathenen Typus Mensch aufrecht. Was zu fürchten ist, was verhängnisvoll wirkt wie kein andres Verhängnis, das wäre nicht die große Furcht, sondern der große Ekel vor dem Menschen; insgleichen das große Mitleid mit dem Menschen. Gesetzt, dass diese beiden eines Tages sich begatteten, so würde unvermeidlich sofort etwas vom Unheimlichsten zur Welt kommen, der ‚letzte Wille‘ des Menschen, sein Wille zum Nichts, der Nihilismus. Und in der That: hierzu ist Viel vorbereitet. Wer nicht nur seine Nase zum Riechen hat, sondern auch seine Augen und Ohren, der spürt fast überall, wohin er heute auch nur tritt, etwas wie Irrenhaus-, wie Krankenhaus-Luft, – ich rede, wie billig, von den Culturgebieten des Menschen, von jeder Art ‚Europa‘, das es nachgerade auf Erden giebt. Die Krankhaften sind des Menschen große Gefahr: nicht die Bösen, nicht die ‚Raubthiere‘.“28
Man versteht von hier aus, weshalb Nietzsche das Christentum als Décadence empfand, warum er im Neuen Testament „lauter kleine Sekten-Wirtschaft, lauter Rokoko der Seele“ entdeckte – im Gegensatz zur griechischen Größe und „guten Erziehung“, aber auch im Gegensatz zur „heroischen Leidenschaft“ und zur „Naivetät des starken Herzens“ im Alten Testament.29 Der christliche Mensch ist nicht nur unvornehm, ein Emporkömmling, ein Décadent, das Christentum nicht nur „Platonismus fürs Volk“ – es ist auch zutiefst ambivalent und zweideutig. Das hängt mit Nietzsches Deutung der jüdisch-christlichen Geschichte zusammen. Für ihn ist die christliche Liebe die subtile Verkehrung – aber zugleich auch die äußerste Steigerung – des jüdischen Hasses: Der jüdische Hass, das schöpferisch gewordene Ressentiment werden im Paradox des „Gottes am Kreuz“ zu äußerster, letzter Konsequenz getrieben. Wenn Gott selbst sich opfert, ist die Umwertung aller Werte vollzogen, und dies von oben her, also unwiderruflich. Alle „vornehmeren Ideale“ müssen vor der „betäubenden Kraft“ dieses Mysteriums den Rückzug antreten.30
Gott ist tot; aber noch leben die Schatten Gottes in der modernen Zivilisation – die Ideen von Humanität, Fortschritt und Gleichheit, die demokratische Bewegung, in der Nietzsche die Fortsetzung christlicher Impulse erkennt. Hier setzt seine Geschichts- und Gegenwartsdeutung ein.31 Woher kommt jene Abstraktion des Lebens, die das europäische Dasein beherrscht: als Wissenschaft, Industrie, Masse, Demokratie, Sozialismus? Sie ist offenbar ein Gesamtphänomen, Ausdruck einer kulturverneinenden Macht. Nietzsche gibt ihr einen Namen: Moral – Moral verstanden als lebensfeindliches Leben, als Tötung des Triebs (Freud wird später sagen: Umkehr der Antriebsrichtung). Dies alles ist ein Erbe des Christentums, das Nietzsche als einen Aufstand deutet: einen Sklavenaufstand der Moral gegen das Herrenmenschentum und die gesunde Ungleichheit des antiken Lebens. Als Quelle dieser Moral entdeckt Nietzsche das Ressentiment (auch hierin ist Freud sein Nachfolger): Ressentiment als Hass der Schlechtweggekommenen. Die demokratische und sozialistische Bewegung ist nichts anderes als eine Tochter der christlichen Moral, die Französische Revolution eine Erbin der christlichen Revolutionierung des Daseins. Alles ist von „Entrüstungspessimismus“ erfüllt, vom Instinkt gegen die Herrschenden, gegen die Vornehmen. Die „Gesamt-Entartung des Menschen, hinab bis zu dem, was heute den socialistischen Tölpeln und Flachköpfen als ihr ‚Mensch der Zukunft‘ erscheint“, bereitet sich vor, die „Entartung und Verkleinerung des Menschen zum vollkommenen Heerdenthiere …“32
So heißt es am Schluss des dritten Hauptstücks von Jenseits von Gut und Böse von den Christen: „Alle Werthschätzungen auf den Kopf stellen – das mussten sie! Und die Starken zerbrechen, die großen Hoffnungen ankränkeln, das Glück in der Schönheit verdächtigen, alles Selbstherrliche, Männliche, Erobernde, Herrschsüchtige, alle Instinkte, welche dem höchsten und wohlgerathensten Typus ‚Mensch‘ zu eigen sind, in Unsicherheit, Gewissens-Noth, Selbstzerstörung umknicken, ja die ganze Liebe zum Irdischen und zur Herrschaft über die Erde in Hass gegen die Erde und das Irdische verkehren – das stellte sich die Kirche zur Aufgabe und musste es sich stellen, bis für ihre Schätzung endlich ‚Entweltlichung‘, ‚Entsinnlichung‘ und ‚höherer Mensch‘ in Ein Gefühl zusammenschmolzen. Gesetzt, dass man mit dem spöttischen und unbetheiligten Auge eines epikurischen Gottes die wunderlich schmerzliche und ebenso grobe wie feine Komödie des europäischen Christenthums zu überschauen vermöchte, ich glaube, man fände kein Ende mehr zu staunen und zu lachen: scheint es denn nicht, dass Ein Wille über Europa durch achtzehn Jahrhunderte geherrscht hat, aus dem Menschen eine sublime Missgeburt zu machen? Wer aber mit umgekehrten Bedürfnissen, nicht epikurisch mehr, sondern mit irgend einem göttlichen Hammer in der Hand auf diese fast willkürliche Entartung und Verkümmerung des Menschen zuträte, wie sie der christliche Europäer ist (Pascal zum Beispiel), müsste er da nicht mit Grimm, mit Mitleid, mit Entsetzen schreien: ‚Oh ihr Tölpel, ihr anmaßenden mitleidigen Tölpel, was habt ihr da gemacht! War das eine Arbeit für eure Hände! Wie habt ihr mir meinen schönsten Stein verhauen und verhunzt! Was nahmt ihr euch heraus!‘ – Ich wollte sagen: das Christenthum war bisher die verhängnissvollste Art von Selbstüberhebung. Menschen, nicht hoch und hart genug, um am Menschen als Künstler gestalten zu dürfen; Menschen, nicht stark und fernsichtig genug, um, mit einer erhabenen Selbst-Bezwingung, das Vordergrund-Gesetz des tausendfältigen Missrathens und Zugrundegehns walten zu lassen; Menschen, nicht vornehm genug, um die abgründlich verschiedene Rangordnung und Rangkluft zwischen Mensch und Mensch zu sehn: – solche Menschen haben, mit ihrem ‚Gleich vor Gott‘, bisher über dem Schicksal Europa’s gewaltet, bis endlich eine verkleinerte, fast lächerliche Art, ein Heerdenthier, etwas Gutwilliges, Kränkliches und Mittelmäßiges herangezüchtet ist, der heutige Europäer …“33
Soweit Nietzsche. Der Terminus des Ressentiments erlaubt es ihm, Judentum und Christentum, religiöse und säkulare Eschatologien, kirchliche und weltliche Gleichheits- und Fortschrittsbewegungen in einem energischen Rundumschlag gleichzusetzen: ein angesichts der verwickelten historischen Zusammenhänge allzu simples, die Unterschiede zwischen Antike, Mittelalter und Moderne unbillig vernachläßigendes und verwischendes Verfahren. Gewiss wirkt die Essenz christlicher Gleichheitsvorstellungen bis in die Moderne hinein, und gewiss hat das christliche Menschenbild universalistische Vorstellungen eines „Rechts der Menschheit“ entbinden helfen – so wie noch Sozialgesetzgebung und Sozialstaat des 20. Jahrhunderts christliche Postulate der Nächstenliebe, des Schutzes der Schwachen usw. mit weltlichen Mitteln eingelöst haben.34 Dennoch geht es nicht an, die Gleichheit vor Gott mit der politischen Gleichheit der Moderne einfach zu identifizieren35. Auch kommt die eigentümliche dialektische Beziehung von Kirche und Welt, die Abfolge gegenseitiger Anziehung und Abstoßung in der Geschichte des Christentums in Nietzsches spiritualistischer Gipfelwanderung vom jüdisch-paulinischen, priesterlich-mönchischen zum liberalen, sozialistischen und anarchistischen Ressentiment nicht in den Blick. Das Christentum hat ebenso zur „Entheiligung“ (besser Entdämonisierung) des (antiken) Staates beigetragen wie umgekehrt auch zum Aufbau wesentlicher Elemente moderner Staatlichkeit.36 Die Kategorie der „Entnatürlichung“ ist viel zu pauschal, um zweitausend Jahre christlich-säkularer Geschichte zu beschreiben oder gar zu entschlüsseln.
Und ist die christliche Liebe wirklich nur die feinste Blüte des Ressentiments? Trägt sie nicht eigene, unverwechselbare Züge? Unterscheidet sie sich nicht grundlegend von der antiken Liebesidee? Max Scheler hat darauf hingewiesen, dass „Liebe“ für die Griechen „ein zur sinnlichen Sphäre gehöriger Tatbestand“ ist, „… eine Form des ‚Begehrens‘, ‚Bedürfens‘ usw., die dem vollkommensten Sein nicht eigen ist … Liebe ist ein Streben, eine Tendenz des ‚Niederen‘ zum ‚Höheren‘, des ‚Unvollkommneren‘ zum ‚Vollkommneren‘, des ‚Ungeformten‘ zum ‚Geformten‘ …“ Wären wir Götter, sagt Platon, würden wir nicht lieben. Demgegenüber findet im Christentum etwas statt, was Scheler die „Bewegungsumkehr der Liebe“ nennt. Jetzt soll sich die Liebe „gerade darin erweisen, dass das Edle sich zum Unedlen herabneigt und hinablässt, der Gesunde zum Kranken, der Reiche zum Armen, der Schöne zum Hässlichen, der Gute und Heilige zum Schlechten und Gemeinen, der Messias zu den Zöllnern und Sündern – und dies ohne die antike Angst, dadurch zu verlieren und selbst unedel zu werden, sondern in der eigentümlich frommen Überzeugung, im Aktvollzug dieses ‚Beugens‘, in diesem Sichherabgleitenlassen, in diesem ‚Sichverlieren‘ das Höchste zu gewinnen – Gott gleich zu werden.“ So verschiebt sich das Bild: „Das ist nicht mehr eine Schar zur Gottheit emporrennender und dabei sich überflügelnder Dinge und Menschen: das ist eine Schar, deren jedes Glied auf das Gott fernere zurückschaut, ihm hilft und dient – und eben darin der Gottheit gleich wird …“ So ist die Wurzel der christlichen Liebe vom Ressentiment gänzlich frei – was nicht ausschließt, dass vom Ressentiment getriebene Personen die christliche Liebe missbrauchen, den Ausdruck der Liebe vortäuschen können.37
Mann und Frau
Die „Bewegungsumkehr der Liebe“ hat noch eine andere, heute fast vergessene Wirkung: Sie überwindet in einem langsam und stetig voranschreitenden Prozess die in den alten Kulturen vorherrschende Asymmetrie der Geschlechter.38 Das betrifft vor allem die Minderstellung der Frauen gegenüber den Männern. So wie rechtliche Ungleichheit und Sklaverei „von Natur“ im Christentum auf Dauer nicht bestehen können – auch wenn die Überwindung Zeit braucht und Rückfälle selbst in modernen Zeiten häufig sind! –, so bleibt es in christlichen Zeiten auch nicht bei einer undiskutierten Vorherrschaft des Mannes und einer bedingungslosen Unterordnung der Frau.
Den Lesern des Neuen Testaments fällt ein spezifischer Zug ins Auge: Jesu Zuwendung zu den Frauen. Dieser Zug ist neu und hebt sich deutlich ab von der Geringschätzung der Frau in vielen zeitgenössischen Texten. Ich zitiere Rudolf Schnackenburg, der besonders auf die lukanische Überlieferung, auf die Frauen in der Kindheitsgeschichte Jesu hinweist: „Hier treffen wir auf Maria, die Mutter Jesu, und ihre Verwandte, die betagte Elisabet. Bei dem Besuch Marias bei ihrer älteren Verwandten tritt die ihnen zugedachte heilsgeschichtliche Rolle deutlich zutage (1, 39–56). Prophetisch ruft Elisabet aus: ‚Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes‘ (1, 42) … Elisabet und Hanna bereiten auf die Ankunft des Erlösers vor. Die Gestalt und Rolle Marias aber ist ganz einzigartig. Sie ist die Begnadete und hat das Kind vom heiligen Geist empfangen, spricht ihr Fiat (1, 26–38) und wird von Elisabet als Mutter des Messias begrüßt (1, 42 f.). Sie stimmt das die Wege Gottes preisende Magnifikat an (1, 46–55) und bewahrt nach der Geburt Jesu alles, was bei der Krippe geschehen war, in ihrem Herzen (2, 19), ebenso auch das, was sie beim Tempelbesuch des zwölfjährigen Jesus erlebt hat (2, 51). Die hohe Zeichnung … hebt sie aus allen anderen Frauengestalten im Evangelium hervor.“39 Schnackenburg erinnert an andere Perikopen bei Lukas, an die Witwe von Sarepta, die Witwe von Nain, die Sünderin mit dem Salböl, die Frauen im Gefolge Jesu, an Marta und Maria, an die Seligpreisung einer Frau aus dem Volk, an die klagenden Frauen am Kreuzweg – und nicht zuletzt an die Botschaft der Frauen von der Auferstehung an die Apostel. Frauen treten im Lukasevangelium an der Seite von Männern auf. Jesus hat sie auf die gleiche Stufe wie die Männer gestellt.40 Das hört sich heute wie selbstverständlich an – man muss jedoch daran erinnern, dass eine solche Nähe zu den Frauen auch im damaligen Judentum noch kaum denkbar war, von der griechisch-römischen Welt ganz zu schweigen.